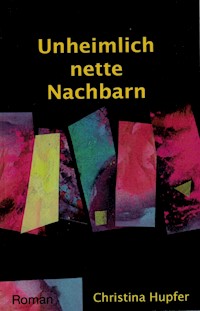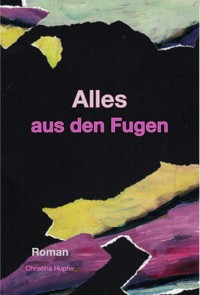
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jeph fehlt ein ganzes Stück seiner Erinnerung. Vor einem halben Jahr stand ihm, mit einunddreissig, noch die Welt offen. Jetzt steht er auf der Straße und weiß nicht weshalb. Die Polizei hat ihn mit Fotos eines Tatorts konfrontiert, an dem er bewusstlos aufgefunden wurde. Nun beherrscht ihn die schreckliche Frage: Trägt er die Schuld am Tod zweier Menschen? Die Ermittlungen der Polizei verzögern sich aufgrund ausufernder Kriminalität, Personalmangels und einer Pandemie, die alles ausbremst. Verzweifelt versucht Jeph wieder auf die Beine zu kommen und sich zu erinnern. Unterstützung hat er so gut wie keine. Abgesehen von einem anderen Obdachlosen und einer kranken jungen Frau, die eher selbst Hilfe brauchen könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alles aus den Fugen
Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42EpilogDankeWeitere Bücher von Christina Hupfer bei epubliLeseprobeKapitel 1
Jeph
„Jetzt reicht‘s, du blöder Hund, hier will jemand schlafen! Halt endlich deine Schnauze!“
Der Mann, der ihn so unsanft wachgerüttelt hatte, legte sich wieder auf sein schmales Bett und drehte ihm unmissverständlich den Rücken zu.
Jeph zitterte, atmete heftig. Sein Brustkorb arbeitete wie ein Blasebalg. Nur langsam registrierte er, dass das viele Blut, das geradezu in Bächen die Wände herunter gelaufen, von der Decke getropft und in hellroten Blasen aus Mündern und Wunden gequollen war, nur in seinem Traum existierte. Er war dem Monster, das ihn an den Haaren gepackt und sich als sein Bettnachbar entpuppt hatte, sogar dankbar, dass es ihn weckte, bevor es ihn erstickte.
Die Wirklichkeit, in die er nun zurückkehrte, war aber auch nicht viel besser als dieser grauenhafte Traum. Er starrte zu der makellos weißen Decke hinauf. Spürte den Menschen, der nur einen Meter neben ihm lag, wie auch er in einer Lage, von der er niemals dachte, sich je zu befinden. Von der kratzigen Wolldecke befreit ließ er seinen schweißbedeckten Körper abkühlen und hörte im Geist wieder die bemüht freundliche Stimme der Sozialarbeiterin: „Zimmer fünf, im Gang hinten rechts, das Bett links. Die Duschen sind im anderen Teil des Hauses. Es gibt heute Abendessen um achtzehn Uhr. Die Rotarierinnen machen das einmal die Woche. Es ist sehr begehrt. Wenn Sie sich beeilen...“
Es war ihm egal gewesen. Hunger hatte er sowieso keinen, und der Mief von scharfem Putzmittel und Verzweiflung wirkte alles andere als appetitanregend. Immerhin hatte sie ihn nicht geduzt.
Der Mann, der ihn gerade so freundlich geweckt hatte — Fred hieß er — hatte gestern Abend seine Portion dankbar verputzt und ihn dann mit ein paar Tipps versorgt. Zum Beispiel, wie man mit der Tusse am Empfang umzugehen hätte; wo man günstig an besseren Fusel käme; wen man meiden solle wie die Pest. Panisch griff er unter sein Kopfkissen, atmete auf. Sein Geldbeutel war noch da. Als er vor gerade mal zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden war und mit seiner schweren Tasche hier eintraf, war ihm noch gar nicht richtig bewusst gewesen, in welch misslicher Lage er sich befand. Denn diese Tasche enthielt alles, was ihm geblieben war.
„Du solltest langsam deinen Arsch hochkriegen. Wenn du noch was von der Brühe, die sie hier Kaffee nennen, haben willst.“
Jeph, der wieder in seine Decke vergraben vor sich hin grübelte, hatte nicht bemerkt, dass es draußen immer heller wurde, die Geräuschkulisse lauter, die Tonart rauer.
„Neu in der Szene, was?“ Das zerfurchte Gesicht seines Zimmergenossen, zumindest das, was unter dessen grau meliertem Bart noch zu sehen war, zeigte so etwas wie Mitgefühl. „Schau, dass du schnell wieder da raus kommst. Sonst...“
Er wies mit dem Kinn auf die abgewetzte Tasche und die Beutel, die am Kopfende seines Betts lagen. Dann zog er einen zerschlissenen Anorak über seinen warmen Pullover und schlurfte zur Tür.
„Komm schon, Kumpel, du brauchst was zwischen die Zähne. Ich hab gestern bei Macdonalds noch ein paar Brötchen abgestaubt. Und Kaffee und Tee bekommen wir hier umsonst.“
Jeph rappelte sich auf, schlüpfte in den unsäglich glänzenden Trainingsanzug, den ihm die Sozialarbeiterin vorgestern noch im Krankenhaus vorbeigebracht hatte. Und der jetzt schon roch als hätte man ihn seit Wochen nicht gewaschen. Egal, es war ja nur ein Penner, dem er nun folgte.
Orientierungslos stand er Stunden später mitten auf einer Kreuzung in der Stadtmitte und zuckte vor einer schrillen Hupe zurück. Wusste nicht, wie er hierher gekommen war. Fast wäre er über seine Tasche gestolpert als er sich beeilte über die Straße zu gelangen. Der ausdruckslose Blick eines Bettlers gab ihm den Rest. Überall sah er sie plötzlich: in einem Hauseingang, in einer Unterführung, am Brunnen. Er hetzte weiter. Vor der Kirche saß schon wieder eine dieser Gestalten.
Die Kirche. Hier hatte seine Tante immer einen Zwischenstopp eingelegt, wenn sie ihre schweren Taschen vom Markt nach Hause trug. „Da find‘st wenigstens immer an freien Platz“, hatte er ihre lachende Stimme noch im Ohr. Fühlte fast ihre Hand, mit dem sie ihm durch die kurzen Haare fuhr. Fluchtartig wandte er sich ab.
„Es gibt immer einen Weg, Seppi!“ Fast meinte er zu hören, wie sie es ihm hinterher rief. Sie hatte sich geweigert, ihn Joseph zu nennen wie ihn seine Eltern genannt hatten. „Dschausef“, mit dieser englische Version kam sie nicht zurecht. Und Jeph, wie ihn seine Freunde nannten, das lag ihr nicht. Für sie und ihren Mann blieb er Seppi. Punkt.
Wo bitte, liebe Tante, wo ist denn nun dieser Weg?, murmelte er in sich hinein. Dieses Mal würdest auch du garantiert keinen finden.
* * *
Die Sonne wärmte die Hausmauern und Straßen. Kinder auf dem Spielplatz im Park lärmten ausdauernd. Jede Bank war belegt von Müttern, die sich unterhielten, Kinderwagen schaukelten und ihre Kleinen beobachteten. Zwei ältere Herren, die dem schönen Wetter nicht trauten und sich in dick wattierte Jacken eingepackt hatten, teilten sich eine Zeitung. Ein Stück weiter, unter den Bäumen am Ufer des Weihers saß eine schmächtige Frau, die ihm Rücken und hängende Schultern zukehrte und Spatzen fütterte. Jephs Magen knurrte. Der Imbissbude mit dem köstlichen Duft nach gebratenen Würsten war er vorher erfolgreich ausgewichen — er musste seine kleine Barschaft zusammenhalten — aber es war schon eine Weile her seit dem kargen Frühstück. Er war drauf und dran der arglosen Frau, hinter der er gerade vorbei lief, das große Wurstbrot aus der Hand zu reißen. Sie zupfte schon wieder ein Stückchen ab und warf es den wartenden Vögeln zu. Am liebsten hätte er sich mit ihnen darum gestritten.
„Wenn Sie wollen, können sie es haben.“
Sie drehte sich nicht um. Nur durch die Bewegung, mit der sie das Brot hochhielt sah er einen kleinen Teil ihres blassen, verweinten Gesichts. Er war hier wohl nicht der Einzige mit Problemen.
Ohne weiter nachzudenken schnappte er sich den verlockenden Happen. „Danke“, brachte er gerade noch heraus. Dann flüchtete er tiefer hinein in den Stadtgarten.
Er musste endlich was unternehmen, aber er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Herrgott nochmal, er war doch sonst nicht auf den Kopf gefallen! Vielleicht, wenn er etwas gegessen hätte. Er hielt immer noch das in Papier eingewickelte, kaum angebissene Sandwich in der Hand, suchte eine ruhige Ecke. Sein Blick schweifte über den schattigen Platz, der sich gerade vor ihm auftat und blieb an der Gestalt hängen, die neben einem überladenen Fahrrad auf einem steinernen Blumenkübel saß. Sein Bettnachbar. Fred. In den Händen eine Ausgabe der örtlichen Obdachlosenzeitung, die er gerade einem der wenigen Spaziergänger andrehen wollte. Erfolglos.
Schnell drehte Jeph sich weg, tat als hätte er ihn nicht bemerkt. Nicht gesehen, wie der potentielle Kunde ebenfalls sein Gesicht abwandte und seine Schritte beschleunigte. Jeph schulterte seine Tasche. Würde seine Zukunft nun auch so aussehen? Ihn schauderte. Doch das war im Moment seine kleinste Sorge. Was war passiert an diesem Tag, der ihn für Wochen ins Krankenhaus gebracht hatte? Was hatte er getan oder nicht getan? Er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern...
Kapitel 2
Kira
Ich sollte nach Hause. Sie macht sich bestimmt schon furchtbare Sorgen... Kira konnte sich nicht aufraffen. Es war so schön hier, so friedlich. Es ging ihr auch wieder relativ gut. Und das, obwohl sie heute morgen schon wieder vergessen hatte, ihre Tabletten zu nehmen. Gerade vorher hatte sie das festgestellt, aber ihre Panikattacke hielt sich in Grenzen. Es war ihr so langsam alles egal. Dieses ewige Auf und Ab. Wie sie es hasste!
Sie hatte sich so auf diese Reise nach Paris gefreut. Mit ihrer Freundin loszuziehen, ohne ihre ewig besorgte Mutter, die bei jedem ihrer Huster das Schlimmste befürchtete. Sie selbst hatte in den vergangenen Wochen strenger als sonst auf ihre Ernährung geachtet, ihre Medizin genau nach Stundenplan eingenommen, den bitteren Kräutertee, der angeblich so gesund sein sollte, unter Todesverachtung geschluckt, jede Anweisung ihres Arztes genauestens befolgt. Sie hatte das Gefühl, dass es jetzt endlich, endlich aufwärts ging. Seit Monaten hatte sie keine erwähnenswerten Probleme gehabt. Laura, ihre neue und einzige Freundin, die sie vor kurzem in der Bibliothek kennengelernt hatte, hatte ihre Mutter bekniet: „Ich werde gut auf Kira aufpassen, das verspreche ich Ihnen, Frau Martens. Ich habe eine SanitäterAusbildung, bin Ersthelferin bei uns im Betrieb. Auch der Reiseveranstalter hat einen sehr guten Ruf. Beste Betreuung ist also garantiert.“
Ihre Mutter hatte nachgegeben. Ungern. Man merkte ihr das Unbehagen förmlich an. Sie hatte versucht mitzukommen, aber ihr Vorgesetzter genehmigte ihr keinen Sonderurlaub. Ihretwegen hatte die Arme keinen einzigen Tag mehr zur Verfügung. So viele Male, an denen sie kurzfristig freinehmen musste. An denen sie an ihrem Bett wachte, ihre Stirn kühlte, sie in Wickel packte und sie tröstete. Kiras schlechtes Gewissen wuchs proportional zu ihrer unglaublichen Freude auf diese „freie“ Zeit.
Sie hatte sich gleich zwei neue Blusen gekauft, eine leichte eisblaue Daunenjacke und, was für eine Verschwendung, eine dieser modischen Dreiviertelhosen. Nicht, dass sie dadurch zur Schönheitskönigin avanciert wäre, aber Laura meinte, die bunten Blusen brächten Farbe in ihr Gesicht, und sie sei richtig neidisch. Sie selbst könne so eine Hose gar nicht tragen. Es war nett von ihr, so was zu sagen. Laura, an deren Proportionen überhaupt nichts auszusetzen war, hätte sie auch mit einem Kleiderständer vergleichen können, der beim leichtesten Windhauch klappernd zu Boden fallen würde. Mit wehendem, dünnem Haar. Ein paar Gramm mehr auf den Rippen hätten ihr schon gut getan. Sie würde sich in Frankreich jede Menge dieser herrlich fettigen Buttercroissants genehmigen!
Gerührt dachte sie auch an den Collegeblock und das dicke Schreibmäppchen, das sie von ihrer Nachbarin Erna bekommen hatte.
„Gab es beim Discounter. Schau mal, da ist ein richtiges Büro drin: Kuli mit Farbminen, Bleistift, Minilocher, Lineal, Tesafilm, Textmarker, Radiergummi, und sogar ein winziger Tacker! Ohne Schreibmaterial bist du doch nur ein halber Mensch. So ohne kann man dich doch nicht fahren lassen.“
Und ihre Mutter drückte ihr sogar noch einen Fünfziger als extra Taschengeld in die Hand.
Vor drei Tagen war dann die Reisegruppe gestartet. Ohne sie.
Während sie wieder einmal blass und geschwächt, angeschlossen an Infusionen, und bewacht von ihrer sorgenvollen Mutter in den Kissen lag, hatte sich ihre Freundin bestürzt und mitleidig von ihr verabschiedet: „Ich gestehe es ungern, aber ich bin froh, dass es dich noch zu Hause erwischt hat. Ich glaube, in Frankreich wäre ich doch ein bisschen überfordert gewesen. Ich werde dir jeden Tag schreiben“, hatte sie ihr noch versprochen.
Die quälenden Bauchschmerzen, die Schweißausbrüche und der Schwindel waren vorbeigegangen. Aber zu spät.
Diese verfluchte Krankheit! Sie bestimmte ihr ganzes Leben. Sie war schuld daran, dass sie manchmal wochenlang keine Schule besuchen konnte, keine Freunde hatte. Schon als Kind lag sie oft, während ihre Altersgenossen draußen spielten, mit klappernden Zähnen oder hohem Fieber in ihrem abgedunkelten Zimmer. Dann wieder ging es ihr wochenlang gut.
Sie begann zu hoffen, mehr oder weniger geduldig, bis der nächste Schub unbarmherzig wieder zuschlug. Und während die anderen später von Party zu Party zogen oder die Welt eroberten, hielt sie sich an unzähligen Tassen Gesundheitstees fest und studierte. Germanistik. Das wenigstens konnte sie und es stellte Dank der virtuellen Möglichkeiten heutzutage kein Problem dar.
Keiner der vielen Ärzte, die sie nach und nach aufgesucht hatte, bekam heraus was ihr fehlte. Sie wurde durch sämtliche medizinischen Mangeln gedreht und kannte jedes Gerät und jedes Laborblatt in- und auswendig. Da ihre Mutter halbtags im Sekretariat des städtischen Krankenhauses arbeitete, wurde sie immer bevorzugt, und Ärzte und Schwestern behandelten sie besonders liebevoll und vertraut. Aber sie konnte sie hinter ihrem Rücken den Kopf schütteln sehen. Sie hörte sie förmlich sagen: „Die arme Kleine hat wohl ein psychisches Problem. Anders ist das doch nicht zu erklären.“
Zwei Leben gingen daran langsam kaputt. Nicht nur das ihre. Auch ihre Mutter konnte ihretwegen keine Beziehung aufbauen, und das Leben flog auch an ihr vorbei. Wer will schon eine Frau mit einem kranken Kind, das alle naselang flach liegt, auf das man ständig Rücksicht nehmen muss, das einem sämtliche Planungen über den Haufen wirft und das nicht mal einen Vater hat, bei dem man es gelegentlich abstellen kann. Zu diesem Thema schwieg ihre Mutter leider immer noch eisern. Bekam verschleierte, unglückliche Augen, bis Kira die Fragen danach aufgab.
Die Eltern ihrer Mutter standen auch nicht zur Verfügung. Ihr Großvater war vor Jahren stolzer, vielbeschäftigter Kassenwart des örtlichen Fussballvereins gewesen. Seine Frau, eine frenetische Tennisspielerin in einem renommierten Club, und ihre Tochter der kommende Star in ebendieser Szene. Sie gewann drei Jugendturniere in Folge. Alles drehte sich in der Familie um den Ballsport. Und dann trat das Mädchen plötzlich mit einem dicken Kugelbauch bei ihnen auf.
Sie hatten es nie verwunden, dass ihre Tochter von heute auf morgen ihre Sportkarriere aufgab. Und es trug ganz und gar nicht zu ihrer Versöhnung mit dieser Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten bei, dass das Wesen, dem sie die Schuld daran gaben, kränklich und unsportlich war.
Nicht, dass Kira sich nicht gerne bewegt hätte. Aber wenn sie, wie so oft, gezwungenermaßen flach lag, flüchtete sie sich in die Welt der Bücher, was ihre Großeltern erst recht nicht nachvollziehen konnten.
Sie kamen in der Folgezeit ab und zu vorbei und brachten Geschenke, denen man jedoch anmerkte, dass ihre Enkelin ihnen fremd war. Es entging Kira nicht, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter immer aufatmeten, wenn sie hinter ihnen her winken konnten. Danach kuschelten sie auf dem Sofa, knabberten Gebäck, schauten einen Film, bevorzugt einen, in dem Familienprobleme auf lustige Art aufgearbeitet wurden, und waren sich doppelt nahe. Wenn sie Glück hatte, sogar ohne dass sie danach wieder das Bett hüten musste.
So verging ihre Kindheit, aber auch als Erwachsene, wenn man sie als solche bezeichnen konnte, musste sie sich eingestehen, dass sie immer noch auf Hilfe angewiesen war. Neidvoll schaute sie auf die vielen unbeschwerten, vor Gesundheit strotzenden Menschen um sie herum.
Eines dieser Wesen, ganz in leuchtendes Rot gekleidet, mit gestähltem, kraftvollem Körper und glatter, gesunder Haut trabte am Ufer vorbei und scheuchte die Spatzen auf, die auf ein paar Krümel von Kiras Sandwich hofften.
Lustlos knabberte Kira daran und stockte plötzlich: Was war denn das? Erschrocken betrachtete sie die rote Spur, die ihre Zähne hinterlassen hatten, befühlte diese nervös mit der Zunge, schmeckte Blut. Das war nicht gerade ein Zeichen strahlender Gesundheit. Angewidert brach sie die angebissene Stelle ab und stopfte das Brot zurück in die Papiertüte. Die blutigen Bröckchen verteilte sie schnell unter die bettelnden Vögel.
„Euch graust wohl vor überhaupt nichts!“, sagte sie schwach lächelnd.
Auch heute war sie, wie immer am Ende ihres Bibliothekstags, hierher gekommen. Auf ‚ihrer‘ Bank gönnte sie sich jedes Mal eine halbe Stunde, dehnte sie aus so lange es irgend ging, bevor sie wieder in ihre vier Wände zurückkehrte.
Sie wusste, dass sie ihrer Mutter dadurch einige unruhige Stunden bescherte, dass die es gar nicht gerne sah, wenn Kira etwas alleine unternahm. Man wusste ja nie, ob ihr nicht ein weiterer Schwächeanfall drohte.
Doch diese Auszeit, die die Bibliothek ihr verschaffte, brauchte sie so dringend. Heute hatte sie nicht wie sonst geschmökert. Sie hatte nur die Bücher abgegeben, die vorbestellten eingepackt, und dann sofort ihr Lieblingsfleckchen am Weiher des Stadtparks aufgesucht.
Sehr viele Besucher verirrten sich nicht bis hierher. Den meisten war es unter den hohen Bäumen zu schattig, und Kira war froh, dass sie sich von ihrer Mutter die wärmere Jacke hatte aufdrängen lassen. Auch der junge Mann, der mit gesenktem Kopf durch den Park trottete und sich mit einer schweren Sporttasche abschleppte, war ziemlich dick eingepackt. Sie schaute genauer hin, schob ihre Brille zurecht. Das ist doch...? Aber nein, der sieht ihm nur ähnlich, dachte sie, wandte sich ab und grübelte weiter: Heute schauen sie sich den Louvre an. Die Gemälde von Botticelli, Raphael und Michelangelo. Die Mona Lisa. Ich hätte sie so gerne mal im Original gesehen. Ob es tatsächlich stimmt, dass sie einem überallhin nachblickt? Sie würden all diese alten Gebäude in dem ganz besonderen Licht sehen: Mont Martre, Sacré-Coeur, den Eiffelturm. Dann an der Seine entlang spazieren, über eine der berühmten Brücken flanieren. In einem Pariser Bistro einen Café au lait trinken, ein Croissant essen. Laura hatte sich noch gar nicht gemeldet...
Gib dich endlich zufrieden, Kira. Hier ist es doch auch schön! Der Windstoß, der das Wasser im Schatten grau kräuselte, und dafür sorgte, dass sie die Jacke enger zuziehen musste, schien sie auszulachen.
Du mich auch!, dachte sie zornig, zog die Brottüte wieder heraus, kramte nach ein paar Bröseln und warf sie den wartenden Vögeln zu. Vielleicht kann ich wirklich niemals in einem dieser wundervollen Hotels sitzen und auch nie an der Concierge meine Französischkenntnisse ausprobieren. Aber unvergessliche Eindrücke gibt es auch im Fernsehen, und der Vin rouge ist bestimmt nicht halb so toll wie jeder meint. Ich könnte ja mit dem tauschen, der gerade hinter mir stehen geblieben ist, und dessen unangenehmer Geruch mir grade in die Nase steigt. Dann hätte ich Grund zu jammern.
Ein eigenartiges Rumpeln drang an ihre Ohren. Magenknurren??? Ohne sich umzudrehen, reichte sie die Tüte mit dem angebissenen Brot nach hinten: „Wenn Sie wollen.....?.“
Die sich hastig entfernenden Schritte verklangen. Wenigstens hatte sie außer den Spatzen noch jemandem eine kleine Freude machen können. Und so langsam sollte sie sich jetzt wirklich auch auf den Weg machen. Sie putzte die Schlieren aus ihrer Brille — die Kontaktlinsen, zu denen sie sich von Laura hatte überreden lassen, lagen zu Hause zuunterst im Schrank, auch so was Unnützes — und stand müde auf.
Kapitel 3
Kira
Ihre Büchertasche wurde immer schwerer, und die Sonne tat ihr Übriges. Kaum zu glauben, dass das ein ganz normaler Februartag war, Dass sie auch den Bus verpassen musste! Erschöpft blieb sie stehen, klemmte ihre nun viel zu warme Jacke zwischen die Knie und wühlte hektisch in den Tiefen ihrer Tasche nach einem Stück Traubenzucker. Sie brauchte es, brauchte Kraft. Trotzdem würde sie es nicht schaffen, rechtzeitig zu Hause zu sein. Sie würde eine weitere Debatte über den Unsinn, alleine in der Stadt herumzustreifen, aushalten müssen.
„Dass ihr Frauen immer ein ganzes Warenlager mitschleppen müsst!“
Die amüsiert klingende Stimme von oben ließ sie zusammenzucken. Ein Sanitätswagen hatte unbemerkt neben ihr angehalten, und erfreut erkannte sie am Steuer einen der netten Samariter, vertraut von viel zu vielen Fahrten ins Krankenhaus.
„Oh, hallo Ralf.“ Sie lächelte ihm zu. „Habt ihr mich erschreckt!“
„Sollen wir dich mitnehmen, Prinzessin? Wir fahren sowieso grade in deine Richtung.“
„Dürft ihr das denn?“, fragte sie zweifelnd, stieg aber bereits ein und zwängte sich zu den beiden jungen Männern in den Wagen.
„Nur nicht zu viel fragen!“, lachte der andere, auch er kein Unbekannter. Im Gegenteil. Der Anblick des dunkelhaarigen angehenden Arztes mit dem markanten Gesicht, Michael hieß er, hatte ihr Herz schon öfter höher schlagen lassen. Und als sie nun so eng an ihn gedrückt auf dem Sitz saß, schlug es noch schneller. Willkommen in „Sturm der Liebe“, Nachbarin Ernas Lieblingsserie. Wie peinlich! Während sie noch mit ihren Gefühlen kämpfte, plauderte der Verursacher unbeeindruckt mit ihr und Ralf. Auch der so ein Exemplar zum Verlieben. Nett und freundlich, genau so ein blondes sonniges Exemplar und genau so unsensibel wie Michael. Aber für die beiden war es ja nichts ungewöhnliches, von Patientinnen aller Altersklassen angehimmelt zu werden. Eine dümmlich grinsende junge Frau, die nicht mal ein paar sinnvolle Sätze von sich gab und sich schmerzlich ihrer dünnen, schlaffen Haare und ihrer fahlen Gesichtsfarbe bewusst war, hatte da erst recht keine Chance.
Viel zu schnell erreichten sie ihr Wohngebiet. Einer rote Ampel verdankte sie immerhin noch ein paar weitere Minuten in dieser angenehmen männlichen Gesellschaft.
„Ist das da nicht Joseph Bronner?“ Ralf deutete auf einen Mann in grünem Anorak, der vor ihnen die Straße querte. „Den haben sie doch gestern erst entlassen.“
„Gestern? Dann sollte er vielleicht nicht schon jetzt mit schweren Taschen durch die Gegend marschieren!“ Michael runzelte besorgt die Stirn.
„Das interessiert in der Klinik doch niemanden. Ist sowieso ein armer Kerl. In seiner Haut möchte ich jetzt wirklich nicht stecken.“
„Wieso eigentlich? Ich hab nur am Rande mitbekommen, dass er ewig lang bei uns in der Klink war. In der Neurologie, soviel ich weiß.“
Kira, die ihre romantischen Vorstellungen energisch beiseite geschoben hatte, schaute neugierig hinaus. Joseph. Jeph! Sie hatte sich also doch nicht geirrt. Er war es, den sie vorher im Park gesehen hatte.
„Den kenne ich“, mischte sie sich ein. „Das ist ein ehemaliger Klassenkamerad von mir. Der Schwarm aller weiblichen Wesen auf dem Schulgelände. Er sah ja auch unglaublich gut aus. Damals“, fuhr sie fort und blickte ihm irritiert nach. „Er hätte jede haben können, ich hab auch zu seinen Fans gehört.“ Sie lachte. „Aber nicht mal unsere Klassen-Queen kam bei ihm an. Obwohl sie ein Fahrgestell hatte, um das wir sie alle beneidet haben, schraubte er lieber an welchen mit Rädern herum. Schon damals hatte er immer irgendein Fahrzeug. An Geld hat es ihm jedenfalls nie gefehlt.“
„Im Moment fehlt es ihm aber eindeutig an beidem!“
„Ja.“ Verwundert schaute sie dem Mann nach, der gerade in eine Seitengasse abbog „Wenn man ihn so sieht.“ Sie konnte es körperlich fühlen. Die ganze Gestalt wirkte niedergeschlagen. Die grüne Jacke, viel zu groß, schlabberte über einer ausgebeulten Jogginghose, und der Gang signalisierte Hoffnungslosigkeit. „Was ist denn passiert?“
“Na, so genau weiß ich das auch nicht.“ Ralf zuckte mit den Schultern. „Eine ziemlich seltsame Geschichte. Er war wohl gerade im Haus seiner Verwandten als die überfallen und dabei umgebracht wurden. Er selbst wurde bewusstlos drinnen aufgefunden. Kann sich angeblich an nichts erinnern.“
„Na, ja, bei einem Schädel-Hirntrauma ist das nicht ungewöhnlich“, sagte Michael.
„Nun, es kursieren die wildesten Vermutungen. Stand ganz groß in der Zeitung. Habt ihr das nicht gelesen?“
„Ich nicht, aber ich war die letzte Zeit so mit meinem Studium beschäftigt“, antwortete Michael. „Wird jetzt echt heftig.“
„Ich hab davon gehört“, sagte Kira betroffen. „Aber ich wusste nicht, dass es dabei um Jeph ging.“
„Und wieso läuft er jetzt durch die Straßen wie ein herrenloser Hund? Hat er kein Zuhause?“, fragte Michael.
„Keine Ahnung.“ Ralf zuckte mit den Achseln und reckte den Kopf. „Besuch hat er so gut wie keinen bekommen, das weiß ich. Dafür war die Polizei öfter da, hat mir Schwester Cordula erzählt. Und die Sozialarbeiterin kam die letzten Tage auch ein paarmal vorbei.“
„Du solltest langsam mal losfahren, glaube ich. Die Ampel wird gleich wieder rot. Sie hat mindestens schon das zweite Mal die Farbe gewechselt!“ Michael knuffte ihn in die Seite, und Kira schaute immer noch verwirrt der Gestalt hinterher, die gerade in der Gasse verschwand.
* * *
„Mama? Was machst du denn da?“
Kira blickte erstaunt auf geöffnete Türen, auf Stapel von Kleidung, Unterwäsche, Schals und einen Berg von Schuhen.
„Kira! Wie gut, dass du endlich da bist.“
Ihre Mutter kam in Unterwäsche aus dem Schlafzimmer und strich sich seufzend die dunkelblonden, halblangen Haare aus dem Gesicht. Mit ihren etwas über fünfzig Jahren war sie noch immer eine attraktive Erscheinung. Nur die tief eingekerbten Falten in ihren Mundwinkel verrieten, dass das Leben es nicht immer gut mit ihr gemeint hatte.
„Warum bist du so spät dran? Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr? Ich muss auf ein Seminar, so einen Workshop. Von jetzt auf nachher. Eine Kollegin ist ausgefallen, und ich sollte bald los. Wie lang braucht man nach München? Drei Tage soll das gehen! Aber ich muss. Bleibt mir nichts anderes übrig. Samstag Abend bin ich wieder da. Kannst du alleine zurechtkommen, Schatz? Wenn es dir nicht gut geht, können die mich mal!“
„Drei Tage? Das geht schon klar. Du kannst nicht immer alles wegen mir absagen. Und mir geht es grade wirklich nicht schlecht“, sagte sie und versuchte, nicht zu zeigen, wie aufgekratzt sie plötzlich war. „Wirklich, mach dir keine Sorgen!“
„Ich habe ein paar Sachen eingefroren. Pizza ist auch da, und vergiss ja nicht, deine Medikamente zu nehmen. Warum muss ich da jetzt unbedingt hin?“, schimpfte sie weiter. „Urlaub habe ich keinen bekommen. Aber jetzt für diese blöde Schulung, da geht es plötzlich im Büro ohne mich.“
„Mama, jetzt reg dich ab. Genieß es doch einfach mal. Wohin geht es? Nach München? Vielleicht sind ja ein paar nette Leute dabei. Und da gibt es doch sicher auch ein Abendprogramm.“
„Schon, aber wenn was ist, rufst du an! Bei den Chinesen ist ein neues Virus aufgetreten. Ziemlich beunruhigend. Pass auf dich auf! Du weißt ja...“
„Ja doch, ich weiß! Ich muss doch bei jeder Grippewelle aufpassen.“
„Ach Baby, ich lass dich so ungern allein. So kurz nachdem du dich ein bisschen erholt hast.“
„Mama, ich bin kein Kleinkind mehr. Die Notrufnummer kann ich auch selbst wählen, sollte was sein. Aber das wird es nicht. Hab keine Angst.“
„Sicher? Heut morgen warst du noch so zittrig, da sind dir die ganzen Tabletten runtergefallen. Wenn wenigstens Erna da wäre. Aber die ist noch mindestens zwei Wochen in Reha. Oh je, ich muss noch bei ihr die Blumen gießen!“
„Mama, du packst jetzt fertig! Ich gehe nachher rüber und mach das!“
Sie konnte ihrer Mutter nicht sagen, dass sie die verfluchten Tabletten zwar eingesammelt, aber nicht eingenommen hatte. Weil gerade kein Glas Wasser in der Nähe war. Schnell ließ sie das verräterische Schüsselchen, in dem sie sie deponiert hatte, unter einem Schal verschwinden. Es würde schon gut gehen! Das würde ihr jetzt nicht mehr passieren!
„Ist noch was übrig vom Abendessen? Ich habe gerade richtig Hunger“, fragte sie ablenkend.
„Nein, aber ich kann dir noch schnell was machen.“
„Mama! Ich bin durchaus dazu imstande eine Pizza in den Ofen zu schieben!“
Als die Tür hinter ihrer Mutter endgültig ins Schloss fiel, atmete sie erleichtert auf und ließ sich dann erschöpft auf das Sofa fallen. Beklommen fragte sie sich, ob sich nicht doch wieder eine Schwächeperiode ankündigte. Sie würde jetzt gleich ihre Medizin einnehmen. Aber, was roch da so verbrannt? Um Himmels willen! Die Pizza!!!
In der Kühltruhe fand sich glücklicherweise noch eine von Ernas Hühnersuppen. Und gekochte Nudeln im Kühlschrank. Sie setzte sich damit an den Küchentisch am Fenster, von wo aus man ein großes Stück der Straße einsehen konnte. Hier war immer was los. Fast wie im Fernsehen. Ihr Wohnviertel zählte nicht zu den bevorzugtesten dieser Stadt, was man an den lieblos gestalteten Anlagen und den in die Jahre gekommenen Gebäuden unschwer erkennen konnte. Die mehrstöckigen Siedlungshäuser waren vor vielen Jahren für privilegiertere städtische Bedienstete gebaut worden, aber heute wohnten hier Menschen mit geringem Einkommen: Alleinerziehende, Studenten, Rentner. Die Stadtväter sahen keinen Grund in eine Verschönerung zu investieren. Der Ausblick war also nicht gerade erhebend, aber immer kurzweilig. Zu dem günstigen chinesischen Imbiss an der Ecke verirrten sich sogar des öfteren Angestellte des angrenzenden Industriegebiets, die sich ihre Anzüge mit Nudeln bekleckerten. Kira und ihre Mutter waren froh als sie vor einem Jahr diese günstige Wohnung beziehen konnten. Mit dem Gehalt für die Halbtagsstelle im Krankenhaus-Sekretariat brachte Frau Martens ihren Zweipersonenhaushalt gerade so über die Runden. Der Nachhilfeunterricht, den Kira an guten Tagen geben konnte, und ein paar kleinere Aufträge für Übersetzungen sorgten für ein wenig Taschengeld, oder es ging gleich für neue Stärkungsmittel drauf, die diesmal — wirklich garantiert! — Hilfe versprachen.
Ein weiterer Glücksfall war die Bekanntschaft mit Erna. Nur wenige Wochen nachdem sie eingezogen waren, fiel sie ihnen praktisch vor die Füße. Samt Fahrrad und einem Korb voller Gemüse. Sie halfen umher kullernde Kartoffeln einzusammeln, Salatköpfe in Tüten zu stopfen und versorgten die alte Dame mit Pflastern und Tinkturen aus ihrer gut bestückten Hausapotheke. Zum Dank dafür wurden sie ab sofort mit Erzeugnissen aus ihrem Schrebergarten verwöhnt. Ab und zu kam sie gleich mit einem ganzen Obstkuchen und verwandelte ihre kleine Küche in ein gemütliches Café. Sogar ihre immer angespannte Mutter wurde in ihrer Gesellschaft gelöster, und Kira genoss einfach die Abwechslung und die interessanten Erzählungen der Nachbarin.
Mit der Zeit zierte sich ihre Mutter, die milden Gaben anzunehmen, aber Erna wäre nicht Erna gewesen, wenn ihr nichts eingefallen wäre: „Kira studiert doch Germanistik, und ich würde so gerne einmal alles aufschreiben was ich erlebt habe. Die Pflegeeltern, die Ferien auf dem Land, das Wirtschaftswunder, mein Mann in der Marine. Er war als Ingenieur viel im fernen Osten, und ich war oft mit dabei. Was meint ihr, kann sie mir dabei helfen?“, fragte sie eines Tages. „Ich kann allerdings nicht viel bezahlen...“
„Oh, ich würde...“ das so gerne machen, wollte Kira antworten, war Feuer und Flamme, bemerkte aber einen kleinen Anflug von Eifersucht in der Miene ihrer Mutter.
„...meinen“, sagte sie stattdessen, „das viele frische Obst und Gemüse, das wir von Ihnen bekommen ist ein guter Gegenwert, da müssen Sie mir viel zu erzählen haben. Ich würde das also sehr gerne machen.“
So kam Kira zu einer Vertrauten, einer Oma, einer Tante, alles in einem, und noch dazu zu einer Freundin. Die einzige, bis sie auf Laura traf. Und Erna umsorgte sie, wenn sie zum Schreiben zu ihr kam, auf ihre Weise genau so wie ihre Mutter.
Im gegenüberliegenden Haus, schräg unten und nur einen Stock tiefer, sah sie auf die beiden Fenster von Ernas Wohnung. Konnte es sein, dass die Pflanzen schon die Köpfe hängen ließen? Sie würde bald rüber gehen müssen. Aber eine halbe Stunde würde sie sich noch hinlegen.
Beim Tisch Abräumen warf sie noch einen Blick hinunter. Der Mann, der gerade im Haus gegenüber verschwand, kam ihr auf verstörende Weise bekannt vor. Ach was, es gibt auf der Welt noch mehr Menschen mit grünen Anoraks, liebe Kira. Leidest du vielleicht jetzt zu allem anderen auch noch an Verfolgungswahn?!
Kapitel 4
Jeph
Diese blöde überhebliche Kuh! Jeph wechselte seine Tasche von einer Schulter auf die andere und fluchte innerlich noch immer vor sich hin. Sah wieder die dicke Hornbrille, durch die milchig blaue Augen ihn missbilligend musterten, und hörte die Alte herablassend sagen: „Fassen wir es mal zusammen: Sie, Joseph Bronner, sind einunddreißig Jahre alt, arbeitslos, und haben nie Versicherungsbeiträge einbezahlt. Sie haben weder eine abgeschlossene Ausbildung noch eine Unterkunft. Sie verfügen über keine Einnahmen, besitzen keine Rücklagen und auch keinerlei Wertgegenstände. Und nun soll Vater Staat Ihnen sagen, was sie tun sollen!“
„Ich...“