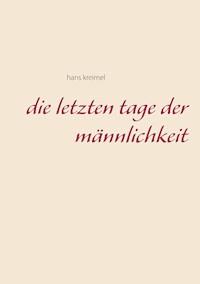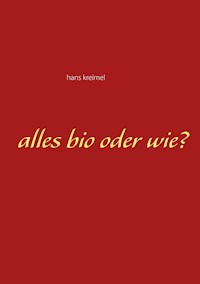
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist alles ganz einfach. Bio und Öko sind toll, super und leiwand. Konventionell ist böse, ganz ganz böse. Leider halten diese Vorurteile der Realität nicht stand. Bio ist nicht immer gut und schön. Die angeblich industrielle Landwirtschaft kommt qualitativ erstaunlich oft der Bio-Erzeugung nahe und hat oft auch Vorteile gegenüber Bio. Warnung des Autors: Dieses Buch ist nicht für Träger von Öko-Scheuklappen geeignet!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Mein eigener Zugang zum Thema
Die Geschichte von Bio
Woran erkenne ich Bio-Produkte?
Bio in der Praxis
Belastungen von biologischen und konventionellen Produkten – ein Vergleich
Wie giftig ist konventioneller Pflanzenschutz?
Pestizide im Detail
Die Glyphosat-Lüge
Integrierte Produktion IP
Rückstandsreduktionsprogramme
einheitliches EU-weites Pflanzenschutzgesetz
Pflanzenschutzpraxis Bio
das Analyse-Dilemma
die Spenden-Industrie
Wie gesund ist gesunde Ernährung?
Bio und Klimaschutz
Kann Bio die Welt ernähren?
Was fällt Ihnen spontan zum Thema „Bio“ ein?
Wo Sie sich weiter informieren können …
Vorwort
Wie kommt man auf die Idee, ein Buch mit diesem Titel zu schreiben?
Die Praxis, zum einen konventioneller Ackerbauer zu sein, zum anderen biologisch (oder ökologisch, wie man in Deutschland zu sagen pflegt) arbeitender Obstbauer, verursacht immer wieder Verwunderung. Darüber hinaus hatte ich immer das Bedürfnis, über den eigenen Tellerrand zu sehen, sowie eigene und fremde Philosophien zu hinterfragen. Nicht ohne Wirkung sind die wild wuchernden NGO.s (Non Government Organisations) geblieben, die ihre Kohle im wesentlichen mit dem Spiel mit Ängsten und dem Erzählen von Schauermärchen verdienen. Oder die Berufsmärchenerzähler, die uns mittels Storytelling in ihren Bann ziehen wollen.
Dazwischen stehen die einfachen Bauern, biologisch wie konventionell arbeitende, die manchmal nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht.
Dieses Buch will Sie nicht in irgendeine Richtung manipulieren.
Dieses Buch will keine Spenden keilen.
Dieses Buch will Sie nicht missionieren oder umerziehen.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Am Ende sind Sie von einer der beiden Philosophien (bio oder konvi) oder auch von der Wichtigkeit beider überzeugt.
Ziel dieses Buches ist auch neue Sichtweisen und Zugänge zu vermitteln.
Dieses Buch sollte ursprünglich „Alles bio oder was?“ heißen. Unter diesem Titel biete ich seit einigen Jahren auch Vorträge unter anderem für das Katholische Bildungswerk der Diözese St. Pölten an. Der Vortrag wurde bisher sehr gut in den örtlichen Pfarr-Bildungswerken angenommen. Der Buchtitel selbst ist leider schon vergeben, das heißt es gibt bereits zwei Bücher mit diesem Titel. Mit dem Titel „Alles bio oder wie?“ hoffe ich einen ebenso verständlichen aussagekräftigen Titel gefunden zu haben.
Eine der ersten prägenden Erlebnisse mit „bio“ will ich dem Leser (und natürlich der Leserin, es sind immer beide Geschlechter gemeint, auch wenn es nicht explizit ausgedrückt wird) nicht vorenthalten. Im Jahr 1989 arbeite ich als landwirtschaftlicher Betriebshelfer auf einem konventionellen Erdbeerbetrieb mit Selbsternte. Zeitweise stehe ich auch im Verkaufszelt. Einmal steigt eine sehr gepflegte Dame jüngeren Alters aus einem Cabrio aus. Die Dame mustert die Erdbeeren – es werden auch bereits gepflückte in Holzkistchen für die Laufkundschaft angeboten – und fragt: „sind die eh alle bio?“. Ich antworte „die werden konventionell erzeugt“ und denke mir, wie oft erliegen Bauern in dieser Situation der Versuchung zu sagen „natürlich, die sind alle vollkommen bio!“ oder „die sind eh nicht gespritzt!“.
Das zweite unvergessliche Bio-Erlebnis verdanke ich Felix Mitterer. Im vierten Teil seiner Piefkesaga, einer vierteiligen Fernseh-Serie, die auf geniale Art die Auswüchse des Tourismus aufs Korn nimmt, schildert er kritisch die Zukunftsvision Tirols. Der mehrmals vorkommende Dialogtext „dosch isch ollasch total bio“ ist eine klare und meiner Meinung kritische Botschaft über die unreflektierte Vermarktung der Bio-Idee.
Das dritte unvergessliche Bio-Erlebnis fußt auf einem Artikel in einer Gemeindezeitung und in einer Bezirkszeitung. Laut Artikel verkauft ein konventioneller Landwirt auf einem Markt biologisches Obst und Gemüse. Es sickert durch, dass konventionelle Paradeiser (zu deutsch: Tomaten) auf einem Großgrünmarkt beschafft und verkauft wurden. Die im Hausgarten gezogenen Gemüse und beernteten Obstbäume werden vielleicht nicht gespritzt. Sie sind allerdings nicht biologisch zertifiziert. Um etwas als Bioprodukt in Verkehr zu bringen, müssen Sie Ihre Produktion entsprechend von einem Kontrollverband zertifizieren lassen. Sonst dürfen Sie das Produkt nicht als Bio-Produkt verkaufen. Das Thema wird ausführlich später behandelt.
So weit wie möglich wird auf Quellen und Links verwiesen. Da ich mich schon lange mit dem Thema auseinandersetze, haben sich viele Informationen angesammelt, deren Quelle in Vergessenheit geraten und daher nicht mehr greifbar ist.
Sollten sich Fehler eingeschlichen haben – ich bin nicht unfehlbar - bitte um Mitteilung wenn möglich mit Quellenangabe an die Mailadresse [email protected]. Auch für Kritik und Ergänzungen bin ich dankbar. Sollte es zu weiteren Auflagen des Buches kommen, nehme ich Ergänzungen und Korrekturen gerne mit auf.
Mein eigener Zugang zum Thema
Wie bereits erwähnt war ich bis Ende 2018 praktizierender konventionell („konvi“) arbeitender Ackerbauer (Mais, Weizen, Soja, Ölkürbis) und biologisch („bio“) arbeitender Obstbauer (Biobirne Uta). Dazu kommt ein Forst und Energieholzanlagen, die ebenfalls konventionell betrieben werden. Ich hab also praktische Erfahrung und Zugang zu beiden Philosophien.
Die öffentliche Darstellung von „bio“ (für biologisch) und „konvi“ (für konventionell) hat mich immer schon gewundert. Bei den Bios (Biobauern) ist alles super, toll und leiwand (öst. für ganz toll), bei den Konvis (konventionell arbeitende Bauern) ist alles böse, schlecht und giftig. Wenn Sie sich noch etwas Hausverstand erhalten konnten, weil Sie etwas älter sind oder vorsichtig kritisch Medien konsumieren, wissen Sie, dass es bei einer solchen Schwarz-Weiß-Darstellung einen Haken geben muss.
Aufgrund meiner Erfahrungen kenne ich Bio-Bauern, die hart an die ökologisch vertretbaren Grenzen gehen. Diese Grenzen würde ich als Biobauer nicht ausreizen wollen. Zum anderen kenne ich Konvi-Bauern, die sehr umweltbewusst arbeiten, auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist, verzichten, und oft Produkte erzeugen, die analytisch den Bio-Produkten um nichts nachstehen. Die Grenze zwischen bio und konvi ist daher fließend.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird bio und konventionell ideologisch und fast pseudoreligiös betrachtet. Ideologische Betrachtung bedeutet, dass man bei den Bios die Nachteile und Schattenseiten wegblendet, während man bei den Konvis die positiven Argumente nicht wahrhaben will. Allerdings muss jeder für sich selbst entscheiden, was er für gut und richtig hält. Ein objektives „gut“ oder „schlecht“ oder „richtig“ oder „falsch“ gibt es nicht. Es sind wertende Sichtweisen, die aus der Sicht des Betrachters für denselbigen immer richtig sind. Für andere Menschen mit einem anderen Horizont oder einer anderen Sichtweise oder solche mit krankhaftem Missionierungsbedürfnis kann das auch nicht richtig sein.
Wer ergebnisoffen, bewusst nicht wertend und ohne ökoideologische Scheuklappen zu einem Urteil kommen will, ist herzlich eingeladen, weiter zu lesen. Folgen Sie den Argumenten und Sichtweisen, nehmen Sie an, was für Sie passt, und vergessen Sie es, wenn Sie anderer Meinung sind. Wenn Sie nur nach Bestätigung Ihrer Vorurteile suchen, werden Sie möglicherweise mit dieser Lektüre nicht glücklich.
Ich verfolge eine einfache Philosophie. Als konventioneller wie biologisch arbeitender Landwirt versuche bzw. versuchte ich mit bestem Wissen und Gewissen möglichst umweltverträglich zu arbeiten. Der Kunde entscheidet mit seiner Kaufentscheidung, ob er das eine oder das andere will. Als Anhänger der Marktwirtschaft akzeptiere ich diese Entscheidung. Aus meiner Sicht sind „bio“ und „konventionell“ zwei Philosophien, die beide ihre Berechtigung haben. Allgemein gültige Be- oder Abwertungen halte ich für unsinnig, und wo sie passieren, für überheblich, anmaßend und bevormundend.
Aus Sicht der Vermarkter, sprich aus Sicht des Lebensmittel-Einzelhandels, kurz LEH, im wesentlichen der großen Handelsketten, ist BIO ein interessantes Segment, um Umsatzmarktanteile zu sichern. Kein maßgeblicher Lebensmittelhändler kommt heute ohne ein solches Bio-Angebot aus. Diese Lebensmittelhandelsketten investieren oft nicht wenig Geld um wenige Zehntel-Prozent an Marktanteilen dazu zu gewinnen. Eine ganze Marketing-Armada ist oft am Werk, um neue Zielgruppen anzusprechen, neue Produkt-Segmente oder einfach nur Lebens-Gefühle und damit verbundene Produkt-Antworten zu entwickeln. Wir leben hier und heute. Die Wirtschaft bietet uns etwas an und wir entscheiden selbst, ob wir zugreifen.
Ein nicht zu übersehendes Phänomen ist die rasant wachsende Spendenwirtschaft. Non-Government-Organisations, kurz NGO.s wachsen aus dem Boden wie Schwammerl. Sie verfolgen ein einfaches Geschäftsmodell. Es wird Betroffenheit erzeugt, Angst, Panik, Dinge werden aus dem Zusammenhang gerissen, teilweise unter massiver Manipulation der Spendenzielgruppe. Ziel ist es, den Menschen, häufig älteren Menschen, möglichst viel Spendengeld aus der Tasche zu ziehen. Da gibt es ein paar Themen, die sich verdammt gut für dieses Geschäftsmodell eignen: Kinder, Tiere, unser Essen. Manche Themen haben sich zu richtigen Spenden-Cash-Cows entwickelt, zb. Glyphosat, Bienen oder Gentechnik.
Die Geschichte von Bio
Im Jahr 1925 arbeiten in Kärnten die ersten Betriebe biologisch dynamisch. Diese Philosophie ist heute unter „Demeter“ bekannt. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise geht auf Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) zurück. Steiner war bekennender Anthroposoph. Bei der Anthroposophie handelt es sich um eine sog. Erkenntnislehre, die jeden Menschen zum eigenen Forschen und Beobachten anregen soll. Sie befasst sich neben der Landwirtschaft auch mit Medizin, Pädagogik, Architektur, Religion, sozialen Themen und dem Finanzwesen.
1959 werden die ersten Bioverbände gegründet. 1962 wird der erste organisch-biologisch arbeitende Betrieb erwähnt. Diese Wirtschaftsweise begründet sich im wesentlichen auf Dr. Hans und Maria Müller. Grundlage ist der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel. Die Ideal-Vorstellung Müllers war der selbstbestimmte Bauer, der möglichst unabhängig von fremden Betriebsmitteln produziert und seine Produkte möglichst selbst vermarktet.
Im Jahr 1980 sind bereits ca. 200 Betriebe bekannt. Es handelt sich großteils um idealistisch motivierte Bauern, aber auch um Aussteiger aus anderen Branchen.
1994 entdeckt der Lebensmitteleinzelhandel das Bio-Segment für sich. Zuvor waren Bioprodukte hauptsächlich in Reformhäusern, auf Bauernmärkten und direkt ab Hof erhältlich. Die Vermarktung über dem LEH benötigt neue Strukturen. Eine Obstwiese mit sieben verschiedenen Apfelsorten ist über Großhandelsstrukturen schwierig vermarktbar. Handelsstrukturen brauchen Mindest-Mengen und gewisse Marktauftrittsflächen für ihre Produkte. Biologisch arbeitende Betreiber von Obstanlagen waren gefragt. Unter den traditionell arbeitenden Biobauern war kaum Bereitschaft vorhanden, ein, zwei, drei Hektar Äpfel, Birnen oder anderes Obst auszupflanzen. Auch klassische Obstbaubetriebe waren anfangs kaum bereit, ihre Anlagen auf Bio umzustellen. Zudem wurden erfahrene Obstvermarkter auf die Tatsache aufmerksam, dass konventionelles Obst in rauen Mengen exportiert, aber biologisches Obst importiert wurde.
In der Folge stampfte eine steirische Erzeugerorganisation ein Bioapfel-Projekt aus dem Boden. Das Projekt konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf die Sorte Topaz, sorgte für Beratung und rund 200 ha konnten in modernen Obstanlagen ausgepflanzt werden. Modern bedeutet Bäume auf der Unterlage M9 in ca. 1 Meter Abstand in der Reihe mit Drahtgerüst, Bewässerung und wenn möglich Hagelnetz sowie ausschließlich biologischem Pflanzenschutz.
Da sich das Bioapfel-Projekt der Fa. Steirerfrucht gut bewährt hatte, entstand etwa um 2000 auch die Idee, Bio-Birnen auf diese Weise zu erzeugen. Als weitgehende Exklusiv-Sorte wurde die Birne Uta, eine deutsche Züchtung aus Dresden-Pillnitz gewählt. Die Sorte ist sehr resistent, wohlschmeckend, aber nicht mit bei Birnen üblichen Quittenunterlagen verträglich. Ab ca. 2002 wurden rund 100 ha ausgepflanzt. Da sich die Birne aber auf einigen Standorten mit der Unterlage Kirchensaller Mostbirne nicht bewährt hat, wurde inzwischen einige Flächen wieder gerodet.
Apfel und Birne sind in der Anlagenführung vollkommen unterschiedlich. Der Bioapfel wird sehr intensiv geführt, hat sehr hohe Anlagekosten (3000 Bäume pro ha, Drahtgerüst, Bewässerung, Hagelnetz), kommt aber relativ rasch in den Ertrag.
Die Bäume haben eine sinnvolle Nutzungsdauer von ca. 15 Jahren. Die Bio-Birne wird vergleichsweise extensiv geführt. Es werden nur rund 1000 Bäume pro ha gepflanzt. Aufgrund der Unterlage kommt die Anlage später in den Ertrag, der Pflanzenschutz-Aufwand ist geringer, die Lebensdauer der Bäume wird mit 25 bis 30 Jahre angenommen. Auch die Birne könnte man so intensiv betreiben wie Apfelanlagen, allerdings auf Quitte mit Zwischenveredelung.