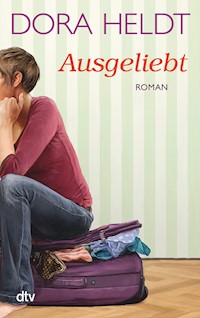Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kolumnen
- Sprache: Deutsch
Wie man am schönsten überreagiert ... Dora Heldt in Höchstform: Der vierte Band mit den erfolgreichen Kolumnen der Bestseller-Autorin - Heitere Alltagsbetrachtungen von Bestseller-Autorin Dora Heldt. Gedanken über überflüssige WhatsApp-Gruppen, perfektes Styling und andere lebenswichtige Dinge. Mit Charme und Witz entführt uns Dora Heldt in ihrem Kolumnenband wieder in ihren bunten Alltag. Warum in jedem noch so schäbigen Outfit auch eine »Pretty Woman« stecken kann, warum ein zweites X–Chromosom eine feine Sache ist und wie man am schönsten überreagiert: All das verrät sie ihren Leser*innen. Aus der Nähe betrachtet, sehen viele Dinge ja ziemlich seltsam aus ... - Digitale Eltern - Früher waren Ferien schöner - Einfach mal überreagieren - Frag mal Mutti - Gute Hypochonde ... aber keine Sorge: Alles eine Frage der Perspektive. Beste Unterhaltung mit den heiteren Alltagsbetrachtungen von Bestsellerautorin Dora Heldt
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dora Heldt
Alles eine Frage der Perspektive
Von handybedingter Nackenstarre,mutierten Märchenprinzen und anderen erstaunlichen Dingen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
hier sind sie, die neuesten Kolumnen, in denen es um Frauen, Männer, Freundinnen, nervige Mitmenschen, schräge Begebenheiten und all die Alltagsdinge geht, die uns Tag für Tag beschäftigen. Die ich geschrieben habe, weil mich irgendetwas amüsiert oder manchmal auch geärgert hat. Weil ich Dampf ablassen musste oder nervige Dinge so beschreiben wollte, damit sie zwar noch nervig, aber etwas lustiger sind. Allen gemeinsam ist, dass diese Kolumnen im Alltag entstehen, dass es um Dinge geht, die viele kennen. Wie fragil unser Alltag aber ist, haben wir in diesem Jahr erfahren, als ein kleines tückisches Virus namens Corona unseren vertrauten Alltag innerhalb kürzester Zeit einfach ausgehebelt hat. Plötzlich war das, was uns vorher wahnsinnig wichtig erschien, überhaupt nicht mehr relevant. Wir mussten uns keine Gedanken mehr über Fehlkäufe, blöde Kollegen, anstrengende Reisen, misslungene Einladungen, schlechte Kosmetikbehandlungen oder die nächste Haarfarbe machen, weil nichts davon mehr eine Rolle spielte. Es ging jetzt um viel größere Dinge, um Gesundheit, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und alles, so wie es war, auszuhalten. Ich glaube, viele von uns haben vieles gelernt. Und ich hoffe, dass wir einiges aus dieser Zeit mitnehmen. Dass wir manches anders beurteilen und einordnen, als wir es sonst gemacht haben. Deshalb lesen Sie diese Kolumnen vielleicht ein bisschen anders. Sie sind vor dieser verrückten Zeit entstanden, manche wären sicherlich auch danach entstanden, manche vielleicht nicht. Es wird irgendwann wieder so sein, dass ich mich über blöde Kollegen innerlich aufrege und sie in einer Kolumne verarbeiten muss. Erst mal jedoch bin ich froh, sie wiederzusehen. Und ich hoffe, dass dieses Gefühl bleibt.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren und gelassenen Blick aufs Leben, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und schon gekommen sind und dass wir das, was wir gelernt haben, noch eine lange Zeit behalten.
Herzlichst, Ihre Dora Heldt
Digitale Eltern
Es gibt so viele lustige Geschichten über Mütter am Smartphone, Väter im Internet und die anstrengende Fehlerbehebung am Telefon. Das kennt fast jeder. Es gibt Mütter, die versehentlich mitten in der Nacht anrufen, obwohl sie doch nur ein lustiges Pinguin-Video schicken wollten, Väter, die der Überzeugung sind, ab sofort Opfer der Geheimdienste zu sein, weil die Meldung, das Virenschutzprogramm müsse aktualisiert werden, für sie nicht akzeptabel ist. Und das Internet sich sowieso gegen sie verschworen hätte. Und man selbst sitzt daneben, atmet achtsam und will nicht schreien. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Die Eltern und die neue Technik. Und eine harte Geduldsprobe.
Aber langsam beschleicht mich ein Verdacht: Das alles könnte eine späte Rache sein. Als Kinder haben wir doch alle nach Mama gebrüllt, egal, ob sie gerade beschäftigt oder im Aufbruch war, nur weil wir zu faul waren, irgendetwas selbst zu suchen. Wir weinten und hatten Wutausbrüche bei den Matheaufgaben, gefolgt von der Frage, ob wir wirklich so doof seien oder nur keine Lust hätten. Und mein Vater hat meinen Fahrradreifen selbst geflickt, weil ich seine Erklärungen einfach nicht begriffen habe. Wir kamen damit durch und deswegen schlägt das Eltern-Imperium jetzt zurück.
Mein letztes Telefonat mit meinem Vater drehte sich um das Einloggen auf einem Tablet, um ein Zeitungsabo benutzen zu können. Das ich ihm geschenkt hatte. »Ich komme nicht rein«, »Doch, du musst in der ersten Zeile gucken, da steht Login«, »Nein, steht da nicht, da ist eine Wurstwerbung«, »Nein, darunter«, »Da steht Berlin, 11 Grad, Regen. Das interessiert mich gar nicht, was soll ich in Berlin«, »Papa, eine Zeile höher«, »Da ist Wurstwerbung«. Das Gespräch dauerte zwanzig Minuten, es endete ergebnislos.
Noch schlimmer war Dorotheas Telefonat mit ihrer Mutter. Die rief nämlich fünf Minuten vor einem sehr wichtigen Termin, von dem sie sogar wusste, bei ihrer Tochter an. Völlig aufgelöst, mit gebrochener Stimme, den Tränen nah. Dorothea verließ sofort mit dem Telefon den Raum, dachte an Todesnachrichten oder Krankheit, brauchte mehrere Minuten, um ihre Mutter zu beruhigen und endlich zu verstehen: »Dorothea, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin völlig verzweifelt … seit einer Stunde leuchtet an meinem Telefon die Taschenlampe und ich kriege sie nicht aus.«
Ich bin mir sicher, sie stellen unsere Geduld auf die Probe, weil wir es mit ihnen auch gemacht haben. Das hätten sie uns sagen sollen. Das so was irgendwann kommt. Dann könnte ich heute Fahrradreifen flicken und Dorothea wäre besser in Mathe gewesen. Aber das ließ sich ja nicht ahnen. Mit Grüßen an alle digitalen Eltern
Ihre Dora Heldt
Früher waren Ferien schöner
Allmählich sind die Ferien vorbei, die meisten meiner Freunde sind wieder zurück, haben ausführliche Reiseberichte abgeliefert und sich mehr oder weniger gut erholt. Eine Sache ist mir in diesem Jahr aufgefallen: Es wurde mehr gemeckert. Über das Wetter (es war zu heiß oder zu nass), über die Staus (wir standen stundenlang auf der Autobahn, lauter Baustellen), über die Unterkünfte (das sah im Netz ganz anders aus, wieso haben die so gute Bewertungen?), über die vollen Toprestaurants am Urlaubsort (das wird überall empfohlen, man kriegt nur nie einen Tisch), fehlendes WLAN, teuren Kaffee oder übervölkerte Badestellen. Und dann kam der Satz: »Also früher waren Ferien schöner.«
Und das halte ich für Unsinn. Ich habe nämlich mal meine alten Alben durchgesehen und mich an die damaligen Sommerferien erinnert. Und jetzt halten Sie sich fest: Es war gar nicht alles schöner.
Es gibt natürlich Fotos mit blauem Himmel und Meer, aber auch welche, auf denen alle in gelben Öljacken und mit unglücklichen Gesichtern im Sturzregen stehen. Wir haben damals auch stundenlang im Auto gesessen, nicht zuletzt, weil die Autos viel langsamer waren und wir Benzin sparen wollten. Es gab während der Reise mehrere schwere Auseinandersetzungen, weil wir uns mindestens einmal verfahren haben und der Beifahrer die Karte nicht lesen konnte, sich aber weigerte, anzuhalten und jemanden zu fragen. Es gab keine Klimaanlage, auf einem Foto hatten wir alle feuchte Handtücher auf dem Kopf, es gab auch keine Raststätten mit schicken Bistros, wir hielten auf Parkplätzen, tranken warme Brause und aßen vor Stunden geschmierte Käsebrötchen. Die Pensions- oder Hotelzimmer kannten wir nur aus dem geschönten Katalog, sie waren in echt immer viel kleiner, wir wussten nicht, ob es überhaupt Toprestaurants in der Nähe gab, und mussten den Tipps der Pensionsbesitzer glauben. Was oft ein Fehler, aber meistens günstig war. Abends lief man durch die Gegend und suchte eine Telefonzelle, um zu Hause anzurufen, tagsüber lag man am See oder am Strand, bekam einen Sonnenbrand, weil Eincremen noch nicht selbstverständlich war, langweilte sich auch mal, schrieb Postkarten, auf denen man ein bisschen log, und überlegte genau, was man fotografieren durfte, damit der 36-Bilder-Film nicht gleich voll war.
Es war anders und es war umständlicher. Aber es war nicht unbedingt schöner. Das glauben wir nur, weil wir das meiste vergessen haben. Die schlimmen Restaurants und die Autokarten zum Beispiel. Und auch, dass wir damals einfach nicht so viel erwartet haben. Wir fanden es super, in die Ferien zu fahren und mal andere Dinge zu sehen und zu machen. Ohne vorher alles gesehen und geplant zu haben. Einfach mal entspannt abwarten, wie es da so wird. Und genau das geht übrigens heute auch noch. Man muss sich nur darauf einlassen. Mit rudimentärer Planung der Herbstferien grüßt
Ihre Dora Heldt
Milchmädchen
Neulich habe ich mal nachgeschlagen, was der Begriff »Milchmädchenrechnung« eigentlich genau bedeutet. Die Definition hat mich richtig erleichtert, trifft es doch ein Problem, mit dem ich mich schon lange herumschlage. Eine Milchmädchenrechnung ist nämlich eine »auf Trugschlüssen oder Illusionen beruhende Rechnung« oder anders gesagt »eine naive Rechnung, die nicht aufgeht«. Dieser Begriff geht auf eine Fabel des französischen Schriftstellers Jean de La Fontaine zurück, »Die Milchfrau und die Milchkanne«, in der sich ein Mädchen auf dem Weg zum Markt vorstellt, was es alles mit dem Erlös der Milch machen wird, wie es erfolgreich und wohlhabend wird, dann aber vorher die Milch verschüttet.
Also eine sehr naive Rechnung, die nicht aufgehen wird. Das habe ich jetzt schwarz auf weiß. Weil mich solche Rechnungen sogar unter Druck setzen. Und ich das jetzt endlich meinem Liebsten erklären kann. Der denkt nämlich kostengünstig. Und kauft mit großer Leidenschaft Tagestickets, liebt Flatrates oder Abos. Wenn wir also irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinwollen, kann ich sicher sein, dass er mir so ein Ticket in die Hand drückt. Es ist vierundzwanzig Stunden gültig, beinhaltet alle Strecken und ich kann den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Das kauft er immer. Gegen meine Überzeugung. Weil wir selten den ganzen Tag durch die Gegend, sondern nur einmal von A nach B und wieder zurück nach A wollen. Was mit Einzelfahrscheinen viel günstiger gewesen wäre. Aber so haben wir ein Tagesticket und ich denke den ganzen Tag, dass ich dringend noch ein bisschen Bahn fahren müsste. Damit das Ticket sich lohnt. Und fühle mich unter Druck gesetzt.
Aus diesem Grund kann ich auch nicht in Restaurants essen, die Sonderpreise oder eine sogenannte Flatrate anbieten. Ich finde, dass sich der Slogan »All you can eat« schon anhört, wie ein Aufruf zu einem Wettkampf. Und in meinem tiefsten Inneren habe ich das Gefühl, da mitmachen zu müssen. Was ich in den seltensten Fällen vertrage. Aber es ist mein Zwang, dass man das Bezahlte auch essen muss. Oder abfahren. Oder aufbrauchen.
Aber jetzt habe ich entschieden, mich nicht mehr auf die Kostenargumentation meines Liebsten einzulassen. Ich will keine »Bezahl zwei, nimm drei« mehr, weil ich das Dritte, egal was es ist, immer übriglasse, ich will nicht mehr drei Cocktails trinken, nur weil gerade Happy Hour ist, und ich kaufe auch keine Familienpackungen mehr, weil ich diese Mengen nie aufbrauche. Punkt. Einzelrechnungen statt Milchmädchenrechnungen und am Ende des Monats sehen wir mal, wer von uns mehr bezahlt hat, weniger Reste und weniger Druck hatte. Da kann er sich warm anziehen, der Liebste, ich wette, der Punkt geht an mich. Mit weniger Druck und mehr Quittungen grüßt
Ihre Dora Heldt
Einfach mal tun
Es gibt einen Satz, den ich schon häufig von Frauen, selten von Männern, nie von Kindern gehört habe. Er lautet: »Ich weiß aber nicht, ob ich das kann.« Meistens kommt er als Antwort auf eine Bitte oder Aufforderung, mit unsicherem Blick, ängstlicher Stimme, einige nagen dabei auch noch nervös an ihrer Unterlippe. Die Reaktion darauf ist meistens: »Okay, dann frage ich jemand anderen. Schon gut.« Und fertig. Man könnte aber auch sagen: »Dann versuch es doch mal«, damit der andere herausfindet, ob er was kann. Und sich endlich mal was traut.
Gestern habe ich einen Straßenmusiker vor dem Bahnhof gesehen. Ich bin sogar stehen geblieben. Nicht weil er so gut war, nein, ganz im Gegenteil. Er spielte Flöte, genauer, er spielte Blockflöte. Wobei man auch nicht spielen sagen kann, es kamen nur fiepende Töne aus diesem Instrument. Es klang, als hätte er es gerade zum ersten Mal in der Hand. Aber dabei wirkte er so engagiert und gut gelaunt, dass die Leute tatsächlich Geld in seinen Becher warfen. Obwohl es sich ganz schlimm anhörte. Ich glaube nicht, dass er sich viele Gedanken darüber gemacht hat, ob er das könne. Er tat es einfach. Genauso wie ein alter Freund von mir, der mich neulich besucht hat. Er sah, dass ein Leuchtmittel in einer Deckenlampe nicht mehr brannte, ließ sich sofort eine Leiter geben, ignorierte meinen Hinweis, dass diese Lampe schwierig sei, und hatte nach zwei Sekunden die Fassung zerstört. Die Schuld gab er der Lampe, normalerweise könne er so was.
Mein zehnjähriger Patensohn kann Fernsehgeräte programmieren, meiner wäre so ähnlich wie der seiner Eltern, das wäre babyleicht. Okay, um das erste Programm zu sehen, muss ich jetzt auf der Fernbedienung die 115 drücken, aber das ist egal, dafür habe ich irgendeinen Kinderkanal ganz vorn. Was mich nur so beeindruckt hat, ist, dass diese drei Männer niemals den Satz »Ich weiß aber nicht, ob ich das kann« auch nur denken würden. Geschweige denn sagen. Sie machen es einfach. Und sehen dann, ob es klappt. Wenn nicht, dann geht die Welt nicht unter. Im schlimmsten Fall muss man hinterher jemanden holen, der es tatsächlich kann. Aber es hätte ja klappen können.
Ich habe mir vorgenommen, den schlimmen Satz aus meinem Sprachgebrauch zu streichen. Stattdessen habe ich mir einen Akkuschrauber von meiner Schwester geliehen, um die Schrauben an meiner Küchentür nachzuziehen. Denn die Tür schließt nicht mehr. Und das Nachziehen der Schrauben soll babyleicht sein. Hat mir neulich ein Nachbar erzählt, der dasselbe Problem hatte. Und er hat es behoben. Dann kann ich es wohl auch. Man muss sich nur trauen. Deshalb wünsche ich jetzt allen viel Erfolg.
Ihre Dora Heldt
Voll verschätzt
Eine der beliebtesten Szenen aus dem Film ›Pretty Woman‹ ist die, in der Julia Roberts in ihrem schlampigen Outfit in eine edle Boutique geht, in der sie von der arroganten Verkäuferin nicht nur schlecht behandelt, sondern gar nicht erst bedient wird. Eine schöne Szene, weil die unfreundliche Verkäuferin im Verlauf des Films natürlich ihre gerechte Strafe bekommt, nämlich dann, als die mittlerweile perfekt gekleidete Julia Roberts mit ihrem Prinzen Richard Gere an den Ort ihrer Schmach zurückkehrt und den entgeisterten Mitarbeiterinnen demonstriert, was ihnen an Umsatz entgangen ist. Und das nur, weil sie sich in ihrer Beurteilung der Kundin so grandios verschätzt haben. Das ist eben Pech. Und es passiert leider immer noch, obwohl ›Pretty Woman‹ schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Weil sich Menschen zu schnell von Äußerlichkeiten ablenken lassen.
Ich habe mir vor vielen Jahren einmal in einem Designerladen eine Lampe angesehen. Das heißt, ich wollte sie mir ansehen, ich wollte sie auch kaufen, ich kannte auch den Preis, aber ich trug an diesem Tag eine alte Jeans, eine zu große Regenjacke und war nicht geschminkt. Als ich die Lampe berührte, schoss eine gut gekleidete Mitarbeiterin auf mich zu und fauchte, ich solle die Lampe nicht anfassen, sie wäre teuer. Ich wusste das, bin aber ohne zu antworten sofort gegangen. Und fühlte mich schlecht. Weil ich keinen Richard Gere an meiner Seite hatte, der noch mal mit mir dort hingegangen wäre. Und weil ich mich nicht gewehrt habe. Wie gesagt, das ist Jahre her. Aber immer noch im Kopf. Den Laden gibt es übrigens nicht mehr, ein kleiner Triumph.