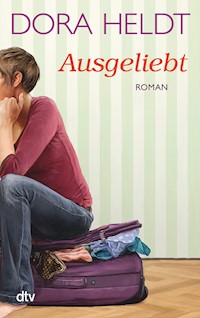9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Haus am See-Reihe
- Sprache: Deutsch
Vergangenheit und Zukunft: Die Frauen-am-See-Erfolgsgeschichte geht weiter Die Fortsetzung des Riesenerfolgs von 'Drei Frauen am See' und 'Drei Frauen, vier Leben' - Der neue SPIEGEL-Bestseller von Dora Heldt - Die Geschichten von Alexandra, Friederike und Jule werden fortgeschrieben Wie geht man damit um, wenn alle Lebensträume zerplatzen? Wie gut kennen wir unsere Eltern? Über ein Projekt im Pflegeheim ihrer Mutter ist Friederike zum ersten Mal gezwungen, sich mit Esthers Leben auseinanderzusetzen. Vieles erscheint in einem anderen Licht ... Alex recherchiert für ein Buchprojekt über die Industriellenfamilie Hohnstein, deren weiße Weste angesichts der Verstrickungen in das Nazi-Regime immer mehr Risse bekommt. Jule, deren Tochter Pia - wie sie selbst einst - ihren Alltag als alleinerziehende Mutter stemmt, muss lernen, dass sie jetzt, mit Mitte Fünfzig, die vielleicht letzte Chance hat, ihr Leben noch einmal zu ändern. Frauenleben: Nur mit der Kraft der Erinnerung kann der Weg in die Zukunft gelingen. Ein lebenssatter, bewegender und Mut machender Roman über den Mut, sich der Vergangenheit zu stellen und sich eine neue Zukunft zu bauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Über ein Projekt im Pflegeheim ihrer Mutter ist Friederike zum ersten Mal gezwungen, sich mit Esthers Leben auseinanderzusetzen. Was sie anfangs mit Widerwillen erfüllt, gibt ihr plötzlich Einblick in eine ganz neue Welt. Auch Alexandra taucht tief in die Vergangenheit ein: Sie recherchiert für ein Buchprojekt über die Industriellenfamilie Hohnstein, deren weiße Weste angesichts der Verstrickungen in das Nazi-Regime immer mehr dunkle Flecken bekommt. Jule, deren Tochter Pia – wie sie selbst vor vielen Jahren – ihren Alltag als alleinerziehende Mutter stemmt, muss lernen, dass sie jetzt, mit Mitte fünfzig, die vielleicht letzte Chance hat, ihr Leben noch einmal zu ändern.
Wie geht man damit um, wenn das eigene Leben plötzlich eine neue Wendung nimmt? Was wissen wir vom Leben unserer Mütter? Und was müssen wir davon verstehen, um zu verzeihen? Diese Fragen müssen sich Friederike, Jule und Alexandra beantworten. Und was sie erfahren, rückt sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in ein ganz anderes Licht …
Dora Heldt
Drei Frauen und ein falsches Leben
Roman
Für Edith, die nur die guten Seiten von Esther hat!
Prolog
5. März 1960
Ein Rosenblatt fiel kreiselnd zu Boden. Esther verfolgte es mit dem Blick, bis es vor ihrer Schuhspitze landete, erst dann lockerte sie den Griff, mit dem sie den Strauß auf ihrem Schoß hielt. Hinter ihr schnäuzte sich Anneliese Brenner lautstark. Esther widerstand der Versuchung, sich umzudrehen, außer der schluchzenden Frau Brenner und der aufgeregten Hilde saß da ohnehin niemand.
Sie hob den Blick und betrachtete den Mann im schwarzen Anzug ihr gegenüber, der mit einer unangenehm monotonen Stimme die ganze Zeit redete. Esther hatte kaum zugehört, es waren nur lauter langweilige Sätze, nichts davon hatte etwas mit ihr zu tun.
Jetzt sah er sie plötzlich direkt an. Er hatte kalte Augen, Fischaugen, dachte Esther und überlegte, ob er auch ein Nazi gewesen war. Aber das wollte doch niemand mehr wissen, die schlechten Zeiten waren ja vorbei. Wobei sie heute vielleicht wieder anfingen.
»Und so frage ich Sie, Fräulein Esther Maria Schulze, wollen Sie den hier anwesenden Dieter Hermann Brenner zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie mit Ja.«
Hermann, dachte Esther. Sie spürte dem Schmerz nach, den dieser Name verursachte, das war auch noch Dieters zweiter Name. So wie Hermann Hohnstein. Sie schloss kurz die Augen und ließ das Gesicht des freundlichen Hermann Hohnstein in ihrem Kopf aufblitzen, der ihr wie ein Vater gewesen, aber dann aus ihrem Leben verschwunden war. So wie alle anderen. Von denen jetzt niemand hier war. Keiner der Hohnsteins war hier. Die Tränen stiegen hoch, sie fühlte sich sehr verlassen.
»Fräulein Schulze?«
Sie öffnete die Augen und sah den Standesbeamten durch einen Tränenschleier stumm an. Er hatte doch keine Ahnung, warum sie jetzt hier saß. Lieben und ehren. Bis dass der Tod sie scheide. Es war verrückt. Total verrückt.
»Soll ich die Frage wiederholen?«
Hinter ihr japste Anneliese plötzlich, Esther drehte sich jetzt doch um. Nicht, dass sie gleich tot vom Stuhl fiel. Sie hatte ja was am Herzen. Aber sie saß aufrecht und starrte Esther mit aufgerissenen Augen an. »Du musst antworten, Kind.«
Esther wandte ihren Blick wieder nach vorn, der Standesbeamte runzelte die Stirn, Hilde stieß sie von hinten an. Vielleicht hielt das Fischauge sie für taub, er wiederholte seine Frage etwas lauter.
»Und so frage ich Sie, Fräulein Esther Maria Schulze, wollen Sie den hier anwesenden Dieter Hermann Brenner zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie mit Ja.«
Plötzlich umschlossen Dieters Finger ihre Hand. Esther betrachtete sie. Seine Hände waren kaum größer als ihre, weiche Hände mit sauberen Nägeln. Alles an Dieter war weich und sauber. Jetzt sah er sie fragend an. Sein rotblondes Haar war wie immer mit Brisk-Pomade straff zurückgekämmt, auf seiner Krawatte war ein winziger Fleck. Kaum sichtbar. Nicht schlimm.
»Esther?« Seine Finger drückten ihre Hand. »Ist alles in Ordnung?«
Nein, dachte sie, nichts ist in Ordnung. Gar nichts. Aber woher sollte er das wissen?
Sie sah Dieter an, er erwiderte besorgt ihren Blick. Esther nickte. »Ja«, ihre Stimme war leise und kratzig, sie musste sich räuspern. »Ja«, wiederholte sie lauter. »Ja, ich will das.«
Sie würde sich nicht unterkriegen lassen, sie nicht, die Hohnsteins würden sich noch wundern. Hilde fing jetzt auch an zu weinen, Dieter Hermann Brenner hielt sanft Esthers Hand. Die Tränen liefen ihr langsam über die Wangen. Aber es war geschafft.
1.
Ihre Mutter hatte einen Sahnefleck am Kinn. Friederike überlegte, ob sie ihr das sagen sollte, ließ es aber, weil ein solcher Hinweis auch schnell einen Wutausbruch zur Folge haben konnte.
»Schmeckt dir die Torte?«
Esther sah hoch und fragte undeutlich, aber freundlich: »Was ist das für ein Obst?«
»Maracuja.«
»Das gab’s früher auch nicht«, Esther kratzte den Rest der Torte vom Teller. »Meine Mutter hat zu besonderen Feiertagen Erdbeertorte gemacht. Oder Nuss. Aber diese Mara…dings, das gab’s noch nicht.«
»Mhm«, Friederike nickte. »Möchtest du noch ein Stück?«
»Nein.« Esther hob den Kopf und sah Friederike unsicher an. »Mehr als eines gibt es nie. Das ist ja viel zu teuer.«
Bevor Friederike etwas sagen konnte, klopfte es an der Tür, die sofort danach geöffnet wurde. »Frau Brenner, es gibt Kaffee«, die blonde Frau mit der Thermoskanne blieb sofort stehen. »Ach, Sie haben Besuch von Ihrer Tochter, guten Tag, ich habe Sie gar nicht kommen sehen.«
»Hallo Schwester Sandra«, Friederike lächelte, blieb aber sitzen. »Ich habe Kaffee mitgebracht. Und zu viel Torte. Möchten Sie auch ein Stück? Maracuja-Sahne.«
»Sie hat immer Erdbeertorte gemacht«, murmelte Esther, »oder Nuss.«
»Nusstorte mag ich auch gern«, Sandra hatte die Stimme gehoben und ihre Hand wie beiläufig auf Esthers Schulter gelegt. »Aber Maracuja-Sahne auch. Haben Sie schon genug Kaffee oder möchten Sie noch eine Tasse?«
Esther schüttelte nur den Kopf, schob den Teller zur Seite und legte ihre Hände in den Schoß. »Ich muss jetzt gleich arbeiten«, sagte sie. »Meine Mittagspause ist fast vorbei. Und Frau von Mandel holt nachher ihr Cape ab.«
»Ja, ich weiß«, antwortete Sandra ernsthaft, bevor sie sich an Friederike wandte und leise sagte: »Können Sie nachher noch mal in mein Büro kommen, bevor Sie fahren? Ich wollte gern noch was mit Ihnen besprechen.«
»Natürlich«, Friederike nickte. »Ich komme gleich.«
»Fein«, Sandra lächelte kurz, dann legte sie die Hand auf den Türgriff. »Und falls wirklich Torte übrig ist, nehme ich sie gern. Die Kollegen freuen sich. Dann gehe ich mal wieder. Ach, Frau Brenner, bevor Sie ins Geschäft gehen, Sie haben ein bisschen Sahne am Kinn.«
Sofort zog Esther ein Taschentuch aus dem Ärmel und rieb sich den Fleck weg. Sie kicherte kopfschüttelnd. »Na, das wäre was gewesen. Danke. Oh Gott, oh Gott.«
Erstaunt hob Friederike die Augenbrauen, Sandra zog die Tür leise hinter sich zu.
»So«, Esther schob das Taschentuch zurück in den Ärmel und stand etwas schwerfällig auf. »Ich müsste mich dann jetzt umziehen. Hilde ist sonst allein.«
»Hilde?«
»Ja«, Esther blickte sie fragend an. »Natürlich. Wollen wir uns ein anderes Mal treffen? Wenn ich mehr Zeit habe? Oder passt es Ihnen nur heute?«
»Esther«, mit einem kleinen Seufzer erhob Friederike sich. »Weißt du nicht, wer ich bin?«
Ihre Mutter starrte sie an. Plötzlich lächelte sie. »Doch, natürlich. Friederike. Aber ich muss jetzt trotzdem los. Frag doch Marie oder Jule, ob sie Zeit für dich haben. Bis später.« Hoheitsvoll nickte sie ihr zu, dann ging sie langsam in ihr Badezimmer und schloss die Tür hinter sich.
Unschlüssig blieb Friederike noch einen Moment stehen. Anscheinend war ihr Besuch jetzt beendet. Sie nahm die Tortenschachtel, die mitgebrachte Thermoskanne und ihre Handtasche, warf einen letzten Blick ins Zimmer ihrer Mutter und machte sich auf den Weg zu Schwester Sandra.
Das Büro lag am Ende des breiten Flurs, in den das Sonnenlicht durch die bodentiefen Fenster schien und die blühenden Zimmerpflanzen zum Leuchten brachte. Irgendjemand hier musste einen grünen Daumen haben. Friederike blieb vor einem der Fenster stehen und sah in den Garten. Es gab schmale Wege, die über das parkähnliche Grundstück führten, kleine Terrassen, auf denen weiße Bänke standen, sie sah Eichhörnchen über den Rasen flitzen und einen Pfleger, der eine alte Dame im Rollstuhl spazieren schob.
Sie gaben sich hier wirklich alle Mühe, trotzdem ließen der Geruch, die Rollatoren in den Gängen und die ganze Atmosphäre keinen Zweifel daran, dass es sich hier um ein Pflegeheim handelte. Natürlich hatte sie Glück gehabt, in dieser Einrichtung einen Platz für Esther bekommen zu haben, sie wurde gut betreut, fühlte sich offenbar wohl und die Pflegekräfte waren nett, aber Friederike war immer heilfroh, wenn sie wieder fahren konnte. Und blieb nie länger, als sie musste.
Sie wandte sich ab und ging langsam den Flur entlang, bis sie vor der Bürotür stand, an die sie kräftig klopfte. Nach einem lauten »Herein« öffnete sie die Tür.
Schwester Sandra sah ihr schon entgegen und lächelte. »Ach, schön, nehmen Sie doch Platz, Frau Brenner. Einen Kaffee muss ich Ihnen wohl nicht mehr anbieten?«
»Nein, danke«, Friederike balancierte die Tortenschachtel immer noch vor sich her. »Kann ich das irgendwo abstellen?«
»Die können Sie mir geben«, Sandra kam mit ausgestreckten Armen auf sie zu. »Ich stelle sie in die Teeküche. Vielen Dank, ist die Torte wieder von Ihrem tollen Konditor im Hotel?«
»Selbstverständlich«, Friederike stellte ihre Tasche ab und ließ sich auf einen Sessel sinken. »Ich habe im Moment so viel zu tun, dass ich sehr froh bin, nur in der Küche anrufen zu müssen, um eine Torte oder irgendwelche anderen Lebensmittel zu organisieren, ich komme kaum noch raus. Augen auf bei der Berufswahl, ich wollte ja unbedingt Hotelchefin werden.«
»Das ist auf Dauer aber auch nicht gesund«, Sandra sah sie an. »Das Leben besteht doch nicht nur aus Arbeit.«
»Es kommen auch wieder andere Zeiten«, Friederike schlug die langen Beine übereinander. »Was wollten Sie mit mir besprechen? Hat meine Mutter Terror gemacht? Mit Gegenständen geworfen? Personal beleidigt? Sagen Sie es ganz unverblümt, solange Sie sie nicht rausschmeißen, kann ich mit allem leben.«
Sandra schüttelte nur leicht den Kopf, während sie sich, einen Kaffeebecher in der Hand, auf den Sessel gegenüber setzte. »Um Himmels willen, nein, es geht um etwas ganz anderes.« Sie trank einen Schluck, dann stellte sie den Becher auf den Tisch und lächelte Friederike beruhigend an. »Ich weiß, dass Ihnen die aggressiven Schübe Ihrer Mutter zu Beginn ihrer Demenz Angst gemacht haben, aber es passiert häufig, dass die Patienten aus Unsicherheit oder Angst Aggressionen entwickeln. Oft verliert es sich wieder. Ihre Mutter fühlt sich bei uns augenscheinlich wohl und sicher, sie reagiert kaum noch aggressiv, im Gegenteil, sie ist fast immer sanft und freundlich.«
»Aha«, Friederike klang nicht überzeugt. »Sanft und freundlich? Das war sie früher selten. Aber gut, vielleicht ist sie auch einfach altersmilde geworden. Neben ihrer Demenz. Entschuldigen Sie, ich will gar nicht zynisch sein, aber meine Mutter war immer schon ein etwas, wie soll ich sagen, spröder Typ. Warum auch immer.« Das Wort böse hätte es besser getroffen, aber Friederike wollte die nette Sandra nicht verschrecken. Die nickte jetzt entschlossen und beugte sich vor. »Ja, und da sind wir beim Thema: Die Uni Lübeck hat uns eine Kooperation vorgeschlagen. Im Rahmen eines Projekts wollen Studierende mittels einer Biografiearbeit mit Dementen untersuchen, ob und wie sich die individuelle Betreuung verbessern lässt. Wir sind sehr stolz, dass unser Haus dafür ausgesucht wurde, und möchten das natürlich sehr unterstützen. Sind Sie einverstanden, dass auch Ihre Mutter einbezogen wird? Und können Sie sich als Angehörige vorstellen, die eine oder andere Frage zum Leben Ihrer Mutter zu beantworten?«
Friederike sah sie gespannt an. »Was sollen das denn für Fragen sein?«
»Es geht dabei um die Biografien unserer Bewohner«, antwortete Sandra geduldig. »Die Studierenden unterhalten sich mit ihnen oder deren Angehörigen und rekonstruieren so die Lebensgeschichten. So ausführlich wie möglich. Also zum Beispiel: Wie war Ihre Mutter früher? Was hatte sie für eine Kindheit? Wie hießen ihre Freundinnen? Wie war ihre Ehe? Welche Erlebnisse haben sie geprägt? Was auch hilfreich wäre, sind neben den Erzählungen auch Fotos, vielleicht Briefe oder Tagebücher. Können Sie uns da etwas zur Verfügung stellen? Oder sich vielleicht selbst mal mit den Studierenden unterhalten?«
Friederike verschränkte die Arme vor der Brust und sah Sandra ratlos an. »Also ganz ehrlich, dabei werde ich keine große Hilfe sein. Meine Mutter hat nie viel über früher geredet, das ist nicht ihre Art gewesen. Ihre alten Fotoalben sind hier, wobei die nicht besonders ergiebig sind, Esther hat anscheinend viel weggeworfen. Ich kann noch mal nachsehen, ob in den Kisten, die bei mir im Keller stehen, noch irgendwas Wichtiges liegt. Ich glaube es aber nicht, ich hatte das ja schon mal flüchtig durchgesehen. Ich weiß also nicht, was ich Ihnen da erzählen könnte. Und was es nützen soll.«
Sandra sah sie nachdenklich an. »Es kann sehr viel nützen. Wenn wir mehr über Ihre Mutter wüssten, könnten wir uns auch eher einen Reim darauf machen, was sie uns erzählt. Nur mal so ein paar Beispiele: War Ihre Mutter auf einer Modeschule? Oder wo hat sie ihre Ausbildung gemacht?«
»Modeschule? Esther?«, Friederike schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, ganz sicher nicht. Sie war früher Verkäuferin in einer Boutique, also vor meiner Geburt. Und später hat sie als Änderungsschneiderin gearbeitet. Bei uns zuhause. Wie kommen Sie auf Modeschule?«
»Weil sie …«, Sandra zog ein Handy aus ihrer Kasacktasche und wischte ein paar Mal über den Bildschirm, bis sie fand, was sie gesucht hatte, und Friederike das Telefon hinhielt. »Weil sie dieses Kleid für unsere Küchenhilfe Jenny auf unserer uralten Maschine genäht hat.«
Friederike nahm das Handy und betrachtete das Foto, auf dem eine junge Frau in einem langen blauen Kleid in die Kamera strahlte. Achselzuckend gab sie Sandra das Telefon zurück. »Esther hat früher viel genäht. Ich musste als Kind ständig selbst gemachte Sachen tragen. Dabei habe ich früher Röcke und Kleider gehasst, irgendwann hatte meine Mutter dann ein Einsehen und ich durfte mir meine Sachen kaufen.«
»Ja, aber«, Sandra warf noch einen abschließenden Blick auf das Foto, bevor sie das Handy wieder einsteckte. »Aber das ist nicht irgendeine Hobbyschneiderei. Jenny war auf eine Hochzeit eingeladen und wusste nicht, was sie anziehen sollte. Und Ihre Mutter hat das mitgekriegt. Und plötzlich stand sie mit einem Zentimetermaß vor Jenny und hat sie ausgemessen. Und selbst einen Schnittbogen gemacht. Nachdem sie uns gesagt hatte, was sie alles dafür braucht. Danach hat sie tagelang an der alten Nähmaschine gesessen, die wir ihr hingestellt haben. Nach einer Woche war dieses Kleid fertig. Und es ist perfekt gearbeitet, ich habe es einer Freundin gezeigt, die sich auskennt, die war ganz begeistert. Und sagte mir, dass das eine Profiarbeit sei.«
Friederikes Begeisterung hielt sich in Grenzen. »Soviel ich weiß, hat meine Mutter nie eine Modeschule besucht«, sagte sie ruhig. »Zumindest habe ich davon noch nie etwas gehört. Aber das muss ja nichts heißen.«
»Es gibt auch noch andere Dinge, mit denen Ihre Mutter sich beschäftigt und die wir nicht nachvollziehen können. Wir wissen dann nicht, in welcher Zeit ihres Lebens sie sich im Kopf gerade befindet«, erklärte Sandra langsam. »Sie hat beispielsweise neulich lange über eine Laura geredet, so als wäre sie gerade da gewesen.«
»Laura van Barig war die älteste Freundin meiner Mutter. Und meine Patentante. Sie ist aber schon seit Jahren tot.«
»Sie waren immer zusammen auf Sylt, hat Ihre Mutter erzählt. Und dass die Hohnsteins böse seien.«
Jetzt hob Friederike die Augenbrauen. »Laura war eine geborene Hohnstein. Aber sie war nie böse. Und auf Sylt? Keine Ahnung, ob sie da mal zusammen waren. Das habe ich auch noch nie gehört.«
Sandra nickte bestätigend. »Und genau dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Informationen. Damit wir darauf eingehen können. Vorhin zum Beispiel, als Ihre Mutter sagte, dass sie jetzt ins Geschäft muss, da habe ich ihr zugestimmt. Damit sie nicht unsicher oder wütend wird. Sie denkt, dass sie ins Geschäft muss, und ich lasse sie in dem Glauben. Und schon ist alles friedlich. Wissen Sie, welches Geschäft sie meint?«
»Die Änderungsschneiderei?« Friederike zuckte die Achseln. »Aber sie hat noch gesagt, dass Hilde sonst allein ist. Sie hatte aber nie Angestellte. Vielleicht doch die Boutique? Ich weiß es wirklich nicht.«
»Sie haben mit Ihrer Mutter wirklich nie viel über früher gesprochen, oder?« Sandra neigte den Kopf und musterte sie. »Das ist schade, es macht für uns vieles leichter, wenn man auf diese Erinnerungen eingehen kann. Wissen Sie, manchmal fallen Namen, die wir natürlich gar nicht einordnen können«, sie beugte sich vor und griff nach einem kleinen Notizbuch, das auf dem Tisch lag. »Zum Beispiel«, sie blätterte ein paar Seiten um. »Da muss es einen Willi gegeben haben, der für sie wichtig war. Und einen Herrn Lemke. Oder eine Martha.« Sie hob den Blick und sah Friederike fragend an. »Sagt Ihnen das was?«
»Nein«, Friederike überlegte kurz, dann schüttelte sie den Kopf. »Keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Nachbarn von ihr? Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter jemals einen Freundeskreis oder Bekannte hatte. Laura und Carl van Barig waren die Einzigen, die es mit ihr ausgehalten haben, und das habe ich schon nicht verstanden. Meine Mutter war immer schon eine sehr schwierige Person.« Sie schluckte weitere Erklärungen hinunter. Das Gespräch wurde langsam unbehaglich. Was nicht an der engagierten Sandra lag, es wurde ihr jetzt nur alles viel zu privat. Und zu viel. Sie beugte sich hinunter und hob ihre Handtasche auf den Schoß. »Wir hatten nie ein gutes Verhältnis«, sagte sie knapp. »Sie war nicht der mütterliche Typ, ich nenne sie auch Esther und nicht Mama oder Mutti. Und sie wollte nie über ihre Vergangenheit reden. Und das wenige, was sie mir erzählt hat, entsprach leider auch nicht immer der Wahrheit. Deshalb kann ich nicht sehr viel dazu beitragen. Es tut mir leid.«
Nach einem Blick auf die Uhr stand sie abrupt auf. »Ich muss leider los«, sie versuchte, einen leichten Ton anzuschlagen. »Ich habe noch einen Termin. Aber ich finde Ihr Bemühen toll. Und wenn ich noch irgendwelche Fotos oder andere Zeugnisse aus der Vergangenheit finde, bringe ich sie mit.«
»Das wäre schön«, Sandra nickte. »Und es ist für Sie auch in Ordnung, dass die jungen Leute mit Ihrer Mutter sprechen?«
»Natürlich«, Friederike schob sich den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter und knöpfte ihre Jacke zu. »Vielleicht finden sie sogar noch etwas Interessantes raus. Ich bin gespannt. Wobei ich glaube, dass meine Mutter ein ziemlich langweiliges Leben hatte. Aber das werden Sie ja sehen.«
Sandra begleitete sie langsam zur Tür und gab ihr die Hand. »Trotzdem danke, Frau Brenner. Dann bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch.«
»Den wünsche ich Ihnen auch«, Friederike lächelte etwas angestrengt. »Bis bald.«
Während sie auf ihr Auto zulief, suchte sie mit einer Hand in der großen Tasche nach ihrem Telefon. Als sie es ertastet und herausgezogen hatte, blieb sie kurz stehen und tippte eine Nummer ein. Beim Weitergehen zählte sie die Freizeichen, nach dem dritten wurde abgenommen.
»Hallo Fiedi.«
»Hey, Jule, ich befürchte, dass ich mich etwas verspäte, ist das ein Problem?«
»Nein, nach dir habe ich keine anderen Patienten, alles gut. Bis gleich.«
Friederike schob das Handy zurück in die Tasche und schloss ihr Auto auf. Ihr Nacken brannte, sie hatte wieder mal verkrampft gesessen und war deshalb heilfroh, gleich auf Jules Massagebank liegen zu können. Jule würde das Brennen der Muskeln und die Unruhe im Kopf hoffentlich vertreiben. Dafür waren Freundinnen schließlich da.
2.
»Meine Güte, was bist du verspannt«, konzentriert massierte Jule Friederikes Schulter, bis sie stöhnte. »Das muss wehtun, ich komme da kaum durch. Was ist los? Hast du gerade so viel Stress?«
»Geht so«, war die gepresste Antwort. Bäuchlings durch die Öffnung in der Kopfstütze zu sprechen, machte eine Unterhaltung schwierig. Das schien Jule egal zu sein.
»Du solltest regelmäßig Yoga oder Pilates machen. Das hilft gegen diese Verspannungen. Du hast doch bestimmt auch öfter Kopfschmerzen, oder nicht?«
»Ich hasse Yoga und Pilates«, murmelte Friederike. »Und Kopfschmerzen bekomme ich nur nach zu viel Rotwein.«
Es knackte im Schultergelenk, als Jule den Druck ihrer Finger erhöhte. »Pia hat mir erzählt, du würdest gerade dermaßen viel arbeiten, dass die Kollegen sich schon fragen, ob du auch im Hotel wohnst. Du hast Stress.«
»Ich werde nie wieder die Tochter einer Freundin einstellen«, Friederike hob den Kopf, um besser sprechen zu können. »Und dann noch eine, die rumquatscht.«
Sanft drückte Jule ihren Kopf wieder runter. »Meine Tochter quatscht nicht rum, sie macht sich Sorgen um dich. Sie meint es gut. Außerdem bist du die Patentante ihrer Tochter, es wäre schade, wenn die kleine Marie nichts von dir hat, weil du tot umkippst, bevor sie eingeschult wird.«
Friederike stöhnte leise und hob wieder den Kopf: »Die kleine Marie ist gerade mal eineinhalb Jahre alt und wackelt noch mit Windelpo durch die Gegend. Ich habe also noch jede Menge Zeit, dem Umkippen vorzubeugen. Wenn du allerdings weiterhin so brutal massierst, bin ich da eher skeptisch, ob ich das schaffe.«
Leise lachend ließ Jule ihre Hände abschließend sanft über Friederikes Rücken wandern. »Du bist erlöst, Fiedi. Bleib noch einen Moment liegen, ich mache uns einen Tee. Oder musst du gleich los?«
»Nein, Tee ist gut«, sie sprach in das Loch unter ihrem Gesicht und bewegte sich vorsichtig hin und her. »Bis gleich.«
Jule ging hinaus, die Tür klappte hinter ihr leise zu. Friederike atmete tief durch und schloss die Augen. Es war schon praktisch, in ihrem Alter eine langjährige Freundin zu haben, die eine eigene Physiotherapiepraxis hatte und eine Massagegöttin war. Stress ging Friederike immer auf den Rücken und im Moment nahm der ihr vieles übel. Wobei es nicht nur die Arbeit als Hotelchefin war.
Langsam drehte Friederike sich auf die Seite und betrachtete die Bilder an der Wand des Behandlungsraums. In der Mitte hing eine große Schwarz-Weiß-Fotografie, die drei junge Frauen von hinten auf einem Bootssteg sitzend zeigte. Sie hatten ihre Füße ins Wasser getaucht, zwei lachten mit zurückgeworfenen Köpfen, eine sah über ihre Schulter zu einer vierten Frau, einer schmalen Blonden, die gerade durch eine Kamera schaute.
Friederike stützte ihren Kopf auf den Arm und lächelte melancholisch. Ein Sommer im Haus am See. Es war so lange her, dass Jule und Alexandra so gelacht und sie selbst Marie so angesehen hatte. Sie waren noch so jung gewesen, jetzt waren Jahrzehnte vergangen, sie waren nicht mehr jung und Marie war schon seit zwei Jahren tot. Das Haus am See gab es immer noch, nur gehörte es jetzt Jule, Alexandra und ihr. Friederike hätte viel dafür gegeben, dass Marie noch die Eigentümerin wäre. Und lebendig.
Die beginnende Melancholie abwehrend, schwang sie ihre Beine von der Liege und tappte barfuß zu ihren Sachen. Während sie sich anzog, schüttelte sie den Kopf. Wenn man zu oft an die Vergangenheit denkt, ist man alt, hatte mal jemand gesagt. Dazu hatte Friederike überhaupt keine Lust. Jetzt noch nicht.
Sie machte die letzten Knöpfe der Bluse zu, musterte sich abschließend im Spiegel und verließ den Behandlungsraum. Der Empfangstresen lag schon im Dunkeln, die Türen der anderen Zimmer standen offen, nur im Aufenthaltsraum hörte Friederike das Klappern von Geschirr.
Als sie hereinkam, stellte Jule gerade Tassen auf den Tisch und sah hoch, als sie das Knarren der Tür hörte. »Und? Wie fühlt sich dein alter Rücken an?«
»Wie neu«, antwortete Friederike und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Ich glaube, ich mache nächste Woche noch mal einen Termin. Hast du noch Lücken im Plan?«
»Keine einzige«, Jule schenkte Tee ein und setzte sich. »Du kannst höchstens am Wochenende kommen. Das Wetter soll schön werden, dann könnten wir anschließend zum See fahren und in die Sauna gehen. Und Alex würde Besuch guttun, seit Hanna ihre Familie in Dänemark besucht, hängt sie ganz allein im großen Haus herum und arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch spricht.«
»Sie spricht noch«, Friederike rührte Zucker in den Tee. »Ich habe gestern mit ihr telefoniert, da konnte sie es noch. Sogar ganze Sätze.« Sie hob den Blick. »Ihr Buch erscheint ja demnächst, ich bin echt gespannt.«
Jule nickte. »Der besondere Blick – Die Fotografin Marie van Barig, eine Künstlerbiografievon Alexandra Weise. Du kannst sagen, was du willst, ich finde den Titel wahnsinnig dröge.«
»Sie hat ja keinen Krimi geschrieben«, entgegnete Friederike. »Es geht um Maries berufliches Leben und ihre Fotokunst, nicht um irgendwelche Liebes- und Familiengeschichten. Das ist schon gut so. Und sehr seriös. Es steht drauf, was drin ist. So soll es sein. Ich freue mich auf die Premiere. Wie viele Leute kommen da eigentlich?«
»Über hundert«, Jule schenkte sich Tee nach. »Micha Beermann ist schon wieder aufgeregt. Sein Anzug passt nicht mehr, er macht jetzt eine Diät.«
Friederike lächelte. Ihr alter Freund Micha hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass in einem Teil seines Ausflugslokals am See nun eine Galerie war. Seit Maries Tod wurden ihre Fotos noch höher gehandelt, der Erfolg der Galerie, die Michas Tochter Anne mithilfe von Maries Erbin und Lebensgefährtin Hanna führte, hatte das in die Jahre gekommene Café Beermann gerettet. Jetzt fanden hier auch ab und zu kulturelle Veranstaltungen statt. Vor jeder einzelnen verlor Micha die Nerven, das kulturbeflissene Volk schüchterte ihn ein.
»So ist er eben«, stellte Friederike fest. »Aber vielleicht hilft es, dass es dieses Mal nur Alex ist, die ihr Buch über Marie vorstellt und nicht irgendein berühmter Künstler oder eine berühmte Künstlerin, die kapriziös und schwierig ist.«
»Apropos kapriziös und schwierig«, Jule stützte ihr Kinn auf die Hand und sah sie an. »Du hast noch gar nicht erzählt, wie es deiner Mutter geht. Oder willst du nicht darüber reden?«
Friederike lehnte sich mit der Tasse in beiden Händen zurück. »Schwester Sandra hat sie gerade als sanft und freundlich beschrieben. ›Fast immer sanft und freundlich‹, um genau zu sein.«
»Esther?« Jule hob erstaunt die Augenbrauen. »Deine Mutter Esther?«
»Ja«, Friederike nickte. »Und ohne Medikamente. Ich war auch überrascht. Aber anscheinend fühlt sie sich dort sicher und ist wie verwandelt.« Sie machte eine nachdenkliche Pause, die Teetasse schwenkend, den Blick auf die schwappende helle Flüssigkeit gerichtet. »Sag mal«, begann sie zögernd, bevor sie sich nach vorn beugte und die Tasse auf den Tisch stellte, »könntest du die Geschichte deiner Mutter erzählen? Wie ihre Kindheit war, wie ihre Freundinnen hießen, wie ihre Ehe war, was die besonderen Ereignisse ihres Lebens gewesen sind? Weißt du das alles?«
»Ach Gott«, Jule stöhnte leise. »Warte mal, also ihre Kindheit war natürlich schwierig, so nach dem Krieg, da haben mein Bruder und ich es immer besser gehabt, wir sollten dankbar sein, meine Mutter und ihre Schwestern hatten ja nichts und wir alles. Und ihre Freundinnen hießen oder heißen immer noch Gisela und Rosi, die hatte sie damals schon und sie ist ja nie aus ihrem Dorf rausgekommen. Die beiden anderen auch nicht. Ihre Ehe, na ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass mein Vater vor Jahrzehnten mal eine Affäre hatte, danach hat meine Mutter ihm ein paar Jahre lang die Hölle heißgemacht, inzwischen ist das aber augenscheinlich vergessen. Und die Ereignisse ihres Lebens sind vermutlich die Enkelkinder und ihre Kreuzfahrten. Warum willst du das wissen?«
Friederike sah sie lange an. »Das Heim macht gerade ein Projekt. Studenten schreiben die Biografien der Bewohner auf, damit die Betreuer wissen, in welcher Zeit sich die Dementen gerade gedanklich befinden. Und Schwester Sandra wollte in diesem Zusammenhang unter anderem wissen, ob Esther mal auf einer Modeschule war. Oder mit den Hohnsteins auf Sylt. Mit den bösen Hohnsteins übrigens. Davon hat Esther nämlich gesprochen. Und über einen Willi und eine Hilde.«
»Und?« Neugierig neigte Jule den Kopf. »Wieso die bösen Hohnsteins? Was hast du geantwortet?«
»Maries Mutter Laura war doch eine geborene Hohnstein, aber nie böse. Das war die einzige Antwort, die ich geben konnte. Alles andere habe ich noch nie gehört. Ich weiß eigentlich so gut wie nichts über das Leben meiner Mutter. Nur dass ihre Eltern tödlich verunglückt sind, als sie siebzehn war, dass sie danach ein paar Jahre bei Lauras Familie gelebt und dann Dieter Brenner geheiratet hat.«
Jule sah sie an und legte ihre Hand auf Friederikes. »Vielleicht kommt ja durch dieses Projekt einiges raus. Es gibt doch eine ganze Menge Dinge, die du immer wissen wolltest und über die sie nie geredet hat. Oder sie erzählt es dir durch dieses Projekt noch selbst. Du hast doch gesagt, sie habe ab und zu noch klare Momente und könne sich plötzlich erinnern.«
»Da bin ich aber nicht immer dabei«, langsam zog Friederike ihre Hand zurück und hob die Schultern. »Ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles so genau wissen will. Nach all den Jahren. Sie war mir gegenüber immer ablehnend, ungeduldig und desinteressiert. Also, warum sollte ich mich jetzt für sie interessieren?«
»Weil du wissen willst, warum sie immer so war. Kein Mensch ist von Natur aus böse und unglücklich«, wandte Jule vorsichtig ein. »Vielleicht wäre es doch ganz spannend rauszukriegen, was deine Mutter in ihrem Leben alles gemacht hat. Warum sie so geworden ist.«
»Toller Vorschlag«, Friederike schüttelte den Kopf. »Jetzt, wo sie dement ist. Glaubst du, wir fallen uns noch versöhnt in die Arme?«
»Sei doch nicht gleich so sarkastisch«, entgegnete Jule. »Wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber du könntest doch mal mit Alex sprechen.«
»Wieso mit Alex?«
Jule richtete ihren Blick gespielt verzweifelt an die Decke und antwortete langsam, als wäre Friederike begriffsstutzig: »Alex, eigentlich Alexandra, unsere langjährige Freundin, die im Haus am See lebt und ein Buch über unsere gemeinsame Freundin Marie geschrieben hat. Und die von Hanna, Maries Lebensgefährtin und Erbin, kistenweise Unterlagen von Marie und deren Eltern für die Recherche zur Verfügung gestellt bekommen hat. Vielleicht sind da ja private Briefe dabei. Laura hat auch Tagebuch geschrieben, daran kann ich mich noch erinnern. Frag doch Alex, ob du die Sachen mal durchsehen kannst. Vielleicht findest du da was über deine Mutter, sie war immerhin Lauras beste Freundin. Und es könnte bei diesem Projekt helfen.« Sie trank einen Schluck Tee und sah Friederike wieder an, bevor sie mit normaler Stimme weitersprach. »Oder dir.«
»Ach, ich weiß nicht«, Friederike schob ihren Stuhl abrupt zurück und stand auf. »Ich hätte ein komisches Gefühl, mich durch das Leben von Maries Familie zu wühlen. Die sind alle tot. Das ist wie Leichenfledderei. Aber danke trotzdem für den Tipp. Ich denke darüber nach. Entschuldige, aber ich muss jetzt los, ich bin noch mit Tom zum Essen verabredet.«
»Oh«, Jule nickte. »Tom. Über den müssen wir auch noch mal sprechen. Ich bin da gar nicht auf dem Laufenden. Ist das immer noch eine aufgewärmte Bettgeschichte oder wird dieses Mal was Richtiges daraus?«
Mit den Händen an der Stuhllehne sah Friederike kopfschüttelnd auf Jule herab. »Aufgewärmte Bettgeschichte? Jule Petersen, du bist so spießig. Was Richtiges? Echt jetzt? Was soll das sein? Eine Verlobung im Frühling?«
Auch Jule hatte sich langsam erhoben. »Du hast ihn uns noch nicht mal offiziell vorgestellt«, sagte sie vorwurfsvoll. »Wenn du nicht in einer schwachen Stunde am See die Geschichte erzählt hättest, wüsste ich gar nicht, dass es ihn gibt. Und wenn ich nicht mit Pia in deiner Hotelbar gewesen wäre, hätte ich ihn überhaupt noch nie gesehen. So hat er uns wenigstens mal einen Drink gemixt. Und Pia hat ihn mir vorgestellt. Ich weiß gar nicht, warum du ihn vor uns versteckst. Nur weil er zehn Jahre jünger ist?«
»Acht«, korrigierte Friederike, »es sind nur acht Jahre. Und vielleicht bringe ich ihn mit zur Buchpremiere. Dann lernt er mit einem Schlag gleich alle kennen. Damit du zufrieden bist. Und vergiss die Geschichte mit der schwachen Stunde. Sonst erzähle ich nie wieder was.«
»Machst du doch sowieso nie«, Jule folgte ihr langsam durch die dunkle Praxis bis zur Tür. »Aber das ist okay so.«
»Genau«, Friederike beugte sich herunter, um Jule auf die Wange zu küssen. »Danke für die Massage und den Tee. Wir telefonieren.«
»Ja.«
Jule hielt die Tür auf und ließ Friederike vorbeigehen. Sie wartete einen Moment, dann rief sie ihr nach: »Sprich mit Alex. Sie ist gerade so gut drin im Recherchieren.«
Friederike hob nur stumm die Hand und stieg ein. Erst als die Rücklichter aus Jules Sichtfeld verschwanden, ging sie wieder rein und schloss die Tür.
April 1955
»Junges Fräulein!«
Ertappt fuhr Esther herum und stieß mit der Hüfte gegen das gerade abgestellte Fahrrad, das scheppernd auf den Kiesweg fiel.
»Oh, einen schönen guten Tag, Frau Hohnstein. Ich wollte nur schnell …«
»Was soll das Fahrrad da? Das gehört da nicht hin.«
Karla Hohnstein stand plötzlich oben auf der Treppe, die zur Haustür führte. »Das habe ich dir schon tausend Mal gesagt. Was verstehst du daran nicht? Herrgott.«
Mit einer Hand auf der Steinbalustrade kam sie, den Blick unverwandt auf Esther gerichtet, die Treppe hinunter. Ihr schwarzer Mantel hatte einen Pelzkragen, der Hut saß etwas schräg auf dem strengen grauen Dutt, der Blick war eisig. Sie blieb vor Esther stehen und hob das Kinn. »Du bringst es auf der Stelle weg.«
Sie hatte unzählige Falten um Mund und Augen, das Gesicht war schmal, ihre Nase lang und spitz. In einem der Romanhefte, die Esther sich ab und zu aus dem Nachtschrank ihrer Mutter lieh, hatte die böse Gräfin eine aristokratische Nase. Genau so eine.
»Natürlich, Frau Hohnstein.« Esther deutete einen Knicks an. »Entschuldigen Sie.«
Sie bekam keine Antwort, Karla Hohnstein wandte sich ab und sah ungeduldig zur Haustür, die immer noch offen stand und in der jetzt ihr Sohn auftauchte. Hermann Hohnstein blieb einen Moment stehen und knöpfte sich den Mantel zu. Er war groß und breitschultrig, mit dunklen Haaren, die langsam grau wurden, und einem immer noch jugendlich wirkenden Lächeln. Er warf einen flüchtigen Blick auf Esther und nickte ihr zu, bevor er seine Mutter wieder ansah und die Treppe hinunterstieg. »Entschuldige, Mutter, ich musste noch etwas klären.«
Karla Hohnstein sah sich um. »Wo ist Herr Lemke?«
»Ich fahre den Wagen selbst.« Er bot ihr den Arm, sie hakte sich bei ihm ein. »Wollen wir?«
»Gute Fahrt, Herr Hohnstein«, Esther stand immer noch auf der Stelle und knickste wieder. »Fahren Sie jetzt zum Bahnhof?«
»Ja, Esther«, er lächelte sie freundlich an. »Die Kinder kommen mit dem Zug um 17:35 Uhr an.«
»Ich …«
»Wir sind spät, Hermann«, unterbrach ihn Karla Hohnstein und presste missbilligend die Lippen zusammen. »Kommst du bitte?«
Esther sah ihnen nach, bis Hermann seiner Mutter in den Wagen geholfen und selbst eingestiegen war. Sie wartete, bis die Hohnsteins langsam den Kiesweg zur Ausfahrt hinunterrollten, erst dann ging sie zu ihrem umgestürzten Fahrrad und hob es mühsam hoch. Zwischen den Speichen hatten sich ein paar Tulpenblätter verfangen, das Rad war mitten ins Beet gekippt. Esther stellte es auf den Ständer und bückte sich, um die platten Tulpen und Narzissen aufzurichten – es brachte nicht viel, nur ihre Finger wurden schmutzig. Sie wischte die Erde ab, dann stieg sie auf ihr Fahrrad und fuhr holpernd über das alte Kopfsteinpflaster zum Hintereingang.
Sie musste einmal um die Villa herumfahren, bis sie schwungvoll in den Hinterhof bog und sofort in die Bremse treten musste, weil plötzlich der alte Gärtner aus der Schuppentür kam.
»Hoppla, willst du mich umbringen?« Seine Stimme war unwirsch, seine Augen freundlich. Er sah sie kopfschüttelnd an. »Du kannst doch nicht so einfach hier auf den Hof jagen. Pass ein bisschen auf.«
»Hallo, Willi«, Esther lächelte ihn an. Er hatte eine Schwäche für sie, er tat immer nur so streng.
»Ist doch nichts passiert, ich habe doch gebremst.«
Willi humpelte auf sie zu und legte die Hand auf den Lenker. Die Franzosen hatten ihm im ersten Krieg ein Bein weggeschossen. Deshalb hatte er nicht in den zweiten gemusst, sondern war bei den Hohnsteins geblieben und hatte hier weiter als Gärtner gearbeitet. Anfangs hatte Esther sein Holzbein gruselig gefunden, mittlerweile war sie daran gewöhnt. Er war nicht der Einzige im Dorf, dem ein Körperteil fehlte, aber Willi kam damit am besten zurecht. Vieles machte er noch selbst, für anderes hatte er mittlerweile Helfer. Viele von den Flüchtlingen arbeiteten jetzt auch bei den Hohnsteins, Willi musste nur noch Anweisungen geben.
»Deine Bremse muss mal geölt werden«, sagte er jetzt und legte auch die andere Hand aufs Fahrrad. »Das ist ja ein schlimmes Geräusch. Lass mir das Rad mal hier, ich mach dir das.«
»Willi, du bist der Beste«, Esther stellte es auf den Ständer und lächelte ihn an. »Danke. Und, da wäre noch was. Ich habe das Beet neben der Eingangstreppe ein bisschen platt gemacht. Das Fahrrad ist auf die Tulpen gefallen. Tut mir leid.«
»Was machte dein Rad denn da?«
»Ich habe es da abgestellt und wollte schnell vorn rein, weil ich dachte, Laura und Lorenz sind schon da«, unbekümmert hob Esther die Schultern. »Ich konnte ja nicht wissen, dass die so spät kommen. Und die alte Frau Hohnstein hat es übrigens gesehen.«
»Es heißt: die gnädige Frau«, korrigierte Willi sofort. »Das andere habe ich nicht gehört. Und das Fahrrad hat nicht vorn zu stehen. Das weißt du doch.« Er sah sie tadelnd an, bevor er einen Schritt zurückging und sie kopfschüttelnd musterte. »Deern, Deern. Ich sehe mir das Beet gleich mal an, das du verwüstet hast.«
»Mein Fahrrad hat’s verwüstet«, stellte Esther fest. »Ich bin ja nicht selbst auf die Tulpen gefallen.«
Sie warf ihm eine Kusshand zu und beeilte sich, durch die Hintertür ins Haus zu kommen. In dem schmalen Gang, der zur Küche führte, standen Holzkisten mit Kartoffeln, Zwiebeln und gelben Rüben, auf den Regalen darüber Gläser mit eingemachtem Obst und Gemüse. Der erdige Geruch, der von den Kisten ausging, verlor sich durch den Duft frischgebrühten Kaffees, der stärker wurde, je näher Esther der Küche kam. Die Tür stand weit offen und gab den Blick auf die kräftige Gestalt von Esthers Mutter frei, die mit beiden Händen einen Teig knetete und den Kopf hob, als sie jemanden eintreten hörte.
»Was machst du denn schon hier?« Rosemarie hielt sofort inne und sah ihre Tochter erschrocken an. »Ist was passiert?«
»Nein, Mutti«, Esther ließ ihre Tasche auf einen Stuhl fallen und schüttelte den Kopf. »Frau Bellmann hat die Schneiderei heute früher geschlossen. Ihre Schwester kommt über Ostern zu Besuch, sie musste noch was vorbereiten. Dafür soll ich Sonnabend früher anfangen.« Mit einer schnellen Bewegung wischte sie ein paar Teigkrümel von der Tischplatte und schwang sich darauf. »Hier riecht es aber gut. Ich habe mich so beeilt, ich dachte, Laura und Lorenz wären schon hier.«
Rosemarie ließ ihre Hände wieder in den Teig sinken und knetete weiter. »Herr Hohnstein und seine Mutter holen sie gerade vom Bahnhof ab.«
»Ich weiß«, Esther beugte sich nach vorn und griff einen Apfel aus einem Korb, den sie an ihrem Ärmel abwischte. »Ich habe sie abfahren sehen. Herr Hohnstein ist selbst gefahren. Was ist denn schon wieder mit Lemke?«
»Herr Lemke«, Rosemarie sah kurz hoch. »Er ist …ein bisschen unpässlich. Aber sei still, er ist nur kurz rausgegangen und kommt gleich zurück. Ich habe ihm gerade einen Kaffee gekocht.«
Esther grinste und biss in den Apfel. Herr Lemke war der Chauffeur der Hohnsteins. Schon immer, sogar in den vergangenen schlechten Jahren. Nur in der letzten Zeit war er ab und zu etwas, wie hier alle sagten, »unpässlich«. Sie war nicht so dumm, es nicht zu verstehen. Vor ein paar Wochen hatte er ihr einen Flachmann hingehalten, weil sie in ihrer dünnen Jacke im plötzlich einsetzenden Schneeregen so gefroren hatte. »Estherkind«, hatte er sehr launig gesagt, »das wärmste Jäckchen ist immer noch ein Konjäckchen.« Er hatte einen großen Schluck genommen und danach einen sehr langen Witz erzählt.
»Oh, hoher Besuch«, die tiefe Stimme war etwas verwaschen, das Gesicht rot. »Welch Glanz in unserer armseligen Hütte.«
»Guten Tag, Herr Lemke«, sagte Esther sofort und glitt vom Tisch, um sich neben ihre Mutter zu stellen. »Geht es Ihnen gut?«
»Bestens«, war die prompte Antwort. »Was denn sonst?«
»Esther, nimm mal eine Tasse raus und schenk dem Herrn Lemke Kaffee ein«, Rosemarie deutete mit dem Kopf auf den Geschirrschrank. »Mit zwei Löffeln Zucker.«
Sofort schoss Esther zum Schrank und befolgte den Befehl. Sie wartete, bis er sich gesetzt hatte, bevor sie die Tasse vor ihm abstellte. »Bitte schön.«
Er nickte, dann begann er, geistesabwesend in der Tasse zu rühren. Mit jeder Runde wurde seine Miene trübsinniger. Esther sah zu ihrer Mutter, deren Blick mitleidig auf dem alten Herrn Lemke lag. »Nun trinken Sie mal schön aus und danach legen Sie sich einen Moment aufs Ohr. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
»Ich habe mir ja den Magen verdorben«, sagte er plötzlich. »Gestern Abend im Grünen Jäger. Da gab es Sauerfleisch. Das war nicht gut.«
»Ja, das kann passieren«, Rosemarie knetete wie zur Bekräftigung den Teig und nickte ernsthaft. »Das kann ganz schnell gehen.«
»Ja«, er nickte, legte plötzlich den Löffel zur Seite und trank den kochend heißen Kaffee ohne abzusetzen. Esthers Hals brannte schon vom Zuschauen. »Danke für den Kaffee, Frau Schulze. Ich gehe dann mal.« Umständlich zog er sich am Tisch hoch, setzte seine Mütze auf und schlurfte langsam aus der Küche. »Wiedersehen.«
»Bis später, Herr Lemke.«
Mutter und Tochter warteten, bis er außer Hörweite war, dann sagte Rosemarie mitfühlend: »Der arme Kerl. Seit seine Frau an der Grippe gestorben ist, ist er aus dem Tritt gekommen. Das ist nicht gut.«
»Deswegen muss er ja nicht so viel Schnaps trinken.«
»Das geht uns nichts an.« Rosemarie presste die Lippen zusammen. »Er hat Kummer und jeder hat Schwächen.«
»Lorenz hat übrigens Weihnachten gesagt, dass Herr Lemke betrunken immer noch besser Auto fährt als Herr Hohnstein nüchtern.«
»Esther«, energisch schob Rosemarie den Teig von den Händen und die Schüssel ein Stück zur Seite. »Rede nicht so dummes Zeug. Und wenn du hier schon rumstehst, kannst du auch helfen. Das Gemüse da muss noch geputzt werden.« Sie wischte ihre teigigen Finger an einem feuchten Lappen ab und legte ein sauberes Tuch über die Schüssel. »So, der Teig muss jetzt gehen. Und du nimmst dir das Gemüsemesser.«
»Aber Mutti, ich habe das gute Kleid an. Kann das nicht Martha machen? Oder Elisabeth? Ich kann doch …«
Statt zu antworten, griff ihre Mutter nach einer Schürze, die an einem Haken an der Tür hing und warf sie ihr zu. »Das war kein Vorschlag. Das Messer ist in der obersten Schublade. Martha und Elisabeth haben noch im Haus zu tun.« Ihr Gesichtsausdruck ließ keine Widerworte zu. Seufzend schlang Esther die Bänder um die Taille. Wenn sie ohnehin auf die Ankunft von Laura und Lorenz warten musste, konnte sie sich auch nützlich machen.
Seit acht Jahren arbeitete Rosemarie Schulze nun schon in der Villa als Haushälterin. Sie kochte, kümmerte sich um den Haushalt und sorgte dafür, dass hier alles reibungslos lief. Beim Putzen gingen ihr zwei junge Frauen zur Hand, Martha und Elisabeth, um den Garten kümmerte sich Willi, aber alles andere lag in Rosemarie Schulzes Verantwortung. Und darüber war sie froh und dankbar. Und Esther sollte es auch sein. Das war sie auch. Schließlich bekam ihre Mutter einen guten Lohn, deshalb hatten sie auch eine Wohnung mit zwei Zimmern, einem Badezimmer und zwei Öfen. Die Villa der Hohnsteins war allerdings fünfmal so groß.
»Wenn du in dem Tempo weiterschälst, gibt es die Kartoffeln zum Frühstück«, unterbrach Rosemarie Esthers Gedanken. »Jetzt leg mal einen Zahn zu.«
Sie riss sich zusammen und griff rasch nach der nächsten Kartoffel. Die gnädige Frau wartete nicht gern aufs Essen. Das hatte ihre Mutter schon oft gesagt. Die gnädige Frau wartete überhaupt nicht gern. Alle ihre Befehle mussten sofort ausgeführt werden, da war sie unerbittlich und sehr streng. Was Esther nur zu gut wusste, als Schülerin hatte sie oft genug hier in der Küche gesessen und auf ihre Mutter gewartet und alles mitbekommen. Mittlerweile saß sie nicht mehr jeden Tag am Küchentisch, sondern machte eine Lehre zur Schneiderin im Modeatelier von Frau Johanna Bellmann in Weißenburg. Jetzt schon im zweiten Lehrjahr. Und heute war sie nur hier, weil endlich Laura und Lorenz kamen. Laura, ihre beste Freundin seit Kindertagen, und deren Zwillingsbruder.
Eines Tages hatte die drei Jahre ältere, aber sehr schüchterne Laura vor dem Küchentisch gestanden, an dem Esther sich hatte unsichtbar machen sollen, und sie gefragt, wer sie denn sei und ob sie ihre Freundin werden wolle. Esther wollte. Und Laura war glücklich, weil sie ihre erste Freundin war. Das stille Mädchen hatte sich bei den anderen Kindern aus ihrer Klasse nie wohlgefühlt. Esther war die Erste, in deren Gegenwart sie sich nicht stumm und langweilig vorkam. Und die mutige und lustige Esther riss Laura mit. Kein Spiel war ihr zu verrückt, kein Baum zu hoch, kein Wasser zu kalt. Laura blühte in ihrer Gegenwart auf.
Esther ließ die letzte Möhre in die Schüssel fallen und wischte sich die Hände an der Schürze ab, bevor sie sie rasch abband. »Ich bin fertig, Mutti. Alle Kartoffeln, alle Möhren, alles geschält und geputzt. Und die Zwiebeln habe ich auch geschält, dann gehe ich jetzt raus, die kommen bestimmt jeden Moment.«
»Gut«, Rosemarie bestrich einen Hefezopf mit Butter und wandte sich nur kurz um. »Du kannst die Schürze aber umbehalten, hier ist noch nicht alles fertig. Und Laura kommt bestimmt sowieso gleich in die Küche, wenn sie eingetroffen ist. Also kannst du auch hier auf sie warten.«
»Ich empfange sie doch nicht in der Schürze«, Esther sah empört auf Rosemaries Rücken. »Ich habe extra das gute Kleid an.«
Resigniert schüttelte ihre Mutter den Kopf. »Kind, sei nicht so eitel. Wenn Flecken auf das Kleid kommen, ist das Geschrei wieder groß. Und Laura ist das doch egal, du bist ihre beste Freundin.«
Esther strich stolz über den dunkelblauen glänzenden Stoff. Sie hatte dieses Kleid erst in der letzten Woche genäht, Frau Bellmann hatte ihr den Stoff überlassen, den eine Kundin nicht hatte haben wollen. Natürlich wurde er von ihrem Lehrlingslohn abgezogen, aber selbst Frau Bellmann hatte sie für die Arbeit gelobt und ihr den Stoff etwas billiger gelassen.
Laura trug immer die schönsten Kleider, ihre Mutter Adelheid legte Wert auf die richtige Garderobe. Schließlich war sie eine höhere Tochter. Esther wollte nicht wie das Küchenmädchen aussehen, wenn ihre Freundin endlich wieder nach Hause kam. Sie kannte sich nämlich inzwischen aus in der Modewelt. Und das sollte Laura auch sehen. Sie hob den Kopf, als Martha in die Küche kam und ihr zunickte. Esther nickte zurück und musterte sie mitleidig. Martha sprach fast nie und starrte auch immer auf den Boden. Sie war ihr ein bisschen unheimlich, diese traurige, dünne Frau, die auf einem Pferdewagen aus Ostpreußen vor den Russen geflohen und irgendwie hier in Weißenburg gelandet war. Willi hatte ihr erzählt, dass sie ihren Mann im Krieg und zwei ihrer drei Söhne auf der Flucht an die Diphterie verloren hatte. Hermann Hohnstein hatte sie an einem Abend bei Bauer Piepke gesehen, als sie die Kartoffeln aus dem Schweinetrog geklaut hatte. Piepke hatte angefangen zu schreien, aber Herr Hohnstein hatte ihn beruhigt und Martha gefragt, ob sie in der Villa arbeiten wolle, sie bräuchten noch Hilfe in der Küche. Und so könne sie Geld für Essen und ihren Sohn verdienen und müsse nicht das Schweinefutter stehlen. So war Herr Hohnstein: immer edel und freundlich. Deshalb arbeiteten nun Martha und auch ihre Schwester Elisabeth hier. Und auch zwei andere Flüchtlinge aus Schlesien, Josef und Karl, die Willi unterstützten, der mit seinem Holzbein ja nicht so schnell war.
»Also, was ist jetzt?« Rosemaries laute Stimme holte sie aus ihren Gedanken. »Die Servietten müssen noch gefaltet werden, dabei bekleckerst du dich nicht und machst trotzdem etwas Sinnvolles.«
Was an gefalteten Servietten sinnvoll sein sollte, wusste Esther zwar nicht, trotzdem holte sie den Stapel gestärkter Servietten von der Anrichte und begann, sie dekorativ zu falten. Mit einem verstohlenen Blick zur Uhr lächelte sie. Alle würde sie ohnehin nicht schaffen, Laura müsste jeden Moment in die Küche kommen. Und sie hatten sich jede Menge Neuigkeiten zu erzählen. Aus der Schweiz, woher Laura gerade kam, und aus Weißenburg, wo Esther ihre beste Freundin in den letzten drei Monaten vermisst hatte.
3.
Ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen, tastete Friederike nach dem Telefonhörer auf dem Schreibtisch. »Ja, Frau Kessel, was gibt es?«
»Sie haben Besuch, Frau Brenner. Alexandra Weise ist hier.«
»Oh, ist es schon so spät? Schicken Sie sie rein.« Sie legte auf, überflog die Mail ein letztes Mal und schickte sie ab, im selben Moment wurde die Tür geöffnet und Alexandra trat ein.
»Na? Bin ich zu früh?«
»Nein«, Friederike sprang auf und ging auf sie zu, um sie zu umarmen. »Du bist pünktlich, ich bin auch gerade fertig. Wir können sofort essen gehen.«
Sie wandte sich um und bückte sich nach ihrer Handtasche, die unter dem Schreibtisch stand, während sie fragte: »Wann musst du denn im Verlag sein? Wie viel Zeit haben wir?«
»Jede Menge«, Alexandras Stimme klang stolz, sofort hob Friederike den Kopf und sah ihre Freundin genauer an. Sie strahlte, ihre Augen glänzten, als sie antwortete: »Ich war schon im Verlag, ich hab es dabei.«
»Was?« Erst jetzt bemerkte Friederike den flachen Karton, den Alexandra unter dem Arm trug. Sofort ließ sie die Tasche fallen und riss die Augen auf. »Wirklich? Lass sehen. Sofort. Ich bin so gespannt.«
Langsam stellte Alexandra den Karton auf den Schreibtisch, nahm den Deckel ab und ein opulentes Buch heraus. Mit beiden Händen überreichte sie es feierlich Friederike und sagte: »Ich habe mir erlaubt, es schon zu signieren. Bitte schön.«
Friederike nahm es ihr ehrfürchtig ab und betrachtete es. Alexandra Weise:Der besondere Blick – Die Fotografin Marie van Barig, eine Künstlerbiografie
Den Umschlag zierte eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Marie. Sie stand in einem schwarzen Hosenanzug, die Kamera in den Händen, an eine Terrassenmauer unter Palmen gelehnt. Ihr Lächeln war entspannt, das helle Haar leuchtete im Sonnenlicht, ein glücklicher Moment in Cannes während der Filmfestspiele. Friederike kannte das Foto, sie hatten es in Maries Nachlass gefunden. Hanna hatte es damals aufgenommen, Jule, Alex und sie hatten es erst nach Maries Tod gesehen. Und einstimmig beschlossen, dass es das schönste Bild von Marie sei, die sich selbst so ungern fotografieren ließ. Und dass es unbedingt auf den Umschlag des Buches musste.
»Wirklich ein tolles Foto«, murmelte Friederike jetzt und schlug das Buch vorsichtig auf. Auf der ersten Seite stand in Alexandras schönster Schrift die Widmung: Für Fiedi, eine von uns vieren.
»Du hättest wenigstens Friederike schreiben können«, sie sah Alexandra stirnrunzelnd an. »So kann ich es niemandem zeigen, der mich ernst nehmen soll.«
»Wer nimmt dich denn nicht ernst?«, Alexandra lächelte. »Aber ein: ›Danke, Alex, ich freue mich sehr über eines der ersten Exemplare‹, hätte auch gereicht.«
»Danke, Alex, ich freue mich sehr«, wiederholte sie und blätterte langsam die Seiten um. Sie überflog die ersten Sätze der Einleitung, betrachtete die Bilder, blätterte etwas weiter, stutzte und hob das Buch höher. »Da sind ja auch Fotos vom See«, sagte sie erstaunt. »Von uns. Und da ist ja auch …«, sie verstummte und kniff die Augen zusammen. »Ist das da am Ufer Esther? In dem schwarzen Kleid?«
Alexandra sah ihr über die Schulter und nickte. »Ja. Sommer 1972. Da war Marie zehn und hat mit ihrer ersten kleinen Kamera schon solche Fotos gemacht. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Als Zehnjährige so ein Motiv zu wählen, finde ich schon erstaunlich.«
Esther stand mit dem Rücken zum Betrachter, sehr aufrecht, hatte ihren Rücken durchgedrückt und bildete in ihrem schwarzen schlichten Kleid und den straff zu einem Knoten gedrehten dunklen Haaren einen harten Kontrast zu dem in der Sonne glitzernden See und der Sommerstimmung, die über dem Foto lag.
»Wie die dreizehnte Fee«, murmelte Friederike.
Alexandra sah nachdenklich auf das Bild. »Ich finde, sie sieht total einsam aus. Aber vielleicht wirkt das auch nur auf dem Foto so. Wenn ich mich richtig erinnere, waren auch Carl und Laura an dem Tag mit am See.«
»Vermutlich«, Friederike blätterte weiter. »Esther war nie allein da. Aber es ist tatsächlich ein irres Motiv. Die kleine Marie.«
Zahlreiche Fotos, die Marie in ihrer beeindruckenden Karriere geschossen hatte, unterbrachen den von Alexandra geschriebenen Text. Friederike überflog die eine oder andere Passage beim Blättern, lächelte mal anerkennend, mal belustigt, schließlich schlug sie das Buch zu und sah hoch. »Ich will mir das in Ruhe ansehen«, sagte sie. »Aber es ist wirklich sehr schön geworden. Bist du wenigstens auch ein bisschen stolz?«
»Schon«, Alexandra lächelte verhalten. »Ich habe zwar gedacht, dass ich als ehemalige Verlegerin das Erscheinen eines Buches etwas neutraler sehe, aber beim eigenen stimmt das nicht. Und schon gar nicht, wenn es um Marie geht. Die Recherche, das Lesen ihrer Tagebücher, das Sortieren der ganzen Fotos und Artikel waren schon eine große Herausforderung. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich dabei geheult habe.«
Nachdenklich strich Friederike mit dem Zeigefinger über das Foto von Marie. »Aber du hast es geschafft. Ich bin jedenfalls stolz auf dich. So und bevor wir jetzt in Melancholie versinken, gehen wir essen und trinken einen Champagner auf dieses erste Exemplar.«
Sie legte das Buch zurück in den Karton. »Auf dass es ein Erfolg wird.«
Der Weg zum Italiener, bei dem Friederike einen Tisch für’s Mittagessen bestellt hatte, führte an der Alster entlang. Alexandras ruhiger Blick war auf das Wasser gerichtet, auf die Alsterbarkassen, die Segler und die beiden Ruderboote, die ihre geraden Bahnen zogen. Friederike sah ihre Freundin von der Seite an. Sie hatte sich in den letzten Monaten verändert, seit sie nicht mehr die gestresste Verlegerin war, die in einer Penthouse-Wohnung in München gelebt, ununterbrochen gearbeitet und nie Zeit gehabt hatte. Ihre Züge wirkten weicher, sie bewegte sich ruhiger, redete langsamer und auch weniger als früher. Als hätte sie Friederikes Gedanken gelesen, sagte sie plötzlich: »Du starrst mich an. Warum?«
»Du hast dich verändert«, stellte Friederike fest. »Deine Entscheidung, München zu verlassen und zurück in den Norden zu kommen, war anscheinend richtig. Zumindest wirkst du tiefenentspannt.«
»Ja, das mag sein«, Alexandra sah sie nachdenklich an. »Vielleicht bin ich manchmal zu entspannt. Egal, die Entscheidung war sicher richtig. Aber ich hätte mir das vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können. Hättest du mir damals gesagt, dass ich heute im Haus am See lebe, zusammen mit einer siebzigjährigen ehemaligen Starpianistin, die die Frau meiner verstorbenen Freundin war, dass ich ein Buch über diese Freundin geschrieben, meine langjährigen Freundinnen nach einer lange fälligen Versöhnung wieder um mich habe, mein Liebesleben aufgeräumt ist und ich jetzt darüber nachdenke, mir einen Hund anzuschaffen, hätte ich dich für verrückt erklärt.«
»Wenn du dir einen Hund anschaffst, halte ich dich für verrückt«, entgegnete Friederike prompt. »Leih dir die Töle von Steffi aus und üb die Nummer mit den Kackbeuteln, dann vergeht dir das.«
Alexandra lachte. »Es ist bislang nur eine Überlegung. Hanna hat damit angefangen. Damit sie gezwungen ist, jeden Tag spazieren zu gehen. Das wäre gut für ihr Rheuma, sagt sie, aber ihr innerer Schweinehund ist zu groß. Ein echter Hund würde sie zwingen. Und wenn sie, so wie jetzt, ihre Familie in Dänemark besucht, kann ich mich um ihn kümmern. Und ansonsten sind du und Jule ja auch noch da.«
»Ich kümmere mich garantiert nicht um so ein Tier«, widersprach Friederike sofort. »Warum sollte ich das tun? Ich kann Hunde nicht mal leiden.«
»Weil du gern mal ein paar Tage am See verbringst und dir Spazierengehen auch guttut«, Alexandra schob ihren Arm unter Friederikes. »Und wenn ich sehe, wie du mit der kleinen Marie umgehst und ganz in deiner Patentantenrolle aufgehst, das Kind mit verklärtem Blick betrachtest und mit ihr redest, als wärst du nicht ganz dicht, dann bin ich überzeugt, dass so ein niedlicher Welpe auch dir das Herz brechen würde. Du tust ja nur so ruppig, in Wirklichkeit bist du doch ganz weich. Ich kenne dich.«
»Vergiss es«, Friederike schüttelte entschlossen den Kopf. »Mit Marie ist das was ganz anderes. Das ist nicht irgendein Kind. Es ist Pias Tochter und Jules Enkelin, außerdem schreit sie kaum, guckt schon klug und nervt nicht. Apropos nerven, geht dir das Landleben nicht doch ab und zu auf den Geist? Das Haus ist ja schön, aber es ist auch am Ende der Welt. Jule hat sich schon Gedanken gemacht, dass du mit niemandem mehr redest, niemanden siehst und nichts mehr machst. Nicht dass du so ein Landei wirst, das von jedem Ausflug in die Stadt überfordert ist. Und vor lauter Langeweile anfängt, Marmelade einzukochen. Oder Hundespaziergänge zu machen. Wir haben ein bisschen Sorge, dass du dich zu sehr vergräbst.«
»Nein, ich vergrabe mich nicht«, Alexandra lächelte. »Ich hatte einfach viel mit dem Buch zu tun, deshalb habe ich in den letzten Wochen nichts anderes gemacht. Aber ansonsten sehe ich euch doch regelmäßig, fahre ab und zu nach Berlin, um Jan zu besuchen, da bin ich sogar in der Hauptstadt, ohne überfordert zu sein.«
Friederike musterte sie. »Aber du verbringst trotzdem die meiste Zeit allein am See. Oder mit Hanna. Wie oft siehst du Jan denn, seit er in der Berliner Redaktion ist?«
»Na ja«, wand Alexandra sich. »Ich hatte ja nun in den letzten Wochen den Abgabetermin vor der Brust und Jan steckt auch bis zum Hals in Arbeit. Er kommt jetzt aber Ende der Woche und bleibt bis zur Buchpremiere. Vielleicht fahren wir vorher auch noch ein paar Tage zusammen weg. Du musst dir keine Sorgen machen, ich vereinsame schon nicht.«
»Na gut«, prüfend sah Friederike sie an. »Und jetzt ist das Buch fertig. Dann kannst du auch wieder mal mehr unter Menschen gehen. Es schadet nicht.«
»Sagt Friederike Brenner, die zu jedem privaten Treffen gezwungen werden muss.«
»Ich sehe jeden Tag im Hotel massenhaft Menschen, ich brauche abends meine Ruhe. Das ist was ganz anderes.«
»Ach so«, achselzuckend erwiderte Alexandra ihren Blick. »Apropos abends, was ist denn eigentlich mit dir und Tom?«
»Ich weiß es noch nicht«, Friederike folgte der nächsten Barkasse mit ihrem Blick. »Ich bringe ihn mit zu deiner Buchpremiere. Mal sehen, wie er sich da schlägt. Vielleicht rennt er auch schreiend weg, wenn er euch alle richtig kennenlernt.«
»Du bist unmöglich«, Alexandra entzog ihr den Arm. Das italienische Restaurant war jetzt schon in Sichtweite, sie überquerten die Straße und gingen mit langen Schritten auf den Eingang zu. »Tom wird überrascht sein, dass eine so komplizierte Frau wie du so einen liebenswürdigen Freundeskreis hat. Das wird er kaum fassen können. Und sich fragen, wie wir es alle schon so lange mit dir aushalten und warum wir dich nicht schon im See ertränkt haben.«
»Witzig, sehr witzig«, Friederike zog die Eingangstür auf und betrat das Restaurant. »Ich hoffe nur, dass ihr euch alle benehmt. Noch findet Tom mich nämlich toll. Mario, come stai?«
Während Friederike mit dem kleinen dicken Inhaber in atemberaubender Geschwindigkeit und auf fließendem Italienisch noch im Gespräch war, setzte Alexandra sich schon an den Tisch und beschränkte sich auf ein Lächeln. Sie verstand kein Wort der sprudelnden Sätze, es war nicht jeder so ein Sprachwunder wie Friederike.
»Siamo affamati. E non molto tempo«, sagte Friederike und gab ihm einen Klaps auf den Rücken, bevor sie sich gegenüber Alexandra auf den Stuhl fallen ließ.
»Subito, mia cara, subito«, war Marios Antwort, bevor er zwei Speisekarten auf den Tisch legte und verschwand.
»War was Wichtiges?« Alexandra klappte ihre Karte auf. »Ich habe nichts verstanden.«
»Seine Schwiegermutter ist zu Besuch«, antwortete Friederike. »Deshalb arbeitet er jetzt auch mittags. Sonst kommt er immer erst um fünf.«
»Kennst du Toms Mutter schon?« Alexandras Frage klang harmlos, Friederike rollte trotzdem mit den Augen.
»Sie lebt in Schweden«, antwortete sie. »Weit genug weg. Und ist im Übrigen nur knapp zehn Jahre älter als ich. Sie war neunzehn, als sie Mutter wurde. Ich kenne sie nicht, es gab bislang auch keinen Grund dafür. Haben wir auch noch ein anderes Thema? Oder beschränken wir uns heute auf Mädchengespräche?«
Mario kam mit einer Platte Antipasti und einer Flasche Wasser und ersparte Alexandra die Antwort. »Für den ersten Hunger, cara«, sagte er laut. »Was möchtet ihr danach?«
Sie bestellten beide die Pasta von der Mittagskarte, Mario verschwand mit den Speisekarten, während Alexandra ihre Serviette auseinanderfaltete und auf den Schoß legte. »Wenn du weiterhin nicht über Tom reden willst, dann wird Jule ihn bei der Buchpremiere komplett ausfragen, das weißt du, oder?«
»Wird sie nicht«, Friederike griff nach einem Stück Brot. »Sie ist im Alter auch diskreter geworden. Aber wenn du es genau wissen willst, Tom und ich fangen gerade erst wieder an. Ich weiß noch nicht, ob es dieses Mal klappt.«