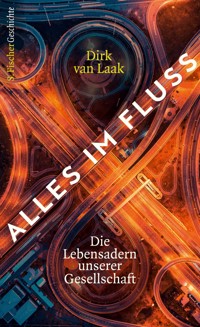
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Brücken und Straßen bis zu Datennetzen: Warum in der Moderne alles fließen muss – eine globale Geschichte der Infrastrukturen Sie sind die Lebensadern unserer Zivilisation: Datenautobahnen, Stromversorgung, Kanäle und Satelliten. In einem großen Überblick erzählt der Historiker Dirk van Laak elegant und anekdotenreich, wie diese Netze, Infrastruktur genannt, in den letzten 200 Jahren die Welt und den Alltag verändert haben. Ohne sie wären weder der moderne Haushalt noch TV, Internet und Smartphones, weder Kolonialismus noch Globalisierung möglich gewesen. Doch ob Wasser, Güter oder Verkehr: Alles muss fließen, sonst geht gar nichts mehr. Dabei sind die Infrastrukturen von Anfang an stetig ausgebaut worden – immer mehr, immer schneller ist bis heute die Devise. Dirk van Laak zeigt nicht nur, wie zentral diese oft unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegenden Strukturen heute sind. Er führt auch vor Augen, wie wichtig es ist, für die Zukunft Konzepte zu entwickeln, um sie zu betreiben und zu erhalten – und fragt, ob ein Innehalten nicht manchmal klüger wäre als der permanente Ausbau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dirk van Laak
Alles im Fluss
Die Lebensadern unserer Gesellschaft – Geschichte und Zukunft der Infrastruktur
Über dieses Buch
Von Brücken und Straßen bis zu Datennetzen: Warum in der Moderne alles fließen muss – eine globale Geschichte der Infrastrukturen.
Sie sind die Lebensadern unserer Zivilisation: Datenautobahnen, Stromversorgung, Kanäle und Satelliten. In einem großen Überblick erzählt der Historiker Dirk van Laak elegant und anekdotenreich, wie diese Netze, Infrastruktur genannt, in den letzten 200 Jahren die Welt und den Alltag verändert haben. Ohne sie wären weder der moderne Haushalt noch TV, Internet und Smartphones, weder Kolonialismus noch Globalisierung möglich gewesen. Doch ob Wasser, Güter oder Verkehr: Alles muss fließen, sonst geht gar nichts mehr. Dabei sind die Infrastrukturen von Anfang an stetig ausgebaut worden – immer mehr, immer schneller ist bis heute die Devise. Dirk van Laak zeigt nicht nur, wie zentral diese oft unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegenden Strukturen heute sind. Er führt auch vor Augen, wie wichtig es ist, für die Zukunft Konzepte zu entwickeln, um sie zu betreiben und zu erhalten – und fragt, ob ein Innehalten nicht manchmal klüger wäre als der permanente Ausbau.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Sahacha Nilkumhang / Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490634-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Ein-Leitung: Hauptsache, sie funktioniert …
Jenseits des Alltäglichen
Wo beginnen?
Definitionskreise
I Die klassische Ära der Infrastrukturen
1 Öffentliche Arbeiten: Das 19. Jahrhundert
Kanalisierung
Westward Ho!
Weltfrieden oder Weltherrschaft
Stadt im Fluss
2 Lebensadern der Gemeinschaft: Das frühe 20. Jahrhundert
La Fée Électricité
Gefährdung und Improvisation
Automobile Zeitreisen
Aneignung und Ausgrenzung
3 Maßstab der Moderne: Das späte 20. Jahrhundert
Unwiederbringliche Gefühle
Kontrollierte Kollektive
Machtspeicher
Rückkehr des Verdrängten
II Knotenpunkte der Debatten um die Infrastruktur
4 Public, private oder partnership? Wie Infrastruktur organisiert wird
Öffentliche und unsichtbare Hände
Werktätiger Gemeinsinn
5 Prestigeprojekte: Symbolwert und Scheitern von Infrastruktur
Sichtbarkeit des Selbstverständlichen
Prestige und Poesie
6 Bröckelnde Brücken: Lebenszyklen von Infrastrukturen
Tempi passati
Warten auf die Wartung
7 Achillesfersen: Die Verwundbarkeit großtechnischer Netze
Ungehinderte Betriebsabläufe
Kritikalität der Netze
8 Die Kalte Persona: Nutzer und Betreiber der Infrastrukturen
Verkehrsteilnehmergesicht
Service und Selbstregulation
Aus-Leitung: Alles im Fluss?
Rohrsysteme und Datenautobahnen
Wie weiter?
Rekapitulation
Literatur
Abbildungsnachweise
Dank
Personen- und Ortsregister
Ein-Leitung: Hauptsache, sie funktioniert …
Wer kennt ihn nicht, den stets und ständig mit seinem Smartphone beschäftigten Menschen? In geselliger Runde oder beim Autofahren, im Kino oder beim Sport – es scheint keinen Ort und keine Situation mehr zu geben, in der das Gerät beiseitegelegt oder gar ausgeschaltet würde. Der Mensch von heute ist chronisch online, und er will es so. Doch spiegelt sich in den Gesichtern derer, die unablässig kommunizieren, oft der Stress einer fortwährenden Überforderung.
Über das Smartphone schaut, tippt und wischt jeder potentiell die ganze Welt herbei. Damit steht es sinnbildlich für alles, was die Aufklärung, die industriellen Revolutionen und der bürgerliche Liberalismus seit dem 18. Jahrhundert auf den Weg gebracht haben: für die Unabhängigkeit vom Raum und der sozialen Herkunft, für den Zugang zu globalen Informations- und Datenströmen und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von Weltbürgern. Das Smartphone ist zur »Fernbedienung« der Netzwerkgesellschaft geworden. Es hat den souveränen Kunden, den umfassend informierten Staatsbürger und die freie und selbstbestimmte Persönlichkeit ermöglicht.
Zugleich macht der hinter dem Gerät stehende Komplex die Menschen abhängig von vernetzten Technologien und deren Angeboten. Dieser Komplex nötigt uns, fortwährend zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen. Damit verdichten sich im Smartphone mehr als zwei Jahrhunderte der Entwicklung eines Feldes, das mit dem scheinbar so neutralen wie sachlichen Terminus der Infrastruktur umschrieben wird.
Jenseits des Alltäglichen
Als Student hörte ich einmal einem Gespräch von Wissenschaftlern zu, die sich über den Besuch einer Historikerdelegation aus der DDR unterhielten. Am stärksten ist mir dabei ein Detail in Erinnerung geblieben: Die Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland, die zum ersten Mal in der Bundesrepublik waren, zeigten sich keineswegs beeindruckt von den zahlreichen Möglichkeiten zum Konsum. Darauf waren sie vorbereitet. Wirklich erstaunt hat sie dagegen die Reibungslosigkeit, mit der die westdeutschen Infrastrukturen funktionierten. Während ich mich kurze Zeit darauf selbst mit der Geschichte städtischer Versorgungsunternehmen beschäftigte, ging die DDR unter – von mir allerdings weitgehend unbemerkt. Die Recherche über langlebige Strukturen wie Schienenstränge, Stromkabel oder Wasserrohre hatte mich die zeitgleich stattfindende Tagespolitik nahezu vergessen lassen. Rückblickend vermag ich in diesem Umstand eine verborgene Logik zu erkennen.
Wer sich mit Infrastrukturen beschäftigt, steht vor einer ganzen Reihe von Paradoxien. Einerseits signalisiert der sperrige Begriff, dass man es besser den Experten überlassen sollte, sich damit zu befassen. Die Einrichtungen der Kommunikation und des Verkehrs, der Versorgung und Entsorgung entlasten uns von den täglichen Fragen, wo Strom und Wasser herkommen, wie wir uns von einem Ort zum anderen bewegen und auf welche Weise wir uns informieren. Andererseits sind Infrastrukturen zu Dauerthemen der öffentlichen Diskussion geworden. Wer soll sie organisieren und verwalten? Wie können wir sie schützen? Und wie ist ihr schlechter Zustand zu erklären? Erst wenn sie nicht mehr funktionieren, wie seinerzeit in der DDR, beginnen wir zu ahnen, dass viele dieser Leistungen nicht so selbstverständlich sind, wie sie uns vorkommen.
Weshalb sind die meisten Menschen so unaufmerksam für etwas, das sie alltäglich betrifft? Weshalb kann die »Conditio sine qua non jeder modernen Gesellschaft«[1] zugleich als so profan und banal empfunden werden? Obgleich sich in der Infrastruktur die Funktionsfähigkeit und der Reichtum einer Gesellschaft widerspiegeln, wurde sie zu einer Kategorie der Insuffizienz: »Infrastruktur«, so der Historiker Paul Edwards, »scheint heute eine allumfassende Lösung und ein omnipräsentes Problem zu sein, unerlässlich und unzureichend zugleich, immer schon vorhanden und dennoch immer auch ein unfertiges Projekt.«[2]
Gleichzeitig ist die Feststellung, dass ein Ort nicht an das Telefonnetz angeschlossen ist oder nicht über fließendes Wasser verfügt, so etwas wie ein ultimatives Urteil über seine zivilisatorische Rückständigkeit. Infrastrukturen versprechen ein besseres und komfortableres Leben. Das erfordert den Anschluss an immer neue, immer effizientere Einrichtungen der Versorgung und des Verkehrs, der Kommunikation und der energetischen Entlastung. Im Feld der Infrastruktur wird meist mit der Not argumentiert, während zugleich die Utopie heraufbeschworen wird, über sie einen Anschluss an die Zukunft zu erlangen.
In diesem Buch wird es aber nicht um eine systematische, zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen, der politischen, der rechtlichen oder gar der technischen Dimensionen der Infrastruktur gehen, obgleich das alles natürlich eine Rolle spielt. Vielmehr soll dargelegt werden, dass das scheinbar so unaufhörliche Wachstum der Infrastrukturnetze und Versorgungseinrichtungen je nach den Umfeldern, in denen sie entstanden, starken und zeitbedingten Schwankungen unterlag. Die Infrastrukturen sollen also geschichtlich verortet werden.
Künstlerische Darstellungen der Energie- und Verkehrsflüsse sind selten. Gustav Wunderwald porträtierte 1927 eine Spandauer Unterführung im Stil der Neuen Sachlichkeit. Der Maler starb 1945 an einer Wasservergiftung.
Vor allem soll der Einfluss der Infrastrukturen auf unsere (post-)moderne Kultur, unser Alltagsleben, unser Bewusstsein und unsere Kulturtechniken deutlich werden. Dies setzt eine Verschiebung von historischen Sichtachsen auf das voraus, was man üblicherweise für »Geschichte« hält. Es erfordert aber auch eine Distanz gegenüber der wohlfahrtsstaatlichen Gemütsruhe, die Infrastrukturen üblicherweise erzeugen.[3] Für meine Generation, die in den 1960er Jahren aufwuchs und in den 1970er Jahren ihr politisches Bewusstsein entwickelte, war diese Haltung mit der unerschütterlichen Erwartung verbunden, dass die Infrastruktur sich ständig ausweiten und verbessern würde.
Heute scheint Infrastruktur hingegen allenthalben zu einem Problem geworden zu sein. Die reichen Länder stehen vor der Aufgabe, einerseits ständig neue Infrastrukturen, momentan solche zum Ausbau der digitalen Welt, einzurichten und andererseits die bestehenden zu pflegen, zu erhalten oder auch rückzubauen. Andere Länder sehen sich dagegen vor die Daueraufgabe gestellt, ein Mindestmaß an Versorgungs- und Entsorgungs-, Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen vorzuhalten, wenn nicht sogar ein ähnliches Niveau anzustreben wie das in den reicheren Ländern seit langem vorhandene. Wo immer in den letzten 150 bis 200 Jahren von Entwicklung die Rede war, wurde darunter vornehmlich das Vorhandensein von mehr oder weniger gut ausgebauten Infrastrukturen verstanden.
Auch und gerade in dieser Hinsicht sind Infrastrukturen zu einem Maßstab für vermeintliche Modernität geworden, ohne die ein Anschluss an die Weltwirtschaft und Weltgesellschaft nicht möglich erscheint. In Bezug auf Infrastrukturen ist immer verglichen worden. Dabei kann es davon offenbar nie genug geben. Immer scheinen es andere noch etwas besser zu haben, noch umfassender angeschlossen zu sein, schneller reisen oder surfen zu können.
Infrastrukturen wurden seit dem 18. Jahrhundert dazu genutzt, Gesellschaften zu modernisieren, sie räumlich, sozial oder kulturell zu integrieren und den Menschen neue Möglichkeiten zu bieten. Zugleich tragen Infrastrukturen dazu bei, die Menschen mehr oder weniger offen zu kontrollieren und zu einem konformen Verhalten zu bringen und sie damit zu binden oder zu steuern. Ausmaß und Funktionalität der Infrastrukturen werden bis heute mit Ordnung und guter Regierung in Verbindung gebracht, oft sogar damit gleichgesetzt. Im Ergebnis entstanden gebaute Umwelten, in denen sich Menschen routiniert, fast intuitiv und wie in einer zweiten Natur bewegen, auf die sie zugleich in hohem Maße angewiesen sind.
Mit Infrastrukturen bildete sich ein Muster der Moderne aus, dessen weitreichende kulturelle Prägekraft kaum zu überschätzen ist. Die Netzwerke der Ver- und Entsorgung, der Kommunikation, des Verkehrs und der Energie haben sich tief in das Alltagsleben und das Verhalten derjenigen eingeschrieben, die regelmäßig darauf zugreifen. Damit bilden sie einen bemerkenswert eigenständigen und unabhängigen Faktor der jüngeren Geschichte, der aufgrund seiner kumulativen Wucht und seiner Komplexität unter den menschlichen Kulturleistungen durchaus etwas Wundersames aufweist.
Nirgendwo sind menschliche Gestaltung und Technik so nah und so umfassend mit dem menschlichen Alltag verflochten wie in diesem Bereich. Zu den täglichen Nachrichten über das Wetter und die Börsenkurse gesellen sich daher immer öfter Analysen über den Zustand der Infrastruktur. Sie betreffen nicht mehr nur die Staumeldungen im Straßenverkehr, sondern mit einer sich scheinbar täglich erhöhenden Taktung auch Streiks im öffentlichen Nahverkehr, betriebsbedingte Ausfälle oder andere Anlässe, die es erforderlich machen, alltägliche Routinen neu zu organisieren. Zu diesen Dysfunktionen addieren sich wie ein Grundbass die gesellschaftlichen Diskussionen darüber, wer das alles organisieren, wer das finanzieren soll und mit welchen Maßnahmen gefährdete Infrastrukturen in Zukunft besser geschützt werden können. Aus den Nischenplätzen der Eisenbahn- und Briefmarkennostalgiker ist das Thema Infrastruktur längst in den Vordergrund der Tagespolitik gerückt.
Die gesteigerte Aufmerksamkeit für diese Einrichtungen macht deutlich, dass wir uns dieser Abhängigkeiten immer bewusster werden und dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir Infrastrukturen nutzen, langsam abnimmt. Vor allem wird immer klarer, wie verwundbar wir geworden sind, seitdem wir unseren Alltag ganz auf die zuverlässige Verfügbarkeit dieser anonymen Leistungen ausgerichtet haben. Im digitalen Zeitalter ist diese Abhängigkeit noch größer geworden und wird vermutlich weiter zunehmen. Es wurde in der Rede über Infrastrukturen schon zu einem Gemeinplatz, dass sie sich uns geradezu schockartig immer dann ins Gedächtnis zurückrufen, wenn sie einmal nicht mehr reibungslos funktionieren, wenn sie marode sind, bestreikt oder attackiert werden oder sich wieder einmal ihr Preis erhöht. Bei vielen Menschen reicht mittlerweile bereits ein beinahe leerer Smartphone-Akku, um sie nervös zu machen.
Das gewachsene Interesse der Gegenwart an den Infrastrukturen deutet noch etwas anderes an: Das mit ihnen verbundene Konzept, die zirkulativen Grundlagen unserer Gesellschaft stetig weiter auszubauen, scheint seinen Höhepunkt inzwischen überschritten zu haben.[4] Diese Feststellung mag insbesondere mit Blick auf die vielen Schwellenländer verwundern, die gerade mit ambitionierten Projekten dabei sind, solche Fundamente erst zu schaffen. Tatsächlich wird ihnen das Recht, ja die Notwendigkeit, dies zu tun, niemand absprechen wollen. Allen sollte an einer basalen Versorgung möglichst vieler Menschen mit so unentbehrlichen Dingen wie sauberem Wasser oder hygienischen Einrichtungen gelegen sein. Der historische Blick auf die Entstehung und die Wandlungen dieser Einrichtungen im 19. und 20. Jahrhundert kann jedoch darüber aufklären, wie stark die leitenden Ideen des stetigen Wirtschaftswachstums, des liberalen Freihandels oder der Beherrschung der Natur darin eingeschrieben sind. Diese Axiome der westlichen Industriegesellschaften stehen aber nicht ohne Grund auf dem Prüfstand.
Eine der zentralen Fragen in diesem Buch ist die, wie die Infrastruktur und die dazugehörigen Basiseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten uns selbst und unser Alltagsleben grundlegend veränderten, wie sie neue Routinen schufen, neue Verhaltensstandards setzten und neue Erwartungen an die Gesellschaft schürten. Der Schwerpunkt wird also auf den historischen Wandlungen dessen liegen, was die Zeitgenossen in der jeweiligen Gegenwart für den Normalfall gehalten haben. Denn es war und ist ja auch der Zweck der Infrastruktur, dass wir uns über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft solcher Leistungen nicht viele Gedanken machen müssen. Sie soll uns von den alltäglichen Beschwernissen der Überlebenssicherung entlasten. Sie soll uns Freiräume verschaffen für kreative Tätigkeiten und uns ermöglichen, unseren Horizont zu erweitern. Infrastruktur erzeugt Fließräume, in die wir uns im Bedarfsfall einklinken, indem wir das Leitungswasser laufen lassen, den Strom anschalten, die Bahn besteigen oder ins Internet gehen. Infrastruktur könnte man definieren als alles Stabile, das notwendig ist, um Mobilität und einen Austausch von Menschen, Gütern und Ideen zu ermöglichen. Es geht hier also um einen engeren, materiellen Begriff von Infrastrukturen, der zumeist Schienen oder Straßen, Röhren oder andere Leitungen meint, durch die etwas fließt.
Es ist ein Thema ohne prominente Helden, ohne große Zäsuren und ohne markante Jahrestage – der Architekturhistoriker Siegfried Giedion hat das einmal eine anonyme Geschichte genannt.[5] Es geht um moderne Durchschnittsmenschen in ihrer wiederkehrenden Bedürfnissphäre, an denen sich Infrastrukturplaner gerne orientieren. Eine Ausgangshypothese ist, dass die Infrastrukturnetze, die uns heute umgeben, keineswegs das Ergebnis einer kohärenten Planung waren, sondern vielmehr in einem Geflecht sehr unterschiedlicher und sehr widersprüchlicher Interessen entstanden sind. Sie sind das materielle Substrat gesellschaftlicher Konstellationen, der geronnene Zustand einer jeweiligen Augenblicks-Konstellation. Ein Zustand aber, der in seiner alltäglichen Nutzung weiter verhandelt und dabei ständig verändert wird. Ich möchte dieses Kontinuitätselement, das unterhalb der alltäglichen Aufmerksamkeitsschwelle liegt, ins Bewusstsein rufen und damit begreifbar machen, wie stark es zugleich historischen Wandlungen unterlag.
Diese Darstellung beschäftigt sich mit säkularen Prozessen der modernen Epoche. Dabei beschränkt sie sich räumlich gar nicht, zeitlich vornehmlich auf die beiden letzten Jahrhunderte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sind die Perspektiven und die ausgewählten Beispiele subjektiv gefärbt und werden in fortgesetzten Wechseln zwischen punktuellen Geschichten und globalen Einordnungen vorgestellt, als in einem sehr wörtlichen Sinne miteinander verflochtene Episoden. Dabei soll in die seit dem 18. Jahrhundert auf die Gegenwart zulaufende Geschichte eine neue Ebene eingezogen werden. Die Infrastruktur kommt in großen historischen Gesamtdarstellungen bislang kaum vor, obgleich sie gegenüber der Geschichte von Industrialisierung und Urbanisierung, Bürokratie und Wohlfahrtsstaat durchaus eigenständig ist. Diese Geschichte wird in den ersten drei Kapiteln erzählt, in denen es um die wesentlichen Phasen des Infrastrukturausbaus im 19. und 20. Jahrhundert geht. Dabei werden Schwerpunkte der Infrastrukturentwicklung identifiziert, die sich räumlich und zeitlich versetzt fast überall auf der Welt wiederfanden.
Es geht zunächst um die urbanen und nationalen, dann um die europäischen und schließlich um die globalen Ebenen. Doch finden sich alle vier Ebenen in den anderen wieder. Eine Darstellung, die sich auf eine bestimmte Region oder ein Fallbeispiel beschränkt, würde dem expansiven und buchstäblich welterschließenden Charakter der Infrastrukturen nicht gerecht. Die Perspektive weist dennoch eine westeuropäisch-atlantische Tendenz auf, schon weil die Forschungen hierzu deutlich dichter sind. Doch werden auch globale Weiterungen des Konzepts Infrastruktur nachverfolgt, eines Konzepts, das sich an der Idee der zirkulativen und wachstumsorientierten Moderne orientierte.
Die Chronologie des klassischen Zeitalters der materiellen Vernetzung löste sich seit den 1970er Jahren zunehmend auf. Seither neigt sich in bestimmten Regionen die Ära des »modernen Infrastrukturideals«, gekennzeichnet durch die Idee eines universalen Zugangs und standardisierter Leistungen eines monopolistischen Anbieters, ihrem Ende zu.[6] Andernorts kommt dieses Ideal, wie angedeutet, freilich gerade erst an. Dem trage ich in den Kapiteln des zweiten Teils Rechnung, in dem ich mich systematischer auf zentrale Felder der Diskussionen über Infrastrukturen konzentriere, die sich in den letzten beiden Jahrhunderten auskristallisiert haben: die Frage nach der Organisation und der Finanzierung, nach der Sichtbarkeit und dem Symbolwert, der Geschichtlichkeit und dem Verfall sowie nach der Verwundbarkeit von Infrastrukturen – und schließlich die Frage nach der individuellen Zurichtung der Nutzer wie der Betreiber von Infrastruktureinrichtungen. Zum Abschluss werden die relevantesten Fragen der gegenwärtigen Debatten über Infrastrukturen gebündelt und einige der Visionen benannt, die sich damit in Zukunft verknüpfen werden.
Es handelt sich hierbei um eine Zwischenbilanz. Insofern spiegelt das Buch, was auch Infrastrukturen meist darstellen: eine von den Konstellationen des Augenblicks abhängige Materialisierung.[7] Infrastrukturen stellen etwas bereit, das anschließend weiterentwickelt und umgenutzt wird oder sich irgendwann überlebt. Denn die Veränderungsdynamik dessen, was wir für »normal« und für »selbstverständlich« halten, ist unverändert rasant. Infrastrukturen sind heute die Voraussetzungen eines vernetzten und globalisierten Geschehens, das den Alltag der jetzt Lebenden bestimmt, das aber zugleich brüchig zu werden droht. Als ich mich 1989 dem Thema zu widmen begann, war die nächste, die digitale Revolution in ihren Dimensionen noch kaum absehbar. Man muss also bei dem Thema ständig auf Neues gefasst sein, kann sich aber mit einem Rückblick auf das Bisherige vielleicht besser darauf einstellen.
Wo beginnen?
Am 1. März 1952 berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass im Umfeld einer NATO-Tagung in Lissabon ein »für deutsche Ohren bizarr und unverständlich« klingendes Wort aufgetaucht sei. Agenturen, Zeitungen und Spezialisten hätten es unmittelbar in ihren Sprachgebrauch übernommen. Wie damals noch üblich, setzte das Qualitätsblatt den Begriff vorsorglich schon einmal in Fraktur und empfahl zudem, den Ausdruck Infrastruktur »immer ins Deutsche zu übersetzen«. Denn nichts erziehe so sehr zu Gedankenlosigkeit wie »der großzügige Gebrauch unverständlicher Worte«.[1] Gerade diese Eigenschaft des Vieldeutigen sollte freilich all jene, denen der expansive Gebrauch des Begriffs bald auf die Nerven ging, zur Verzweiflung treiben. So auch Bernhard S. Katz. Der Werbeunternehmer stellte 1989 in einer Zeitungskolumne fest, dieser »Infrastruktur« sei nirgendwo mehr zu entkommen und der Begriff offenbar »für die Liebhaber dunkler Anspielungen zu verlockend, um ihn ignorieren zu können«.[2]
Wieder ein Vierteljahrhundert später scheint Infrastruktur für den Journalisten Till Briegleb zu einer »diffusen Allzweckmetapher für nahezu jede Form von System zerflossen« zu sein.[3] Tatsächlich erlebt der Ausdruck seit einigen Jahren in immer neuen Zusammenhängen immer neue Konjunkturen. Oft wird er gleichbedeutend mit Voraussetzungen aller Art verwendet, die nicht nur technische, sondern auch soziale und kulturelle Prozesse ermöglichen.[4] Bis heute geht vom Begriff »Infrastruktur« die bezwingende Aura des Notwendigen aus. Vermutlich hat er sich in der Alltagskommunikation auch deswegen einen festen Platz erobert, weil er in all seiner Sperrigkeit die Autorität eines Konzepts für sich beansprucht. Und dieses Konzept, so wird im Folgenden argumentiert, entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts in Westeuropa und den USA, formte sich im 20. Jahrhundert weiter aus und fand in den 1950er und 1960er Jahren schließlich zu seinem Begriff.[5] Es basiert auf Vorstellungen, die heute weltweit als hegemonial gelten können, auch wenn es zu ihnen, wie ebenfalls zu zeigen sein wird, stets Gegner und Gegenentwürfe gab. Heute wiederum verdichten sich Stimmen, die den Begriff und das Konzept »Infrastruktur« historisieren, um beides mit veränderten Inhalten zu füllen.
So sieht der Sozialpsychologe Harald Welzer Infrastrukturen fest in unser Denken eingeschrieben: »Die institutionellen Infrastrukturen regulieren das Wachstum, die materiellen manifestieren es, die mentalen übersetzen es in die lebensweltliche Praxis. Sie statten die Bewohner der Wachstumsgesellschaften mit den dazugehörigen Selbstkonzepten und Biographien aus.«[6] Sein hieraus abgeleitetes Plädoyer für eine Gesellschaft, die den Gedanken des ständigen Wachstums hinter sich lässt, ist sicher eine der am weitesten gehenden Deutungen des Infrastrukturkonzepts.
Einstweilen mag dieser Deutungsvorschlag dabei helfen, die sich unwillkürlich aufdrängende Frage zu beantworten, weshalb man Infrastrukturen überhaupt an eine bestimmte Epoche bindet. Macht es nicht Sinn, in Bezug auf die Antike oder das Mittelalter ebenso von »Infrastrukturen« zu sprechen? Was sonst sind denn Brunnen oder Straßen, Kanäle oder Stadtmauern, Getreidespeicher oder Kirchturmuhren, Zeughäuser oder Gefängnisse in der »Vormoderne« gewesen? Gerade das Römische Reich wurde seit dem 19. Jahrhundert zu einer geradezu stereotypen Referenz dafür, welches Niveau staatlich organisierte Versorgungs-, Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerke in der Geschichte schon einmal erreicht hatten. Es hinterließ Relikte wie den ersten gepflasterten Fernweg der Welt, die seit 312 v. Chr. aus Rom herausführende Via Appia, Aquädukte in Südfrankreich oder den Limes in Deutschland. Immer wieder wird auf die aufwendige Versorgung Roms mit Wasser und auf das Abwassersystem der Cloaca Maxima verwiesen, aber auch auf die beeindruckende Vernetzung mit Straßen und auf den gut funktionierenden Postverkehr. Der Cursus Publicus stellte römischen Dienstreisenden bereits eine hochentwickelte Logistik mit Transporttieren und Fahrzeugen, Wechselstationen und Rasthäusern zur Verfügung.[7]
Das Wissen um diese Einrichtungen gehört bis heute zum bildungsbürgerlichen Standardrepertoire der Antikenverehrung. Mit den opera publica gab es sogar schon einen römischen Begriff, der später als obras públicas, réseaux publics, public works beziehungsweise »öffentliche Arbeiten« in moderne europäische Sprachen übersetzt wurde. Aus heutiger Perspektive, nach der Europa eine Weltprovinz unter vielen ist, kommen weitere historische Höchstleistungen hinzu, die weniger bekannt sind, uns aber zu nachträglicher Demut nötigen: das Kanalnetz in China, die Fernstraßen in Japan, die Bewässerungssysteme in Ägypten, Indien und Mittelamerika oder die zentralasiatische Seidenstraße.[8]
Man kann den Begriff »Infrastruktur« durchaus auf diese Systeme anwenden. Trotzdem schlage ich vor, für die letzten zwei Jahrhunderte das engere Verständnis des spezifischen Infrastruktur-Konzepts zugrunde zu legen. Das Konzept ist nicht an bestimmte Technologien gebunden – diese hatten viele Vorläufer, über die man durchaus sinnvoll diskutieren kann. Gemeint sind hier die – westlich geprägten – Vorstellungen einer Zirkulation von Gütern, Menschen und Ideen sowie einer möglichst gleichmäßigen Versorgung und Kommunikation aller Bürger. Sie entstanden zeitgleich mit der Aufklärung, den Revolutionen in den USA und in Frankreich, mit der industriellen Revolution, mit dem liberalen Wirtschaftsbürgertum und der modernen Massengesellschaft.
Von »Infrastrukturen« soll hier – gerade in Abgrenzung zu früheren Stadien der Verkehrserschließung, des Informationsaustauschs oder der Fürsorge – daher erst dann gesprochen werden, wenn tendentiell eine Mehrzahl an Menschen im Alltag auf entsprechende Einrichtungen tatsächlich zugreift. Daher macht nicht schon deren Vorhandensein, sondern erst eine solche Nutzung diese Vorkehrungen zu Infrastrukturen. Diese Definition verhindert nicht den Vergleich mit anderen räumlichen und zeitlichen Epochen. Sie weist vor allem darauf hin, dass diese spezifische Konfiguration einer spezifischen Zeit zugeordnet werden muss.
Wo also beginnen? Darauf sind mehrere Antworten möglich. Lässt man klassischerweise erst die Ideen sprechen, die mit sogenannten Vordenkern in Verbindung gebracht werden? Dann müsste man vermutlich bei den Utopisten und den Projektemachern der Frühen Neuzeit einsetzen, die Vorstellungen von integrierten, gerechten und vollständig versorgten Gesellschaften entwarfen. Diese Visionen einer stabilen Zukunft, in der weder materielle Not noch Ausgrenzung herrschten, entwarfen freilich meist etwas langweilige Schlaraffenländer.
Oder will man die Betonung auf die praktische Politik legen? Dann wird man eher auf die Entstehungsprozesse des modernen Staates und die begleitenden Wirtschaftspolitiken des Merkantilismus und des Kameralismus abheben, die Entwicklungsmöglichkeiten für klar definierte Territorien skizzierten. So meinte etwa der »Kirchenvater« des modernen Wirtschaftsdenkens, Adam Smith, in seinem 1776 erschienenen Werk über den »Wohlstand der Nationen«, es sei die Pflicht des Staates, »solche Anstalten zu treffen und solche Werke herzustellen und zu unterhalten, die, wenn sie auch für eine Nation höchst vorteilhaft sind, doch niemals einen solchen Gewinn abwerfen, dass sie einzelnen oder einer kleinen Anzahl von Personen auch nur die Kosten ersetzen, und deren Errichtung und Unterhaltung daher von keinem Einzelnen und keiner Anzahl von Personen erwartet werden darf«.[9] Von solchen Beobachtungen ausgehend haben sich in der Folgezeit immer mehr Experten der Staatswissenschaften mit solchen »Werken« beschäftigt – zwei Jahre später fiel dabei in Deutschland zum ersten Mal der Begriff »öffentliche Anstalten«.[10]
Oder legt man die Elle der historischen Wendezeit an? Dann würde man vermutlich bei der spätestens im 18. Jahrhundert ausgeprägten Vorstellung einsetzen, dass Aufklärung und Fortschritt etwas mit »Circulation« zu tun haben, nämlich dem freien Austausch von Menschen, Waren und Ideen.[11] In der Folge wurden Abgeschlossenheit und Sesshaftigkeit immer stärker mit Rückständigkeit identifiziert, die es zu überwinden galt. Damit verbunden war die Vorstellung vom Netz als einem positiven Funktionsbild für Gemeinschaft, das zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung oszilliert.[12] Hier deuten sich bereits Konflikte zwischen expansiven Infrastrukturen und Vorstellungen von national abgeschlossenen Wirtschaftsräumen an, wie sie in Johann Heinrich von Thünens Theorem des »isolierten Staats« (1826) formuliert sind. Im Grunde waren es Konflikte zwischen Parteien, die eher protektionistisch oder eher freihändlerisch argumentierten, wobei die Infrastrukturen je nach dem Ansatz, dem die Verantwortlichen zuneigten, unterschiedlich ausgestaltet wurden. Gerade deshalb aber blieben diese Konflikte bis heute ungelöst.
Auch aus umwelthistorischer Perspektive zeigt sich eine Wende beim Übergang vom 18. in das 19. Jahrhundert. Die Nutzung fossiler Brennstoffe zum Antrieb von Arbeitsmaschinen wurde zur Voraussetzung nicht nur der Industrialisierung, sondern auch einer konzentrierten Bearbeitung der Natur nach menschlichem Bedarf. Dieser Wille zum Eingriff hatte sich geistig seit langem vorbereitet, lange standen aber nur begrenzte Mittel dafür zur Verfügung.[13] Doch erneut ist Vorsicht geboten: Auch im vormaschinellen Zeitalter hatte es, etwa im Marschland und in Küstenregionen, schon gewaltige Eingriffe in die Landschaft gegeben, um sich gegen Stürme, Überflutungen, Überschwemmungen und dergleichen zu schützen und die Natur »berechenbarer« zu machen.[14] Johann Wolfgang von Goethe ließ seinen zweiten Teil des Faust mit solch einer Vision enden. Die maschinell verstärkten Eingriffe führten schließlich dazu, keine der Naturvorgaben mehr als gegeben hinzunehmen. Die Landschaft schien nun gestaltbar, wie es den Anwohnern beliebte.
Möchte man beim Menschen und seinen Bedürfnissen, namentlich bei seinem Wunsch nach Bequemlichkeit ansetzen, so kann man vermutlich nicht früh genug beginnen. Bei genauerer Betrachtung muss man freilich konstatieren, dass nahezu alle vermeintlichen Vorläufer der heutigen Infrastrukturen aus vormodernen oder außereuropäischen Kontexten nur von einer verschwindend geringen Anzahl an Menschen genutzt werden konnten. Die Annehmlichkeiten einer Dienstleistung oder die Nutzung kommunikativer Möglichkeiten waren in aller Regel adlige oder elitäre Privilegien und wurden meist durch umfassendes spezialisiertes Personal gewährleistet. Dies änderte sich tendentiell erst im 19. Jahrhundert.
Vielleicht fängt eine Geschichte der Infrastrukturen aber auch bei den Verkehrs- und Kommunikationseinrichtungen selbst an? Dann müsste auf die Turmuhren und die Glocken verwiesen werden, die seit dem 14. Jahrhundert den Wandel von einer Zeit der Kirchen zu einer Zeit der Händler anzeigten, wie der Historiker Jacques Le Goff dies einmal beschrieb.[15] Oder es würde auf das Straßen- und Kutschenwesen oder auf die seit dem 16. Jahrhundert entwickelte Post abgehoben, auf schon seit längerem gebräuchliche optische Telegrafen und Ähnliches. Spätestens hier würden auch die Spannungen zwischen militärischer und ziviler Infrastruktur aufscheinen, zwischen defensiven, im Krisenfall besonders gefährdeten und bisweilen improvisierten Einrichtungen auf der einen, langfristigen und für die Alltagsnutzung in Friedenszeiten ausgelegten Einrichtungen auf der anderen Seite.
Ein nächster Zugriff auf die Frage des möglichen Beginns wäre es, die großen Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist namentlich für das 18. und 19. Jahrhundert und gern von den Angehörigen technischer Berufe so gehandhabt worden. Diese wiesen meist mit einem trotzigen Unterton auf heroische Pioniere hin, weil die Beiträge dieser Personen zum Wohlergehen der Menschheit nicht genügend gewürdigt würden. Nun kann man die Folgen der Tätigkeit eines George Stephenson, eines Isambard Kingdom Brunel, eines Heinrich von Stephan, eines Thomas Alva Edison oder eines Nikola Tesla in der Tat kaum überschätzen. Ihre Leben und Leistungen sind Gegenstände von Festschriften und Liebhaberkulturen, und die entsprechenden Einträge bei Wikipedia gehören nicht von ungefähr zu den umfangreichsten.
Wenn man den Blick über einzelne Pioniere hinaus weitet, würde vor allem die Herausbildung entsprechender Expertenkulturen als ein qualitativer Sprung erscheinen. Gemeint sind hiermit Militär- und Zivilingenieure, Planer und Verwalter, Bankiers und Unternehmer, Erfinder und Entwickler, Hoch- und Tiefbaufirmen sowie Politiker auf sämtlichen Ebenen ihrer Zuständigkeit. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind Infrastrukturen aber nicht mit den Namen oder den Personen verbunden, die sie entwarfen oder erbauten. Vielmehr sind sie fast immer eher kumulativ entstandene Bauwerke gewesen, an denen sich erstaunliche Prozesse einer synthetisierenden Vernetzung ablesen lassen.
Infrastruktur scheint historisch am besten getroffen zu werden, wenn man sie als Ergebnis von Prozessen der Aushandlung und der kollektiven Kompromisse versteht.[16] Infrastruktur ist daher ein Thema aus der Mitte der Gesellschaft, das alle angeht und zu dem zahlreiche Disziplinen des Wissens etwas zu sagen haben. »Geschichte« kommt in den Diskursen über Infrastruktur aber meist nur insofern vor, als sie verantwortlich gemacht wird für uneinheitliche Strukturen, die eben »gewachsen« statt einheitlich geplant worden seien.
Ansonsten handelt es sich um einen Politikbereich, der sich oft ausdrücklich unhistorisch, ja unpolitisch gibt, weil er für sich beansprucht, keine spezifischen Interessen zu betreffen, sondern der Allgemeinheit und dem Gemeinwohl zu dienen. Dieses zeit- und politikferne Labeling ist ein integraler Bestandteil des Konzepts Infrastruktur.
Um dieses Konzept sichtbar zu machen und zu verzeitlichen, wird in diesem Buch allerdings weniger danach gefragt, wann etwas begann, sondern eher danach, ab wann etwas unzweideutig auf die Gegenwart zulief. Die lange Dauer ist dabei wichtiger als kurzfristige Veränderungen, die Gebrauchsgeschichte der alltäglichen Routinen wichtiger als die Innovations-, Diffusions- und Veränderungsgeschichte und das Unsichtbare oft wichtiger als das Sichtbare.
Definitionskreise
Infrastrukturen wurden mittlerweile mit allen möglichen Definitionen versehen. Modern zu sein bedeute, innerhalb von und durch Infrastrukturen zu leben, so der schon erwähnte Paul Edwards. Sie seien die unbemerkte Basis der Moderne selbst.[1] Andere umschreiben Infrastrukturen als »ein Symbol des kollektiven Wir«.[2] Wieder andere haben Infrastrukturen als die »Materie« des Gesellschaftlichen oder als deren »Funktionsbedingung« definiert.[3] Kulturwissenschaftlich wäre ein solcher »Infrastrukturalismus« auch als Gefüge, Ensemble, Dispositiv, Rhizom oder Konsolidierung zu beschreiben.[4] Man kann es aber auch lakonisch wie ein technischer Experte ausdrücken: »Ohne funktionsfähige Abwasseranlagen (…) ist die moderne Zivilisation nicht mehr denkbar.«[5]
Im Folgenden wird diese Vielfalt etwas geordnet, wenn auch nicht aufgelöst. So ist spätestens seit dem 18. Jahrhundert über Voraussetzungen des Marktes nachgedacht worden, ohne die er nicht funktioniert, die er aber ohne den Staat nicht hervorbringen kann. Dem schon erwähnten Adam Smith folgten weitere Liberale, denen man heute zu Unrecht unterstellt, sie hätten in Wirtschaftsfragen eine jederzeit strikte Enthaltsamkeit des Staates gefordert.[6] Viele forderten durchaus staatliches Engagement, das sich aber auf Arbeiten zur Behebung akuter Notfälle beschränken sollte. Zugleich mussten sie jedoch einräumen, dass es in der Ökonomie Bereiche gibt, in denen das System von Angebot und Nachfrage nicht greift.
Daher wurden die travaux publics, wie der Franzose Jules Dupuit sie 1844 nannte, seither als konstitutiver Bestandteil staatlicher Politik verstanden.[7] In den angelsächsischen Ländern sprach man von public works, im deutschen Sprachraum eher von »öffentlichen Arbeiten«. Um sie zu koordinieren und zu überwachen wurden im 19. Jahrhundert entsprechende Ministerien gebildet. Sie widmeten sich vornehmlich dem Aufbau der nationalen Verkehrs- und Kommunikationsnetze.
Seit der Mitte desselben Jahrhunderts beschäftigten sich außerdem Raum- und Verkehrswissenschaften mit der Verteilung von Waren, Menschen und Ideen im Raum. Die hieraus entwickelten Theorien zu Standorten sind bis heute Angelpunkte der staatlichen, mehr noch der kommunalen Infrastrukturpolitik geblieben. Sie wollen soziale Entwicklungen in Gang setzen und wirtschaftliches Wachstum fördern. Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein wurde unter Wachstum vornehmlich eine Steigerung der Produktion verstanden. Daher forderten Unternehmen von zuständigen Behörden nicht selten, dass entsprechende Infrastrukturen bereitgestellt werden müssten, damit sie sich im betreffenden Gebiet niederließen.
Als zweites Feld der Infrastrukturpolitik etablierte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert die sogenannte Wohlfahrtsökonomie. Sie schrieb dem Staat und den Kommunen Aufgaben zu, die bislang von Großfamilien oder von sozial engagierten Unternehmern ausgefüllt wurden. Um gut ausgebildete Arbeiter möglichst eng an sich zu binden, schufen viele der expandierenden Unternehmen der Montanindustrie wie Krupp, Thyssen oder Cockerill Einrichtungen der sozialen Fürsorge und bauten komfortable Wohnanlagen für Werksangehörige. Viele dieser Vorkehrungen und Vorsorgen wurden später durch Versicherungen und den »Vorsorgestaat« übernommen.[8] Der moderne Nationalstaat schuf gewaltige Rücklagen zur sozialen Sicherung und – in Gestalt von Verkehrs- und Kommunikations-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen – auch ein staatliches »Anlagevermögen«.
In der Zwischenkriegszeit hatte sich mit den public utilities ein neuer Sammelbegriff für diese staatlichen Einrichtungen etabliert. Mit ihnen verknüpfte sich in diesen Jahren die Vorstellung eines big push, man erhoffte sich vom Ausbau der Infrastruktur also eine katalysierende Wirkung für die gesamte Ökonomie.[9] Der estnische Ökonom Ragnar Nurske schrieb 1953, die Wirtschaft gerade der »unterentwickelten« Regionen müsse dazu ermuntert werden, in das Grundgerüst der Infrastrukturen gleichsam hineinzuwachsen.[10]
Seit Anfang der 1960er Jahre werden unter Infrastrukturen im Allgemeinen die Basisfunktionen einer Gesamtwirtschaft verstanden, die notwendig sind für Wachstum, Integration und Versorgung. Der Volkswirt Reimut Jochimsen legte 1966 eine erste »Theorie der Infrastruktur« vor.[11] Auch wenn seither nie geklärt wurde, was eigentlich alles dazugehört, hat sich die Infrastruktur neben der militärischen und sozialen Sicherung längst zum größten Investitions- und Gestaltungsbereich der öffentlichen Hand entwickelt.
Gerade der in Infrastrukturen eingelagerte Reichtum macht das Konzept Infrastruktur für die Politik interessant. Infrastrukturbauten gelten als eine Demonstration der Macht und eines – wie immer definierten – Gemeinwohls. Die europäischen Nationalstaaten nutzten Kanal- und Straßenbauten, die Post und das Nachrichtenwesen aber vor allem als Agenten der gesellschaftlichen Kommunikation und Vereinheitlichung.[12] Erst im Verlauf dieser Nationsbildung wurden bretonische Bauern zu Franzosen oder katalanische Fischer zu Spaniern.[13] Mit Telegrafendrähten und Stromkabeln wurden regionale Flickenteppiche gleichsam zu Nationen verkabelt.[14] Die administrativ und technisch vernetzten Gesellschaften legitimierten sich mit der Behauptung, Wohlstand im Innern schaffen und Gefahren von außen abwehren zu müssen.[15]
Bis heute hat sich über wechselnde Epochen und Systeme hinweg die politische Inszenierung des ersten Spatenstichs, des Durchschneidens farbiger Bänder oder des ersten Knopfdrucks erhalten. Diese Demonstrationen des Vertrauens in die Zukunft, des organisatorischen Funktionierens eines Gemeinwesens und der guten Regierung lassen die eindeutigen Grenzziehungen zwischen den Handlungsräumen der Politik, der Bürokratie und der Zivilgesellschaft verschwinden.[16] »Dies ist kollektive Macht«, so Michael Mann, »Macht durch eine Gesellschaft, die das soziale Leben durch staatliche Infrastrukturen koordiniert.«[17] Diese Infrastrukturmacht sei jedoch auf die Zustimmung der jeweiligen Gesellschaft angewiesen.[18] Der Soziologe Trutz von Trotha hat dies als Organisationsmacht bezeichnet:
»Aber die Produktivität der Organisationsmacht, die Tatsache, dass sie etwas bewirkt und verändert, entwickelt Überzeugungskräfte. Das gilt für die gepflanzten Bäume, die Gebäude, Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen. In ihnen schafft die Organisationsmacht vollendete Tatsachen, deren Endgültigkeit zum Zeichen ihres unbedingten Anspruches wird.«[19]
Vorläufer hierfür mag man in jenen Gesellschaften erkennen, deren Überleben von vornherein auf kollektiven Anstrengungen beruhte. Das trifft besonders auf die Gemeinschaften zu, die sich entweder vor Wasser schützen mussten oder es nutzen wollten, etwa zum Anbau von Getreide oder Reis. Max Weber hat die daraus erwachsenden Strukturen als »wasserbaubürokratischen Beamtenstaat« bezeichnet, der Soziologe Karl August Wittfogel als »hydraulische Gesellschaft«. Ob Infrastrukturen Gesellschafts- und Herrschaftssysteme tatsächlich determiniert haben, wie hierbei suggeriert wird, ist historisch sicher diskutierbar. Vorerst kann festgehalten werden, dass Infrastrukturen nicht nur Macht verleihen, sondern diese auch zu speichern, zu legitimieren oder aber zu kaschieren vermögen.[20]
In den komplexen Gesellschaften der Moderne kann Macht über die Einrichtungen des Verkehrs, der Kommunikation oder der Versorgung aber nicht einfach geradlinig exekutiert werden. Vielmehr sind die steuernden, integrierenden oder ausschließenden Prozesse, die mit Infrastrukturen möglich sind, stets auch gegen diejenigen umkehrbar, die mit ihnen Macht auszuüben versuchen. Das wird im Zusammenhang mit den realsozialistischen Systemen des 20. Jahrhunderts noch von Bedeutung sein. Infrastrukturen, so könnte man es mit den Historikern Jens Ivo Engels und Gerrit Jasper Schenk umschreiben, »ermächtigen«. Aber sie ermächtigen eben nicht nur Politiker, Planer oder Betreiber, sondern auch deren Nutzer.[21] Und sie sind ein Politikfeld, in dem sich indirekte und technokratisch operierende Ansätze tummeln.[22]
Die Stadtforscherin Keller Easterling hat darauf hingewiesen, dass einige der nachhaltigsten Veränderungen der sich globalisierenden Welt heute durch Infrastrukturen bewirkt werden. Denn diese operativen Systeme von Stadträumen entstünden rascher als sie administrativ reguliert werden könnten. Daher müssten sie als eine Macht jenseits der staatlichen, als »Extrastatecraft« bezeichnet werden.[23] Weltweit tätige Beratungsfirmen, multinationale Unternehmen oder die International Organization for Standardization würden »fortgesetzt und energisch darauf zuarbeiten, eine uniform gebaute Umwelt zu erschaffen«.[24]
In nichtwestlichen Gesellschaften trifft Infrastruktur freilich auf grundlegend andere Traditionen des Umgangs mit Macht. Das hat die sogenannte Entwicklungspolitik lernen müssen, die seit vielen Jahrzehnten versucht, das westlich geprägte Konzept, ohne es kulturell oder historisch zu hinterfragen, auf vermeintlich »unterentwickelte« Länder zu übertragen. Klassische Entwicklungsplaner sehen im Aufbau basaler Infrastrukturen nach wie vor eine Art Allheilmittel zur Überwindung von »Rückständigkeit« und »Primitivität«.[25] Geht die Formel nicht auf, sind rasch Erklärungen zur Hand, die entsprechenden Gesellschaften hätten die spezifische »Sprache der Infrastruktur« nicht verstanden.[26]
Weit häufiger dürfte der Fall etwas anders gelagert sein: In Infrastrukturen äußerte sich eine Art moderner Fetisch. Er hat viele Gesellschaften dazu verleitet, sie vor allem deswegen zu errichten, weil ihre vermeintliche Modernität eine besondere Form der Verzauberung mit sich brachte.[27] So wurden etwa in Ländern des Balkans in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Straßen gebaut, ohne dass zugleich der private Besitz von Fahrzeugen gefördert wurde.[28] Die Symbolik eines modernen Verkehrswegs schien schon auszureichen, um eine räumliche und soziale Integration von Landesteilen zu zementieren, die bislang nur lose miteinander verbunden waren.[29]
Entsprechend wurden Infrastrukturen oft als kollektive Programmierung einer Gesellschaft definiert. Schon 1950 beschrieb der Wirtschaftspublizist Ferdinand Fried dies relativ genau:
»Man begibt sich damit in ein ungeheures Netz gegenseitiger vertraglicher Verflechtungen, und man fügt sich damit in eine gewaltige Organisation ein, ohne die das moderne Dasein in Anarchie verfallen würde. (…) Auf diese Weise befindet sich der moderne Mensch in einem magischen Zirkel, aus dem er nicht mehr heraus kann. Alles beeinflusst und übersteigert sich gegenseitig zu einem Furioso der Notwendigkeit, das die Menschen zu immer größeren Zweckgemeinschaften zusammentreibt.«[30]
Soziologen haben die Herausbildung solcher Zweckgemeinschaften sprachlich meist komplexer ausgedrückt, etwa als Prozess der »Strukturierung« (Anthony Giddens) einer Gesellschaft oder als »Megamaschine« (Lewis Mumford).[31] Infrastrukturen codieren in diesem Sinne menschliche Handlungen, den Habitus und das Wissen, sie bilden also die Basis für kulturelle Praktiken, für soziale Organisation, Kommunikation und Information. Darüber hinaus ermöglichen sie deren Kontrolle.[32] Um ein Beispiel anzuführen: Mit der Einführung von Wasseruhren, die mit Münzen betrieben werden, kommt neben dem Wasser auch eine Bürger- und Verbrauchermoral ins Haus. So wird der Nutzer zu einem »kalkulierenden Subjekt« erzogen.[33]
Großtechnische Systeme, wie Infrastrukturen sie darstellen, begründen inzwischen eigene Forschungszweige.[34] So wurde danach gefragt, ob und wie sich politische und gesellschaftliche Entscheidungen in Technologien einschreiben, wie sie bestimmte soziale Effekte auf Dauer stellen. Die Frage »Do artifacts have politics?« sollte aber differenzierter beantwortet werden, als der Technikphilosoph Langdon Winner dies 1980 am Beispiel von New Yorker Brücken tat: Sie seien so niedrig gebaut worden, dass nur die von Weißen gesteuerten Automobile sie hätten passieren können, während die in Bussen reisende farbige Bevölkerung das Nachsehen gehabt habe. Diese Behauptung stellte sich als Mythos heraus.[35]
Für die Infrastruktur hat der spanische Soziologe Manuel Castells den Begriff der »technischen Fließräume« geprägt, gemeint als ein modernes Gewebe aus technischem Raum, fluider Natur und urbaner Kultur. Die Soziologin Elisabeth Heidenreich hält die Gewöhnung an die jederzeitige Verfügbarkeit solcher Fließräume sogar für »eines der einschneidendsten Geschehnisse der Moderne«.[36] Die Natur werde dabei zu einem Konsumgut, zu einer Ware, zu Rohmaterial, zu Treibstoff, kurzum: Sie werde »kommodifiziert«. Infrastrukturen verflüssigten nicht nur den gesellschaftlichen Austausch, sondern auch den Stoffwechsel mit der Natur. Weil sie auf Dauer gebaut sind und komplexe Organisationen erfordern, legten sie Gesellschaften gleichzeitig für lange Zeit fest, sie stellten also »Pfadabhängigkeiten« her.
Anthropologen, Ethnologen und Kulturtheoretiker weisen seit geraumer Zeit darauf hin, dass der Mensch gelernt habe, seine vergleichsweise begrenzten Kräfte technisch zu potenzieren. Werkzeuge und andere Hilfsmittel wirken im Sinne des Soziologen Arnold Gehlen insofern als Prothesen des »Mängelwesens Mensch«. Sie verstärken die Reichweite der Organe und dienen der Bequemlichkeit, der Kontrolle wie der Horizonterweiterung. Der Philosoph Hans Blumenberg argumentierte hingegen, der technische Fortschritt ziele eher auf Zeitgewinn und damit eine relative, gleichsam »gefühlte« Verlängerung des Lebens ab.[37] Der Soziologe Wolfgang Eßbach betont hingegen eher die zunehmende Abhängigkeit des modernen Menschen von der »zweiten Natur«, mit der er in einer »bioartifiziellen Symbiose« lebt.[38]
Seit Georg Simmels Analysen des Großstadtlebens aus dem frühen 20. Jahrhundert wurden auch die Folgen der spezifischen Reizüberflutung thematisiert, die mit der zweiten Natur und ihren zahlreichen Impulsen einhergeht. Man musste lernen zu filtern, um nicht irre daran zu werden oder der Nervosität – um die Wende ins 20. Jahrhundert geradezu eine »Modekrankheit« – anheimzufallen.[39] Die subjektiv empfundene »Vernichtung von Raum und Zeit«, von welcher der Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch in Bezug auf die Eisenbahn sprach, wurde zu einem Dauerthema der kulturellen Diagnose der Moderne. Gerade die Postmoderne zeichne sich, so wird oft postuliert, durch eine vermeintlich ständige Beschleunigung, wenn nicht sogar ein »Tempo-Virus« aus.[40] Solche Beschreibungen nehmen meist Bezug auf Innovationen im Bereich der Kommunikation und auf Verdichtungen des Verkehrs.
Wie aber schaffen es Millionen Menschen, sich den Herausforderungen des Straßenverkehrs oder der alltäglichen Logistik zu stellen? Wie gehen sie mit der ungeheuren Informationsfülle um, die sie heute umgibt? Weniger die Planung von großtechnischen Netzwerken sei erklärungsbedürftig, so die Soziologin Susan Leigh Star, sondern vielmehr das fortgesetzte Basteln an diesen Einrichtungen und das Zuschneiden für den Alltagsgebrauch. Es sei geradezu paradox zu beobachten, wie oft Nutzer die bekannte und routinierte Nutzung einer Infrastruktur auch solchen Alternativen vorziehen würden, die sich als funktioneller oder kostengünstiger erwiesen.[41] Solche Befunde belegen immer wieder, wie stark Infrastrukturen und die sich darum kristallisierenden Praktiken den menschlichen Alltag stabilisieren.
Von der Beobachtung ausgehend, dass Infrastrukturen »disponieren«, haben auch die Medienwissenschaften nach den Ursprüngen der heutigen Netzwerkgesellschaft gefragt.[42] Dabei wurde die Fortentwicklung moderner Medien oft auf militärische Impulse zurückgeführt. Kanonen, Artillerie, Funktechnik, Fliegerei, Satelliten, Teletechnologien oder das Internet seien Pioniere bei der Durchsetzung der dynamisierten Räume der Moderne gewesen.[43] Sie besäßen grenzsprengende und grenzauflösende Wirkungen. Aber auch an den zivilen Orten des Verkehrs und ihren »Zirkulationskulturen« äußere sich ein zu früheren Zeiten und Gesellschaften oft deutlich abweichendes Sozialverhalten.[44]
Die Analyse des Fremden und des Anderen, der ethnologische Blick, wurde daher zunehmend auf die industrialisierten und mit Infrastrukturen ausgestatteten Gesellschaften zurückgeworfen. Ob er sich nicht »die Reise sparen und gleich mit dem oft befremdlichen Nebeneinander der Kulturen in London, Paris oder Los Angeles beschäftigen« könne, wurde 1996 der Ethnologe Marc Augé gefragt.[45] Wenn soziale Beziehungen tatsächlich immer stärker technisch vermittelt sind, muss auch eine »infrastrukturelle Gewalt« analysiert werden. Sie kann etwa durch Ausschlüsse von den soziotechnischen Netzwerken oder deren ungerechte Verteilung ausgeübt werden.[46]
Aufschlussreich anders scheinen Infrastrukturen vor allem in den boomenden Megacities des Globalen Südens zu sein. Denn Orte wie Lagos oder die ostasiatischen Megastädte, so die Architekturhistorikerin Swati Chattopadhyay, existierten jenseits aller Stadtplanung und seien eigentlich nicht mehr definierbar. Da Infrastruktur in ihren wesentlichen Eigenschaften – Verbinden, Teilen und Transportieren – ein westlich geprägtes Konzept sei, müsse es an solchen Orten neu gedacht werden. Denn die Subalternen eigneten es sich ebenso kreativ wie eigensinnig an.[47]
Nicht mehr das zuverlässige Vorhandensein, sondern gerade die Unvorhersehbarkeit von Flüssen und Anschlüssen bestimmt in solchen Umfeldern das Alltagsleben.[48] Für die entwurzelten und äußerst mobilen Menschen, die in »Infracities« – etwa den fragmentarisch ausgebauten Townships in Johannesburg oder Kapstadt – leben, stellen flexibel aktivierbare Sozialkontakte die eigentlichen Infrastrukturen dar.[49] So schließt sich der Kreis: In den übernutzten und nur durch Notbehelfe in Gang gehaltenen Lebensräumen sind es doch wieder die Menschen und nicht die großtechnischen Systeme, die das Überleben sichern.[50]
Insgesamt sind Infrastrukturen in den vergangenen Jahren von immer mehr Wissenschaften als dankbare Untersuchungsobjekte entdeckt worden. Denn sie verknüpfen die unterschiedlichsten Ebenen der Gesellschaft miteinander. Sie sind materielle Niederschläge sozialer und politischer Aushandlungen. Sie strukturieren Gesellschaften und formen Individuen. Indem ich auf solche Ansätze zurückgreife, wie sie hier einleitend skizziert wurden, werde ich die Vielgestaltigkeit dieser oft anonym bleibenden Geschichte im Folgenden so plastisch wie möglich darzustellen versuchen. Dabei werde ich zeigen, wie stark Infrastrukturen einerseits für stabilisierende Kontinuitäten stehen, für neue Möglichkeiten und Chancen, andererseits für Brüche, Gefährdungen und neue Belastungen. Infrastrukturen spiegeln alltägliche, soziale und kulturelle Prozesse. Insofern sind sie – ob sichtbar oder unsichtbar – zu einem der prägendsten Aspekte unseres Lebens geworden.[51]
IDie klassische Ära der Infrastrukturen
1Öffentliche Arbeiten: Das 19. Jahrhundert
Kanalisierung
In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs entdeckte der britische Fantasy-Autor Robert Fordyce Aickman eine Erzählung seines Kollegen Lionel T.C. Rolt. In »Narrow Boat« hatte dieser eine stimmungsvolle Bootsreise beschrieben, die er 1939 mit seiner Verlobten auf den idyllischen Wasserwegen Mittelenglands unternommen hatte. Das Kanalsystem war zu dieser Zeit nahezu funktionslos und fast schon wieder selbst zur Natur geworden. Aickman entwickelte aus seiner Lektüre eine bestechende Idee: Er schlug Rolt vor, die annähernd 7000 Kilometer schiffbarer Gewässer als das Gegenteil dessen wiederzubeleben, wofür sie einst gebaut worden waren.
Am 15. Februar 1946 gründeten beide Schriftsteller die Inland Waterways Association. Die sah fortan ihre Aufgabe darin, die weithin verwaisten künstlichen Wasserwege in England für den Tourismus zu erschließen. Hierfür verfasste Aickman einen Reiseführer, der mehrfach neu aufgelegt wurde: »Know Your Waterways«.[1] Das Beispiel machte Schule. Bis heute gehört die englische oder irische Bootsreise zu den Urlaubshighlights der Britischen Inseln. Denn sie stellt tatsächlich eine der gemütlichsten Möglichkeiten dar, sich vom Getriebe der industriellen Moderne zurückzuziehen. Nur wenigen Urlaubern ist dabei bewusst, dass diese Wasserstraßen einmal den Beginn einer Epoche der Industrie- und Infrastrukturgeschichte eingeleitet haben.
Die Wurzeln der britischen Kanäle reichen bis zu den Römern zurück. Während ihrer Besatzung Britanniens hatten diese ab 43 n. Chr. erste strategisch nützliche Grabungen vorgenommen. Auch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit entstanden solche künstlichen Verbindungswege zwischen Flüssen und Seen. Sehr viel mehr noch waren geplant, wegen des immensen Aufwands aber nicht realisiert worden. Später verfolgten absolutistische Herrscher und frühneuzeitliche Projektemacher in ganz Europa den ausdrücklichen Anspruch, die Natur zu verbessern und menschliche Ordnungsmacht durch idealisierte Stadt- und Gartenanlagen zu dokumentieren. Im Zentrum stand dabei die Beherrschung des Wassers und seiner Kräfte.[2]
Besonderes Aufsehen erregte der 1681 unter Ludwig XIV. fertiggestellte Bau des Canal du Midi, der als Canal de Deux Mers fortgeführt wurde. Seine Entstehungsgeschichte sollte später niemand anderes als Lionel T.C. Rolt in einem Buch beschreiben.[3] Der Mehrwert des Kanals bemaß sich weniger nach seiner Wirtschaftlichkeit. Er bestand vielmehr darin, dass der Herrscher damit seine Macht demonstrierte und den Raum seines Imperiums markierte.[4] Will man für England ein ähnlich symbolhaftes Datum fixieren, dürfte sich das Jahr 1761 anbieten. Damals wurde ein Kanal eröffnet, mit dem Francis Egerton, der dritte Duke von Bridgewater, fortan Kohle aus seinen Minen in Worsley bis nach Manchester transportieren ließ, wo sie dann in der entstehenden Montanindustrie verfeuert wurden. Damit war einer der ersten künstlichen Wege geschaffen, die sich an den Erfordernissen der ersten industriellen Revolution orientierten, die in England gerade einsetzte.
Dem Bridgewater-Kanal folgten rasch weitere Kanäle, so dass in Mittelengland nach und nach ein weitverzweigtes Netz an schiffbaren Wasserwegen entstand. Sie wurden zur Voraussetzung einer billigen und zuverlässigen Zirkulation von Rohstoffen, vor allem von Kohle, aber auch von Lebensmitteln und anderen Gütern des industriellen und täglichen Bedarfs. Den Antrieb übernahmen vorerst noch Pferde, welche die schmalen Schiffe auf Treidelpfaden relativ gemächlich hinter sich herzogen. Trotz dieses noch biogenen Tempos trugen die Kanäle schon wesentlich dazu bei, vorhandene Unterschiede zwischen rohstoffreichen und lebensmittelreichen Regionen auszugleichen. Dies war dann eines der Hauptargumente, das die Wirtschaftsexperten – Kameralisten und Merkantilisten –, aber auch Politiker für den Bau solcher Kanäle anführten.[5]
Damit wurde ein zunächst kaum merklicher, letztlich aber welthistorisch bedeutsamer Schritt vollzogen. Denn nun konnten Energieträger wie die Kohle überall dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht wurden. Das mineralisch und fossil geprägte Zeitalter war angebrochen, und es verdrängte allmählich die Epochen der organisch begrenzten Energien wie etwa Holz. Erst hierdurch wurde der Gedanke des fortgesetzten Wachstums möglich.[6]
Ebenfalls im 18. Jahrhundert begannen die schon erwähnten Fachleute für die wirtschaftliche Wohlfahrt eines Landes damit, sich den politisch Verantwortlichen als Berater anzudienen. Sie forcierten den Ausbau von Kanälen und anderen Einrichtungen, die sehr viel später erst als Infrastruktur bezeichnet wurden. Dadurch empfahlen sich diese Experten zugleich für eine Steuerung der gesamten Gesellschaft.[7] Denn ein Ausgleich zwischen Überfluss und Mangel war wiederum die Voraussetzung dafür, dass sich Rohstoffproduzenten, verarbeitendes Gewerbe, spezialisierte Arbeitskräfte und urbane sowie industrielle Zentren räumlich und gesellschaftlich weiter ausdifferenzierten. So konnten auch entlegene Gebiete eines Landes »in Wert« gesetzt werden, und der produktiven Marktwirtschaft wurden neue Ebenen eingezogen. Hieraus entstand nach und nach so etwas wie eine nationale Ökonomie, während sich gleichzeitig bereits die Umrisse eines »Infrastrukturstaates« abzeichneten, der – nicht ohne auf Widerstände zu stoßen – seine Macht durch Kanal-, Straßen- oder andere Kunstbauten definierte.[8]
Zwar kam der Bridgewater-Kanal noch ohne Schleusen aus, doch musste er mit Wasserbrücken über kreuzende Flüsse hinweggeleitet werden. Damit wies er ein weiteres Charakteristikum moderner Infrastrukturen auf, nämlich die Ambition, sich von landschaftlichen Vorgaben so unabhängig wie möglich zu machen. Dieses Ziel scheiterte zwar immer wieder an landschaftlichen Bedingungen, an wirtschaftlichen und strategischen Erwägungen oder an Fragen des Eigentums von Land. Doch die Wege- und Tiefbau-Ingenieure hielten am Ziel einer möglichst idealen, weil effizienten Linienführung fest. Vor allem in zentralistischen Staaten kamen außerdem politische Vorgaben hinzu. Sie führten etwa in Frankreich und in Spanien dazu, die Verkehrslinien sternförmig auf die jeweilige Hauptstadt auszurichten, statt das Land zum Vorteil der jeweiligen Provinzen gleichmäßig zu vernetzen.[9]
Das Zeitalter der Kanäle erreichte in England gegen Ende des 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. Die Wasserwege entstanden meist in privater Initiative, auch um den Wert des anliegenden Grunds und Bodens zu steigern. Mitte des 19. Jahrhunderts waren dann schon annähernd 25000 Binnenlastkähne unterwegs.[10] Geschlossene Kanalsysteme für den Transport und zur Regulierung des Wassers entstanden auch in anderen Ländern, etwa den Niederlanden. Hier bildete sich sehr früh ein spezialisiertes Ingenieurskorps heraus – schon weil man dem in dieser Region stets übergriffigen Meer Einhalt gebieten musste.[11] Auch außerhalb Europas hatten solche spezialisierten Kenntnisse eine lange Tradition, namentlich in Mittelamerika, im Vorderen Orient, in Indien und in China, wo die Gesellschaften jeweils stark vom Wasserbau geprägt waren. Es war daher auch kein Zufall, dass eines der ersten Ministerien für öffentliche Arbeiten schon im frühen 19. Jahrhundert das ägyptische war. Es führte vor allem die hydraulischen Vorhaben fort, die seit dem Alten Reich das Land tief geprägt hatten.
Doch wurde das Wasser in den küstennahen Ländern der Deiche und Kanäle als Gefahr wie auch als Möglichkeit erfahren, eine Ambivalenz, die sich auch anderswo in Europa fand. Die Zeit des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts war von der Suche nach neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten geprägt, aber ebenso vom Bemühen um Schutz vor Gefährdungen, die man nicht mehr so passiv hinnahm wie zuvor.[12] Flüsse bildeten schon lange wesentliche Transport- und Versorgungslinien, und vornehmlich auf diesen Zweck richteten sich die Bemühungen um deren menschengerechte Gestaltung. Johann Gottfried Tulla, Carl Friedrich von Wiebeking und andere berühmt gewordene Hydrotechniker dieser Zeit verstanden die Eingriffe in den Rhein oder die Donau als »Korrektion« einer bedürftigen Landschaft. Für sie war dies eine Aufgabe, die Gott dem Menschen bewusst gestellt hatte.[13]
Ein zuvor als wild und unbezähmbar geltender Strom wie der Rhein wurde durch Wehrbauten und Schleusen zu einem kanalisierten Wasserweg umgestaltet, der industriellen, kommerziellen und urbanen Interessen diente. So verlor er bis 1975 neun Zehntel seines Überschwemmungsgebiets. Er wurde insgesamt um 105 Kilometer verkürzt und zugleich auf eine einheitliche Breite festgelegt.[14] Die entlang seinen Ufern errichteten Siedlungen und Infrastrukturen wurden mit einer verlässlichen Regelmäßigkeit ausgestaltet und bildeten mit dem Rhein eine räumliche Einheit. Gab es dennoch Überschwemmungen, wurden sie als Rückkehr einer nun als feindlich empfundenen Natur gewertet, auch weil die Folgen für die Anwohner des Flusses oft umso schwerwiegender waren.[15] Neben diesen ernüchternden Tendenzen im Umgang mit der Natur gab es zugleich aber Prozesse, die der Natur neuen Zauber verliehen: Erst im 19. Jahrhundert und als Reaktion auf die menschlichen Eingriffe entstand so etwas wie eine spezifische »Rheinromantik«. In ihr drückte sich weiterhin die Ehrfurcht aus, die der Mensch vor Natur und Landschaft empfand. Doch sie wandelte sich zu einer ebenfalls gezähmten und touristisch konsumierbaren Emotion.[16]
Das Management von Wasserstraßen ist bis heute eine staatliche Daueraufgabe, die schon früh internationaler Absprachen bedurfte. Daher wurde 1831 eine Zentralkommission für die Rheinschifffahrt gegründet.[17] Denn für die Schweiz, Frankreich, Deutschland und die Niederlande war der Strom gleichermaßen bedeutsam. Damit bestand die Gefahr, dass er politisch, strategisch, nationalkulturell oder wirtschaftlich von einem der Anrainerstaaten dominiert und vereinnahmt wurde. Um kaum einen Fluss ist in den vergangenen zwei Jahrhunderten politisch und kulturell so viel gerungen worden.[18]
Viele Flüsse in Mitteleuropa überschritten politische Grenzen. Aus diesem Grund und wegen denkbarer Abkürzungen wurde immer wieder nach schiffbaren Alternativen gesucht. So wie der Canal de Deux Mers den Franzosen die lange Route um die iberische Halbinsel herum ersparen sollte, erwogen etwa die Schweizer lange Zeit den Plan eines Transhelvetischen Kanals, um sich selbst und anderen Ländern eine Durchfahrt zum Mittelmeer zu ermöglichen.[19] Mit einer Verbindung zwischen Donau, Oder und Elbe wollte sich auch die Tschechoslowakei an die europäischen Küsten anschließen.[20] Die Belgier verhandelten mit den Deutschen viele Jahrzehnte vergeblich über den Plan eines Rhein-Maas-Schelde-Kanals.[21] Mit großem Erfolg verwirklicht wurde 1895 der Kaiser-Wilhelm-Kanal, der seit 1948 Nord-Ostsee-Kanal heißt. Durch eine Verkürzung des Weges zwischen Nord- und Ostsee um ganze 700 Kilometer ersparte er nicht nur Zeit. Er brachte Dänemark zugleich um wertvolle Gebühren und Zolleinnahmen.[22] Noch erfolgreicher waren der 1869 eröffnete und bald von den Briten vereinnahmte Suezkanal sowie der von den USA errichtete Panamakanal. Dessen Eröffnung am 3. August 1914 wurde jedoch vom parallel ausbrechenden Ersten Weltkrieg überschattet.[23]
Diesen Beispielen könnten zahllose weitere Kanäle in aller Welt hinzugefügt werden. Sie erleichterten und beschleunigten nicht nur die Schifffahrt auf Binnengewässern, sondern auch auf dem Meer. Die Seeschifffahrt wird in ihrer Bedeutung für die Zirkulation von Gütern, gerade in der Gegenwart, oft unterschätzt. Zur Infrastruktur wurde sie jedoch nicht durch die immensen technischen Fortschritte in der Navigation oder beim Antrieb mit Dampfkraft. Vielmehr wurde der Seeverkehr instrumentell in die Frühform dessen einbezogen, was heute als globale Logistik firmiert. Die von Europa ausgehenden Entdeckungen, Erforschungen und Erschließungen waren bis ins 19. Jahrhundert hinein von wenigen seefahrenden Ländern getragen worden, von denen mal das eine, mal das andere dominierte. Diese Erkundungen waren weitgehend eine Angelegenheit einzelner Herrscher oder privater Gesellschaften wie der britischen oder niederländischen Ostindien-Kompanien gewesen. Sie hatten zu unermesslichem Reichtum geführt und einzelnen Regionen, mehr noch einzelnen Personen, Familien oder Gesellschaften großen Wohlstand eingebracht.
Alle diese Aktivitäten wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts in die Politik der jungen Nationalstaaten einbezogen. Erst jetzt wurde der Austausch von Rohstoffen und anderen Waren, der bislang weitgehend auf Luxusgüter beschränkt gewesen war, zu einem essentiellen Bestandteil der europäischen Wirtschaft. Entsprechend sensibel reagierten Regierungen und Militärs auf die Möglichkeit eines seegestützten Wirtschaftskrieges, wie er zwischen 1806 und 1811 vom napoleonisch dominierten Kontinent gegenüber England geführt worden war. Der Aufbau von Handelsflotten ging daher meist mit der von Kriegsflotten einher. Die Anlage von Häfen und Stationen wurde nicht mehr nur mit dem Ziel geplant, Frachtkosten zu senken, sondern folgte zunehmend auch strategischen Überlegungen.[24]
Parallel zum Verkehr auf dem Wasser entwickelte sich auf allen Kontinenten auch der Verkehr im Landesinneren. Auf den Höhepunkt der canal mania im ausgehenden 18. Jahrhundert folgte ab den 1830er Jahren die railway mania. Zunächst als Zubringer zu den Kanälen genutzt, verdrängte in England das flexiblere Streckennetz der Eisenbahnen die Kanalschifffahrt Schritt für Schritt. Meist übernahmen die Eisenbahnunternehmen die Kanäle, ließen sie aber nicht selten verkommen. So wurden die britischen Wasserstraßen zur ersten modernen Infrastruktur, die nach kurzer Blüte schon wieder verfiel – bis sie wie beschrieben nach 1945 eine neue Bestimmung fand.
Ein zweites Leben war auch der London Bridge beschieden, die seit 1831 die Themse überspannt hatte. In den 1960er Jahren hatte sich gezeigt, dass sie der Last des täglichen Autoverkehrs nicht mehr gewachsen war. Man ersetzte sie durch eine neue sechsspurige Brücke mit beheizbaren Bürgersteigen. Der amerikanische Industrielle Robert McGulloch, der sein Geld mit Kettensägen und Außenbordmotoren für Boote verdient hatte, kaufte die alte Brücke kurzerhand auf. Anschließend ließ er sie durch den Panamakanal in die USA transportieren und am Lake Havasu in Arizona wieder aufbauen. 1971 wurde sie im Beisein des Londoner Bürgermeisters erneut eingeweiht. Seither ist sie ein Tourismusmagnet.[25]
Westward Ho!
Als William Clark am 11. Mai 1880 in Begleitung eines U.S.-Marshalls im kalifornischen Distrikt Mussle Slough auftauchte, kam es zum Showdown. Der Vertreter der Southern Pacific Railroad sollte widerspenstige Siedler von Land vertreiben, das nominell der Eisenbahngesellschaft gehörte. Neben den Räumungsbeschlüssen trugen beide vorsichtshalber ein paar Waffen bei sich. Tatsächlich wurde schon der erste Farmer, der aufgesucht wurde, von Vertretern der Settlers Land League unterstützt, die diese Vertreibungen verhindern wollte. Als beide Parteien aufeinandertrafen, entbrannten Wortgefechte, die rasch in eine Schießerei eskalierten. Am Ende lagen sieben Männer tot am Boden, ein weiterer war schwer verletzt.
Worum ging es? Die private Bahngesellschaft hatte wie üblich von der amerikanischen Regierung entlang ihrer Strecken Landkonzessionen erworben. Mit den daraus gezogenen Gewinnen sollten die Investitionen in den Bahnbau abgesichert werden. Das damals noch karge Gebiet im San Joaquin Valley wurde 1870 an Siedler verpachtet. Vereinbart war, dass sie es im Falle einer erfolgreichen Urbarmachung zehn Jahre später von der Gesellschaft für zweieinhalb Dollar pro Morgen übernehmen könnten. Mittlerweile war der Bodenwert des infrastrukturell erschlossenen Landes im Herzen Kaliforniens aber deutlich angestiegen.[26] Die Bahngesellschaft verlangte daher nicht weniger als das Zehnfache des ursprünglich ausgemachten Preises. Die Siedler, die jahrelang entwässert und angebaut sowie Straßen und Häuser errichtet hatten, fühlten sich hinters Licht geführt und organisierten in der Land League ihren Widerstand. Sie appellierten an die lokale Öffentlichkeit und drohten sogar mit Blutvergießen, sollte die Gesellschaft an ihren Forderungen festhalten. So war es schließlich auch gekommen.
Die Tragödie von Mussle Slough ist einer von unzähligen Konflikten, die mit dem Ausbau der Infrastrukturen im 19. und 20. Jahrhundert einhergingen. In diesem Fall waren die Koalition von Gewinnkalkülen des Staates und der privaten Bahngesellschaft auf der einen, die Interessen der lokalen Anwohner auf der anderen Seite frontal aufeinandergeprallt. Solche Gewalt war zwar eher die Ausnahme. Dennoch zeigt der Vorfall, dass die Errichtung von Infrastrukturen keineswegs eine ruhige Abfolge von technischen oder Verwaltungsakten war.
Die Erschließung des amerikanischen Westens ist nachträglich oft heroisch verklärt worden. Tatsächlich erfolgte sie aus allen Richtungen ins Innere des Landes und war von zahlreichen Auseinandersetzungen begleitet. Die ergaben sich nicht nur dort, wo die Eisenbahn die Lebensräume von Indianern durchschnitt und zusammen mit den begleitenden Telegrafenlinien zur Absicht beitrug, die indigene Bevölkerung zu »zivilisieren«. Die populäre Kultur der USA ist voll von mythisch überhöhten Geschichten solcher Erschließungskonflikte. Sie handeln von Entdeckern und Erforschern, von Straßenbaupionieren und Eisenbahnarbeitern, von den Reitern des legendären Pony Express, den Erfindern des Telefons und des Flugzeugs, des Fernsehens und des Internets. Ob das nun tatsächlich alles in den USA entstanden ist oder nicht: Die Prominenz dieser Infrastrukturen in der Geschichte des Landes zeigt, dass sich die amerikanische Gesellschaft über lange Zeit hinweg ausdrücklich über die technische Erschließung des Raums definierte. Bisweilen sah sie darin sogar ihre »offensichtliche Bestimmung«.
Der aus Berlin in die USA eingewanderte Maler John Gast hatte diesen »American Progress« im Jahr 1872 auf ein Gemälde gebannt, das ursprünglich Westward Ho/Manifest Destiny hieß: Den ins Dunkel der Geschichte vertriebenen Tieren und Indianern folgen darauf die hell ausgeleuchteten Siedler, die Postkutschen, Eisenbahnen und Schiffe auf dem Fuß. Darüber schwebt – die Heilige Schrift und eine Rolle Telegrafenkabel in der Hand – die Göttin des Fortschritts.
John Gasts Gemälde Westward Ho von 1872: Der von Infrastrukturen begleitete Fortschritt bringt Licht ins Dunkel der vermeintlich rückständigen »Ureinwohner«.
Unzählige Balladen, Romane, später vor allem auch Filme, verklären diese Eroberung des Westens zum Mythos. Dennoch war das Vorrücken der Erschließungsgrenzen stets von kritischen Stimmen begleitet. Auch der Vorfall in Mussle Slough wurde 1901 durch den progressiven Journalisten Frank Norris aufgegriffen. Er gestaltete seinen Bericht darüber als kritisches Porträt der Gier und Übermacht der großen amerikanischen Eisenbahngesellschaften sowie einer korrupten Politik. Dabei verglich er die Machenschaften an der amerikanischen frontier mit einem Riesenkraken, einer damals beliebten Verbildlichung von großen industriellen Trusts.[27] Zu den amerikanischen Unternehmern, unter denen die Harrimans und die Vanderbilts die bekanntesten waren, gab es mit Bethel Henry Strousberg oder Baron Maurice de Hirsch auch europäische Entsprechungen. Diese »Eisenbahnkönige« sahen sich ständigen Skandalisierungen ausgesetzt, die sich auf ihre überragende Macht und ihren enormen Reichtum richteten.[28]





























