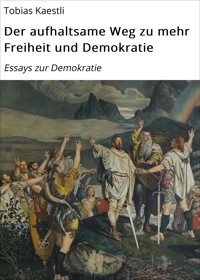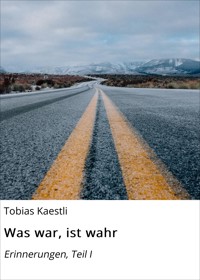4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nach dem Fall der Berliner Mauer fuhr der Autor mit dem Velo zwischen West- und Ostberlin hin und her. Für einen Schweizer, der einst in dieser Stadt studierte und die Teilung Berlins als Absurdität erlebte, war diese Fahrt eine befreiende Aktion. Grosse Hoffnungen auf eine friedliche, demokratische Welt wurden wach. Was seither geschah, war oft alles andere als friedlich. Doch es eröffneten sich Möglichkeiten, sich für Demokratie, Menschenrechte und für das Völkerrecht zu engagieren. Von diesem Engagement als Staatbürger und als Publizist erzählen diese Memoiren. Sie sind die Fortsetzung eines ersten Teils, der im Juni 2020 unter dem Titel "Was war, ist wahr" erschien und der hauptsächlich von den politischen und lebensweltlichen Erfahrungen im Rahmen der 68er Bewegung handelte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tobias Kaestli
Alles ist Geschichte
Erinnerungen, Teil II
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einführung
Velofahren in Berlin
Beten für den Frieden
Der gefrässige Magen
Was ist Sozialismus?
4. Der Künstler und der Bundesrat
5. Blocher und der EWR
6. Jugoslawen, Kosovaren und Bosniaken
7. Wahnvorstellungen
8. Heirat und Verschwinden des Vaters
9. Freundschaften
10. Ach Europa!
11. Eine Republik in Europa
12. Die Schweiz neu denken
13. Die Schweiz in guter Verfassung?
14. Wohnen und Leben zu zweit
15. Polen 1998
16. Die Paläste der Textilbarone
17. Ursula Koch und die Grundwerte
18. Blocher, die SP und der Faschismus
19. Liberalismus versus Totalitarismus
20. Nach der Jahrtausendwende
21. Simonetta Sommaruga und das Gurten-Manifest
22. Wie weiter?
23. Das Erbe der «Urschweiz»
24. Popen und Mönche im Balkan
25. Frauen in Kosova
26. Der völkerrechtliche Sündenfall
27. Demokratie und Menschenrechte
28. Krieg und Terror ohne Ende
29. Religion und Sinn des Lebens
30. Tod der Mütter und Geburt der Enkelkinder
31. Das Projekt einer neuen Bieler Geschichte
32. Der Dorfmeister von Bözingen
33. Wohnen, Arbeit und Familienleben
34. Schreiben in der Zeit von Corona
35. Selber Bücher machen
36. Putin und die Ukraine
37. Kants ewiger Frieden und die Menschenrechte
Dank
Impressum neobooks
Einführung
Seit ich mich in den 1980er Jahren mit der damals modischen «Oral History» auseinandersetzte, weiss ich: Erinnerungen sind trügerisch. Erzählungen von Zeitzeugen sind zwar oft interessant, aber sie sind für den Historiker eine unsichere Quelle und müssen auf jeden Fall überprüft werden. Das gilt auch für meine eigenen Erinnerungen. Als ich vor ein paar Jahren meine Geschichte als Jugendlicher, Student, junger Historiker und Journalist zu erzählen versuchte, merkte ich, als ich die ersten Entwürfe anhand meiner Tagebücher und anderer schriftlicher Unterlagen überprüfte, wie sehr mich meine Erinnerungen täuschten. Ich korrigierte und ergänzte, und daraus entstand das Buch «Was war, ist wahr». In ähnlicher Weise gehe ich hier im zweiten Teil meiner Memoiren vor. Es ist ein langer, spannender Prozess, der mir hilft, mich meiner selbst zu vergewissern.
Viele Menschen führen Tagebücher, aber längst nicht alle. Notwendig ist es nicht, denn es gibt andere Methoden der Selbstvergewisserung. Dürrenmatt schreibt in seinen «Stoffen», er habe nie Tagebuch geführt, weil er das, was ihn gedanklich beschäftigte, nicht fixieren wollte. Seine Einsichten formte er immer wieder fantasievoll um. Er demonstriert in seinem Alterswerk, wie im fortlaufenden Nachdenken über Erlebtes und früher Gedachtes Neues entsteht. Nicht vergangene Ereignisse schriftlich «festhalten», sondern kreativ bleiben! Dürrenmatts «Stoffe» regen dazu an, etwas Ähnliches zu versuchen. Aber so, wie er es tut, kann es nur einem grossen Dichter gelingen.
Für mich sind die Tagebücher ein nützliches Instrument. Meine täglichen Notizen genügen dem praktischen Bedürfnis, ab und zu etwas, was in der Vergangenheit geschah, nachzuprüfen, zum Beispiel, wann meine Enkelkinder zur Welt gekommen sind oder wann ich mit meinen Wanderfreunden vom Stockhorn zum Gantrisch gewandert bin. Im ausführlicheren Tagebuch, das ich als Datei auf meinem Laptop führe, geht es eher darum, aus dem, was ich erlebe und erfahre, herauszufiltern, was mir wichtig scheint, mir das Wesentliche bewusst zu machen, es zu reflektieren.
Ich weiss, dass alles, was ich schriftlich festhalte, nicht identisch ist mit dem, was ich erlebt habe, was wirklich geschehen ist und was ich mir dabei gedacht habe. Es ist immer ein Rückblick auf etwas Vergangenes. Die schriftlich festgehaltenen Erinnerungen an reale Ereignisse wecken beim Wiederlesen eine erneuerte Erinnerung, die nicht deckungsgleich ist mit der ursprünglichen. Deshalb bewirkt das autobiografische Schreiben nicht unbedingt eine Fixierung oder Versteinerung vergangener Erlebnisse und Vorstellungen, sondern kann als Prozess des Nachdenkens aufgefasst werden. Eine doppelte Dialektik wird angestossen. Erstens ist es die Dialektik zwischen dem Jetzt des Notierens und dem vergangenen Jetzt der beschriebenen Ereignisse, und zweitens ist es die Dialektik zwischen dem jetzigen Jetzt des Wiederlesens der Notizen und dem vergangenen Jetzt des Notierens. Es ist ein hermeneutischer Prozess, der mein Bewusstsein stärkt und nicht nur meinem individuellen Leben Sinn verleiht, sondern dem menschlichen Leben insgesamt. Denn immer wieder fühle ich mich gedrängt, mir klarzumachen, was zu einer bestimmten Zeit in der Welt geschah, welche politischen Ereignisse in den Medien kolportiert wurden. Im Tagebuch bin ich oft darauf eingegangen. Jetzt, da ich mir alles noch einmal vergegenwärtige, ergänze ich, was mir besonders wichtig scheint. So werden die Erinnerungen auch zu einer subjektiv gefärbten Zeitgeschichte.
Als Student in den 1960er Jahren identifizierte ich mich mit einer sich radikalisierenden Studentenbewegung. Spätestens im Frühjahr 1967 stand mein Entschluss fest, mich gegen Gewalt und Unterdrückung zu engagieren und für Gerechtigkeit, Frieden und das Recht auf Glück einzustehen. Mein politisches Ich überholte mein privates Ich. Mein Glaube war gross, das Wissen aber klein. Daraus entstand nicht nur Gutes. In den Jahrzehnten seither habe ich Erfahrungen gesammelt, Einsichten gewonnen und dabei gelernt, dass der Bereich des Nichtwissens um ein Vielfaches grösser ist als der eines stets prekären Wissens. Der Glaube an eine gerechte und friedliche Welt, in der alle Menschen gleichermassen glücklich sein können, ist mir stückweise abhandengekommen. Zudem hat sich das, was ich für Aufklärung hielt, als wenig tragfähig erwiesen; das Irrationale ist stärker als die Vernunft. Wir handeln mehrheitlich nicht nach eigener Einsicht, sondern sind Getriebene. In Wirtschaft, Politik und Gesellschaft behaupten sich Gewalt und Unterdrückung. Die Gier nach Geld und Reichtum ist ungebrochen; Lügen und Vorurteile bestimmen die Politik. Wir leben in einer Welt der schreienden Ungerechtigkeit.
Doch dies ist nur die eine Seite. Wir erleben auch Mitleid, Gerechtigkeitssinn, Vernunft, Friedfertigkeit, Mässigkeit und Solidarität. Meine Stimmung schwankt zwischen Glück und Traurigkeit, Freude und Zorn. Die meiste Zeit über herrscht die Banalität des Alltags. Ich versuche, auch ihr einen Sinn abzugewinnen. Mit Genugtuung sehe ich, wie sich viele Jugendliche engagieren, und ich hoffe, sie verlieren mit zunehmender Desillusionierung nicht jegliche Zuversicht. Mit meinen Geschichten möchte ich dazu ermutigen, sich ungescheut mit der Welt auseinanderzusetzen und dabei den Glauben an das Gute nicht zu verlieren. Jede Geschichte ist Teil einer unfassbaren Gesamtgeschichte. Geschichten kann man erzählen, das Ganze nur ahnen. So fahre ich fort mit meiner Erzählung.
Velofahren in Berlin
Am 5. September 1990 landete ich auf dem Flughafen Berlin Tegel, fuhr mit der U-Bahn zur Prinzenstrasse. In einem kleinen Hotel bezog ich ein Einzelzimmer. Am anderen Morgen ging ich zu Fuss an die Ritterstrasse, wo mein einstiger Studienkollege Andreas sich mit seiner Weinhandlung unweit der Mauer wohnlich eingerichtet hatte. 1966/67 hatten wir beide an der FU studierte, hatten die gleichen Vorlesungen und Seminare besucht. Er war in Berlin hängengeblieben, ich war in die Schweiz zurückgekehrt. Seither hatte ich ihn immer wieder besucht. Er war etwas behäbig geworden, wirkte nicht mehr so athletisch wie einst, die Haare hatten sich von blond zu grau verfärbt, waren akkurat geschnitten und himmelwärts gebürstet. Ich hatte ihm geschrieben, ich würde diesmal nicht bei ihm in der WG wohnen, könne es mir leisten, im Hotel zu logieren. Als ich bei ihm anklopfte, hatte er gerade Kundschaft. Nur kurz unterbrach er das Verkaufsgespräch, um mich zu begrüssen, lieh mir sein Zweitfahrrad aus, ein etwas rostiges Damenvelo. Wir vereinbarten, uns zwei Stunden später in einem Kaffee in der Nähe zu treffen.
Das Wetter war unbeständig; trotzdem machte ich mich auf zu einer ersten Radtour im neuen Berlin, dem Berlin nach der Maueröffnung.
6. September 1990
Ich radle zum Potsdamer Platz, wo neuerdings der Verkehr ungehindert zwischen West- und Ostberlin fliesst. Mitten auf dem Platz ein paar Zelte und ein Schrotthaufen, an dem sich ein paar Männer in Trainerhosen und Regenjacken zu schaffen machen. Es nieselt. Die Händler, welche echte oder gefälschte Uniformstücke der Volksarmee verramschen, decken ihren Stand mit einer DDR-Flagge zu. Beim Anhalterbahnhof gehe ich in ein Kaffeehaus, schreibe ein paar Ansichtskarten an Freunde in Bern. Weiterfahrt zur Kochstrasse, radle ohne Halt über den Checkpoint Charly nach Ostberlin, dann durch die Leipziger Strasse zum Alexanderplatz. Links und rechts der sechsspurigen Fahrbahn stehen riesige Wohnblöcke. Woher kommen alle die Autos? Ich muss mit dem Rad aufs Trottoir ausweichen. Dann drehe ich ab nach Nordwesten, komme zur Schwedter Strasse, die vor der Wende an der Mauer endete. Jetzt kann ich weiterfahren zur Bernauer Strasse. Bis zur Ackerstrasse ist die Mauer weg, die verbindenden Strassenstücke zwischen West und Ost werden überall wieder hergestellt. Weiter südlich steht die Mauer noch. Ein kleiner tarnfarbiger Bagger der Marke «Fortschritt» müht sich an ihr ab, entfernt Stücklein um Stücklein. An der Chausseestrasse, wo der Grenzübergang war, sind die sinnlos gewordenen Wörter ZOLL und STOPP auf die Fahrbahn gemalt. Auf der Ostberliner Seite sehe ich den Zugang zur neuen U-Bahn-Haltestelle «Stadion der Weltjugend». Weiterfahrt zum Reichstag und zum Brandenburger Tor; es wird renoviert. Vorbei an der Philharmonie zur Potsdamer Strasse. An der Ritterstrasse stelle ich das Velo vor dem Kaffee ab. Andreas sitzt schon da. Wir begrüssen uns noch einmal mit einer kurzen Umarmung, setzen uns an ein kleines Tischchen; er bestellt ein Bier, ich einen Milchkaffee. Wie er seit der Öffnung der Mauer lebe, will ich wissen. Es sei wohl eine geschichtliche Notwendigkeit, meint er, aber für ihn habe die Wende nur Nachteile. Kreuzberg sei jetzt nicht mehr ein Randbezirk von Westberlin, sondern werde Teil des neuen Zentrums der zusammenwachsenden Stadt. Schon sehe man, dass Liegenschaften gekauft würden, für die sich vorher kein Mensch interessiert habe. Die Immobilienpreise würden steigen und damit auch die Mieten. Die ganze schöne Alternativszene, die sich hier entwickelt habe, komme in Bedrängnis. Er rechne damit, dass er mit seiner Weinhandlung bald umziehen müsse, und sehr wahrscheinlich werde seine WG aus der grossen Altbauwohnung hinausgeekelt werden. Man werde weiter hinaus nach Neukölln oder sogar in den Osten hinüber nach Friedrichsfelde umziehen müssen. – Ich kann seine Besorgnis nicht so recht ernst nehmen, erzähle von meiner Fahrradtour und schildere, wie erfrischend es doch sei, entlang der ehemaligen Mauer zu fahren und von West nach Ost zu wechseln und umgekehrt. Beton, Stacheldraht, Wachtürme und Selbstschussanlagen seien nun sozusagen in den Staub der Geschichte versunken. Ich erinnere ihn daran, wie wir einst als Studenten zu Theaterbesuchen in den Osten hinüberfuhren, wobei uns der Anblick des Stacheldrahts und die Kontrolle durch die unfreundlichen Grenzbeamten immer wieder erschütterten. Er scheint es schon fast vergessen zu haben.
7. September 1990
Besuch bei Christina in Berlin Mitte. Wie andere auch hat sie nach der Öffnung der Mauer eine Reise in den Westen unternommen und so fürs erste ihr Fernweh gestillt. Im Juli 1990 kam sie in die Schweiz. Sie hatte sich für eine Wanderwoche in der Salecina angemeldet. Mein Schwager Heini war der Wanderleiter, und ich marschierte mit über die Bündner Alpenpässe. Die Pianistin aus Ostberlin fiel mir schon am ersten Abend auf. Sie hatte ein interessantes Gesicht, hohe Wangenknochen und blaue Augen unter strohblondem Haar. Dass sie dreifache Mutter war, sah man ihr, schlank und beweglich wie sie war, nicht an. Immer wieder suchte ich ihre Gesellschaft, fragte sie nach ihren Lebensumständen aus und wollte wissen, wie sie die dramatischen Entwicklungen in Berlin erlebt habe. Es sei eine aufregende Zeit, sagte sie, ihr Leben werde sich stark verändern. Einerseits fürchte sie sich davor, andererseits freue sie sich darauf. Der maroden DDR weine sie keine Träne nach, sei aber auch gegenüber einer wahrscheinlichen Vereinigung mit der Bundesrepublik skeptisch. Im Moment habe sie immer noch eine Anstellung als Korrepetitorin an der Musikhochschule, aber das werde wohl nicht so bleiben. Sie lebe getrennt von ihrem Mann in einer grossen Wohnung zusammen mit ihren Kindern. Trotz aller Einschränkungen habe sie sich in der Kargheit Ostberlins immer recht wohl gefühlt. Sie habe Freundschaften gepflegt, die offizielle Propaganda missachtet und sich mit dem zufrieden gegeben, was sie habe. Das Beste an der Veränderung sei, dass sie jetzt den bisher für sie verschlossenen Westen entdecken könne.
Vom Hotel aus habe ich sie angerufen, und sie hat mich zu einem kleinen Abendimbiss eingeladen. Mit dem rostigen Damenvelo fahre ich zu ihr. Ihre Wohnung an der Zolastrasse liegt direkt hinter der Volksbühne in Berlin Mitte. Grosse, hohe Räume, alles ein wenig zerschlissen. Wir sitzen in der Küche in knarrenden Korbstühlen, trinken Wein und essen Brot und Wurst. Der kleine Louis ist aus dem Bett gestiegen, zeigt sich sehr zutraulich und bietet mir einen Kaugummi an. Auch die beiden Mädchen tauchen auf, neugierig, wer da angekommen sei. Christina scheucht sie alle drei ins Bett zurück. Nach der Wanderwoche in der Salecina habe sie noch ein paar Tage auf der wunderschönen Insel Rügen verbracht, sagt sie. Jetzt sei sie wieder im gewohnten Alltag angekommen. Allerdings, wenn sie an die Zukunft denke, werde sie ein wenig ängstlich. Was wird die Vereinigung mit der BRD mit sich bringen? Bald werden andere Gesetze gelten, ein anderes Steuersystem, private Krankenversicherung usw. Sie fühle sich überfordert. Wie sie so erzählt, klingelt es an der Wohnungstür. Detlef und Barbara kommen herein, er Industriedesigner, der sich neuerdings als bildender Künstler versteht, sie Aufnahmeleiterin bei der volkseigenen Deutschen Film AG (DEFA), deren Zukunft ungewiss ist. Sie sei zu hundert Prozent auf Kurzarbeit, sagt sie. Die beiden erzählen von ihrer Bioenergetik-Gruppe. Halb sei es eine Selbsthilfe-, halb eine Therapiegruppe unter Leitung eines Westberliners. Es sei wichtig, sich gegenseitig auszusprechen, meint Detlef, denn das nun zusammengebrochene System habe einen zum Krüppel gemacht, und es hocke immer noch tief in seinem Leib. Er habe auf einen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus gehofft, aber damit sei nun nichts; sein Frust sei gross. Barbara war im Sommer in Portugal. Sie erzählt, wie schön es dort gewesen sei: Sonne, Landschaft, gutes Essen, nette Freunde. Sie kommt richtig ins Schwärmen. Dort sollte man leben, meint sie. Den Unterschied zwischen ferienmässiger Ausnahmesituation und Alltag scheint sie nicht zu kennen. Christina ist da abgeklärter. Sie weiss, dass sie das Berliner Milieu braucht, den vertrauten Freundeskreis. Aber der Dreck der Stadt und der Lärm schlagen ihr aufs Gemüt, besonders wenn es wie in den letzten Tagen beständig regnet. Ihr Hauptproblem: Sie kann die Kinder nicht nach draussen lassen. Kein Garten, kein Kinderspielplatz in der Nähe. Die Kinder purzeln in der Wohnung herum, streiten untereinander, wollen Mamas Aufmerksamkeit, lenken sie ab von ihrer Arbeit. Kurzfristig hat sie zugesagt, an einem Konzert Klavierstücke von Schostakowitsch vorzutragen, die sie noch nie gespielt hat. Wie soll sie das bloss schaffen?
8. September morgens
Mit Christina und den Kindern gehe ich zum Alexanderplatz, wo neuerdings ein kleiner Markt stattfindet. Direktverkauf von Wurstwaren, Gemüse und Früchten, alles etwas billiger als in der Einkaufshalle. Das Angebot ist spärlich. Christina muss noch zur Musikbibliothek im Marstall, um die Noten zu den Präludien von Schostakowitsch abzuholen. Ich will Rolf besuchen, und sie zeigt mir den Weg der Spree entlang zum Monbijoupark. Ganz in der Nähe ist das Siebdruckatelier, in dem Rolf arbeitet; es gehört zur Akademie der Künste der DDR. Wie Christina habe ich ihn im Sommer in der Salecina kennengelernt, und auch mit ihm habe ich mich angefreundet. Ich finde ihn an seinem Arbeitsplatz in einem kleinen Pavillon. Er säubert seine Instrumente. Die ganze Nacht habe er an den Plakaten für eine Ausstellung gearbeitet, sagt er. Jetzt wolle er schlafen gehen. Ich bin ein wenig enttäuscht, habe mich gefreut, ihn zu sehen. Aber er ist offensichtlich übermüdet. Am nächsten Tag, einem Samstag, habe er frei, sagt er; da könnten wir zusammen etwas unternehmen. Ursula, die Grafikerin aus der Schweiz, werde zu ihm kommen. Sie könne mich bei meinem Hotel abholen; das liege an ihrem Weg.
9. September mittags
Ursula und ich fahren zu Rolf. Sie fährt schnell auf ihrem Rennrad, tritt mit ihren langen Beinen kräftig in die Pedale; ihre langen, dunklen Haare flattern im Fahrtwind. Ich muss mich mächtig anstrengen, um nicht abgehängt zu werden. Rolf erwartet uns in seiner kleinen Hinterhofwohnung am Käthe-Kollwitz-Platz. Er ist Olivgrün angezogen, wetterfest, sieht aus wie ein Förster oder ein Ranger. Die Farbe passt gut zu seinen kurzen, blonden Haaren. Er schlägt vor, ein Fest in der Mainzerstrasse zu besuchen. Zu dritt radeln wir durch die Karl-Marx-Allee (früher Stalin-Allee), wo die riesigen Wohnblocks im Stil von Prunkhotels der zwanziger Jahre die sechsspurige Autostrasse säumen. Die Mainzerstrasse im Friedrichshain ist eine Seitenstrasse zur Frankfurter Allee; sie ist gleich breit wie die Häuser hoch sind, was ihr ein streng geometrisches Aussehen gibt. Näher betrachtet fällt auf, dass die Häuser auf der einen Seite dem Zerfall anheimgegeben sind, während die auf der anderen Strassenseite einigermassen gepflegt aussehen. Die schlechten Häuser sollen abgerissen werden, erzählt Rolf. Sie sind jetzt aber von jungen Leuten besetzt worden; es seien sogenannte Autonome aus Westberlin. Auf der anderen Seite der Strasse wohnten die Stinos, die stinknormalen Bürger, die sich von den Hausbesetzern ungemein gestört fühlten.
Die Wände der besetzten Häuser sind vollgesprayt und aus den Fenstern hängen Fahnen. Es hat sich hier eine Szene breitgemacht, die mich an diejenige in der Berner Reitschule erinnert. Es regnet, und es sind nicht allzu viele Leute da. Laute, aggressive Musik ertönt aus den Lautsprechern, es wird Bier gesoffen, die jungen Leute sind fast alle schwarz gekleidet. Einer kotzt Rolf direkt vor die Füsse. Wir haben genug gesehen, besteigen wieder unsere Räder und fahren zurück auf den Prenzlauer Berg. Rolf kocht für uns. Ursula und er fachsimpeln über technische Probleme der Plakatherstellung. Sie sind sich einig darüber, dass Grafik und Design in der DDR einen besonderen Stil entwickelt haben. Es bestehe die Gefahr, dass nun mit der Wende dieser DDR-Stil verworfen und verdrängt werde. Er sei aber eine eigenständige Weiterentwicklung der Grafik der 1920er und 1930er Jahre und knüpfe am Bauhausstil an. Viele Gegenstände des Alltags seien von diesem Design geprägt. Mir ist auch schon aufgefallen, dass Produkte wie Zündhölzer, Butter oder Kaffee in Verpackungen stecken, die meinen westlichen Augen auf den ersten Blick altmodisch oder unbeholfen vorkommen, auf den zweiten Blick aber eine besondere Qualität zeigen. Rolf holt seine Sammlung von Plakaten hervor, die wir gemeinsam anschauen und angeregt darüber diskutieren.
10. September mittags
Erneut treffen wir uns bei Rolf. Mit dem Fahrrad fahren wir zur S-Bahn-Station, verladen die Räder und fahren mit der Bahn nach Mahlsdorf zum Gründerzeit-Museum von Lothar Berfelde. Der weisshaarige Mann, dessen Füsse in auffälligen Damenschuhen mit hohen Absätzen stecken, führt uns durch das Haus, das er als das erste Privatmuseum der DDR bezeichnet. Seine umfangreiche Sammlung von Neugotik- und Neurenaissance-Möbeln, industriell und seriell gefertigt in der Gründerzeit zwischen 1870 und 1900, kommentiert er kenntnisreich. Er demonstriert uns ein noch gut funktionierendes Grammophon mit Handkurbel am Holzkasten und grossem Schalltrichter. Sorgfältig legt er die Schelllackplatte auf, spannt eine neue Nadel ein, richtet den Blechtrichter. Erstaunlich klar ertönt ein Strauss-Walzer. Das Geheimnis sei einfach, sagt er: jedes Mal eine neue Nadel einlegen.
Auf dem Weg hierher hat mir Ursula gesagt, Berfelde sei als junger Mann in versteckten Cabarets als Transvestit aufgetreten und sei als Charlotte von Mahlsdorf eine bekannte Figur in der Untergrundszene der DDR gewesen. Warum er eine so starke Vorliebe für Gründerzeitmöbel habe, frage ich ihn. Er holt weit aus: Als Kind habe er mit Vorliebe Mädchenkleider getragen. Seine Eltern seien damit nicht zurechtgekommen, zumal das in der Nazizeit als abartig gegolten habe. Sie hätten ihn in die Obhut seines ledigen Grossonkels gegeben; der habe ihn gewähren lassen. Als 1945 die Russen nach Berlin vorstiessen, hätte er zum letzten Aufgebot der 16- bis 18-jährigen gehört. Er habe nicht kämpfen wollen, habe sich versteckt. SS-Soldaten hätten ihn entdeckt, als er sich in seinem Mädchenmantel in einen Luftschutzkeller begeben habe. Beinahe sei er standrechtlich erschossen worden, aber ein Hauptmann habe eingegriffen und ihm das Leben gerettet. Nach Kriegsende habe er sich in der homosexuellen Szene herumgetrieben. Auch unter dem DDR-Regime sei er von Verhaftung bedroht gewesen. Der Grossonkel sei ihm immer beigestanden. Dessen Wohnung, vollgestopft mit Gründerzeit-Möbeln, sei ihm wie ein sicherer Hafen vorgekommen. Nach dessen Tod habe er alles geerbt. Das sei der Grundstock seiner Sammlung gewesen. Er habe Möbel restauriert und alte Geräte wie Grammophone und anderes geflickt. So habe er als privater Kleinunternehmer im realsozialistischen System überlebt.
Ursula möchte die Mulackritze sehen. Berfelde ist sichtlich erfreut. Er öffnet eine schmale Türe und geht uns voran eine steile Treppe in den Keller hinunter. Betreten auf eigene Gefahr, steht auf einem Emailschild an der Wand. Halten Sie sich am Geländer fest, ruft er uns über die Schulter zu und fügt neckisch bei: Leben ist immer lebensgefährlich. Unten angekommen dreht er den Lichtschalter an, und wir sehen eine komplett eingerichtete kleine Kneipe. Solche Arbeiterkneipen habe es früher viele gegeben im Berliner Scheunenviertel, sagt er. Die Mulackritze an der Mulackstrasse 15 sei aber etwas Besonderes gewesen. Der Tresen und das Rückbüfett stammten aus dem Jahr 1890. Damals habe der Zeichner und Dichter Heinrich Zille dort verkehrt und die Szene der Kleinkriminellen und Huren beobachtet und so das Material für seinen Romanzyklus «Hurengespräche» gesammelt. Nach der Jahrhundertwende sei die Mulackritze eine Lesben- und Schwulenkneipe gewesen, später, nach dem Ersten Weltkrieg hätten bekannte Künstler und Künstlerinnen wie Henny Porten, Fritzi Massary, Claire Waldorff oder Gustaf Gründgens dort verkehrt. Auch der Sexualforscher Magnus Hirschfeld sei Stammgast gewesen. 1951 seien vom DDR-Regime alle Lesben- und Schwulenbeizen geschlossen worden. Die letzten Gastwirte der Mulackritze, Minna und Alfred Mahlich, hätten das Lokal vergammeln lassen. Als 1963 bekannt wurde, dass das Haus abgerissen werden sollte, habe er den Mahlichs das Mobiliar abgekauft, auf einem Handkarren von Berlin Mitte nach Mahlsdorf transportiert, hier im Keller restauriert und originalgetreu wieder aufgebaut. Ich bin schwer beeindruckt, bewundere die Art und Weise, wie Berfelde sein Leben mit Hilfe der Gegenstände in seinem Museum inszeniert und dokumentiert hat.
Von Mahlsdorf radeln wir weiter nach Köpenick, schauen dem Treiben am dortigen Herbstfest zu. Im Rathaus besichtigen wir den Tresor und die Geldkassette, die der Schuster Friedrich Wilhelm Voigt, als Hauptmann verkleidet, im Jahr 1906 raubte, nachdem er einem Trupp gutgläubiger Soldaten den Befehl gegeben hatte, den Bürgermeister zu verhaften und ihn zum Öffnen des Tresors zu zwingen. Die Geschichte, die Carl Zuckmayer zum Theaterstück «Der Hauptmann von Köpenick» inspirierte, macht deutlich, wie gross der Respekt vor allen Uniformierten im damaligen Preussen war.
Während unserer Rückfahrt nach Berlin Mitte verziehen sich die Wolken; die Sonne scheint. Am Käthe-Kollwitz-Platz, wo es neuerdings schick renovierte Strassenkaffees gibt, setzen wir uns an ein Tischchen und trinken Bier. Von einer Telefonzelle aus ruft Rolf bei Christina an, um sie zum Abendessen bei ihm zuhause einzuladen. Sie ist an diesem Sonntag zusammen mit den beiden Mädchen zu ihrer Mutter nach Wittenberg gefahren, um den alten Trabi abzuholen, den diese ihr geschenkt hat. Sie sei noch nicht wieder zuhause angekommen, sagt Rolf. Erst einige Zeit später erreicht er sie, und sie erzählt etwas wirr und unzusammenhängend, sie habe unterwegs einen Unfall gehabt und sei mit dem Zug nach Berlin zurückgefahren. Sie werde jetzt Louis bei seinem Vater abholen, die Kinder zu Bett bringen und dann herüberkommen. In Rolfs Wohnung, kochen wir gemeinsam ein feines Essen, plaudern über Charlotte von Mahlsdorf, über die Mulackritze und den Hauptmann von Köpenick. Ursula weiss viel zu erzählen über Hausrenovierungen und Hausbesetzungen, denn sie wohnt selbst in einem besetzen Haus an der Mulackstrasse. Als Christina kommt, setzen wir uns an den Esstisch. Sie ist immer noch verstört, erzählt, wie der Trabi während der Fahrt plötzlich krachend abgesackt und von der Strasse abgekommen sei. Das Auto habe sich überschlagen und liege jetzt dort im Acker mit gebrochener Hinterachse, sei nicht mehr zu gebrauchen. Als der Trabi nach dem seitlichen Überrollen zum Stillstand gekommen sei, habe sie im Innenrückspiegel nach den Mädchen gekuckt und nichts gesehen. Dann seien die beiden Köpfe hinter der Rücklehne aufgetaucht und Lynn habe vorwurfsvoll gefragt: Mama, was tust du denn? Christina muss lachen, als sie es erzählt. Wir anderen lachen mit. Alles noch einmal gut gegangen!
Anderntags vernehme ich, die Mädchen hätten über Kopfschmerzen geklagt, und Christinas Knie sei stark angeschwollen. Ich fahre allein nach Mahlsdorf, spreche lange mit Lothar Berfelde, mache ausführliche Notizen. Zurück in Bern schreibe ich einen Bericht über das «Gründerzeitmuseum», der im «Tages-Anzeiger-Magazin» veröffentlicht wird.
Knapp einen Monat nach meinem Berlinbesuch, in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990, wurde die Vereinigung von BRD und DDR vollzogen. Die Menschen in Ost und West jubelten, Feuerwerke stiegen in den Himmel, die Glocken läuteten. Bundespräsident Richard von Weizsäcker verkündete in der Philharmonie: «Die Einheit Deutschlands ist vollendet. Wir sind uns unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.»
Beten für den Frieden
Seit dem November 1989 verströmten die Medien Optimismus: Maueröffnung, Ende des Kalten Kriegs, Ende der Diktaturen, endgültige Ankunft im Zeitalter der Demokratie, des Liberalismus und der Menschenrechte. Doch die politische Lage war verworren und unberechenbar. Unsicher war die Lage vor allem im Nahen Osten. Im Iran war 1979 ein islamistischer Gottesstaat entstanden. Der laizistische Irak, diktatorisch regiert von Saddam Hussein, hatte von 1980 bis 1988 Krieg gegen das iranische Mullah-Regime geführt. Der Westen hatte der Schlächterei mit Entsetzen und heimlicher Genugtuung zugeschaut. Rückblickend sprach man vom ersten Golfkrieg. Er fand seine Fortsetzung zwei Jahre später im Irakkrieg, der auch als zweiter Golfkrieg bezeichnet wird. Wie kam es dazu? Saddam Hussein annektierte im August 1990 widerrechtlich das benachbarte Kuwait. Die USA verlangten ultimativ den Rückzug, und als der irakische Gewaltherrscher nicht nachgab, bereiteten sie eine Invasion vor. Zuerst war es nur Kriegsgetöse in den Medien, aber die Lage war ernst. Aus kirchlichen und pazifistischen Kreisen kamen dringende Aufrufe, den Frieden zu bewahren. In den Zeitungen war zu lesen, was alles passieren würde, wenn es zum Krieg käme. Erdölbohrstellen und Tanklager würden in Flammen aufgehen, Saddam Hussein würde Giftgas einsetzen und so auch viele Zivilisten töten. Ein grosses Durcheinander unter den westlichen Truppenverbänden würde entstehen, worauf Israel mit seiner disziplinierten und gut trainierten Armee eingreifen würde, was wiederum die Sowjetunion zur Intervention veranlassen würde. Der Einsatz von Atomwaffen sei nicht ausgeschlossen. Solche Szenarien versetzten uns in Angst. Der sensible Niklaus Meienberg raste herum und glaubte, ihm sei aufgetragen, die Welt zu retten. Er schrieb, faxte, entfaltete eine hektische Aktivität und war überzeugt, von der CIA verfolgt zu werden; der Wahnsinn hatte ihn gepackt. Er war ein Extremfall, aber viele Menschen sahen die Welt am Abgrund und wollten irgendetwas tun, um die eigene Machtlosigkeit zu vergessen. Der angespannte Schwebezustand dauerte bis Anfang 1991. In meinem Tagebuch finde ich dazu ein paar Notizen.
15. Januar 1991
Das Ultimatum am Golf läuft heute Nacht aus. Wird morgen Krieg sein? Als ich heute um 18 Uhr aus dem Büro kam, um an die Fraktionssitzung ins Volkshaus zu gehen, waren auf dem Bärenplatz einige hundert Menschen versammelt, mit Fackeln und Transparenten. Sie demonstrierten für den Frieden. Peter Sigerist, einst Aktivist der Revolutionären Marxistischen Liga (RML), die seit 1980 Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) heisst, rief die US-Soldaten zur Desertion auf. Über den Lautsprecher ertönte ein Lied von Wolf Biermann. Am späteren Abend Friedensgottesdienst im Münster. Beinahe wäre ich hingegangen, zog es dann aber doch vor, zuhause Radio zu hören. Auf DRS1 war eine Gesprächsrunde versammelt, vorwiegend Frauen, die, angeregt von den Fragen der telefonisch zugeschalteten Hörerinnen und Hörer, über friedliche Konfliktbewältigung, Angst und Hoffnung sprachen. Der Krieg, der höchstwahrscheinlich bevorstand, war für sie alle eine grauenhafte Aussicht. Ein Kind rief an und fragte, was die Kinder zur Erhaltung des Friedens tun könnten. Ein Lehrer aus dem Aargau forderte dazu auf, an den Golf zu reisen und eine Menschenkette zwischen den Konfliktparteien zu bilden. Auch er wurde ernst genommen. Ein paar Anrufende meinten, es sei richtig, Saddam Hussein mit Gewalt wegzuschaffen, aber danach müsse man ernsthaft für allseitige militärische Abrüstung sorgen. Eine Frau aus der Gesprächsrunde sagte, sie habe nicht nur vor dem Krieg Angst, sondern auch vor einem Sieg der Amerikaner, weil dann die Missachtung der Araber weitergehe. Zum Schluss meldete sich noch ein Hörer, der im Ton eines Propheten sagte, wenn es zum Krieg komme, werde vieles zusammenbrechen und es werde das Ende der männlichen Politik sein.
16. Januar 1991
Am Morgen höre ich am Radio, die USA hätten losgeschlagen, ohne dass ein Gegenschlag des Irak erfolgt sei. Sind die US-Truppen derart überlegen? Es ist viel von Saddam Husseins Raketenarsenal die Rede gewesen. Hat der Diktator nur geblufft? Oder haben die USA die Lüge von den irakischen Raketen verbreitet, um ihren Erstschlag zu legitimieren?
17. März 1991
Es ist alles nicht ganz so schlimm herausgekommen, wie ich es am 15. Januar befürchtete. Der Irak hat gegen die US-Truppen kein Giftgas eingesetzt; Israel hat nicht in den Krieg eingegriffen. Der Krieg hat nur 6 Wochen gedauert. Der Westen ist glimpflich davongekommen. Für den Irak allerdings ist die Sache schlimm ausgegangen. Die Infrastruktur ist weitgehend zerstört. Zehntausende von Soldaten und Zivilisten sind ums Leben gekommen. Auf der Seite der US-Truppen kamen etwa 200 Soldaten ums Leben. Ist der Krieg damit wirklich zu Ende? Im Irak kämpfen jetzt Schiiten und Kurden gegen Saddam Hussein. Es zeichnet sich keine wirkliche Friedenslösung für den Nahen Osten ab.
Weitere Tagebucheinträge widerspiegeln, wie sich meine anfängliche Besorgnis in distanzierte Gelassenheit wandelte. Mein Vorrat an Empörung war aufgebraucht; ich versuchte, mich damit abzufinden, dass die Welt so war, wie sie war. Alle idealistischen Ansätze zu einer dauerhaften Friedensordnung wurden durch die Realität durchkreuzt. Wie oft schon hatten wir den Ausbruch von kriegerischer Gewalt aus der Ferne miterlebt? Immer wieder waren wir empört und vergassen dann schnell. Heute, da ich mich zu erinnern versuche, fallen mir nur ein paar wenige Beispiele ein. An erster Stelle der Vietnamkrieg, gegen den wir Achtundsechziger auf der Strasse protestierten. Was gab es sonst noch? Wikipedia listet nicht weniger als 45 Kriege und Bürgerkriege auf, die weltweit zwischen 1945 und 1991 stattfanden. Ein paar Beispiele: Griechischer Bürgerkrieg 1946-1949; Französischer Indochinakrieg 1946-1954; Indisch-Pakistanischer Krieg 1947-49; Koreakrieg 1950-1953; Algerienkrieg 1954-1962; Suezkrieg 1956; Laotischer Bürgerkrieg 1958-1961; Algerisch-Marokkanischer Grenzkrieg 1963-1964; Vietnamkrieg 1964-1975; Israelisch-Arabischer Sechstagekrieg 1967, Äthiopischer Bürgerkrieg 1974-1991 usw.
In der UNO-Charta von 1945 ist ein Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen festgeschrieben, und trotzdem gibt es immer wieder bewaffnete Konflikte, Kriege zwischen zwei oder mehreren Staaten, die sich alle gleichermassen auf das Recht zur Selbstverteidigung berufen. Noch häufiger sind innerstaatliche Gewaltakte bis hin zu eigentlichen Bürgerkriegen. Diese werden von der Charta nicht erfasst, weil sie als Angelegenheit des jeweiligen Staates angesehen werden, in die sich die UNO nicht einzumischen hat.
Wir waren an Kriege gewöhnt. Warum gab es trotzdem vor dem Ausbruch des zweiten Golfkriegs dieses besondere Aufsehen, diese gesteigerte Angst? Die Propaganda, die vor und während jedem Krieg ungehemmt einsetzt, verfing damals nicht so richtig. Schnell wurde deutlich, dass es nicht in erster Linie um den Schutz von Kuwait ging, auch nicht um Demokratie oder Diktatur, sondern um die Sicherung der Erdölvorräte, auf die der Westen Anspruch zu haben glaubte. Offensichtlich nützten die USA die Schwäche der zusammenbrechenden Sowjetunion aus, um die westliche Vormachtstellung in der Welt und im Nahen Osten wieder herzustellen. Der vordergründig lokal begrenzte Konflikt war in Wirklichkeit ein weltpolitischer Konflikt, und er barg in sich ein beträchtliches Eskalationspotential. Wie würde die Sowjetunion darauf reagieren? Konnte sie überhaupt reagieren, oder war sie innerlich so voller Widersprüche, dass sie nach aussen nicht mehr handlungsfähig war?
Am Wochenende vom 17. und 18. August 1991 war ich zusammen mit den Genossinnen und Genossen vom Vorstand der SP-Sektion Bern Nord in unserem Ferienhaus in Magglingen. Fast alle waren gekommen, hatten etwas zum Bräteln mitgebracht. Wir spielten Fussball auf dem Sportplatz End der Welt, sassen danach in unserem Garten um das Feuer, verspeisten gebratene Cervelats und Kartoffeln, tranken Rotwein und diskutierten über die Agenda unserer SP-Sektion. Der motorisierte Verkehr im Quartier müsse reduziert oder zumindest verlangsamt werden, fanden wir; den Breitenrainplatz wollten wir zu einer Begegnungszone umgestalten. Wortführer war Res Hoffmann, Physiklehrer am Gymnasium Kirchenfeld und als Stadtrat im steten Kontakt mit den Behörden. Er las alle Baupublikationen und erhob im Namen der SP Bern-Nord Einsprache, wenn ihm ein Bauprojekt überrissen schien. Immer war er bestens informiert. Sein Fokus war auf das Quartier gerichtet; die gesamtstädtischen Angelegenheiten interessierten ihn nur wenig. Ihm gehe es um seinen eigenen Lebenskreis; alles andere überfordere ihn, behauptete er. Er war es gewesen, der mich zum Beitritt zur SP aufgefordert hatte, und als Stadtrat arbeitete ich eng mit ihm zusammen. Natürlich beschränkten sich unsere politischen Überlegungen nicht auf Quartierpolitik; wir versuchten, immer auch das globale Geschehen im Auge zu behalten. Gerne hätte ich mit den Genossinnen und Genossen über Gorbatschow und die Sowjetunion und allgemein über die Weltlage nach dem Irakkrieg geredet, aber das war nicht möglich, weil das Gesprächsthema eben dadurch gesetzt war, dass wir alle mehr oder weniger in der Quartierpolitik engagiert waren. Natürlich sprachen wir auch über andere Dinge, etwa über abwesende Genossinnen und Genossen und deren Beziehungsschwierigkeiten; solchem Tratsch und Klatsch waren wir nicht abgeneigt. Über die Krisenherde im Nahen Osten und die prekären Verhältnisse in der damals noch existierenden Sowjetunion sprachen wir nicht. Je länger der Abend wurde und je mehr Wein wir tranken, desto mehr blödelten wir nur noch herum und liessen alle Ernsthaftigkeit fahren.
Die meisten Genossinnen und Genossen kehrten mit der letzten Bahn nach Bern zurück. Res, Cornelia, Markus und Marianne blieben. Die vier waren Mitglieder der von mir gegründeten Ferienhausgenossenschaft am Wald und hatten das gleiche Recht wie ich, das Ferienhaus zu benützen. Am Sonntagvormittag wanderten wir fünf von Magglingen aus hinunter in den Joret und nach Orvin, assen dort im Restaurant Crosse de Bâle eine kalte Platte und tranken Weisswein. Dann trennten wir uns. Ich stieg allein wieder hinauf nach Magglingen, während die anderen den Weg nach Leubringen einschlugen und von dort aus nachhause fuhren.
Im Ferienhaus angekommen, setzte ich mich in den Schatten des Nussbaums und bereitete mich auf die nächste GPK-Sitzung vor. Zwischendurch schaute ich auf den gegenüberliegenden Schanzenhang, wo Hansuedi Rohrbachs Kühe weideten. Ich liebe diese schwerfälligen Tiere, die, ohne dass man sie dazu zwingen musste, Gras und Kräuter fressen und unablässig Milch produzieren. Ich liebe es, wenn sie mich aus langbewimperten Augen ansehen, neugierig nach aussen gerichtet und gleichzeitig immer auf die Vorgänge in ihrem Bauch mit den vielen Mägen konzentriert. – Als die Sonne sich der hinteren Jurakette näherte, ass ich die Reste vom Frühstück und setzte mich dann an die Westwand des Hauses, um noch ein wenig in Karl Dietrich Brachers Buch über «Zeitgeschichtliche Kontroversen um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie» zu lesen. Die Stellen, die mir wichtig waren, unterstrich ich mit Bleistift. Zum Beispiel diese: «Ich halte es für einen Irrweg und eine Täuschung, die schon 1917 in Russland und 1922 in Italien, 1933 in Deutschland und 1945 in Europa verhängnisvolle Folgen hatte, wenn über dem ideologischen Streit um das richtige System die Grundfrage nach seinem demokratischen oder diktatorischen Charakter, nach der Stellung und den Rechten des Menschen als eines freien Bürgers zu kurz kommt oder zu spät gestellt wird.» Bracher ist ein konservativer Historiker, aber ich finde, auch als Sozialdemokrat könne ich von ihm einiges lernen. Sein Eintreten für die Demokratie und die Menschenrechte scheint mir keineswegs überflüssig, denn ich weiss, dass manche Linke immer noch dem 68er Radikalismus huldigen, auf den Umsturz des kapitalistischen Systems hoffen und die Bewahrung der Demokratie und den Schutz der Menschenrechte, mindestens insofern es die Bourgeoisie betrifft, hintanstellen. Zudem stimmt das, was er über die neomarxistische Faschismustheorie sagt, vollkommen mit dem überein, was ich seinerzeit in Paris lernte, als ich im Musée sociale die Protokolle der Komintern-Kongresse studierte. Er sagt nämlich, die neomarxistische Definition des Faschismus gehe im Grunde immer auf die Definition zurück, die zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg von der stalinistischen Komintern propagiert wurde. Danach wurde alles als faschistisch bezeichnet, was der «Erhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie» diente. Unter diese Definition fielen auch die reformistischen Sozialdemokraten, die als sozialfaschistisch bezeichnet wurden, während die Nationalsozialisten in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts vorübergehend aus der Faschismusdefinition ausgeklammert wurden.
Ich stimme mit Bracher auch darin überein, dass es ein Fehler der Neuen Linken sei, wenn sie den Begriff des Totalitarismus in Bausch und Bogen ablehne. Wörtlich schreibt er: «Die gegenwärtige Renaissance einer allgemeinen Faschismustheorie bietet mit ihrer einseitigen Ausrichtung auf die ideologischen und sozio-ökonomischen Komponenten der modernen Diktatur keinen Ersatz für den politisch-herrschaftlichen Ansatz der Totalitarismusforschung; überdies vernachlässigt sie die legitime Frage nach der Vergleichbarkeit rechter und linker Diktaturen – eine Frage, die nicht als blosse Ausgeburt des Antikommunismus abgetan werden kann.» Das ist auch nach meiner Erfahrung der springende Punkt: Viele Linke bestehen darauf, der deutsche Nationalsozialismus und der sowjetische Kommunismus dürften generell nicht miteinander verglichen werden, weil in letzterem der christliche Urkommunismus, also das moralisch Gute, enthalten sei, während der Nationalsozialismus, ein Rechtsextremismus der übelsten Sorte, die Vernichtung der «Parasiten am Volkskörper», also der Juden, der Sinti und Roma, der Homosexuellen und der körperlich oder geistig Beeinträchtigten anstrebe. Natürlich ist es richtig, die Verbrechen des Nationalsozialismus auf diese Weise hervorzuheben, aber es ist falsch, gleichzeitig den Sowjetkommunismus zu verharmlosen, indem seine schönen Ideen erwähnt und seine Verbrechen dahinter versteckt werden. Zwar besteht in der Linken spätestens seit dem 20. Parteitag der KPdSU, an dem Chruschtschow die Verbrechen Stalins anprangerte, die Bereitschaft, dies auch zu tun, aber Lenin bleibt mehr oder weniger unantastbar. Dass der Kommunismus auch vor Stalin schon und auch danach Menschenrechte und Demokratie verachtete, wird in dieser Betrachtungsweise völlig verkannt.
Nun, wenn diese Einschätzung für einen Teil der Linken vor 1989 zutraf, so veränderte sich dies in der Gegenwart von 1991, als das Ende der Sowjetunion und das Ende der KPdSU absehbar waren. Präsident Michail Gorbatschow versuchte, das dysfunktionale System aktiv umzubauen. Doch dann geschah Überraschendes. Ich vernahm es mit Verspätung, denn an jenem Magglinger Wochenende hörte ich keine Nachrichten. Als ich am Montag nach Bern fuhr, war ich über die neusten Entwicklungen in Moskau nicht im Bild. Am Bahnhof Bern nahm ich den Bus bis zur Gerechtigkeitsgasse, ging zu Fuss zum Erlacherhof und begab mich ins Sitzungszimmer der Geschäftsprüfungskommission. GPK-Präsident Martin Frick spielte in seiner Begrüssung auf dramatische Ereignisse in Russland an. Ich verstand nicht, worum es ging. Nach der Sitzung klärte mich Otto Mosimann mit ernster Stimme darüber auf, dass konservativ-kommunistische Kräfte gegen Gorbatschow geputscht hätten.
Anders als viele Menschen im Westen, vor allem in Deutschland, war ich nie Gorbi-Fan. Deshalb bewegte mich die Nachricht vom Putsch kaum. Als aber in den folgenden Tagen bekannt wurde, dass die Putschisten versucht hätten, das Weisse Haus, den Sitz des Obersten Sowjets der Russischen Föderativen Sowjetrepublik, zu stürmen, begann mich die Sache zu beschäftigen. Ich fürchtete, Glasnost und Perestrojka könnten rückgängig gemacht werden und die Putschisten könnten wieder einem dogmatischen Betonkopf zur Macht verhelfen. Der Oberste Sowjet, also das russische Parlament, hatte eine Politik der Entstaatlichung eingeleitet, und damit die eingefleischten Kommunisten zum Aufstand bewogen. Der Putsch scheiterte am entschlossenen Widerstand der Moskauer Bevölkerung. Gorbatschow, der in den Ferien am Schwarzen Meer weilte, kehrte nach Moskau zurück. Boris Jelzin, der gewählte Präsident der Russischen Föderation, die den gewichtigsten Teil der Sowjetunion ausmachte, prellte vor und verbot alle Tätigkeiten der Kommunistischen Partei auf russischem Boden. Damit trieb er nicht nur den Prozess der Entstaatlichung in Russland voran, sondern förderte auch die zentrifugalen Tendenzen in den nichtrussischen Sowjetrepubliken.
Die Folgen waren dramatisch. Russlands Wirtschaftsordnung zerfiel; Kriminelle, in Zusammenarbeit mit korrupten Politikern, Geheimdienstlern und Parteifunktionären, rissen Geschäfte und ganze Industrieteile an sich; die Bevölkerung litt. Die baltischen und kaukasischen Staaten, Weissrussland und die Ukraine fielen von Moskau ab und erklärten sich zu souveränen Staaten. Die Balkanstaaten, die der Sowjetmacht indirekt untergeordnet gewesen waren, mussten sich neu orientieren, was auch dort zu chaotischen Zuständen führte. Im Balkan geriet alles ausser Kontrolle. Die «Volksseelen», genährt von Demagogen aller Art, gerieten in heftige Wallungen. In Bulgarien, Rumänien und Albanien kam es zum Umsturz. Am schlimmsten entwickelten sich die Verhältnisse im ehemaligen Jugoslawien, obwohl dieser Staat schon lange Distanz zu Moskau gewahrt hatte. Aber Jugoslawien war selbst ein Vielvölkerstaat, der seit 1989 in seine Teilrepubliken zerfiel. Die neue Staatenbildung war von kriegerischen Auseinandersetzungen begleitet. Der serbische Präsident Slobodan Milosevic liess sich von grossserbischen Nationalisten dazu verleiten, die Armee in die Nachbarländer einmarschieren zu lassen. Das sollte uns in der Schweiz noch speziell beschäftigen. Im Kapitel über Jugoslawen, Kosovaren und Bosniaken werde ich darauf näher eingehen.
Der gefrässige Magen
Manchmal koppelte ich mich bewusst von den grossen Problemen ab und wandte mich Näherliegendem zu. Die Arbeit im Stadtrat und in der GPK nahm ich sehr ernst; ich fand sie wichtig. Anfänglich schien mir die Verbindung von politischer Arbeit und Berufsarbeit sei geradezu ideal, denn die praktische politische Erfahrung erleichterte es mir, die Themen zu erkennen, über die ich schreiben wollte. Doch mit der Zeit wurde das Gefühl stärker, die Politik nehme zu viel Platz ein und meine Arbeit als Historiker und Journalist leide darunter. Die Frage wurde immer dringender, ob ich mein politisches Engagement nicht reduzieren sollte.
25. August 1991
Als Mitglied der GPK hat man viele Papiere zu studieren und viele Sitzungen zu bewältigen. Im Sommerquartal, wenn die Verwaltungsbesuche anstehen, wird das GPK-Mandat zusammen mit den übrigen politischen Tätigkeiten – Stadtratssitzungen, Fraktionssitzungen, SP-Delegiertenversammlungen, SP-Arbeitsgruppen, Sektionsversammlungen, Vorstandssitzungen – rein zeitlich gesehen zu einem Halbtagsjob. Für GPK-Mitglieder, die Angestellte oder Beamte sind und trotz häufiger Abwesenheit den vollen Lohn beziehen, ist das zwar auch eine Zusatzbelastung, aber finanziell kein Problem. Für mich als Selbstständigerwerbender ist es anders, da die mageren Sitzungsgelder keine ausreichende Kompensation sind. Im ersten Halbjahr 1991 bezog ich insgesamt 3600 Franken, wovon noch die Steuern und die Parteisteuer in Abzug kommen. Die eigentliche Entschädigung für GPK-Mitglieder besteht wohl darin, dass sie als Ratsmitglieder mit «Insiderwissen» ein höheres Prestige geniessen, von Verwaltung und Gemeinderat zuvorkommend behandelt und nach den Verwaltungsbesuchen jeweils zu einem ausgiebigen Essen eingeladen werden. Zudem dürfen sie alljährlich auf einer zweitägigen Reise mit diversen Empfängen als Botschafter der altehrwürdigen Stadt Bern auftreten.
In diesem Jahr führte die Reise ins Welschland. Ich fuhr mit, obwohl ich dachte, ich hätte eigentlich Gescheiteres zu tun. Das vorgesehene Besichtigungsprogramm (Glasrecycling-Anlage in Renens, Glasfabrik in St-Prex, Kehrichtverwertungsanlage Cheneviers bei Genf und Umfahrungsautobahn Genf) war vielversprechend und interessierte mich. Ausserdem wollte ich miterleben, wie sich meine Kollegen – die einzige Kollegin in der GPK, Ursula Begert, kam nicht mit – verhalten würden. Das Besichtigungsprogramm erwies sich tatsächlich als interessant, und die Kollegen tranken so viel Wein, wie ich erwartet hatte. Sie schienen im Gefühl zu leben, sie hätten all das gute Essen, die Geschenke und Komplimente unserer Gastgeber, das teure Einzelzimmer im Hotel in Morges und alle die Höflichkeiten und Ehrbezeugungen, die von unserer Seite eifrig erwidert wurden, durch Stellung und Tätigkeit ehrlich verdient. Der Gedanke, das Ganze sei einfach ein Prozess der Korrumpierung, des teilweisen Einbezugs in die Interessen der Geschäftemacher und Profiteure, den ich zwischendurch vorsichtig andeutete, fand keinen Anklang.
Wir trafen uns auf dem Bahnsteig, sieben Männer und drei Frauen. Martin Frick, der freisinnige GPK-Präsident, ist von Beruf Ingenieur und befasst sich beim kantonalen Tiefbauamt mit Lärmschutz. Meistens macht er ein säuerliches Gesicht, zeigt aber manchmal überraschend seine humorvolle Seite. Er ist ein guter Präsident, gut informiert, nicht zu wortreich, lässt allen ihren Platz. Sein Parteikollege Peter Bühler, Elektrotechniker bei der SRG, ist ein Kindskopf, der seine reaktionären Ansichten charmant vorzubringen weiss. Hans Imesch (CVP), Generalvertreter einer Versicherungsgesellschaft und früherer Bundesbeamter, ist ein selbstbewusster Walliser, der sich auf Finanzfragen spezialisiert hat und beständig nach Sparmöglichkeiten bei der öffentlichen Hand sucht. In seinem Privatleben spart er nicht, denn er verdient gut, kommt immer elegant gekleidet daher und fährt einen grossen, neuen Mercedes. Manchmal verblüfft er mich durch seine offene Haltung und seine sozialen Ansichten, die allerdings eher propagandistischer Art sind. Hans Zwahlen von den Schweizer Demokraten ist kein Kirchenlicht, versteht es aber, den Eindruck zu erwecken, er sei mindestens Prokurist einer grösseren Firma, was mitnichten der Wahrheit entspricht. Essen und Trinken gehen ihm über alles. Hans Imesch lacht über ihn, weil er völlig unkritisch übernimmt, was der Gemeinderat vorschlägt. André Seydoux von der grünen Fraktion ist ein linker Anwalt, der seinerzeit Leute der 1980er Jugendbewegung, die wegen Sachbeschädigung oder Ähnlichem angeklagt wurden, erfolgreich verteidigte. Er ist an einem industriellen Kompostierungsprojekt beteiligt, das nach seinen Aussagen finanziell sehr interessant werden könnte. Ständig trägt er ein kleines Natel-Telefon (Kostenpunkt etwa 4000 Franken) mit sich herum und telefoniert von Bus und Zug aus mit seinem Anwaltsbüro. Von ganz anderer Art ist mein SP-Kollege Res Nacht, Lokomotivführer und solider Gewerkschafter, der bei allen Geschäften, die auch Arbeitsplätze betreffen, zuerst nach den Arbeitsbedingungen fragt. Bei Geschäften, die aus SP-geführten Direktionen kommen, ist er unkritisch, bei den anderen ist er misstrauisch. Ueli Brönnimann vom Jungen Bern spielt den Lausbuben. Das Gängige stellt er in Frage und sucht nach der Alternative. Otto Mosimann von der EVP ist ein stets freundlicher Mensch, dem man abnimmt, dass er moralische Grundsätze verinnerlicht hat und danach lebt. Mit dabei waren ausserdem Margrit Kohler, unsere Protokollführerin, Marianne Staub, unsere juristische Sekretärin, und Brigitte Bigler, Mitarbeiterin der Stadtkanzlei. Während der ganzen Reise blieben sie diskret am Rand des Geschehens.
In Renens wurden wir von Direktor Weiss von der Vetro-Recycling AG empfangen, einem versoffenen Manager der jovial-militärischen Art. Er zeigte uns die Fliessbänder, auf denen die eingesammelten und zertrümmerten Glasflaschen heranfuhren. Geistig behinderte Menschen standen am Band und suchten keramische und metallische Fremdkörper zwischen den Glasscherben heraus. Die so gereinigte Ware wurde dann waggonweise an die Glasfabriken weitergeleitet. Nach dieser ersten Besichtigung lud uns Direktor Weiss in eine Fressbeiz in Essertines oberhalb von Rolles ein. Der Weisswein stand schon bereit. Nachdem wir aus kleinen Gläsern fleissig getrunken hatten, setzten wir uns zu Tisch, vertilgten ein mehrgängiges Essen und tranken dazu roten Wein. Die Gespräche schwankten zwischen fachlich-interessiert, witzig, dümmlich und schlüpfrig. Direktor Weiss vergass nicht, jede Frage, die wir ihm stellten, als wichtig oder interessant zu bezeichnen.
Am Nachmittag besichtigten wir unter Führung von Direktor Kübler die Glasfabrik in St-Prex. Wie Weiss war er ein Deutschschweizer, aber sprachlich gut assimiliert und wesentlich sympathischer als jener. Die Glasfabrik mit einem Ausstoss von einer Million Flaschen pro Tag war beeindruckend. Zum Abschluss der Besichtigung gab es wieder Wein, und zwar vom besten (Dézalay Chemin de Fer), und für jeden von uns einen Regenschirm mit dem Recycling-Signet darauf. Wir verabschiedeten uns und fuhren zum Hotel «Mont Blanc» in Morges. Dort assen und tranken wir erneut ausgiebig. Ich bemühte mich, bei der Tischunterhaltung mitzumachen, die, immer lauter, in kürzer werdenden Abständen von Lachsalven unterbrochen wurde. Neben mir sass André Seydoux und vis-à-vis Hans Imesch. Mit den beiden im Gespräch zu bleiben, war nicht allzu schwierig, und doch strengte es mich an. Als Dessert, Kaffee und Schnaps serviert waren, zündete Hans eine Zigarre an, die er elegant zwischen Zeigfinger und Mittelfinger eingeklemmt hielt, und schlug vor, man könnte doch nachher, wenn der Speisesaal geschlossen würde, noch in eine Bar gehen. Das war mir nun doch zu viel. Ich gab vor, ich müsse zur Toilette, schlich mich aber auf mein Zimmer. Dort riss ich mir die Kleider vom Leib, denn es war unerträglich heiss. Obwohl schon bald Mitternacht war, wollte ich noch ein wenig TV gucken. Da ich selbst kein Gerät besass, genoss ich es bei jedem Hotelaufenthalt, durch die verschiedenen Kanäle zu zappen. Hier standen sagenhafte elf Sender zur Verfügung, und in einer Nachrichtensendung sah ich, wie Gorbatschow, von der Krim nach Moskau zurückgekehrt, der internationalen Presse mitteilte, der Putsch gegen ihn sei endgültig gescheitert. Die gleiche Szene war immer wieder auf allen Kanälen zu sehen. Ich lag auf dem Bett, als draussen ein Gewitter losbrach. Durchs offene Fenster drang frische Luft ins Zimmer. Ich zappte weiter, und nach Mitternacht zeigte das Westschweizer Fernsehen eine dümmliche Show, in der eine Sängerin, sich wiegend und weiter singend, völlig unmotiviert ihr enganliegendes Kleid auszog, während eine andere Frau kichernd an den eigenen Brustwarzen herumfummelte. Ich hatte schon davon gelesen, dass sich nun auch das Schweizer Fernsehen auf das schlüpfrige Gebiet vorwage, aber ich war dennoch erstaunt, als ich es sah.
Am anderen Morgen stiegen wir nach dem Frühstück in einen Bus. Die meisten Kollegen sahen etwas zerknittert aus und schliefen während der Fahrt ein. In Cheneviers bei Genf stiegen wir vor einer riesigen Kehrichtverbrennungsanlage aus. Direktor Spoerli, ein schlanker Mann im besten Alter, empfing uns. Er dankte uns dafür, dass wir ihm während des Umbaus seiner Anlage, als die Verbrennungskapazität vorübergehend eingeschränkt gewesen sei, einen Teil des Kehrichts abgenommen hätten. Seine Schmeicheleien dämpfte er durch eine Prise Ironie. Nachdem er uns eine kurze Tonbildschau gezeigt hatte, führte er uns durch die Anlage. Er tat es auf charmante Art und wirkte gleichzeitig kompetent. Als Maschineningenieur versteht er die technische Seite seines Jobs bestens, scheint aber auch die politische Seite zu beherrschen. Offenbar war es ihm gelungen, seinem Chef, Regierungsrat Christian Grobet, die Notwendigkeit einer möglichst sauberen Verbrennung des Mülls darzulegen und den Einbau besonders effizienter, aber auch besonders teurer Filteranlagen bewilligt zu bekommen.
Das Mittagessen wurde uns in einer Bauarbeiterkantine bei Cartigny serviert, wo ein Tunnel für die Umfahrungsautobahn von Genf gebaut wird. Dieser Autobahnabschnnitt ist gemäss den landschaftsschützerischen Erkenntnissen der letzten Jahre neu geplant worden und wird möglichst ins Gelände hineinversenkt und durch Pflanzungen verdeckt, so dass sie optisch und akustisch wenig auffällt. Vor 20 Jahren wäre so etwas wohl aus Kostengründen abgelehnt worden. Der Kantonsingenieur, der uns auf die Baustelle führte, war ein assimilierter Deutscher, der ein mässiges Französisch und ein schauderhaftes Deutsch sprach. Er hatte auf seinem dicken Kinn, auf Hals und Wangen einen Stoppelbart wie Arafat und sein Bauch hing über die Jeanshosen hinunter. Sein Vortrag war gespickt mit Seitenhieben gegen Journalisten, Juristen und andere Meckerer, wobei die Quintessenz war, dass dank allen diesen Meckerern jetzt ein viel besseres als das ursprünglich geplante Projekt realisiert werden konnte.
Als wir am Abend in einem Erstklasswagen des Intercity-Zugs zurück nach Bern fuhren, war ich sehr müde und nicht mehr in der Lage, mit den anderen zusammen im Speisewagen den Inhalt einer Bündner Platte mit Wein herunterzuspülen. Stärker als bisher ist mir seither bewusst, dass ich zum Politiker nicht tauge, weil mein Magen zu wenig gefrässig ist. Ich denke, Ende Jahr werde ich mein Mandat zurückgeben, damit ich wieder mehr Zeit fürs Recherchieren und Schreiben habe.
Soweit meine Tagebuchnotizen. Ende 1991 trat ich tatsächlich aus der GPK aus, blieb aber im Stadtrat. Am 6. Dezember 1992 waren Gemeindewahlen. Beim Wahlkampf machte ich mit, so gut ich konnte. Unser Ziel war es, mehr Frauen in den Stadtrat zu bringen. Das gelang, und auch insgesamt war die SP erfolgreich. Zusammen mit den Grünen und der Mitte hatte sie nun eine absolute Mehrheit in Stadt- und Gemeinderat. Diese Rot-Grün-Mitte-Koalition, die sogenannte RGM-Mehrheit, sollte sich lange halten. Obwohl ich auch mit einem guten Resultat wiedergewählt worden war, trat ich kurz danach aus dem Stadtrat aus und übernahm zusammen mit dem Philosophen Urs Marti die Redaktion der «Roten Revue», der Theoriezeitschrift der SP Schweiz. Es wurde mir vorgeworfen, ich hätte schon vorher gewusst, dass ich zurücktreten wolle, und hätte mich nur wählen lassen, um einem schlechter platzierten Kandidaten den Sitz zu sichern. Tatsächlich war ich schon vor den Wahlen nicht sicher gewesen, ob ich weiterhin im Stadtrat politisieren wollte. Als mir klar war, dass ich bei der «Roten Revue» mitmachen würde, entschied ich mich definitiv zum Rücktritt. Manche meiner Kolleginnen und Kollegen nahmen mir das übel und betrachteten mich als eine Art Fahnenflüchtigen.
Was ist Sozialismus?
Fabrizio Boeniger war Gymnasiallehrer und Bildungsverantwortlicher der SP Schweiz. Zusammen mit seiner Frau, ebenfalls Lehrerin, und einem Papagei lebte er in Dachsen am nördlichen Ende des Kantons Zürich. Er war weder gross noch klein, weder dick noch dünn, freundlich im Auftreten, so dass seine Vorliebe für ironische Bemerkungen nie verletzend wirkte. Sozialdemokrat durch und durch, war er weniger durch bestimmte Theorien geprägt als vielmehr durch seine Parteiarbeit. Jährlich führte er im Nanen der SP Schweiz Bildungskurse durch. Seit 1989 half ich ihm dabei, und wir schrieben Kurse zur Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung aus. Der erste fand im Tessin statt, im Hotel des Arbeiterhilfswerks in Cavigliano. Wir arbeiteten mit den grösstenteils jungen SP-Mitgliedern in Lerngruppen, leiteten zur Lektüre von Quellentexten an, hielten Einführungsreferate, zeigten Filme und wagten uns sogar an Rollenspiele. Zu bestimmten Themen luden wir externe Referentinnen und Referenten ein. In Cavigliano war Arnold Künzli als exzellenter und kritischer Marx-Kenner dabei. Ich kannte ihn von diversen Diskussionen über Selbstverwaltung und schätzte ihn als einstiges Mitglied einer SP-Kommission, die ein neues SP-Parteiprogramm vorbereitet hatte, das dann am Widerstand traditioneller SP-Mandatsträger scheiterte. Als emeritierter Professor für Philosophie der Politik bekundete Künzli anfänglich ein wenig Mühe mit den lockeren Umgangsformen in unserem Kurs, denn im Grunde war er schüchtern. Doch er fand sich damit ab, dass ihn alle duzten. Was ihm Halt gab, war sein Hund, der ruhig und lautlos neben seinem Stuhl am Boden lag.
Für mich war die Auseinandersetzung mit den Kursleuten sehr aufschlussreich. Einige stammten aus traditionellen SP-Familien und hatten das linke Gedankengut sozusagen mit der Muttermilch eingesogen; für sie war ein linkes politisches Engagement eine Selbstverständlichkeit. Andere kamen aus bürgerlichem Milieu und begründeten ihre linke Haltung mit ethischen oder religiösen Grundsätzen. Es gab auch Technokraten wie den jungen Eisenbahningenieur, der bei den SBB arbeitete und überzeugt war, dieser Staatsbetrieb hätte das Potenzial, viel mehr für eine ökologisch nachhaltige Mobilität zu tun, wenn nur alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft würden. Ein Schlüsselerlebnis war für mich die Diskussion mit einem Mechaniker der Verkehrsbetriebe Biel. Er war Familienvater, besass ein Auto, ein Motorrad und ein Segelboot. Sein Einkommen lag weit über meinem. Trotzdem fühlte er sich benachteiligt. Er werde immer als Tschumpel behandelt, meinte er; nur die Studierten könnten wirkliche Wertschätzung erfahren. Warum und in welchen Situationen er sich als Tschumpel fühlte, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht hatte er einen arroganten Vorgesetzten, vielleicht lag es an seinem schwachen Selbstbewusstsein. Ich weiss es nicht. Aber es wurde mir deutlich, dass eine gute handwerkliche Ausbildung, ein ausreichendes Einkommen und sogar ein wenig Luxus nicht ausreichen, um den prestigemässigen Vorsprung, den eine akademische Ausbildung verschafft, zu kompensieren oder aufzuholen. Musste es also das Ziel sozialdemokratischer Bildungspolitik sein, möglichst allen jungen Menschen zu einer akademischen Bildung zu verhelfen? Oder ging es eher darum, auch nichtakademischen Berufen höheres Prestige zu verleihen? Wenn ich in Betracht zog, wie sehr ich gute Handwerker, ihr Wissen und Können bewunderte, schien mir letzteres gar nicht so schwierig zu sein.
Die Begegnungen in den Bildungskursen bestärkten mich in meinem Glauben an die Möglichkeit einer friedlichen und sozialistischen Zukunft in Europa. Gerade wegen des Zusammenbruchs des «Realsozialismus» in der DDR und in vielen anderen Ländern schien mir die Chance, dass die SP Schweiz vermehrten politischen Einfluss gewinnen würde, gewachsen zu sein. Denn es würde rechten Kräften nun nicht mehr möglich sein, Verbindungen zwischen der SP und autoritären Regimen im Osten zu unterstellen. Auch bei den meisten der eingeladenen Referentinnen und Referenten stellte ich einen gewissen Optimismus fest. Manche blieben nach Kursende noch zum Abendessen, so dass wir weiterdiskutieren konnten und sie im lockeren Gespräch noch besser kennen lernten. Grossen Eindruck machte mir Hansjörg Braunschweig, ein rundlicher Mann mit blitzenden Gedanken und einer unerschütterlich pazifistischen Haltung. Er stand dem religiösen Sozialismus nahe und engagierte sich mit Leib und Seele für Menschen am Rand der Gesellschaft. Zudem macht er bei der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSOA) mit, obwohl er mit Jahrgang 1930 zu einer anderen Generation als die im Durchschnitt viel jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten gehörte; er wurde von ihnen akzeptiert. Was er dachte, lebte er auch; bei ihm schien es keine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis zu geben.
Die SP-Bildungskurse fanden jedes Mal an einem anderen Ort statt. Im Sommer 1993 waren wie im Kurshaus Lindenbühl bei Trogen. Es war ein wunderschöner Ort mit Aussicht auf das hügelige Appenzellerland. Auf dem Programm standen wiederum Referate, Lektüre, Diskussionen, Rollenspiele, Filme. Unser Angebot war breit. Wir diskutierten über Frühsozialismus, Marxismus, Anarchismus, Reformismus, Leninismus, Stalinismus und religiösen Sozialismus. Unter den etwa 20 Kursteilnehmerinnen griff eine Art Bildungseuphorie um sich, und am Ende der Woche waren manche geradezu übermotiviert und wollten sogleich in ihren Sektionen, in der Kantonalpartei und letztlich auch in der SP Schweiz ein neues Feuer entfachen und zum entschiedenen Handeln aufrufen. Die sozialistische Idee sei wichtiger denn je, meinten sie, und es gelte, die Revolution voranzutreiben. In dieser Stimmung verabschiedeten wir uns voneinander. Die meisten hatten ihr Köfferchen oder ihren Rucksack schon gepackt und waren bereit zur Abreise. Da kamen Charles und Eva auf mich zu und verwickelten mich in eine längere Diskussion. Zunächst baten sie mich dringend, etwas von dem, was wir gemeinsam während der vergangenen Woche erarbeitet hatten, in die «Rote Revue», deren Ko-Redaktor ich war, einfliessen zu lassen. Offensichtlich hatten sie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, was sie aus dem Kurs mit nachhause nehmen wollten.
Charles, der SBB-Ingenieur, meinte, in der SP sei alles aufgehoben, was in den vergangenen 150 Jahren an sozialen Ideen geäussert worden sei; eigentlich komme es nur darauf an, das Vergessene wieder hervorzuholen. Das gelte vor allem für den Marxismus. Darauf sagte ich, in den letzten zehn Jahren seien viele alte Achtundsechziger, zu denen ich mich selbst auch zählte, in die Partei eingetreten, und viele von ihnen hätten sich den Marxismus als Grundlage für ihr Weltverständnis angeeignet. Einige seien rasch die politische Karriereleiter hinaufgeklettert, so dass heute in der SP-Bundeshausfraktion nach meiner Einschätzung eher zu viel als zu wenig Marxismus vorhanden sei. Eva, die Sozialarbeiterin, wollte von Charles wissen, was es seiner Meinung nach hervorzuholen gelte, wenn er sich mehr Marxismus in der Partei wünsche. Vor allem die Einsicht, dass das Sein das Bewusstsein bestimme, sagte er. Die Aussagen der Politiker und Politikerinnen, aber auch der führenden Leute in Wirtschaft und Verwaltung sollten immer in Relation gesetzt werden zu den Lebensumständen, in denen diese Leute steckten, zu den Interessen, die sie antrieben. Nur so sei eine realistische Einschätzung der widersprüchlichen politischen Kräfte möglich. Damit sei ich einverstanden, sagte ich. Wenn ich bei der Bundeshausfraktion eher zu viel als zu wenig Marxismus sehe, so meine ich etwas anderes, nämlich die Überzeugung, das Proletariat sei die revolutionäre Kraft, die mit geschichtlicher Notwendigkeit den Sozialismus und als dessen höchste Stufe den Kommunismus herbeiführen werde. Mit dieser Idee im Hinterkopf sähen sich die am linken Rand politisierenden Mitglieder der Bundeshausfraktion als Erfüllungsgehilfen einer objektiven geschichtlichen Tendenz. Damit neigten sie zum Dogmatismus, und ihre unflexible Haltung, etwa in der Frage, welche Aufgaben der Staat zu erfüllen habe, erschwere eine pragmatische Reformpolitik, die eben nur möglich sei, wenn linke Politikerinnen und Politiker den Kompromiss mit den bürgerlichen Parteien suchten.
Charles war erstaunt über diese Aussage. Ich hätte doch im Kurs von der Notwendigkeit einer Revolution gesprochen; warum ich denn jetzt eine kompromisslerische Reformpolitik befürworte. Revolution sei ein grosses Wort, sagte ich, und als Muster für gelungene Revolutionen hätten wir immer die Französische Revolution von 1789 und die Russische Revolution von 1917/18 vor Augen. Aber eine Revolution sei kein in sich geschlossenes Ereignis, das rasch seinen Abschluss finde, sondern entstehe aus langfristigen Prozessen, die erst in der Rückschau als revolutionär wahrgenommen würden. Die Französische Revolution sei im Grund genommen bis heute nicht abgeschlossen. Arnold Künzli habe das in seinem kürzlich erschienenen Buch «Trikolore auf halbmast» einleuchtend dargelegt. Wenn ich von Revolution gesprochen habe, hätte ich diesen langfristigen Prozess gemeint.
Das sei ihr zu theoretisch, meinte Eva. Linke Politik sei doch einfach Politik für die unteren sozialen Schichten. Es sei wichtig, an diesem Grundsatz festzuhalten, zumal die alten Achtundsechziger, die jetzt in der Partei so tonangebend seien, mehrheitlich aus der Mittel- oder gar der Oberschicht stammten. Manche hätten nicht genug Sensibilität für die Probleme der Büezer, der schlecht bezahlten Frauen, der Alleinerziehenden, der Verkäuferinnen, Coiffeusen usw. Deren Interessen gelte es zu wahren, und wer, wenn nicht die SP, könne das tun.
Einverstanden, sagte Charles, aber man müsse auch weiterdenken, und da sei die Theorie von Marx immer noch hilfreich. Das Interesse der Kapitalbesitzer bestehe darin, den Profit zu maximieren. Soziale Ungleichheit trage dazu bei, die Löhne in gewissen Sektoren tief zu halten, was immer im Interesse der Unternehmer sei. Solche Zusammenhänge müsse man begreifen, um die richtigen Strategien dagegen zu entwickeln. Und er fügte hinzu: «Unser Ziel ist der Sozialismus, also eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, in der der Staat für mehr Gleichheit und mehr Gerechtigkeit sorgt und in der die Banken und die Schlüsselindustrien verstaatlicht sind. »
«Du gehst davon aus, dass die linken Intellektuellen Strategien entwickeln müssen, wie die SP den Sozialismus herbeizwingen könnte», entgegnete Eva. «Es kommt aber zunächst darauf an, dass die alleinerziehenden Mütter, die Coiffeusen, die Fabrikarbeiterinnen und die Verkäuferinnen merken, wie ungerecht sie behandelt werden, und dass sie sich zuerst einmal selbst wehren. SP-Politik besteht darin, sie zu unterstützen.»