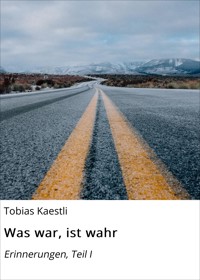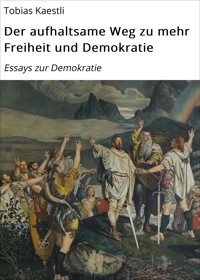
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn die AfD in Deutschland und die SVP in der Schweiz sich verbal für die Demokratie stark machen, ist es eine Irreführung der Öffentlichkeit, denn Demokratie kann nicht gedeihen, wo in populistischer Manier die gegnerischen Parteien heruntergemacht und bewusst Unwahrheiten erzählt werden. Die liberale Demokratie setzt eine an der Wahrheit orientierte Diskussionskultur voraus. Der Autor vertritt die These, heute brauche es in Deutschland und in der Schweiz nicht weniger, sondern mehr direkte Demokratie. Es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern, ob sie sich für die Demokratie engagieren oder ob sie deren Zerfall widerspruchslos hinnehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tobias Kaestli
Der aufhaltsame Weg zu mehr Freiheit und Demokratie
Essays zur Demokratie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt
Die schweizerischen Parteien und die Demokratie
Zerfall der liberalen Demokratie
Gründungsmythos der Schweiz
Impressum neobooks
Inhalt
Der aufhaltsame Weg zu mehr Freiheit und Gerechtigkeit
Essays zur Demokratie
von Tobias Kaestli
Schwierige Demokratie
Es ist eine fundamentale Regel der Demokratie, dass Kandidaten, die eine Wahl verloren haben, dies sogleich anerkennen, wenn nicht offensichtlich Fehler im Wahlverfahren vorliegen. Deshalb war es eigentlich schon ein Frontalangriff auf die Demokratie, als Trump nach dem Wahlsieg von Jo Biden im November 2020 von einer «gestohlenen Wahl» sprach und deutlich machte, dass er Präsident bleiben wolle. Am 6. Januar 2021 sollte im US-Kongress das Ergebnis der Präsidentschaftswahl bestätigt werden. Trump rief seine Anhänger zum Protest auf. Ein gewaltbereiter Mob drang ins Kapitol ein und richtete Chaos und Verwüstung an. Ich war entsetzt und empört, schrieb sofort an Freunde und Bekannte, um mich zu versichern, dass ich mit meinen Gefühlen nicht allein war.
Damals war ich noch überzeugt, die Kongressabgeordneten beider Parteien und die Gerichte würden den Angriff auf das Zentrum der amerikanischen Demokratie hart bestrafen. Das war ein Irrtum. Zwar wurden viele Krawallanten vor Gericht gebracht und zu Gefängnisstrafen verurteilt, aber der eigentlich Verantwortliche, Donald Trump, blieb ungestraft. Die nächsten vier Jahren nutzte er dazu, eine höchst unanständige Kampagne gegen Jo Biden und die Demokraten zu führen, die Republikaner hinter sich zu scharen und seine erneute Wahl vorzubereiten. Tatsächlich ist er am 5. November 2024 zum zweiten Mal gewählt worden und kann nun vom Oval Office aus seine Angriffe auf die liberalen Institutionen und auf die geschriebenen und die ungeschriebenen Gesetze der Demokratie effizient vorantreiben. Gleichzeitig stellt er völkerrechtliche Regeln in Frage und boykottiert diverse UNO-Organisationen.
Die scheinbar so stabile US-Demokratie ist bis in ihre Grundfesten erschüttert. Das hat weltweite Auswirkungen. Autokraten und Möchtegerndiktatoren fühlen sich bestätigt und kaum noch verpflichtet, ihr Tun und Lassen zu rechtfertigen. Sie geben sich als effiziente Staatenlenker aus und stützen sich auf die Reichen und Superreichen, die sie mit Steuererleichterungen und anderen Privilegien an sich binden. In Westeuropa ist es noch nicht so weit, aber überall bereiten sich rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien darauf vor, die Macht an sich zu reissen.
Wie sieht es bei uns in der Schweiz aus? Könnte auch unser Staat, der in der Vergangenheit oft als «Schwesterrepublik» der USA bezeichnet wurde, weil er, wie diese, ein Bundesstaat ist und ein Zweikammersystem hat, von Rechtsextremisten und Populisten gekapert werden? Scheinbar ist die Demokratie in der Schweiz unangefochten; von links bis rechts bekennen sich die Parteien zur Demokratie. Am eifrigsten tut es die SVP. Doch was genau versteht sie unter Demokratie? Liegt sie nicht eigentlich auf einer rechtspopulistischen Linie, die letztlich zur Abschaffung des liberalen Rechtsstaates und der liberalen Demokratie führt? Befindet sie sich nicht auf ähnlichem Kurs wie die Alternative für Deutschland (AfD)? Alt Bundesrat Ueli Maurer (SVP) hat sich seit seinem Rücktritt aus der Landesregierung mehrmals in einer Weise geäussert, die dies nahelegt. Der ehemalige SVP-Nationalrat und Weltwoche-Chef Roger Köppel pflegt Kontakte zu Rechtsextremisten in Deutschland und kungelt mit Ungarns Ministerpräsident Orbán, der sich ausdrücklich zum «Illiberalismus» bekennt. SVP-Nationalrat Gregor Rutz tut alles, um die SRG, die der liberalen Demokratie verpflichtet ist, zu schwächen und folgt damit einer typisch rechtspopulistischen Agenda. Christoph Blocher, Milliardär und Graue Eminenz der SVP, vermeidet es zwar, Verwandtschaften mit ausländischen Rechtsextremisten zu benennen, aber die Ähnlichkeit seiner Ideen mit denjenigen einer Marine Le Pen oder eines Herbert Kickl sind offensichtlich. Wenn er sich nicht an ihnen orientiert, so zumindest sie an ihm.
Die Idee der Demokratie, die sich nach dem Mauerfall 1989 aufmachte, die Welt zu erobern, ist heute im Sinkflug. Am 1. April 2025 veröffentlichte «Der Bund» einen Artikel unter dem Titel «Das Vertrauen in die Demokratie bröckelt – ausser in der Schweiz». Darin wird über die Ergebnisse einer Umfrage zum Zustand der Demokratie berichtet: Gallup International fragte zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 rund 44 000 Personen in 43 Ländern, ob ihre Regierungen «nach dem Willen des Volks» handelten. In Deutschland bejahten nur 39 Prozent diese Frage; in England waren es 45 Prozent und in Italien 47 Prozent. In diesen Ländern ist also eine Mehrheit misstrauisch gegenüber dem Regierungshandeln und glaubt nicht, dass dieses demokratisch legitimiert sei. Demgegenüber sind in der Schweiz immerhin 69 Prozent der Befragten der Meinung, im Regierungshandeln drücke sich der Wille des Volks aus; in Finnland sind es 72 Prozent.
Der längerfristige Trend zeigt in vielen Ländern eine zunehmende Skepsis gegenüber der Demokratie. In den USA fühlten sich im Jahr 2000 noch 66 Prozent der Befragten von der Regierung vertreten, 2024 waren es nur noch 43 Prozent. In Deutschland sank dieser Wert von 53 auf 39 Prozent. Es mag sein, dass in der Schweiz das Vertrauen in die Demokratie vergleichsweise hoch ist, was damit zusammenhängen könnte, dass wir über direktdemokratische Mittel (Volksinitiative, Referendum) verfügen.
Doch auch bei uns zeigen sich Abnutzungserscheinungen. Viele kleine Gemeinden haben Mühe, Gemeindepräsidenten im Nebenamt zu finden. Die Aufgaben werden immer anspruchsvoller, und gleichzeitig greift unter Gemeindemitgliedern die Lust um sich, die Behörden hart und oft ungerechtfertigt zu kritisieren, wenn diese nicht genau das tun, was sie persönlich wollen. Im «Bieler Tagblatt» vom 12. April 2025 stand ein aufschlussreiches Interview mit der ehemaligen Gemeindepräsidentin von Studen und dem ehemaligen Gemeindepräsidenten von Safnern. Dieser fühlte sich im Amt zunehmend überlastet und schlitterte in ein Burnout. Jene war nahe daran, ihr Amt vorzeitig abzugeben. Speziell zu schaffen machte ihr, dass ihr grosses Engagement für mehr Schulraum und eine neue Turnhalle von der Gemeindeversammlung abgelehnt wurde, nachdem sich ein Gegenkomitee gebildet hatte. Im Interview sagt sie: «Es hat mich schon getroffen. Nicht dass das Projekt abgelehnt wurde. Mehr die Art und Weise, wie es bekämpft wurde. Drei Jahre lang haben wir daran gearbeitet und wurden dann abgekanzelt, als hätten wir schnell, schnell etwas dahingeplant. Es hat mir schon zugesetzt, dass die Organisatoren des Komitees nicht vorher zu mir gekommen sind und stattdessen ein Komitee organisiert haben.» Der Ex-Gemeindepräsident von Safnern machte ähnliche Erfahrungen: «Mich dünkt auch, dass die Bevölkerung kritischer wurde. Etwa, dass einige gleich zur Regierungsstatthalterin gehen, statt Anliegen erst einmal mit dem Gemeinderat zu besprechen.»
Dass die Bürger kritisch sind, gehört zur Demokratie. Ebenso aber, dass sich Menschen bereitfinden, für ein Amt zu kandidieren, in dem sie nicht übermässig entlöhnt werden, aber etwas für die Allgemeinheit tun können. Sie verdienen zumindest Respekt und wohl auch ein wenig Vertrauen. Geht das Vertrauen verloren, zu Recht oder zu Unrecht, wankt die Demokratie. So weit ist es bei uns zum Glück noch nicht. Glaubt man der Gallup-Umfrage, funktionieren die Regierungen und Verwaltungen auf den Ebenen der Gemeinden, der Kantone und des Bundes zufriedenstellend, so dass eine Mehrheit dem demokratischen System vertraut.
Aber was stellen sich diejenigen vor, die nicht glauben, dass die Regierungen sich am Volkswillen orientieren und deshalb die Demokratie verraten? Was ist eigentlich mit dem Volkswillen gemeint? Es ist ein Begriff, den die Rechtspopulisten gerne brauchen. Sie tun so, als stünde dem Volk eine Classe politique gegenüber, die in ihrem eigenen Interesse regiert und den Volkswillen missachtet. Erst wenn diese Elite beseitigt wird und die Populisten die Staatsgewalt übernehmen, kann der Volkswille durchgesetzt werden. Hinter diesem populistischen Diskurs steckt die Vorstellung, das Volk sei eine Einheit, ein Körper mit einem einheitlichen Willen. Die Populisten, im Gegensatz zur Classe politique, kennen diesen Willen, und sie versprechen, ihm zum Durchbruch zu verhelfen.
In Wirklichkeit gibt es natürlich keinen einheitlichen Volkswillen, sondern viele unterschiedliche Interessen, unterschiedliche politische Vorstellungen und unterschiedliche Wertsysteme. Das Kennzeichen der Demokratie ist es nicht, einem irgendwie gearteten Volkswillen zum Durchbruch zu verhelfen, sondern in einem durch Verfassung und Recht geregelten Verfahren aufgrund möglichst vieler Informationen eine öffentliche Diskussion zu führen und im fairen Wettbewerb zwischen den Parteien die bestmögliche Lösung für die anstehenden Probleme zu finden. In seinem neusten Buch Nexus beschreibt Yuval Noah Hariri die Demokratie als ein Informationsnetzwerk, das möglichst dezentrale Entscheidungen fällt und das fähig ist zur Selbstkorrektur. Damit ist sie das Gegenmodell zur Diktatur, in der alle Informationen an eine Zentrale gehen, die dann entscheidet und ihre Entscheide auch dann durchsetzt, wenn sie falsch sind, und die kaum Selbstkorrekturmechanismen kennt. Mit Jürgen Habermas kann man auch sagen: Demokratie ist ein Prozess der Kommunikation und der Deliberation. So gesehen beschränkt sich Demokratie keineswegs auf Regierungshandlungen und Parlamentsberatungen, und sie ist nicht garantiert, wenn es regelmässig Wahlen gibt. Demokratie ist etwas viel Umfassenderes. Sie setzt eine verantwortungsbewusste Bevölkerung voraus, Gewaltenteilung mit unabhängigen Gerichten, freien Medien und Mechanismen der Selbstkorrektur.
In der Schweiz ist das alles gegeben. Allerdings droht die «vierte Gewalt» als kritische Instanz wegzubrechen: Die traditionellen Medien sind in einer Krise und die neuen Medien lassen es oft an Verantwortungsbewusstsein fehlen. Das machen sich die Populisten zunutze. Durch Verbreitung von Hassrede, Verschwörungstheorien und frei erfundenen Geschichten säen sie Misstrauen. Vor allem auf Bundesebene wird das spürbar, weil dort die SVP öffentlichkeitswirksam gegen die Classe politique agitieren kann. Wahlweise schiesst sie auf eine amtierende Justizministerin, die angeblich ein «Asylchaos» veranstaltet, oder auf eine Verteidigungsministerin, die «falsche Prioritäten» setze, weshalb sie unverzüglich zurückzutreten habe. Freiheit, Neutralität sowie die äussere und die innere Sicherheit der Schweiz seien bedroht, weil die Fau Bundesrätin sich «lieber mit Gender-Themen in der Armee als um die Ausrüstung» kümmere.
Man kann solche Statements der SVP als Politgeplänkel abtun, aber dahinter steckt System. Trotz ihrer ständigen Beteuerung, ihr gehe es um die Erhaltung der direkten Demokratie, unterminiert die SVP-Spitze diese konsequent, indem sie nur ihre eigene Meinung gelten lässt, und alles, was ihr nicht passt, mit heftigen oder unflätigen Worten heruntermacht. Wer auf anderen herumhackt, wie es Trump und seine Nachahmer tun, will gegen alle Beteuerungen nicht Demokratie, sondern illiberalen Autoritarismus. Wir sollten nicht warten, bis es so weit ist, sondern uns rechtzeitig wehren.
Lust auf Demokratie
An meinen 20. Geburtstag trug ich ein Minenwerferrohr auf den Jaunpass. In den Taschen meines Tarnanzugs steckten Gasmaske, Feldflasche und Gamelle, der Kampfrucksack und der Spaten hingen am Rücken, der Helm am Gurt. Es war heiss, das Rohr wog schwer auf meiner rechten Schulter. Aber nichts konnte meine gute Laune verderben. Zwanzig Jahre alt zu werden, bedeutete, im rechtlichen Sinn mündig zu werden. Als Rekrut der Schweizer Armee war ich faktisch entmündigt, aber an jenem Tag überwog die erhebende Vorstellung, dass ich von nun an in Gemeinde-, Kantons- und Bundesangelegenheiten mitbestimmen und an Wahlen für öffentliche Ämter teilnehmen durfte.
Mündig zu sein, war für mich das höchste aller Gefühle. Die Eltern als Vormünder war ich los; nun wollte ich ein nützliches Glied der Gesellschaft werden, dazu gehören, mitbestimmen, unsere Zukunft mitgestalten. Dass dies in unserem Land, der Schweiz, möglich war, schien mir selbstverständlich, denn wir lebten in einer gefestigten Demokratie, in der besten Demokratie der ganzen westlichen Welt. Im kommunistischen Osten blieben die Menschen ein Leben lang entmündigt; sie wussten nicht, was Demokratie ist; sie wurden vom Staat oder von der Staatspartei gegängelt. Wir mussten aufpassen, dass wir von diesem totalitären System nicht unterwandert oder angegriffen wurden. Im Fall eines tatsächlichen Angriffs mussten wir mit unserer Armee zurückschlagen. So wurde uns Rekruten die Lage geschildert. Ein Teil von mir akzeptierte diese Erzählung. Allerdings hatte ich in den letzten Jahren am Gymnasium und zu Beginn meines Studiums an der Universität Bern eine Neigung entwickelt, auf eine andere Erzählung zu hören. Ich wurde kritischer, sogar ein wenig aufmüpfig. Ernsthaft hatte ich mir überlegt, den Militärdienst zu verweigern. Die Angst vor dem Gefängnis hinderte mich daran. Zudem sagte ich mir, es könnte von Vorteil sein, die Armee als wichtigen Teil unseres Staatswesens von innen kennen zu lernen.
Noch während der Rekrutenschule ging ich erstmals an die Urne, und zwar in Uniform. Als ich ins Wahllokal trat, wurde ich von den zur Aufsicht aufgebotenen älteren Männern freundlich begrüsst. Ersichtlich waren sie verantwortungsbewusste Staatsbürger, die sich freuten, dass ein Junger und erst noch ein Soldat an die Urne kam und so in zweifacher Art, militärisch und zivil, kundtat, dass ihm unsere Heimat am Herzen lag. Es waren nur Männer im Wahllokal; die Frauen waren damals, 1966, immer noch nicht zu Wahlen und Abstimmungen zugelassen. Das war eine Ungerechtigkeit und eine krasse Beschränkung der Demokratie, aber nach meinem damaligen Empfinden war es kein Skandal, denn ich hielt es für den natürlichen Lauf der Dinge, dass es jetzt noch so war, aber demnächst nicht mehr so sein würde. Fortschrittlich gesinnte Frauen hatten seit Jahrzehnten für ihre politischen Rechte gekämpft. Bald sollten sie das Wahl- und Stimmrecht bekommen, zuerst in der Gemeinde dann im Kanton und schliesslich 1971 auch auf Bundesebene. Das konnte ich damals, bei meinem ersten Gang zur Urne, zwar noch nicht sicher wissen, aber doch einigermassen abschätzen.
In den Gemeinden wurden Jungbürgerfeiern organisiert. In der Chronik im Anhang des Bieler Jahrbuchs