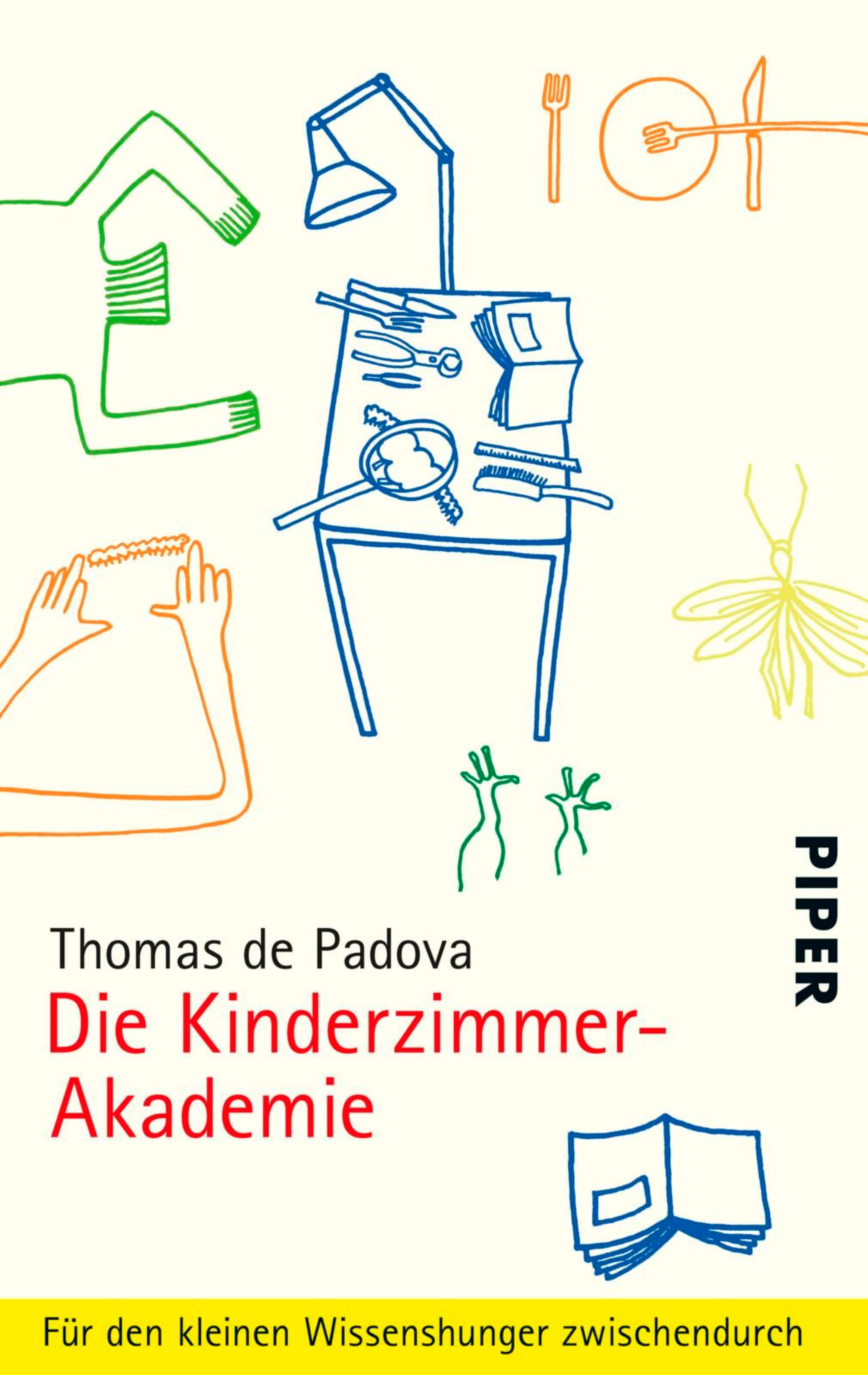Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die andere Renaissance: ein spannendes Epochenportrait auf den Spuren von Dürer, Da Vinci und ihren Zeitgenossen.
Im 15. und 16. Jahrhundert erwacht die Mathematik in Europa. Die arabischen Ziffern samt der bis dato unbekannten Null erobern das kaufmännische Leben. Die Erfindung der Zentralperspektive und die Wiederentdeckung der griechischen Geometrie verändern Kunst und Wissenschaft. Bilder sind nun Fenster zur Welt, die neue Mathematik ebenso. Regiomontanus und Albrecht Dürer in Nürnberg spielen bei diesem Umbruch eine ebenso große Rolle wie Leonardo da Vinci und Girolamo Cardano in Mailand. Lebendig und mit dem besonderen Blick für das Verborgene erzählt Thomas de Padova ein spannendes Kapitel der Mathematikgeschichte und eröffnet eine neue Perspektive auf eine flirrende Epoche – die Renaissance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die andere Renaissance: ein spannendes Epochenportrait auf den Spuren von Dürer, Da Vinci und ihren Zeitgenossen.Im 15. und 16. Jahrhundert erwacht die Mathematik in Europa. Die arabischen Ziffern samt der bis dato unbekannten Null erobern das kaufmännische Leben. Die Erfindung der Zentralperspektive und die Wiederentdeckung der griechischen Geometrie verändern Kunst und Wissenschaft. Bilder sind nun Fenster zur Welt, die neue Mathematik ebenso. Regiomontanus und Albrecht Dürer in Nürnberg spielen bei diesem Umbruch eine ebenso große Rolle wie Leonardo da Vinci und Girolamo Cardano in Mailand. Lebendig und mit dem besonderen Blick für das Verborgene erzählt Thomas de Padova ein spannendes Kapitel der Mathematikgeschichte und eröffnet eine neue Perspektive auf eine flirrende Epoche — die Renaissance.
Thomas de Padova
Alles wird Zahl
Wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Einführung: Vom Abakus zur Formelsprache
Eine kurze Geschichte der Zahlen
Ziffern aus dem Orient
Kunst und Geometrie
Unterwegs zur Formelsprache
Europa kriegt die Kurve
I Zahlen und Zeichen
II Proportionen und Perspektiven
III Algorithmen und Algebra
Dank
Schluss: Das Ende einer Epoche
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
Register
Einführung: Vom Abakus zur Formelsprache
Als ich ein kleiner Junge war, schenkten mir meine Eltern einen Abakus. Sein Rahmen war aus Holz, auf den dazwischen eingespannten Drähten reihten sich gelbe und blaue, rote und weiße Holzperlen aneinander. Sie glitten auf den dünnen Strängen hin und her, wenn ich sie einzeln, paarweise oder in größeren Gruppen bewegte.
Unten fünf rote neben fünf weißen Kugeln. Für das Rechnen hatten die Farben keine Bedeutung. Sie halfen aber dabei, die Übersicht zu behalten. Eine Anzahl von sieben gleichfarbigen Holzperlen hätte ich kaum auf einen Blick erfassen können. Bei fünf weißen und zwei roten Kugeln erkannte ich sofort, wie viele es waren.
Natürlich wusste ich nicht, wie alt diese Bündelung in Fünfergruppen war, die sich bereits in jahrtausendealten Kerbhölzern und Knochen findet. Auch die alten Römer schrieben nicht IIIIIII, sondern VII, also 5 und 1 und 1. Kellner benutzen die Fünferbündelung tagtäglich, wenn sie nach jeweils vier Strichen auf einem Bierdeckel oder Papierblock einen Querstrich ziehen. Sie dient der besseren Überschaubarkeit.
Meine Kugelrechenmaschine entpuppte sich als Stufenleiter mathematischer Erkenntnis. Ganz unten die Einer. Sobald ich alle zehn Kugeln nach rechts geschoben hatte, kamen sie wieder zurück nach links, und ich setzte stattdessen in der Reihe darüber eine Kugel nach rechts. Das war die wichtigste Regel: der Übertrag. Ein Zehner für zehn Einer. Er wurde irgendwann zum Automatismus. Befanden sich in der Zehnerreihe zehn Kugeln auf der rechten Seite, schob ich eine Hunderterkugel nach rechts. Auf diese Weise wanderten die Kugeln hin und her, lief das Addieren auch von größeren Zahlen bald wie von selbst.
Das Rechnen auf dem Abakus ist deshalb so anschaulich, weil dabei jede Zahl als Anzahl von Kugeln erfahrbar ist. Doch sosehr das Recheninstrument als mathematische Einstiegshilfe taugt, so begrenzt sind seine Anwendungsmöglichkeiten. Und bei aller praktischen Rechenfertigkeit: Am Ende bleibt nur das Ergebnis stehen, nicht aber der Weg, auf dem man zu ihm gelangt ist.
Eine Rechnung auf dem Abakus ist so vergänglich wie das gesprochene Wort. Um Rechnungen in ihrem Verlauf festzuhalten und zu überprüfen, um vielschichtige Beziehungen zwischen Zahlen zu erkennen und weiterzuentwickeln, bedarf es des Mediums der Schrift. Sie bringt das Dauerhafte ans Licht: Rechenoperationen, die wiederum neue Rechenoperationen ermöglichen. Was Ziffern und schriftliches Rechnen für das Auffinden mathematischer Gesetze und für die Magie der Zahlen bedeuten, ist vergleichbar damit, was Alphabet und Schrift für unsere Gesetzgebung und für die Poesie bedeuten.
Eine kurze Geschichte der Zahlen
Eben dieser Weg zum schriftlichen Rechnen, den heute alle Schülerinnen und Schüler beschreiten, war Europa lange versperrt geblieben. Die römischen Zahlen, welche das Imperium Romanum zusammen mit dem lateinischen Alphabet überdauert hatten, ließen sich zwar wunderbar in Stein meißeln. Sie taugten dazu, Daten und Ergebnisse zu fixieren. Zum Rechnen aber waren sie, abgesehen vielleicht von einfachen Additionen, völlig ungeeignet. Gerechnet hatte man seit dem Altertum mit dem Abakus, mit Rechensteinen auf dem Rechenbrett oder schlicht mit den Fingern.
Wie sehr diese Trennung zwischen dem gegenständlichen Rechnen mit Kugeln oder Rechensteinen einerseits und der Notation von Zahlen andererseits die Entwicklung der Mathematik gelähmt hatte, wird erst deutlich, wenn man den Blick auf jene Epoche richtet, in der diese Spaltung überwunden wurde: die Renaissance. Erst in der Renaissance setzte sich in Europa das schriftliche Rechnen durch. Und zwar auf Basis jener neuen Ziffern, die wir bis heute benutzen.
Woher kommen unsere Zahlen? Worauf beruht die in Zahlen und Zeichen geronnene Rationalität der Moderne? Wie haben sich alle jene Rechentechniken entwickelt, die grundsätzlich auch von einer Maschine ausgeführt werden können?
Dieses Buch rollt die Geschichte der Zahlen und der Mathematisierung der westlichen Welt auf. Es handelt vom neuen Glanz und von der Wirkmächtigkeit der Mathematik in der Renaissance und lädt dazu ein, Gleichungen und geometrische Formen mit anderen Augen zu betrachten. Und zu hinterfragen, wie die Mathematik zu einer weltumspannenden Sprache werden konnte.
Ihr Aufschwung während der Renaissance verdankte sich nicht so sehr den Höchstleistungen Einzelner, sondern dem Aufbruch vieler. Universitätsgelehrte und Kaufleute, Maler und Architekten, Ärzte und Theologen entdeckten ihre Begeisterung für Rechenkunst und Geometrie. Um ihre Lebensläufe, ihren Zugang zur Mathematik geht es in den folgenden Kapiteln. Mit Zeichen und mit Bildern arbeitend, symbolisch und visuell, erklommen sie eine neue Stufe der Rationalisierung. Sie erschufen eine neue Formelsprache und veränderten die Sprache der Bilder durch die Erfindung der Zentralperspektive von Grund auf.
Ziffern aus dem Orient
Das erste Kapitel »Zahlen und Zeichen« hebt an mit der Frage: Warum benutzen wir noch heute das lateinische Alphabet, nicht aber die römischen Zahlzeichen? Für gewöhnlich machen wir uns keine Gedanken über den Ursprung unserer Ziffern. In der Renaissance waren sie für manche Menschen ziemlich plötzlich da.
Zum Beispiel für die Besucher des Regensburger Doms: Nachdem ein Steinmetz erstmals die uns heute vertrauten indisch-arabischen Ziffern anstelle von römischen Ziffern in Stein gehauen hatte, lasen sie im nördlichen Seitenflügel des Doms die Inschrift »1464«. Diese neuartigen Ziffern im Dom vermehrten sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Für ungeschulte Betrachter waren sie kaum zu entschlüsseln. Denn hinter der Schreibweise der Ziffern 1, 2, 3 … war, anders als hinter den römischen Ziffern I, II, III …, keinerlei Logik zu erkennen. Man nannte sie daher zunächst die »neun Figuren«, zu denen noch ein kleiner Kreis hinzukam: ein Zeichen für das Nichts. In Regensburg und andernorts drängten sie die römischen Ziffern nach und nach zurück.
Die neue Zahlschrift kam aus dem Orient. Vornehmlich italienische Kaufleute hatten sie sich zu eigen gemacht. Sie engagierten sich im Fernhandel, regelten ihre Geschäfte von der Stadt aus, mussten Briefe an Handelsvertreter schreiben, über Waren- und Geldgeschäfte Buch führen, das finanzielle Risiko von Beteiligungen an Handelsfahrten und Gesellschaften ermitteln, Zinsen kalkulieren, kurzum: Der typische Renaissancekaufmann hatte »tintige Finger«. Und für seine Bedürfnisse eigneten sich die Ziffern, die über Indien in die arabische Welt gelangt waren, hervorragend.
Es wäre allerdings ein großer Irrtum zu glauben, in der Renaissance wäre nur eine Zahlschrift gegen eine andere ausgetauscht worden. Die Bedeutung der indisch-arabischen Ziffern reichte viel weiter. Die Darstellung der Zahlen, das uns heute geläufige dezimale Stellenwertsystem, machte es überhaupt erst möglich, schriftlich zu rechnen. Damit verschaffte sich der europäische Kontinent Zugang zu einer Kulturtechnik, ohne die die moderne Mathematik undenkbar wäre. Die aus der arabischen Welt übernommenen Rechenpraktiken hatten eine geradezu befreiende Wirkung auf die mathematische Kreativität.
Einer dieser Kreativen ist der Mathematiker und Astronom Johannes Müller, auch Regiomontanus genannt. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das mathematische Erbe sowohl der griechischen Antike als auch der arabischen Welt zu heben. Durch ihn erhalten wir Einblick in die humanistische Gedankenwelt und in die Geschichte der indisch-arabischen Zahlen einschließlich der rätselhaften Null. Ist sie überhaupt eine Zahl? Sind Zahlen nicht immer aus Einheiten zusammengesetzt wie die römischen Zahlen I, II, III …?
Wir begleiten Regiomontanus auf einer heiklen Kreuzzugsmission nach Venedig und im Sommer 1464 nach Rom. Dort haben zwei Deutsche die erste Druckerei auf italienischem Boden eingerichtet. Regiomontanus, fasziniert von den Möglichkeiten der Buchdruckerkunst, wird in Nürnberg den ersten mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachverlag gründen.
Kunst und Geometrie
Die Geschichten in diesem Buch überqueren immer wieder die Alpen, ziehen über Passstraßen von Süd nach Nord und von Nord nach Süd. Auf den Spuren von Papiermachern und Druckern, Lehrlingen und Studenten, Pilgern und Kardinälen, Künstlern und Mathematikern wie Regiomontanus pendeln sie zwischen dem deutsch- und italienischsprachigen Raum hin und her. Dieser Wissenstransfer über die Alpen stimuliert eine ganze Epoche.
Im selben Jahr, in dem Regiomontanus in Nürnberg seine ersten Bücher unter die Presse legt, wird Albrecht Dürer dort geboren, einer der beiden Protagonisten des zweiten Kapitels »Proportionen und Perspektiven«. Dürer lernt das Malerhandwerk in einer Werkstatt, die der größten Nürnberger Druckerei zuarbeitet. Er ist Kind einer Medienrevolution, bereichert die Bücherwelt um unnachahmliche Holzschnitte und verkauft Kupferstiche als Einblattdrucke in Serie.
Bei seinen Italienreisen wird er mit dem Kunstverständnis jenseits der Alpen konfrontiert. Dort ist die Geometrie zum Fundament der Malkunst geworden. Italienische Künstler sind überzeugt davon, mit der Zentralperspektive eine geradezu unfehlbare Methode gefunden zu haben, Dinge so abzubilden, wie wir sie sehen. Ein Gemälde, so der zeitgenössische Tenor, habe zu sein wie ein Fenster, durch das man von einer festgelegten Position auf die Welt schaut. Und diese täuschend echte Darstellung der Wirklichkeit wird durch eine mathematische Konstruktion ermöglicht, die auch Dürer in ihren Bann zieht.
Die Zentralperspektive, eine Erfindung toskanischer Künstler, ist aus einer Verschmelzung der Lehren der Geometrie und Optik hervorgegangen. Leonardo da Vinci ist mit ihr aufgewachsen und hat daraus hervorgegangene Reproduktionstechniken wie den Perspektografen bereits während seiner Lehre kennengelernt. Vor einer solchen Apparatur sitzt der Maler wie ein moderner Fotograf: Den Kopf fixiert, ein Auge geschlossen, überträgt er auf eine Glasplatte, was er sieht.
Leonardo und Dürer verflechten Ästhetik und Mathematik miteinander und experimentieren virtuos mit dem perspektivischen Repertoire. Der Maler aus Vinci entwickelt Zeichentechniken, wie wir sie im 21. Jahrhundert in Anatomiebüchern, in Gebrauchsanweisungen und Montageanleitungen finden. Er erweitert Medizin und Kartografie um die Möglichkeiten einer als Wissenschaft verstandenen Kunst.
Nichts davon veröffentlicht er. Dürer dagegen schreibt ganze Bücher zur darstellenden Geometrie und Proportionenlehre. Die beiden Künstler stehen stellvertretend für all jene Maler, Ingenieure und angehenden Naturforscher, die die Sprache der Mathematik für sich entdecken und den neuzeitlichen Wissenschaften den Weg ebnen.
Unterwegs zur Formelsprache
Dürer schreibt Bücher in deutscher Sprache. Die Druckerpresse vereinheitlicht nicht nur die Landessprachen. In derselben Epoche, in der unser Deutsch entsteht, wird auch eine neue mathematische Sprache aus der Taufe gehoben, die die Verständigung über Distanzen hinweg erleichtert: eine Formelsprache. An die Stelle von Wörtern treten nun Symbole für verschiedene Rechenoperationen, Zeichen für Plus und Minus, das Wurzelziehen oder das Rechnen mit unbekannten Größen. Sie sind die heimlichen Protagonisten des dritten Kapitels »Algorithmen und Algebra«.
Im Zuge dieser Formalisierung trennt sich die europäische Mathematik von ihrem arabischen Vorbild. Durch den Gebrauch von Symbolen schaffen Rechenmeister und Gelehrte Spielräume für Zahlen, die mit dem bisherigen Zahlbegriff unvereinbar sind. Die Null ist kaum in den Kreis der Zahlen aufgenommen, da sehen sie sich bereits gezwungen, auch negative Zahlen als Lösungen von Gleichungen ins Auge zu fassen.
Mit dem Arzt und Astrologen Girolamo Cardano, der seine eigene Spielsucht zur Grundlage einer Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, und dem Theologen Michael Stifel, einem Freund Martin Luthers, der als Weltuntergangsprophet deutschlandweit Berühmtheit erlangt, begegnen uns in diesem Kapitel zwei weitere schillernde Figuren der Renaissance. Cardano und Stifel sind Pioniere einer neuen Gleichungslehre, der Algebra. Sie verwandeln vormals schwierige oder unmögliche Rechenoperationen in Routinen, in Algorithmen, die sich stur abarbeiten lassen.
Stifel gelingt es, die Lösung sämtlicher quadratischer Gleichungen in einer einzigen Rechenregel zusammenzufassen. Eine der wichtigsten Techniken dabei: das Wurzelziehen. Im sächsischen Holzdorf erneuert Stifel das Wissen über das Wurzelrechnen und mithin über Zahlen, die sich nicht durch das Verhältnis zweier ganzer Zahlen ausdrücken lassen. Sie werden heute als »irrationale Zahlen« bezeichnet.
Währenddessen stößt Cardano in Mailand zu einem allgemeinen Lösungsverfahren für Gleichungen dritten Grades vor. In diesem Zusammenhang kommen mathematische Objekte ins Spiel, die sich jeglicher Anschauung entziehen. Denn was soll das für eine Zahl sein, die mit sich selbst multipliziert eine negative Zahl ergibt? Cardano rechnet auch mit diesen obskuren Größen, die später »komplexe Zahlen« genannt werden.
Hatte man es in der klassischen Arithmetik nur mit ganzen Zahlen und Brüchen zu tun, wandelt sich das Zahlenverständnis gegen Ende der Epoche. Um Gleichungen jeder Art routinemäßig lösen zu können, bedarf es der Null und der negativen Zahlen, der irrationalen und komplexen Zahlen. Diese Ausdifferenzierung der Zahlen ist das Resultat der in Formeln gegossenen, verallgemeinerten Rechenpraktiken. In dem erweiterten Zahlenraum schlagen Mathematiker bald darauf eine neue Brücke zur Geometrie mit ihren kontinuierlichen Größen. Durch die Erfindung des kartesischen Koordinatensystems wird es ihnen möglich, geometrische Kurven in algebraische Gleichungen zu übersetzen. Alles wird Zahl.
Europa kriegt die Kurve
Dieses Buch erzählt vom Aufstieg der Zahlen in einem fast vergessenen Jahrhundert der Mathematik. Einem Jahrhundert, das nicht mit spektakulären Fortschritten in Einzelfragen aufwartete, aber den europäischen Kontinent innerhalb weniger Generationen aus seiner Rückständigkeit an die Spitze der mathematischen Forschung führte. In der Renaissance begann die Mathematik alle Bereiche des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens zu durchdringen. Mehr noch: Sie bereitete den modernen Wissenschaften den Boden.
Die Mathematik, in der Renaissance als »Königin der Wissenschaften« gefeiert, hat sich seither in etwas ungemein Mächtiges verwandelt. Im 21. Jahrhundert bestimmen Algorithmen das menschliche Zusammenleben mehr denn je. In Zeiten des Klimawandels und der Pandemien sind wir ständig mit Zahlen konfrontiert. Auf ihrer Grundlage treffen Politiker Entscheidungen über die Zukunft, über Leben und Tod.
Unsere moderne Welt ist durchtränkt von Zahlen und Algorithmen. Wenn beim Fahrkartenkauf am Automaten ein Bildschirm auf die Berührung unseres Zeigefingers reagiert, können wir die Geometrie der elektrischen Schaltkreise unter der Tastfläche vielleicht noch erahnen. Ihre wohlberechnete Anordnung auf winzigen Computerchips dagegen bleibt unseren Augen verborgen.
Es lohnt sich, sich mit dieser überall versteckten Mathematik zu beschäftigen. Und zwar nicht nur, weil sie nützlich ist, sondern weil sie den Geist anregt. Weil sie die Wirklichkeit in komprimierter Form abzubilden imstande ist. Weil sich ungeahnte Chancen daraus ergeben, die Mathematik zu einer Inspirationsquelle des eigenen Denkens zu machen.
Leonardo und Dürer, die beiden bekanntesten Protagonisten dieses Buches, ließen den Pinsel liegen, um sich in die Konstruktion von Ellipsen oder Vielecken, die Quadratur des Kreises oder die Verdopplung des Volumens eines Würfels zu vertiefen. Ohne eine besondere Schulbildung genossen zu haben, tauchten sie ein in die Welt der Mathematik. Ihre Erkenntnisbegeisterung ist auch heute noch ansteckend.
I
Zahlen und Zeichen
1
Das Universum der Zahlen
Erstes Kapitel, in welchem wir einen jungen Deutschen von Venedig nach Padua begleiten, um der ersten Universitätsvorlesung über die Geschichte der Mathematik beizuwohnen. Wie kommt man zu großen und immer größeren Zahlen?
San Giorgio, 1464. Wie auf einem Präsentierteller liegt die Lagune vor ihm: über dem Meer der Dogenpalast, schwebend in Weiß und Rosa, daneben die Piazzetta mit den beiden Granitsäulen, ein offenes Tor, das die ankommenden Schiffe empfängt, und dahinter, dem von der Adria her wehenden Wind trotzend, der Campanile, der Glockenturm, der alle Häuser überragt. Wasser und Stein, Schiffe und Wind.
Johannes Müller hat dieses Panorama oft genossen. Ein Dreivierteljahr hat er bei den Benediktinern auf San Giorgio verbracht. Das Kloster direkt gegenüber von San Marco ist ihm zur Heimstatt geworden, ein Ort der Stille inmitten der Lagune von Venedig, dem größten Warenumschlagplatz des Abendlands, der Drehscheibe des Handels zwischen Ost und West, Nord und Süd.
Andere Deutsche kommen in die Seerepublik, um Geschäfte zu machen. Als Kaufleute logieren sie im Fondaco dei Tedeschi, der deutschen Faktorei am Rialto, wo internationale Handelshäuser und Banken angesiedelt sind, wo sich Lager und Magazine mit Produkten aus aller Herren Länder füllen, wo Tuch-, Gewürzhändler und Juweliere Tag für Tag ihre Stände und Tische aufbauen. Es ist ein Gewimmel aus Einheimischen und Fremden, ein Rausch der Farben und betäubenden Düfte des Orients, ein Durcheinander von Waren und Währungen. Überall in diesem Geschäftsviertel fühlt man den Zauber des Geldes.
Nicht so auf San Giorgio. Die Koggen und Galeeren, die vollbeladen durch die Lagune fahren, lassen die Insel links liegen. Zwischen San Marco und San Giorgio verkehren nur kleine Boote.
Manchmal setzt eine Gruppe Pilger über, Männer, die auf die Überfahrt ins Heilige Land warten und sich die Zeit damit vertreiben, venezianische Kirchen und Klöster zu besichtigen. Auf San Giorgio wollen sie zuerst den Altar sehen, in dem die Gebeine des Heiligen Georg aufbewahrt werden, ein Anblick, der seinen Niederschlag in Reisetagebüchern findet: »Ist sant jorgen arm mit der handt noch gantz in eynem altar.«1 Staunen erweckt auch der große Garten, in dem Oleander- und Holunderbüsche, Weintrauben und Feigen wachsen. »Dieser ist nicht nur der schönste von ganz Venedig, sondern auch von allen, die ich in Italien sah«, schreibt einer der Reisenden des humanistischen Zeitalters, der Brite Thomas Coryate. »Er übertrifft sogar den bemerkenswerten Garten der Benediktiner in Padua.«2
Die Mönche auf San Giorgio führen ein Leben nach den Ordensregeln des Heiligen Benedikt. Jeden Nachmittag prüft der Abt, ob sie diese auch befolgt haben. Nach ihren Zeiten und Rhythmen, mit ihren Gesängen und Gebeten hat Johannes Müller in den zurückliegenden Monaten gelebt. Er kennt ihren Tagesablauf in allen Einzelheiten. In dem weitläufigen Benediktinerkloster hat er jene Ruhe gefunden, die ihm und seinem Patron, dem Kardinal, lieb ist.
Der junge Deutsche genießt den Ruf des Sternenkundigen. Wenn es dunkel wird, zieht er sich mit seinen astronomischen Messgeräten in einen Winkel des Klostergartens zurück. Tagsüber hält er sich oft in der Bibliothek auf. Auch dann ist er mit seinen Gedanken in einer anderen Welt als diejenigen, die um ihn herum an Schreibpulten stehen.
Johannes Müller ist weder Mönch, noch sieht man ihm an, dass er zum Gefolge eines Kardinals zählt. Ein Holzschnitt aus einer Nürnberger Werkstatt, die einzige zeitgenössische Abbildung, die wir von ihm besitzen, zeigt ihn als hageren, nachdenklich dreinschauenden Mann. Er trägt schlichte Kleidung und eine Mütze, in der Hand hält er ein Messinstrument, ein Astrolab.
Seine von San Giorgio verschickten Briefe hat er mit Ioannes Germanus unterzeichnet.3 Die Gelehrtensprache Latein fließt ihm leicht aus der Feder. In Rom nannte man ihn auch Johannes molitoris und in amtlichen Briefen Johannes Muller de Kunigspergk, was auf seine Geburtsstadt, das fränkische Königsberg, verweist. Ihr ist auch die lateinische Wendung Ioannis de Regio monte geschuldet. Und um der späteren Geschichtsschreibung Genüge zu tun, werden auch wir von jetzt an von Regiomontanus sprechen.
Der Mann vom Schwarzen Meer
Die Latinisierung des Namens steht im Einklang mit seiner Liebe zu den Schriften des Altertums, einer Liebe, die stetig gewachsen ist, seit er Kardinal Bessarion vor vier Jahren in Wien begegnete. Bessarion hat in ihm das Bewusstsein dafür geweckt, dass die Werke der Antike für einen zeitgenössischen Gelehrten mehr sind als Orientierungspunkte. Sie bilden die wichtigste Grundlage für eine Neuausrichtung der Philosophie und der Wissenschaften.
Wann immer es ihm möglich ist, widmet sich Regiomontanus in der Zurückgezogenheit des Klosters der Handschriftensammlung des Kardinals, liest antike Texte, versucht, sie gedanklich zu durchdringen, fertigt Kopien an, schreibt Übersetzungen und Kommentare. Bessarions private Bibliothek enthält einzigartige griechische Codices. Einige davon hat der Kardinal über Mittelsmänner gekauft, andere eigenhändig aus Konstantinopel mit nach Italien gebracht. Sein Name wird überall in Italien mit der Wiederentdeckung des verlorenen Wissens der griechischen Antike in Verbindung gebracht.
Der Mann vom Schwarzen Meer gehörte einst dem griechischen Klerus an. Während seine Heimat nach und nach unter osmanische Herrschaft fiel und die Truppen des Sultans immer weiter nach Westen vordrangen, hoffte Bessarion auf den Zusammenhalt der Christenheit. Mit der ihm eigenen Energie setzte er sich dafür ein, die griechisch-orthodoxe und die römisch-katholische Kirche nach ihrer jahrhundertelangen Spaltung wieder zu einen. Bei seiner gut vorbereiteten Mission feierte er in Italien unerwartete Erfolge. Doch obwohl das Unionsbekenntnis von beiden Seiten schon ausgesprochen war, scheiterte er letztlich am Widerstand in den eigenen Reihen.
Wie viele andere griechische Gelehrte verließ Bessarion seine Heimat noch vor der Eroberung Konstantinopels. Er siedelte nach Italien über, wo ihn der Papst nach seiner Bekehrung zum Kardinal ernannte. Seither ist es sein vordringliches Anliegen, zumindest das geistige Erbe des Ostens zu bewahren.
Seine Wertschätzung für die Antike und seine Werbung für die griechische Philosophie werden von vielen italienischen Gelehrten geteilt. Griechische und lateinische Klassiker sind zu begehrten Luxusgütern geworden. Papst Pius II. gibt für die Anschaffung von Büchern ähnlich hohe Summen aus wie Cosimo de’ Medici in Florenz. Beide beschäftigen Agenten, die Klosterbibliotheken durchstöbern und in privaten Sammlungen nach Exemplaren mit Seltenheitswert suchen. Sie heuern Schreiber für die Anfertigung von Kopien an und vergeben Aufträge an Spezialisten, die sich der Rezeption der Antike verschrieben haben.
Bessarion versammelt eine ganze Gelehrtenschar um sich. Regiomontanus hat es von Beginn an als intellektuelle Auszeichnung empfunden, zu seinen »familiares« zu gehören, seinen engsten Vertrauten. Er selbst bringt als Mathematiker ein Expertenwissen ein, das nicht nur getreue Übersetzungen ermöglicht, sondern eine lebendige Auseinandersetzung mit den griechischen Klassikern.
Die Kenntnis der griechischen Sprache habe er sich im Hause seines hochverehrten Herrn angeeignet, schreibt er in einem seiner Briefe aus San Giorgio.4 Inzwischen übersetzt er eigenhändig aus dem Griechischen ins Lateinische, korrigiert, ergänzt und kommentiert bereits vorhandene Übertragungen alter Schriften. Und zwar solche astronomischen und mathematischen Inhalts, darunter ein Codex des Archimedes, eine faszinierende Sammlung ausgewählter Arbeiten des größten Mathematikers des Altertums.
San Giorgio ist der rechte Platz für Studien dieser Art. Die Benediktiner verbringen selbst einen Teil des Tages mit stiller Lektüre. Bessarion spielt inzwischen mit dem Gedanken, ihnen seine wertvolle Büchersammlung zu vermachen, zumal er erfahren hat, dass dem Kloster für die Aufbewahrung der eigenen Bestände eine neue Bibliothek in Aussicht gestellt worden ist: eine Schenkung aus Florenz.5 Vor etlichen Jahren saß Cosimo de’ Medici hier zusammen mit seinem Bruder Lorenzo in der Verbannung. Die Benediktiner hatten die politisch Verfolgten seinerzeit willkommen geheißen, wofür sich die Florentiner Dynastie, die zu unvorstellbarem Reichtum gelangt ist, nun erkenntlich zeigen möchte.
Bessarion und seine Gesandtschaft haben sich dem Rhythmus der Mönche angeschlossen. Während Regiomontanus das Tageslicht nutzt, um in der Klosterbibliothek zu arbeiten, verlässt der Kardinal San Giorgio immer wieder, um Verhandlungen zu führen. Seine Rastlosigkeit legt er auch hier nicht ab.
Schon aufgrund seines langen Bartes würde ihn niemand für einen Benediktiner halten. Die griechische Bartpracht fällt jedem sofort ins Auge. Sie beschäftigt italienische, flämische und deutsche Maler. Einer von Regiomontans papstkritischen Landsleuten nannte den Kardinal gar einen »Bock«.6
Als Gelehrter mag Bessarion hoch angesehen sein, als Kirchenpolitiker hat er zahlreiche Widersacher. Damit wurde Regiomontanus schon bei ihrer ersten Begegnung konfrontiert, und zwar in der kaiserlichen Residenzstadt Wien, wo Bessarion im Jahr 1460 als Legat des Papstes eingetroffen war. Schon damals warb er leidenschaftlich für einen Kreuzzug gegen die Türken, die mit der Eroberung Konstantinopels sieben Jahre zuvor den Untergang des längst verblichenen Oströmischen Reiches besiegelt hatten. Zur Finanzierung des Krieges forderte der Kardinal den deutschen Klerus zur Zahlung eines Zehnten auf. Damit erregte er viel Unmut. Seine Mission war allerdings wegen der Uneinigkeit der deutschen Fürsten, die sich untereinander bekriegten und von denen etliche dem Reichstag ferngeblieben waren, von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Auch in Italien konnten Bessarion und Papst Pius II. die zerstrittenen Staaten nicht zu einem gemeinsamen Militäreinsatz bewegen. Der Christenheit sei im Jahr 1453 mit Konstantinopel ihr zweites Auge ausgerissen worden, so eines der drastischen Bilder des Papstes.7 Doch selbst die Seerepublik Venedig, deren Fernhandel unmittelbar betroffen war, schreckte vor einem Krieg zurück und versuchte, ihre Handelsprivilegien in Verhandlungen mit dem osmanischen Herrscher Mehmed II. zu sichern — und sei es durch entsprechende Zahlungen.
Angesichts der ungebremsten Expansionspolitik des Sultans ist die Stimmung zumindest in der Lagune gekippt. Venedig sieht sich mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Die Osmanen haben auf der Peloponnes jahrhundertealte venezianische Handelsstützpunkte eingenommen. Auf dem Balkan sind sie bis nach Bosnien vorgedrungen. Nun rüstet die Serenissima gemeinsam mit dem Kirchenstaat und im Bündnis mit Ungarn zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete.
Der Bücherjäger
Um den Kreuzzug vorzubereiten, wurde Bessarion nach Venedig geschickt. Mit achtzehnköpfigem Gefolge zog der Kardinal im Sommer 1463 ins Kloster San Giorgio ein.8 Von hier aus erledigt er seine Amtsgeschäfte. Regiomontanus erhält seine Korrespondenz mit der Gelehrtenwelt aufrecht und unternimmt im Auftrag des Kardinals gelegentlich kürzere Reisen, zuletzt nach Mailand.9 Vor allem aber hat ihn Bessarion mit seiner Begeisterung für griechische Klassiker und mit seiner Sammelleidenschaft angesteckt.
In Venedig ist Regiomontanus selbst zum Bücherjäger geworden. Über die näheren Umstände seines bedeutendsten Funds verraten seine Briefe leider nichts. Mag sein, dass er die Klosterbibliotheken durchforstet hat, um nach Relikten der griechischen Mathematik zu suchen. Vielleicht aber hat ihm auch ein Zufall den einzigartigen Codex in die Hände gespielt. Venedig ist ein Umschlagplatz für Waren jeder Art, auch für seltene Bücher, unter denen sich naturkundliche und mathematische Werke einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Durch die Auflösung privater Bibliotheken geraten immer wieder unerkannte Schätze in Umlauf.10
Über seine außergewöhnliche Entdeckung hat Regiomontanus den Hofastronomen des Herzogs von Ferrara, Giovanni Bianchini, soeben in Kenntnis gesetzt: »Hier sage ich Eurer Herrschaft, dass ich jetzt in Venedig Diophantos, einen griechischen Mathematiker, gefunden habe, der noch nicht ins Lateinische übersetzt ist.« Es handele sich um ein Werk, das wahrhaftig wunderschön, aber auch höchst schwierig sei.11
Diophant stammte aus Alexandrien. Er war einer der letzten großen Vertreter der griechischen Mathematikertradition. Ein Laie hätte mit seiner »Arithmetica« nichts anfangen können. Regiomontanus hat vermutlich auf den ersten Blick erkannt, dass dieser Codex ein völlig neues Licht auf die antike Mathematik wirft: Die »Arithmetica« liefert den Beweis dafür, dass die Griechen, Meister auf dem Gebiet der Geometrie, auch in der Algebra weit vorangeschritten waren.
Bei dem umfangreichen Fragment, einer Abschrift aus dem 13. Jahrhundert, handelt es sich um eine Sammlung von Aufgaben zu quadratischen Gleichungen und Gleichungen höheren Grades. Auch Gleichungen mit mehreren Unbekannten kommen vor. Bereits im Vorwort führt Diophant ein Symbol für eine solche Unbekannte ein — wir würden sie heute »x« nennen, Regiomontanus spricht von »res«. Es folgen weitere Symbole für x2 (»census« bei Regiomontanus) oder x3 (»cubus«).
Sechs Bücher seien in der Handschrift enthalten, heißt es in Regiomontans Brief an Bianchini. Im Vorwort verspreche Diophant aber, er werde dreizehn Bücher schreiben. Daher bittet er seinen Briefpartner im Februar 1464, sich in Ferrara und andernorts nach den noch fehlenden Teilen umzuschauen.12
Was Regiomontanus nicht voraussehen kann und was seine Entdeckung so kostbar macht: Diophants »Arithmetica« ist nicht nur das erste wiedergefundene Werk zu einer antiken Algebra, die sich von der Geometrie abgelöst hatte, sie wird auch das einzige Lehrbuch dieser Art bleiben, das die Zeit überdauert hat. Generationen von Mathematikern werden davon zehren.
Die »Arithmetica« wirkt bis in die moderne Mathematik hinein. Ohne ihre Lektüre hätte zum Beispiel der französische Mathematiker Pierre de Fermat zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht seinen berühmten Satz formuliert, dessen Beweis erst an der Schwelle zum 21. Jahrhundert geglückt ist und der eine Vielzahl neuer mathematischer Erkenntnisse ans Licht gebracht hat.
Zahlenspiele
All dies liegt in weiter Ferne, als Regiomontanus die »Arithmetica« der Vergessenheit entreißt. Dennoch kann man sich seine Aufregung bei der ersten flüchtigen Durchsicht des griechischen Codex ungefähr ausmalen. Liest man seinen überschwänglichen Brief an den Kollegen Bianchini in Ferrara, hört man das Mathematiker- und Humanistenherz noch immer klopfen.
Der Fund ist ganz im Sinne des Kardinals. Allerdings ist Bessarion gegenwärtig zu beschäftigt, um ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Die Kreuzzugsvorbereitungen nehmen ihn voll und ganz in Anspruch. Seit er in der Kirche von San Marco die Weihe der Kriegsfahne vollzogen hat, treibt Bessarion zusammen mit den kirchlichen Behörden und der venezianischen Regierung Geld für das militärische Unternehmen ein.15 Er lässt sogar auf eigene Kosten eine Galeere in der venezianischen Schiffswerft, dem Arsenal, bauen.
Den Venezianern geht es bei diesem Kreuzzug in erster Linie um die Durchsetzung ihrer kommerziellen Interessen. Sie wollen den Peloponnes zurückgewinnen. Doch der Doge agiert halbherzig und zögerlich, und Bessarion bezweifelt bereits, dass die vereinten Seestreitkräfte wie geplant im Juni in Ancona zusammengezogen werden können.
Sein hoher Herr werde nach Griechenland für die Sache der christlichen Religion übersetzen, schreibt Regiomontanus nach Ferrara. »Ich aber werde entsprechend seiner Anordnung in Italien zurückbleiben. Mögen jene gehen, um die Türken zu vernichten. Ich werde mit Eurer und meiner übrigen Freunde Unterstützung versuchen, die Himmelsvorgänge zurechtzurücken.«16
Das Schreiben ist, wie viele aus seiner Hand, gespickt mit astronomischen Fragestellungen und Rechenaufgaben. Regiomontanus konfrontiert Bianchini und andere Briefpartner gerne mit kleinen mathematischen Knobeleien. Gerade unter italienischen Gelehrten, die in öffentlichen Disputationen gegeneinander antreten müssen, ist dies nicht unüblich, denn auf diese Weise können sie sich auf solche Wettkämpfe einstimmen. Er selbst verweist darauf, dass auch Archimedes anderen Mathematikern geometrische Probleme geschickt habe. »Derart werden unsere Geschenke wissenschaftlicher Natur sein, nicht alltäglicher.«17
Um das mathematische Rätselraten zu würzen, ist Regiomontanus auf der Jagd nach großen Zahlen. So hat er mit viel Geduld Tabellen für quadratische und kubische Zahlen angelegt. Die Quadratzahlen reichen von
die Kubikzahlen von
Ursprünglich sollten die Tafeln noch umfangreicher ausfallen.18 Regiomontanus benutzt sie als Nachschlagewerke, wenn er Bianchini und andere Kollegen auf die Probe stellen möchte. Unter den Rechenaufgaben in seiner Korrespondenz sind vergleichsweise leichte, wie:
Finde vier Quadratzahlen, deren Summe wiederum eine Quadratzahl ergibt.19
Eine einfache Lösung ist
Mit der Aufgabe, zwanzig Quadratzahlen zu finden, deren Summe wieder eine Quadratzahl und obendrein größer als 300.000 ist, strapaziert Regiomontanus die Geduld seiner Briefpartner allerdings über Gebühr.20
Unterwegs nach Padua
Der zitierte Brief an Bianchini ist der letzte, den Regiomontanus in jenen Monaten von Venedig aus verschickt. Irgendwann im März, als die Kälte aus den Klostermauern gewichen ist, rollt er Federn und Federmesser ein, verstaut die Schreibutensilien in seinem Bündel, verpackt seine astronomischen Beobachtungsgeräte, auf die er auch in den kommenden Wochen nicht verzichten mag, und verabschiedet sich von den Benediktinern und von Bessarion. Zumindest kurzfristig trennen sich nun ihre Wege. Während der Kardinal seiner Abreise nach Ancona entgegenfiebert, wo die Kreuzfahrer unter der Führung des Papstes in See stechen sollen, steigt er in eines jener Boote, die der Legation dauerhaft zur Verfügung gestellt worden sind, und bricht nach Padua auf.
Welchen Weg er einschlägt, wissen wir nicht. Vielleicht lässt er sich zum Festland bringen und nimmt ein Pferd. Wahrscheinlich aber begibt er sich dorthin, wo der Brentakanal in die Lagune mündet und ein Bootshebewerk die Weiterfahrt nach Padua mit dem Schiff ermöglicht. Ein bequemer Weg, wie Pilger aus Deutschland schildern. »In eyner nacht mag man faren von Venedig zu Padaw.«21
Der Brenta ist eine Lebensader Venedigs. Über Jahrtausende hinweg hat er Schlamm, Geröll und Treibgut aus den Alpen herangespült. Aus den Frachten mehrerer solcher Flüsse hat sich die Lagune mit ihren mehr als hundert Inseln und kleinen Erhebungen aufgebaut. Das Wasser der Adria dringt nur noch durch wenige Kanäle ein.
Unentwegt kämpfen die Venezianer mit dem Meer und dem Zustrom der Flüsse. In den beiden zurückliegenden Jahrhunderten ist der Wasserstand in der Lagune um etwa zwei Meter gesunken. Daher wird der Sand, den der Brenta mitführt, zunehmend als bedrohlich empfunden, weshalb man beschlossen hat, den Großteil des Flusses künftig nicht mehr wie bisher nahe der Mündung, sondern bereits früher umzuleiten und den mitgeführten Sand über einen längeren Kanal ins offene Meer zu lenken.22
Für die Versorgung der Metropole bleibt der Brenta unentbehrlich. Über ihn werden Getreide und andere Waren nach Venedig verschifft, aus dem Gebirge auch Baumstämme und Baumaterialien. Flussaufwärts gelangt man nach Stra und von dort zu Fuß ins nahe gelegene Padua, das mitten im venezianischen Herrschaftsgebiet liegt.
Die Seerepublik hat zu Beginn des 15. Jahrhunderts Padua und danach in Kriegen mit dem Herzogtum Mailand weitere Städte in ihr Territorium eingegliedert. Ihre Besitzungen auf dem Festland, der »terra ferma«, reichen mittlerweile bis vor die Tore Mailands. Aus dem Frieden, den die oberitalienischen Staaten im Jahr 1454 nicht zuletzt wegen der osmanischen Gefahr geschlossen haben, ist Venedig als stärkste Landmacht hervorgegangen — ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Mailand und Florenz nicht am Kreuzzug beteiligen wollen. Venedig ist ihnen zu mächtig. Sie hoffen auf eine Schwächung ihrer Rivalin im Kampf gegen die Osmanen. Über diplomatische Kanäle untergraben sie erfolgreich die Bemühungen des Papstes und Bessarions um den Aufbau einer gesamteuropäischen Armee.
Die Universitäten der oberitalienischen Staaten konkurrieren ebenfalls miteinander. Wer etwa im Herzogtum Mailand lebt und studieren möchte, ist verpflichtet, die Universität Pavia zu besuchen. Venedig wiederum erkennt nur jene akademischen Titel an, die in Padua verliehen wurden. Venezianer, die eine andere Hochschule besuchen, müssen ein Bußgeld zahlen.
Regiomontanus ist von der Universität Padua zu einer längeren Vortragsreihe eingeladen worden. Sie ist eine der ältesten Universitäten Italiens, gegründet von unzufriedenen Magistern und Studenten aus Bologna.23 Und zwar als Studentenuniversität, bei der die Studentenschaft das Amt des Rektors stellt. Mal kommt der Rektor aus den Reihen der »cismontanes«, der Italiener, im folgenden Jahr aus den Reihen der »ultramontanes«, der Studenten aus Ländern jenseits der Alpen. Wer Rektor werden möchte, muss beredt sein und aus reichem Elternhaus stammen, denn der Wahlkampf und die feierliche Amtseinführung im Dom mit anschließendem Bankett und öffentlichem Reitspektakel sind kostspielig.
Während Bologna für die Ausbildung von Juristen international bekannt ist, hat Padua ein eigenes Profil entwickelt. Im 14. Jahrhundert haben sich hier die Medizin und die »Freien Künste«, zu denen die mathematischen Fächer zählen, von den Rechtswissenschaften abgespalten. Die praxisorientierte Ausbildung lockt Studenten aus ganz Europa an, insbesondere aus Nürnberg. Aus keiner anderen Stadt nördlich der Alpen kommen so viele Akademiker hierher wie aus der süddeutschen Handelsmetropole.
Anatomie lernen sie in Padua unter anderem bei Leichensektionen. Hier können sie verfolgen, wie ein Chirurg, meist unter freiem Himmel, einen Leichnam öffnet, während zwei andere Professoren den Aufbau des Körpers und die Funktion der Organe anhand von wissenschaftlichen Texten erläutern.24 Aus den Briefen des Nürnberger Medizinstudenten Hartmann Schedel, der einer solchen Leichensektion beiwohnt, erfahren wir, dass die Universität, dem Zeitgeist folgend, 1463 einen Lehrstuhl für Griechisch eingerichtet hat. Zur selben Zeit wie er entdecken viele Nürnberger Patriziersöhne in Padua ihre Liebe zur Antike. Sie schreiben griechische Grammatiken ab und kopieren alte Texte. Schedel und andere Studenten werden den Humanismus noch vor Regiomontanus mit dem Lastesel über die Alpen nach Nürnberg tragen.
Regiomontanus möchte in Padua allerdings mehr auf die Waagschale legen als die Errungenschaften der griechischen Antike, von denen im Kreise Bessarions ständig die Rede ist. Als Propagandist des Kreuzzugsgedankens schlägt der Kardinal einen Ton an, der die Verdienste muslimischer Gelehrter mitunter vergessen lässt. Regiomontanus dagegen weiß um die großen Errungenschaften der arabischen Mathematik. Gerade die mathematischen Wissenschaften schöpfen aus beiden Hochkulturen.
Zweifellos sieht auch er die Christenheit bedroht. Gelegentlich nennt er das osmanische Reich sogar einen giftsprühenden Drachen.25 In seiner Vortragsreihe aber möchte er über einen seiner muslimischen Vordenker sprechen, über Abu’I-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani al-Hasib, kurz: Alfraganus, und damit den Blick auf jene Epoche lenken, in der Bagdad die Hauptstadt der islamischen Welt und der mathematischen Wissenschaften war.
Damals ließen die Kalifen zahllose Bücher aus fremden Sprachen ins Arabische übertragen. Im »Haus der Weisheit« kamen Gelehrte aus aller Welt zusammen. Regiomontanus wandelt in ihren Fußstapfen. Das intensive Studium der Klassiker hat ihm vor Augen geführt, wie viele Werke einzig und allein durch arabische Übersetzungen erhalten geblieben sind und wie sehr der Rückgriff auf die Antike das Abendland mit der islamischen Welt verbindet.
Alfraganus war einer der Fackelträger griechischer Gelehrsamkeit im 9. Jahrhundert. Sechs Jahrhunderte vor Regiomontanus schrieb er ein Kompendium der griechischen Himmelskunde, ergänzt um neue Berechnungen der Planetenpositionen und des Erdumfangs. In Italien hat dieses Buch viel Beachtung gefunden. Kein Geringerer als der Dichterfürst Dante Alighieri berief sich in seiner »Göttlichen Komödie« und in seinem »Gastmahl« auf Alfraganus.
Eine kurze Geschichte der Mathematik
Als Regiomontanus in Padua eintrifft, erwartet man ihn dort bereits. Was man den akademischen Betrieb nennt mit all seinen eigentümlichen Regeln, Begrüßungszeremonien und Hahnenkämpfen, ist ihm inzwischen fremd. Das Universitätsleben reizt ihn nicht mehr. Und doch empfindet er den Besuch in Padua nicht als lästiges Gastspiel, denn es ist der Ort, an dem einst sein Wiener Lehrer Georg von Peuerbach unterrichtete, dem er sich drei Jahre nach dessen Tod noch immer verbunden fühlt.
Zwar habe er seit mehr als zwei Jahren keine Vorlesung mehr gehalten, teilt Regiomontanus den Zuhörern mit, als er zum ersten Mal auf die Kanzel steigt. Der Einladung nach Padua sei er dennoch gerne gefolgt. Um das Auditorium auf die Lehren des Alfraganus vorzubereiten, wolle er zunächst einen Blick auf die historische Entwicklung der mathematischen Wissenschaft werfen.26
Regiomontanus ist 27 Jahre alt und längst aus dem Schatten seines Wiener Lehrers herausgetreten. Als Mathematiker, Astronom und Astrologe genießt er in der Gelehrtenwelt beträchtliches Ansehen, überblickt er doch alle Zweige dieser Wissenschaften. Entsprechend weit spannt er den Bogen. Sein Einführungsvortrag ist die erste bekannte Universitätsvorlesung über die Geschichte der Mathematik.27
Regiomontanus bezeichnet sie als Wissenschaft der Größen. Als solche zerfalle die Mathematik in zwei Teile: die Geometrie und die Arithmetik. Erstere handele von kontinuierlichen oder ausgedehnten Größen, Letztere von Zahlengrößen.
Die griechischen Mathematiker stellten die Geometrie weit über die Arithmetik. Was Euklid, Archimedes oder Apollonius von Perge — Letzterer, so Regiomontanus, sei noch nicht ins Lateinische übersetzt — über Kreise, Parabeln oder Kegelschnitte herausfanden, schien ihnen ungleich interessanter als die Verbindungen zwischen Zahlen. Auf Basis einer systematischen Anwendung logischer Schlussfolgerungen schmiedeten sie ein Begründungsinstrument, das keine andere Kultur bis dahin hervorgebracht hatte: den geometrischen Beweis.28 Damit stellten sie die mathematischen Erkenntnisse auf ein Fundament, das in Orient und Okzident Maßstäbe für die Nachwelt setzte.
Die Arithmetik kam eher schleppend voran. Ein Grund dafür war das griechische Zahlensystem, das vor allem darauf ausgerichtet war, die Notation von Zahlen zu erleichtern. Im vierten vorchristlichen Jahrhundert schlugen die Griechen einen ähnlichen Weg ein wie vor ihnen die Phönizier. Sie benannten die Zahlen nach dem erweiterten Alphabet. Angefangen mit Alpha, Beta und Gamma für eins, zwei und drei, gab es neun verschiedene Zeichen für die Einer, neun Zeichen für die Zehner und weitere neun Zeichen für die Hunderter.
Mit der Vielzahl von 27 Zahlzeichen kamen die Griechen bis 999. Für die Tausender führten sie kleine Häkchen als Sonderzeichen ein, die sie den Einern unten anhängten. Die größte von ihnen benannte Zahl war die Myriade, die Zehntausend.
Das Aufschreiben von Zahlengrößen war eine Sache, das Rechnen eine andere. Griechische Händler oder Verwaltungsbeamte rechneten mit Rechensteinen auf einem Rechenbrett. Das einzige aus jener Epoche erhaltene Rechenbrett wurde auf der Insel Salamis ausgegraben. Die Marmorplatte zeigt ein Linienschema mit den Untereinheiten der griechischen Drachme, dem Obolos, Halb- und Viertelobolos sowie dem Achtelobolos oder Chalkus.29
Während sich das Rechnen mit Rechensteinen im Altertum großer Beliebtheit erfreute, machte die Wissenschaft der Zahlengrößen zunächst nur kleine Fortschritte. Regiomontanus weist allen voran auf den Mathematiker Pythagoras hin, der durch sein Wissen von den Zahlen Unsterblichkeit erlangt habe. Pythagoras lebte im sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Seine Schule im süditalienischen Kroton prägte die Entwicklung der griechischen Zahlentheorie wie keine andere, weil er erkannte, dass in der Natur allenthalben rationale Zahlenverhältnisse zu finden sind. Sie verbergen sich hinter den musikalischen Harmonien oder den Umläufen der Planeten. Zahlen, so Pythagoras, seien das Wesen aller Dinge.
Allerdings dachte auch Pythagoras vornehmlich geometrisch. Und wenn pythagoräische Mathematiker Rechensteine benutzten, dann auf ganz andere Weise als Schatzmeister und Händler. Sie breiteten die Steine im Sand aus und bildeten daraus geometrische Figuren wie Dreiecke, Quadrate und Rechtecke, um auf diese Weise Erkenntnisse über Dreieckszahlen, Quadratzahlen oder rechteckige Zahlen zu gewinnen.
Man beginnt zum Beispiel mit einem Rechenstein, legt ihn vor sich in den Sand und fügt drei Steine an, die einen Winkel bilden, ein Gnomon (siehe Abb. 1). Auf diese Weise erhält man ein Quadrat aus vier Steinen. Dieses kleine Quadrat wird im nächsten Schritt um einen Winkel aus fünf Steinen erweitert.
Abb. 1: Die Quadratzahlen.
So gelangt man zum nächstgrößeren Quadrat aus drei mal drei Steinen und zu der Einsicht, wie man von einem Quadrat zum nächsten und von einer Quadratzahl zur nächstgrößeren gelangen kann, nämlich durch Anlegen eines Gnomons oder, in Zahlen ausgedrückt, durch Addition der nächstgrößeren ungeraden Zahl:
Mithilfe der figurierten Zahlen entdeckten die Pythagoräer viele mathematische Gesetze, zu denen auch ganz andere Wege führen — ein Beispiel für die große schöpferische Freiheit innerhalb der Mathematik.
Archimedischer Zahlenzauber
Eine der schönsten Abhandlungen zu Zahlen, genauer gesagt, zu großen Zahlen, von denen seit jeher ein besonderer Zauber ausgeht, stammt von Archimedes. Etwa drei Jahrhunderte nach Pythagoras wirkte der legendäre griechische Mathematiker im heutigen Sizilien, in Syrakus. Für Regiomontanus und seine Zeitgenossen ist die archimedische Wissenschaft gleichbedeutend mit der wahren Kunst der Mathematik. Nachdem er in seinem historischen Überblick etliche Schriften des Archimedes zur Geometrie aufgelistet hat, darunter die Bücher »Kugel und Zylinder«, »Über Konoide und Sphäroide«, »Über spiralförmige Linien«, »Über die Messung des Kreises« und die »Quadratur der Parabel«, kommt er auch auf »arenae numerum«, »die Sandzahl«, zu sprechen.30
In dieser Schrift zeigte Archimedes, dass man grundsätzlich bis ins Unendliche weiterzählen kann, dass aber das griechische Zahlensystem dafür denkbar ungeeignet ist. Denn zum Benennen großer und immer größerer Zahlen reicht die Addition allein nicht aus. Wer in die Unendlichkeit strebt, kommt mit Multiplikationen schneller voran.
»Die Sandzahl« wirft ein grelles Licht auf die Schwierigkeiten, in die man mit Zahlensystemen hineingeraten kann. Sie ist zugleich ein Ausflug in Fantasielandschaften der Zahlen:
*
»Etliche glauben, König Gelon, dass die Zahl der Sandkörner unendlich sei«, wendet sich Archimedes an das Herrscherhaus von Syrakus. »Ich spreche dabei nicht allein vom Sand um Syrakus und im übrigen Sizilien, sondern auch vom Sand der ganzen bewohnten und unbewohnten Erde.« Andere hielten die Zahl der Sandkörner zwar nicht für unendlich, meinten aber, es habe noch keine Zahl genannt werden können, die die Menge des Sandes übertreffe. Er aber wolle versuchen, durch geometrische Beweise zu zeigen, dass unter den von ihm gefundenen Zahlen einige nicht nur größer seien als die Zahl der Sandkörner in einer Kugel vom Volumen der Erde, sondern auch größer als die Zahl der Sandkörner in einer Kugel so ausgedehnt wie der gesamte Kosmos.31
Archimedes geht sofort aufs Ganze. Um zur größten irgendwie noch vorstellbaren Zahl vorzustoßen, füllt er den größtmöglichen Raum, den kugelförmig gedachten Kosmos, mit den kleinsten Elementen, den Sandkörnern. Und da er bei seiner Argumentation ganz sichergehen möchte, fängt er mit allerfeinstem Sand an:
»Es soll ein Raum von Mohnkorngröße nicht mehr als 10.000 Sandkörner fassen.« Noch das kleinste Sandstäubchen soll also in seine Betrachtung einbezogen werden. »Und es sei der Durchmesser eines Mohnkorns nicht größer als der 40. Teil einer Fingerbreite.«32 Anders gesagt: 40 aneinandergereihte Mohnsamen mögen etwa der Breite eines Fingers entsprechen.
Von hier aus schreitet Archimedes fort zu einem Stadion, einer Längeneinheit der Griechen, die ungefähr 185 Metern entspricht. Das seien zirka 10.000 Fingerbreiten. Eine Kugel mit Stadion-Durchmesser habe etwa das 10.000 × 10.000 × 10.000-fache Volumen einer fingerbreiten Kugel. Womit wir bei maximal 1.000.000.000.000 × 640.000.000 Sandkörnern angelangt wären.
Schon der nächste Gedankensprung führt den Mathematiker zu einer Kugel mit Erddurchmesser. Letzteren entnimmt Archimedes den Berechnungen seines Kollegen Eratosthenes, mit dem er einen regen Gedankenaustausch pflegt. Archimedes konfrontiert den Direktor der Bibliothek von Alexandria ein ums andere Mal mit mathematischen Rätseln, und zwar auf ähnliche Weise, wie Regiomontanus dies 1700 Jahre später mit Bianchini tun wird. Dieser Lust der Mathematiker an Knobeleien begegnet man in allen Hochkulturen.
Bei Archimedes erfahren wir nicht, wie Eratosthenes die Ausmaße der Erde ermittelte. Alfraganus jedoch wird dasselbe geometrische Verfahren benutzen. Nach Wiederholung sämtlicher Messungen seines griechischen Vordenkers wird Alfraganus auf einen fast identischen und erstaunlich präzisen Wert für den Erdumfang kommen: in modernen Maßstäben etwa 40.000 Kilometer.
Aus dem Erdumfang ergibt sich eine obere Grenze für die Zahl der Sandkörner, die eine Kugel von der Größe unserer Erde fassen würde. Anschließend schätzt Archimedes das Volumen der Sonne. Die nächste imaginäre Kugel ist dann schon so groß wie das Weltall, das damaligen Vorstellungen gemäß bis zu den Fixsternen reichen sollte. Schließlich gelangt er zu dem Ergebnis, eine Kugel von der Größe des Weltalls könne nicht mehr Sandkörner enthalten als 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, also eine Eins mit 63 Nullen oder kurz: 10 hoch 63. Mit einem Wort: eine Dezilliarde.
Archimedes’ Sandzahl ist unvorstellbar groß, aber nicht unendlich. Um zu zeigen, dass es noch sehr viel größere Zahlen gibt, ersinnt der Mathematiker ein System, mit dem er wahre Zahlenungetüme schafft. Dabei ist er zur Originalität gezwungen, denn was die moderne Zusammenfassung seiner Abhandlung verschleiert: Archimedes kann nicht von 1 zu 10, 100, 1000 und weiter bis zu 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 voranschreiten, indem er jeweils die entsprechende Anzahl von Nullen anfügt. Er kennt nämlich keine Null und auch kein dezimales Stellenwertsystem.
Stattdessen muss er auf das griechische Zahlensystem zurückgreifen, das mit 27 Buchstaben und Häkchen als Sonderzeichen operiert. Seinerzeit ist die größte bekannte Zahl die Myriade, die Zehntausend. Für noch größere Zahlen gibt es keine eigenen Bezeichnungen. Wer im Alltag von Myriaden spricht, meint damit bereits unzählbare Mengen.
Archimedes sprengt diesen Horizont. Weil eine Menge von Myriaden Sandkörnern schnell erreicht ist, erfindet er eigene Namen und Darstellungsformen für große Zahlen. Er fühlt sich frei, die Zahlenreihe beliebig weit fortzuführen und die neu hinzukommenden Zahlen so zu benennen, wie es ihm für seine Zwecke angemessen erscheint.
Dabei muss er selbstverständlich beachten, dass Zahlwörter im Unterschied zu anderen sprachlichen Ausdrücken in einer festen Abfolge stehen. Sie bilden eine Sequenz.34 Aus einem folgt das nächste und so fort. Aufgrund dieses rekursiven Aufbaus sind alle Zählreihen — und darum geht es Archimedes in seiner »Sandzahl« — potenziell unendlich.
Mit den »Zahlen der zweiten Achtheit« lässt sich dann wieder in gewohnter Manier fortzählen (108 + 1, 108 + 2 …), bis nach wiederum einer Myriade Myriaden auch die »Zahlen der zweiten Achtheit« erschöpft und die »Zahlen der dritten Achtheit« (1016 + 1, 1016 + 2 …) erreicht sind. So schreitet Archimedes in seiner »Sandzahl« voran zu den Zahlen vierter, fünfter, sechster Achtheit und so weiter. Schließlich lässt er in Gedanken eine Myriade Myriaden Achtheiten hinter sich. In moderner Notation entspricht dies bereits einer Zahl mit 800 Millionen Nullen (10800.000.000).
Selbst hier endet die Zählung nicht. Archimedes nennt alle Zahlen kleiner als jene 100.000.000ster Achtheit die »Zahlen der ersten Periode«. Er macht 10800.000.000 zur neuen Basis, um zu den »Zahlen der zweiten Periode« zu gelangen und von dort bis zur dritten und vierten Periode weiterzuzählen. Des Zählens scheint nun kein Ende mehr. Die Macht der Multiplikationen treibt ihn schneller und schneller voran. Die größte von ihm in dieser Folge bezeichnete Zahl — Archimedes nennt sie »myriakis-myriostas periodu myriakis myrioston arithmon myriai myriades« — hat in moderner Notation 80 Billiarden Nullen. Es sind so viele, dass ein fleißiger Renaissancekopist wie Regiomontanus, der in jeder Sekunde eine Null schreiben würde, noch in Jahrmillionen damit beschäftigt wäre, sie zu Papier zu bringen.
Endlich hält Archimedes inne. Er ist mit dem Erreichten zufrieden, hat er doch deutlich gemacht, dass er sein Verfahren beliebig ausbauen könnte. Im Universum der Zahlen folgt eine Zahl auf die nächste. Man kann sie alle benennen. Aber ganz gleich, wie weit man damit fortfährt, man wird unendlich viele noch nicht benannt haben.
Den mathematisch ungebildeten Menschen werde die Zahl der Sandkörnchen an allen Stränden dieser Erde oder in einer Kugel, so ausgedehnt wie das Weltall, unglaublich erscheinen. »Den mathematisch gebildeten Menschen, die über die Abstände und die Größenverhältnisse der Erde, der Sonne, des Mondes und des ganzen Weltalls nachgedacht haben, aber keineswegs«, schreibt Archimedes, an König Gelon gewandt. »Deshalb glaubte ich, dass es auch dir wünschenswert sein würde, dies zu erkennen.«36
*
Regiomontanus kennt die »Sandzahl« durch und durch. Er ist mit Archimedes so vertraut wie kein anderer Mathematiker des 15. Jahrhunderts.37 Bereits zu Beginn der 1450er-Jahre wurden die archimedischen Schriften im Auftrag des Papstes aus dem Griechischen ins Lateinische übertragen. Regiomontanus hat eine handschriftliche Kopie dieses kürzlich übersetzten Codex angefertigt. Damit ist er nicht der Einzige. Was seine Arbeit jedoch vor allen anderen auszeichnet: Er vergleicht die Übersetzung des Jacopo von Cremona Absatz für Absatz mit einer griechischen Vorlage, die sich im Besitz Bessarions befindet, und zieht weitere Quellen heran, darunter Kommentare anderer griechischer Mathematiker zu Archimedes. Mehrere Hundert Korrekturen und Anmerkungen in seinem Manuskript zeugen von dem immensen Aufwand, den Regiomontanus in den Jahren 1462 bis 1464 betreibt.38 Seine revidierte Übersetzung wird später Grundlage für die erste gedruckte Archimedes-Ausgabe werden.
Vor den Studenten der Universität Padua spricht er voller Hochachtung von dem Bändiger großer Zahlen, der mit Myriaden Myriaden rechnete. Archimedes stieg zu immer höheren Rangzahlen auf und stellte quasi nebenbei mathematische Lehrsätze für den Umgang mit Zahlenreihen auf. All dies gelang ihm ohne die Null und das dezimale Stellenwertsystem. Das Zahlensystem, mit dem wir heute rechnen, ist späteren Ursprungs. Von Indien kommend, wanderte es erst in jener Epoche, die Regiomontanus ins Zentrum seiner Vortragsreihe gestellt hat, in den arabischen Kulturkreis ein. Von dort aus gelangte es um die Jahrtausendwende erstmals nach Europa.
Warum erst mit einer solchen Verzögerung? Warum überhaupt der Umweg über die indische und arabische Kultur? Mit seinen Zahlen erster, zweiter und dritter Achtheit hatte Archimedes die Vorzüge von Stellenwertsystemen gegenüber einfachen Additionssystemen wie dem griechischen Zahlensystem doch bereits klar erkannt. War ihm bei all seiner Findigkeit verborgen geblieben, wie elegant sich sämtliche Zahlen mithilfe von lediglich zehn Ziffern darstellen lassen?
Für uns ist das dezimale Stellenwertsystem die natürlichste Sache der Welt. Archimedes, dem unbestrittenen Meister mathematischer Imagination, lag eine Präferenz für ein Zahlensystem womöglich fern. Wollte er vielleicht gerade zeigen, dass wir nicht nur beliebig große Zahlen schaffen können, sondern darüber hinaus frei sind, das Universum der Zahlen auf diese oder jene Weise aufzuspannen, sofern wir gewisse Konstruktionsregeln beachten?
2
1, 2, 3 und
Zweites Kapitel, in welchem wir Regiomontanus beim Rechnen über die Schulter schauen. Während die meisten seiner Zeitgenossen anno MCCCCLXIIII nur die römische Zahlschrift kennen, ist er als Mathematiker im Jahr 16 längst mit den indisch-arabischen Zahlen vertraut.
Die Astronomie steht schon lange in dem Ruf, eine exakte Wissenschaft zu sein. Und doch fiebert Regiomontanus immer wieder aufs Neue jenen besonderen Momenten entgegen, in denen der Himmel ein für alle sichtbares Zeichen setzt, dass es tatsächlich mathematische Gesetze sind, die im Kosmos regieren. Ihm bekannte Gesetze.
In der Nacht vom 21. auf den 22. April 1464 verdunkelt sich der Mond über Padua. Regiomontanus hat das Himmelsschauspiel angekündigt, ohne auch nur einen Moment an der Vorhersagekraft astronomischer Modelle zu zweifeln. Als der Mond dann vor Mitternacht wie berechnet für eine knappe Stunde im Schatten der Erde verschwindet, misst der Astronom mit der ihm eigenen Sorgfalt die Positionen umliegender Gestirne.1 Womöglich im Beisein des Astrologieprofessors, dessen Vorlesungen für angehende Mediziner obligatorisch sind und der sich vor allem für eines interessiert: Was bedeutet die Mondfinsternis für die Ausbreitung der Pest?
In ganz Oberitalien mehren sich die Todesfälle. Manche Städte waren bereits im vergangenen Sommer betroffen. Als Regiomontanus seinerzeit zusammen mit Kardinal Bessarion von Rom über Siena und Bologna nach Venedig reiste, wollten sie auch Ferrara einen Besuch abstatten, erfuhren dann aber, dass die Stadt von der Seuche heimgesucht worden war, und machten einen weiten Bogen um sie.
In Ferrara sprach man von einer »grandissima moria«,2 in Nürnberg und Augsburg »hub es an zu sterben«,3 in Regensburg verzeichneten die Chronisten zur selben Zeit »ein grosses Sterben allhier«4. Auf Friedhöfen wurden Leichname zu Hunderten in Massengräbern verscharrt. Versuche, die Pestopfer zu zählen, gab es etwa in Augsburg und Umgebung, wo man Opferzahlen aus allen Pfarreien zusammentrug. Die groben Schätzungen beliefen sich auf 9000 bis 11.000 Tote.5
Nun hat die Pestwelle Florenz, Venedig und Padua erreicht. Die städtische Bevölkerung schottet sich ab. Kontaktvermeidung und Quarantäne sind die üblichen Mittel, mit denen man die Epidemie einzudämmen versucht. Die Ärzte tragen Masken, die Kirchen erhalten Spenden und geben Altäre zu Ehren der Pestheiligen in Auftrag. Wer kann, sucht das Weite.
In Padua bitten in diesen Wochen viele Studenten darum, ihre Prüfungen vorzeitig ablegen zu dürfen. Zum Beispiel treten die deutschen Medizinstudenten Sebald Volckamer und Peter Luder eiligst vor das Doktorenkollegium und erlangen binnen weniger Tage ihre Promotionsurkunden. Ihre Nürnberger Kommilitonen Hartmann Schedel und Georg Pfinzing ziehen vorübergehend aufs Land. Zwei Monate verbringen sie in den Hügeln nördlich von Venedig, ehe sie ihr Studium fortsetzen.6
Regiomontanus