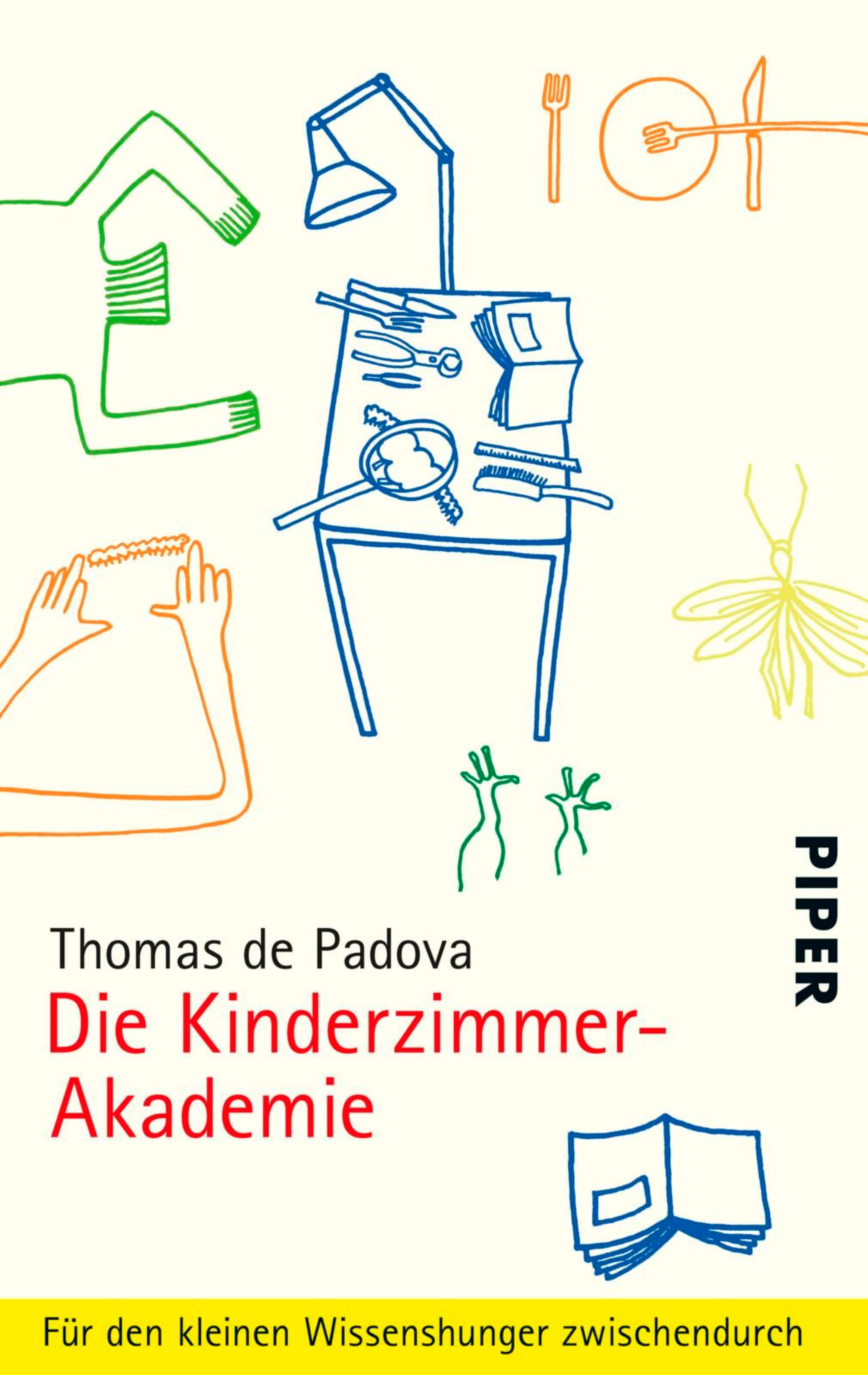Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Albert Einstein hat unser Verständnis von Raum und Zeit für immer verändert. Thomas de Padovas Biographie lässt Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie in gänzlich neuem Licht erscheinen. Berlin 1914: Einsteins Welt zerbricht. Seine Ehe mit Mileva scheitert, Deutschland zieht begeistert in den Krieg. Kollegen wie Max Planck unterschreiben den rassistischen "Aufruf an die Kulturwelt", sein Freund Fritz Haber führt an beiden Fronten einen grausamen Gaskrieg. In bestechend klarer Prosa zeigt de Padova erstmals, wie Einstein in seinen frühen Berliner Jahren zum leidenschaftlichen Pazifisten wird – und wie er inmitten einer kollabierenden Welt die Physik neu erfindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas de Padova
Allein gegen die Schwerkraft
Einstein 1914–1918
Zitat auf S. 15 – Textauszug aus: Peter Sloterdijk, Zur Welt kommen – Zur Sprache kommen. Frankfurter Vorlesungen. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1988. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2015 Carl Hanser Verlag München
www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Umschlaggestaltung: Birgit Schweitzer, München, unter Verwendung von Fotos von © ullstein bild und © akg-images
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media, Krugzell
E-Book-ISBN 978-3-446-44482-9
Inhalt
Vorwort
Teil I: Das Vorfeld
1. Von Zürich nach Berlin?
An dem Tag, als der Schweizer Oskar Bider in einem wackeligen Einsitzer zum Flug über das gesamte Alpenmassiv abhebt, nimmt sein Landsmann Albert Einstein ein verlockendes Angebot an: von Zürich nach Berlin an die Preußische Akademie der Wissenschaften zu wechseln.
2. Forscherpaare
Zusammen mit der Nobelpreisträgerin Marie Curie bricht Einstein zu einer Bergtour auf. Mit von der Partie, doch stets in seinem Schatten, seine Frau Mileva, die ebenfalls Physik studiert und von einer gemeinsamen Wissenschaftlerkarriere geträumt hat. Mileva stammt aus einer serbischen Familie. Als die Wanderung ausklingt, geht auf dem Balkan ein grausamer Krieg zu Ende.
3. Metropolis
Einstein sieht seiner »Verberlinerung« nun zunehmend mit Unbehagen entgegen. Die deutsche Reichshauptstadt, in der seine Geliebte Elsa Löwenthal auf ihn wartet, überrascht den bis dahin nur in Fachkreisen bekannten Physiker mit Willkommensgeschenken und medialer Aufmerksamkeit.
Teil II: Das Schlachtfeld
4. Ultimatum
Um seine Frau Mileva zur Scheidung zu bewegen, knüpft Einstein unmögliche Bedingungen an ein weiteres Zusammenleben. Sie verlässt Berlin zusammen mit den Kindern am Abend des 29. Juli 1914 in einem der letzten Züge nach Zürich, bevor der Erste Weltkrieg nach Ablauf des österreichischen Ultimatums an Serbien entbrennt.
5. »Unglaubliches hat nun Europa in seinem Wahn begonnen«
Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Belgien verteidigen Einsteins engste Kollegen in dem berüchtigten Aufruf »An die Kulturwelt« den Militarismus und streiten alle deutschen Kriegsverbrechen ab. Er selbst, tief betroffen, unterstützt den pazifistischen »Aufruf an die Europäer«. Der Völkerbundgedanke wird zu seiner politischen Leitidee.
6. Die Genese einer Terrorwaffe
Einstein schließt sich einer politischen Vereinigung an, die auf einen Verständigungsfrieden hinarbeitet. Unterdessen bereitet Fritz Haber, in dessen Institut er ein Arbeitszimmer hat und dessen Sohn er Nachhilfeunterricht gibt, den ersten großen Chemiewaffeneinsatz an der Westfront vor. Der Giftgasangriff in Ypern endet in einer menschlichen und familiären Tragödie.
Teil III: Das Gravitationsfeld
7. Wettlauf zur Weltformel
Unter dem Einfluss der Gravitation vergeht Zeit langsamer, läuft Licht auf krummen Wegen. Einstein hat Jahre gebraucht, um eine Theorie der Schwere zu formulieren. Im Herbst 1915 stößt er auf grundlegende Fehler in seiner Arbeit. Doch dann geht alles ganz schnell: ein Wettlauf zwischen ihm und dem Mathematiker David Hilbert um den Abschluss eines Jahrhundertwerks.
8. Beben der Raumzeit
Unmittelbar nach Vollendung der allgemeinen Relativitätstheorie sagt Einstein die Existenz von Gravitationswellen voraus, nach denen Forscher noch hundert Jahre später suchen werden. Sein Renommee wächst, pazifistische Organisationen werden verboten, der Krieg wird total.
9. Einsteins Universum
Der Physiker entwirft das Bild eines in sich geschlossenen Weltalls auf der goldenen Mitte zwischen Expansion und Kollaps. Während er das kosmische Gleichgewicht mathematisch austariert, steigt auf dem militärischen Fluggelände in Berlin-Johannisthal eine Maschine Marke Einstein mit »Katzenbuckel-Flügeln« in die Luft. Die harmlose Erfindung eines Pazifisten?
10. »9. XI. – fiel aus wegen Revolution« – Einstein, der Aktivist
Als der Große Krieg im November 1918 endet und in Berlin die Republik ausgerufen wird, schlägt die Stunde des überzeugten Demokraten. In den Revolutionstagen steht Einstein als politischer Redner auf dem Podium, sein Name wird aber auch von dem Industriellen Walther Rathenau und anderen für Parteiaufrufe missbraucht.
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweise
Vorwort
Dieses Buch erzählt von der Entstehung der allgemeinen Relativitätstheorie mitten im Ersten Weltkrieg. Es handelt von einer Katastrophe, die niemanden verschont, und von einem Forscher auf der Suche nach der Schwerelosigkeit. Von einer Welt, die zerbricht und in Albert Einsteins Physik in beispielloser Weise geistig zusammengehalten wird.
Unsere Geschichte beginnt am 13. Juli 1913, an dem Einstein vor der Entscheidung steht, die Weichen für sein künftiges Leben noch einmal neu zu stellen. Am Züricher Bahnhof trifft er auf Max Planck und Walther Nernst, die eigens aus Deutschland angereist sind, um ihrem deutlich jüngeren Forscherkollegen einen hoch dotierten Posten anzubieten – einen Traumjob ohne jegliche Lehrverpflichtungen an der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Nach Berlin also? Planck und Nernst kommen ihm vor »wie Leute, die eine seltene Briefmarke erwerben wollen«.1
Derselbe 13. Juli 1913 ist auch das Datum eines anderen, gewagteren Aufbruchs: Nach einer klaren Nacht steigt der Schweizer Oskar Bider um 4 Uhr in der Früh in einen hölzernen Flugapparat, mit dem er das gesamte Alpenmassiv überqueren will, von Bern bis nach Mailand. Seine motorisierte Maschine rollt auf Fahrradreifen über eine Wiese – und schon ist Bider in der Luft, winkt den Schaulustigen noch einmal zu und nimmt Kurs auf das 3500 Meter hohe Jungfraujoch.
Während das staunende Publikum zu Bider und anderen Piloten aufschaut, den gefeierten Helden des frühen 20. Jahrhunderts, die einen uralten Menschheitstraum wahr gemacht haben, dreht Einstein die Perspektive um. Er fragt sich, was jemand erlebt, der aus großer Höhe im freien Fall auf die Erde zustürzt. Was für einen Piloten eine Höllenfahrt wäre, lädt den Physiker dazu ein, die altbekannten Fallgesetze aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten:
Angenommen, man befände sich in einer rundum geschlossenen Kabine, würde im freien Fall der Erde entgegensausen, unterwegs seine Schlüssel aus der Hosentasche nehmen und loslassen. Dann würden die Schlüssel nicht kurz darauf am Boden der Kabine aufschlagen, sondern an eben der Stelle im Raum verharren, an welcher sie losgelassen worden sind. Sie würden schweben. Auch man selbst würde keine Schwerkraft spüren.
Die Vorstellung, schwerelos zu sein, fasziniert ihn. Kaum ein Forscherkollege, dem Einstein noch nicht davon erzählt hat, wie sich die Schwerkraft aus Sicht eines frei fallenden Beobachters plötzlich in nichts auflösen würde. Sein Entwurf für eine neue Gravitationstheorie, an dem er nun schon seit sechs Jahren arbeitet, baut auf diesem Gedanken auf.
Planck betrachtet den Versuch, die bewährte newtonsche Theorie der Schwerkraft aus den Angeln zu heben, mit ziemlicher Skepsis. Dennoch will er Einstein in Berlin sehen. Er und Nernst versprechen sich von dem jungen Kollegen vor allem Beiträge auf einem anderen Gebiet, der Quantentheorie, über die in Wissenschaftlerkreisen kontrovers diskutiert wird. Einstein hat seine Originalität auch hier bereits unter Beweis gestellt.
Nach Berlin also, »als Akademie-Mensch ohne irgendeine Verpflichtung, quasi als lebendige Mumie«?2 Für Einstein kommt das Angebot unerwartet, aber zum richtigen Zeitpunkt. Was Planck und Nernst nicht wissen: Er kennt Berlin nicht nur als Hochburg der Physik und Technik, wo er sich neue Impulse für seine theoretischen Arbeiten erhoffen darf. In der siedenden Millionenmetropole wartet seine Cousine und heimliche Geliebte Elsa Löwenthal auf ihn. Er hat das leidenschaftliche Werben um sie gerade erst wieder aufgenommen. Allerdings ist Berlin auch das Zentrum des preußischen Militarismus, der ihm seit seiner Jugend verhasst ist und der die europäischen Nachbarländer verstört.
Genau ein Jahr später, nur vier Monate nach seinem Umzug, macht das Deutsche Reich mobil. Plötzlich dringt ein lautstarker Nationalismus in alle Stätten der Wissenschaft. Wie eine tückische Krankheit habe er um sich gegriffen und sonst tüchtige und sicher denkende Menschen gefesselt, schreibt Einstein nach Zürich.3 Max Planck, Walther Nernst und Fritz Haber, die alles dafür getan hatten, den jungen Genius nach Deutschland zu holen, geraten in einen Kriegstaumel.
Als Universitätsrektor ruft Planck die Berliner Studenten zum Kampf gegen »die Brutstätten schleichender Hinterhältigkeit« auf.4 Der Chemiker Nernst erforscht, sobald der Stellungskrieg beginnt, die Wirkung von Tränen- und Reizgasen, mit denen der Feind aus den Schützengräben vertrieben werden soll. Und im selben Institut, in dem der mehr als hilfsbereite Haber seinem Kollegen Einstein ein Arbeitszimmer angeboten hat, damit er in Ruhe über die Gravitation und eine Verallgemeinerung seiner Relativitätstheorie nachdenken kann, beginnt die Suche nach noch wirksameren chemischen Kampfstoffen. Während Einstein Habers zwölfjährigem Sohn Nachhilfeunterricht in Mathematik erteilt, bricht der Institutsdirektor an die Westfront auf, um Giftgaseinsätze vorzubereiten.
Warum bleibt Einstein in Berlin, wo er zwar als Wissenschaftler ganz oben schwimmt, »aber allein, wie ein Tropfen Öl auf dem Wasser, isoliert durch die Gesinnung und Lebensauffassung«?5 Anhand paralleler Ereignisse führt dieses Buch die Leser langsam hinein in Einsteins zerrissenes Lebensumfeld und in seinen Gedankenkosmos. Es stellt den Menschen und Forscher als Zeitzeugen dar.
Die Jahre zwischen 1914 und 1918 sind Jahre des Staunens und des Schreckens. Sie erzählen von der wissenschaftlichen Aufbruchsstimmung in Berlin und der Entfesselung eines gewalttätigen Nationalismus. Sie zeigen, wie weit ein einzelner Forscher kommen kann, wenn er sich von seinen Fragen leiten und verführen lässt und wenn er Widerstand leistet gegen das unmenschliche Wüten.
Wie schnell ihn der Krieg politisiert, lässt sich unter anderem anhand seines im Jahr 2012 erstmals in seiner Gesamtheit veröffentlichten Briefwechsels mit seinem Freund Heinrich Zangger in Zürich nachvollziehen: Ende 1914 ist sich Einstein der Bedeutung von Wissenschaft und Technik im Krieg bereits voll bewusst. Ihr Zerstörungspotenzial sei riesig. »Wir müssen deshalb nach meiner Meinung eine politische Organisation im Großen anstreben, die gegen den einzelnen Staat sich verhält, wie letzterer gegen den einzelnen Räuber«, schreibt er nach Zürich.6 Ein europäischer Staaten- oder Völkerbund ist in seinen Augen langfristig der einzige Ausweg aus der Gewaltspirale. Um diesem Ziel näher zu kommen, schließt er sich dem soeben gegründeten »Bund Neues Vaterland« an, der sich nach dem Krieg in »Deutsche Liga für Menschenrechte« umbenennen wird.
Aus Sicht seiner Forscherkollegen sind seine pazifistischen Bemühungen ähnlich hoffnungslos wie sein Versuch, die newtonsche Schwerkraft zu überwinden. Tatsächlich stürzt seine mühsam ausgearbeitete Theorie der Gravitation, die auf einer gekrümmten Raumzeit fußt, im Herbst 1915 wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Als er ihre Voraussetzungen noch einmal überdenkt, erwächst ihm in dem Göttinger Mathematiker David Hilbert plötzlich ein Mitstreiter um deren mathematische Formulierung. Einstein, in Aufregung, gerät in einen Schaffensrausch. Innerhalb von vier Wochen präsentiert er der Preußischen Akademie drei Neufassungen.
Am 25. November 1915 mündet der angespannte Wettlauf zwischen den beiden Forschern schließlich in die Grundgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die er bald darauf auf das Universum als Ganzes anwendet. Als Pfeiler der modernen Kosmologie haben Einsteins Feldgleichungen auch hundert Jahre später nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Auf ihnen beruhen heutige Vorstellungen von schwarzen Löchern, Gravitationswellen und expandierenden Universen.
Die folgenden Kapitel laden die Leser dazu ein, Einstein auf seinem Weg nach Berlin zu begleiten, zu einer Zeitreise ins Mekka der damaligen Physik, wo sich seine idyllisch gelegene Arbeitsstätte nach und nach in eine Großforschungseinrichtung für Massenvernichtungswaffen verwandelt, wo Pläne geschmiedet werden für einen Krieg, in dem nicht nur Flugzeuge erstmals zum Einsatz kommen und Panzer, sondern alle Ressourcen und Erfindungen des menschlichen Geistes, vom Ohrstöpsel bis zur einheitlichen Zeitmessung, in den Dienst des Militärs gestellt werden. »Unser ganzer gepriesener Fortschritt der Technik, überhaupt die Civilisation, ist der Axt in der Hand des pathologischen Verbrechers vergleichbar«, so Einsteins bitteres Fazit inmitten des Krieges.7 Er kann nicht ahnen, dass seine eigene, hochgradig abstrakte Forschung hundert Jahre später eine sichere Navigation im Straßenverkehr ermöglichen wird, den Militärs allerdings auch das punktgenaue Lenken von Raketen und den Einsatz von Drohnen.
Die allgemeine Relativitätstheorie ist Einsteins bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Seine gedankliche Verknüpfung von Raum, Zeit, Materie und Gravitation wirft Fragen auf, die Physiker und Philosophen bis heute umtreiben. Sie hat einen Wert an sich. Welchen Nutzen die Menschheit aus ihr ziehen kann, hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob sie auch sein pazifistisches Erbe antritt.
Teil I: Das Vorfeld
»Auf dem Vorfeld herrscht der leichte Ton, die Nebenfiguren sind die Helden.«8
(Peter Sloterdijk)
1. Von Zürich nach Berlin?
An dem Tag, als der Schweizer Oskar Bider in einem wackeligen Einsitzer zum Flug über das gesamte Alpenmassiv abhebt, nimmt sein Landsmann Albert Einstein ein verlockendes Angebot an: von Zürich nach Berlin an die Preußische Akademie der Wissenschaften zu wechseln.
Über die Alpen
Nun also über die Alpen. Der Plan des Schweizer Aviatikers hat Schlagzeilen gemacht. Als Oskar Bider am Sonntag, dem 13. Juli 1913, in einen hölzernen Flugapparat steigt, um von Bern aus das gesamte Alpenmassiv zu überqueren und bis nach Mailand zu fliegen, umringen etwa fünfzig Schaulustige den Einsitzer. Sie sind früh aufgestanden, um den für 4 Uhr angekündigten Start mitzuerleben.
Nach einer sternenklaren Nacht liegt feiner Nebel über den Bergen. Ob die Alpenwand den jungen Mann mit dem weißen Sweater und der Sportjoppe hinüberlassen wird? Wird sich Bider mit seinem Monoplan so weit hochschrauben können, bis das Jungfraujoch unter ihm verschwindet?
Vielen Umstehenden ist es ein Rätsel, wie ihn die wackelige Flugmaschine über das 3500 Meter hohe Joch hinwegtragen soll. Heißluftballons erheben sich mühelos in die Lüfte, neuerdings auch die Konstruktionen des Grafen Zeppelin, der die Schweiz 1908 von oben grüßte. Sein majestätisches Luftschiff war mit Wasserstoff gefüllt und daher leichter als Luft. Dagegen vertraut Bider auf ein Fluggerät, das sichtlich schwerer ist als Luft. Dennoch soll die von einem Motor angetriebene Propellermaschine so viel Fahrt aufnehmen, dass die an den Flügeln vorbeiströmende Luft irgendwie den nötigen Auftrieb erzeugt, was selbst zeitgenössischen Physikern rätselhaft bleibt.
Der Motorflug hat sich rasant entwickelt. Nicht einmal zehn Jahre sind vergangen, seit zwei Fahrradfabrikanten in den USA mit einem motorisierten Doppeldecker die ersten Luftsprünge machten. Orville Wright blieb damals ganze zwölf Sekunden in der Luft, sein Bruder Wilbur knapp eine Minute. Als der Franzose Louis Blériot dann den Ärmelkanal überquerte und fliegend über das offene Meer hinweg von Calais nach Dover gelangte, war die Luftfahrt plötzlich in aller Munde. Noch im selben Jahr strömten Hunderttausende zu den Flugwettbewerben im französischen Reims, in Berlin oder zur Internationalen Luftschifffahrt-Ausstellung in Frankfurt, wo man die Brüder Wright, Blériot und andere Flugpioniere wie Artisten feierte.9
»Über Meerengen und weite Ebenen wegzufliegen, ist heute keine ungewöhnliche Sache mehr«, stellt ein Berner Reporter nun, im Sommer 1913, heraus und verweist auf den jüngsten Europaflug des Franzosen Marcel Brindejonc:10 von Paris nach Warschau in nur einem Tag, dann weiter bis Sankt Petersburg und über Stockholm und Kopenhagen wieder zurück nach Paris. Eine Strecke von insgesamt 4860 Kilometern.11 Dieser Flug habe gezeigt, »dass der Luftraum über dem ebenen Land dem tüchtigen Aeroplan keine Hindernisse bietet«.12
Anders im Hochgebirge. »Noch vor zwei Jahren, als ein schweizerischer Aviatiker von Berlin nach Bern fliegen wollte, war allgemein die Frage: Wird er über den Hauenstein hinwegkommen?« Und am Hauenstein habe jener schöne Flug ein rasches Ende gefunden.13 Was aber ist der Hauenstein verglichen mit dem Jungfraujoch, das sich vor Biders Flugapparat auftürmt!
Bider hat in diesen Tagen immer wieder an den Peruaner Jorge Chávez denken müssen, der vor ihm versucht hatte, die Walliser Alpen am Simplonpass zu überfliegen, und kurz vor dem Ziel abgestürzt war. Selbst der Konstrukteur des Eindeckers hat ihm von dem Flug abgeraten. Sein 70-PS-Motor reiche für eine Alpenüberquerung nicht aus. Wegen der dünnen Luft am Jungfraujoch werde er die erforderliche Flughöhe nicht halten können.
Bei Biders erstem Anflug auf die Alpen knapp zwei Wochen zuvor trug ihn seine »Blériot XI.« zwar mehrfach nahe ans Joch heran, jedoch nicht hoch genug. Nach dreistündigem Flug sah sich der enttäuschte Pilot zur Rückkehr nach Bern gezwungen. »Ich zog das Höhenruder – aber vergebens!«14
Dennoch will er nicht auf einen stärkeren Motor warten. Stattdessen hat er das Gewicht seiner Maschine vor dem neuerlichen Flugversuch noch einmal reduziert, seinen Sitz durch einen leichteren ersetzt und weniger Benzin getankt. Sein Plan sei nun, in Domodossola eine Zwischenlandung vorzunehmen, hat er einem Freund in Mailand geschrieben. »In diesem Fall brauche ich weniger Benzin und Oel und kann den Apparat um vierzig Kilo erleichtern.«15
Nun stülpt er einen Lederhelm über seine Mütze, setzt die Schutzbrille auf und zieht den Schal übers Kinn, um den eisigen Temperaturen zu trotzen, die ihn dort oben erwarten. Die Wetteraussichten sind gut. Ein Mechaniker zieht noch einmal sämtliche Schrauben an, dann rollen unter Motorengedröhn zwei Fahrradreifen und ein kleineres Heckrad über die Wiese. Sie tragen einen Eschenrumpf mit einem aufgesetzten hölzernen Tragflächengerüst, das auf dem Berner Beundenfeld klappernd Fahrt aufnimmt. Um 4 Uhr und 7 Minuten erhebt sich die Maschine vom Applaus des Publikums begleitet in die Lüfte. Mit gerecktem Hals sieht alles zu ihm hinauf, wie er in seinem Aeroplan steigt und steigt.
»Was geschieht denn?«, fragte der noch unbekannte Schriftsteller Franz Kafka, als er zum ersten Mal den Franzosen Louis Blériot in einem Flugapparat über sich kreisen sah. »Hier oben ist zwanzig Meter über der Erde ein Mensch in einem Holzgestell verfangen und wehrt sich gegen eine freiwillig übernommene unsichtbare Gefahr. Wir aber stehn unten ganz zurückgedrängt und wesenlos und sehen diesem Menschen zu.«16
Viele Piloten wehren sich erfolglos. Zwischen 1908 und 1913 haben allein in Deutschland mehr als 400 Aviatiker für den kurzen Höhenrausch mit dem Leben bezahlt. Etwa doppelt so viele Flugapparate sind zerstört worden.17 Sitzt jetzt mit dem Schweizer Oskar Bider, der tags zuvor seinen 22. Geburtstag feierte, der nächste Todeskandidat in einer fliegenden Kiste?
Während das Publikum nach dem gelungenen Start aufatmet, fliegt Bider in seinem Aeroplan auf die Berge zu, die vor ihm größer und größer werden. Sofort erklimmen einige Schaulustige eine Anhöhe, um noch möglichst lange zu verfolgen, wie der über ihnen kreisende Eindecker nach und nach an Höhe gewinnt. Noch etwa eine Stunde lang hören sie das leise Surren seines Motors. Dann entschwindet er ihren Ohren.
Zurück in der Stadt, trifft bald die erste Meldung von der Station Eigergletscher ein: Bider hat seine Maschine um 6 Uhr 7 übers Jungfraujoch gesteuert und die große Alpenmauer bezwungen. Beim anschließenden Flug längs des großen Aletschgletschers habe man das Flugzeug noch eine knappe halbe Stunde lang im Auge behalten können. Aus dem vernebelten Domodossola schließlich die Nachricht von seiner kurzen Zwischenlandung und dem Weiterflug nach Mailand.
»Wir jubeln und sind ernst zugleich«, kommentiert die Presse die Tollkühnheit des Piloten. »Nur 50 bis 100 Meter über dem Joch! Wie nötig war die Gewichtserleichterung! In 50 Metern, wenn da ein Lokalwind ... aber doch hinüber!« Biders Alpenüberquerung werde als eine der bedeutendsten Taten in die Geschichte des menschlichen Fluges eingehen. Jetzt wisse man, dass auch die höchsten Gebirge nicht unüberfliegbar seien.18
Endlich nur noch forschen
An diesem 13. Juli 1913 steht am Bahnhof in Zürich ein Mann in Sonntagskleidung: mittelgroß, breitschultrig und mit schwarzem Schnurrbart. Sein Blick gleitet über die Passanten hinweg, bis er endlich die beiden Männer sieht, auf deren Rückkehr er gewartet hat. Es schmeichelt dem 34-jährigen, dass die beiden Wissenschaftler eigens aus Berlin angereist sind, um ihm ein Stellenangebot zu unterbreiten. Tags zuvor hatte er sie vertröstet, da er noch einmal prüfen wollte, wohin sich seine innere Kompassnadel drehen würde.
Bei den Besuchern handelt es sich um Walther Nernst und Max Planck. Letzterem fühlt er sich als theoretischer Physiker besonders verbunden. Planck vertiefte sich zeitweilig derart in die Relativitätstheorie, dass seine sonstigen Studien völlig in den Hintergrund traten. Als einer der Ersten erkannte er ihre fundamentale Bedeutung, trug selbst dazu bei, die Gesetze der Mechanik entsprechend umzuformulieren, betreute Doktorarbeiten zum Problem der einsteinschen Relativität und warb bei führenden Fachkollegen um ihre Anerkennung. Ihm ist es auch zu verdanken, dass Einstein in diesem Jahr bereits zum dritten Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde.
Allein aus Dankbarkeit seinem Förderer gegenüber konnte Einstein die Berliner Offerte jedoch nicht annehmen. Deshalb hatte er am Vortag um 24 Stunden Bedenkzeit gebeten und dem passionierten Bergwanderer und seinem Begleiter Walther Nernst, die zusammen mit ihren Ehefrauen nach Zürich gekommen waren, vorgeschlagen, die Zeit für einen Ausflug ins Gebirge zu nutzen.
Nun zückt er ein weißes Tuch und winkt seinen neuen Kollegen damit zu. Mit diesem verabredeten Zeichen nimmt Einstein das Angebot an. Er hat sich für Berlin entschieden. Trotz seines Misstrauens gegenüber dem preußisch-militärischen Obrigkeitsstaat will er die Schweiz verlassen, um Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu werden.
Planck und Nernst fällt ein Stein vom Herzen. Sie haben Einsteins Berufung in den zurückliegenden Monaten minutiös vorbereitet. Als geschickter Wissenschaftsorganisator auf internationalem Parkett hatte Nernst dabei die heikle Aufgabe übernommen, den finanziellen und institutionellen Rahmen abzustecken. Einstein soll nicht nur Akademiemitglied und Professor an der Universität werden, sondern eine leitende Stelle an einem noch zu gründenden Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik bekommen.
Der 49-jährige Chemiker Nernst, berühmt geworden durch seine Forschungen in der Wärmelehre und als Erfinder der »Nernstlampen«, ließ seine guten Kontakte zur Industrie spielen. In einem vertraulichen Schreiben sagte ihm der Bankier und Großindustrielle Leopold Koppel schließlich zu, für die Dauer von zwölf Jahren die Hälfte zu Einsteins monatlichem Salär von 12 000 Mark beizusteuern, »um dem Berufenen ein hinreichendes Gesamtgehalt anbieten zu können«.19 Das ist selbst für einen Wissenschaftler seines Formats beachtlich und lässt Einstein manch unerfreulichen Disput vergessen, den er in Brüssel und Berlin mit dem »herrschsüchtigen und empfindlichen, aber nicht unehrlichen« Nernst gehabt hat. Der erste Eindruck, den der gewiefte Kaufmann, famose Techniker und leidenschaftliche Verfechter der Quantentheorie auf ihn machte, war nicht gerade günstig gewesen. In einiger Distanz lebend könne man sich jedoch durchaus mit ihm vertragen.20 Bald wird er freundlicher vom »kleinen, dicken Nernst« sprechen, einem gemütlichen Menschen, der für jede Gelegenheit ein passendes Bonmot parat hat.21
Während hinter den Brillengläsern des Chemikers erwartungsfreudige Augen funkeln, ist Planck reserviert. Der 55-jährige Physiker, schlank und groß gewachsen, stammt aus einer wilhelminischen Beamtenfamilie. Nur im Kreis der Familie und engsten Freunde taut er gelegentlich auf, etwa bei den Hauskonzerten in seiner Villa im Grunewald, bei denen er selbst am Klavier sitzt. In Gegenwart des ehrwürdigen Theoretikers legt selbst Einstein wert auf korrekte Kleidung und einen ernsten Gesprächston.22
Vor einem Monat trat Planck als Sekretär vor die versammelten Akademiemitglieder, um sich für Einsteins Wahl »in das vornehmste wissenschaftliche Institut des Staates« starkzumachen.23 In seinen Augen übertrifft Einsteins neuer Zeitbegriff »an Kühnheit wohl alles, was bisher in der spekulativen Naturforschung, ja in der philosophischen Erkenntnistheorie geleistet wurde«.24 Dem ganzen System der Physik werde durch seine Theorie ein neues einheitliches Gepräge gegeben.25
Planck schätzt Einstein nicht nur als Relativitätstheoretiker. Er sei überdies der Erste gewesen, der die Bedeutung der Quantenhypothese für die Energie der Atom- und Molekularbewegungen nachgewiesen habe. Auch in der Behandlung und Vertiefung der klassischen Theorie könne Einstein als Meister gelten.26
Einstein sieht es nicht gerne, dass man in Berlin einen Hans Dampf in allen Gassen aus ihm macht. Gegenwärtig hat er nämlich nur ein Ziel im Blick: die bisherige Relativitätstheorie zu verallgemeinern, um auch die Schwerkraft in sein Gedankengebäude einzuschließen. Dabei bewegt er sich auf schwankendem Grund. Vor allem die mathematische Ausgestaltung des neuen Theoriengebäudes ist äußerst anspruchsvoll. »Das eine ist sicher, dass ich mich im Leben noch nicht annähernd so geplagt habe, und dass ich große Hochachtung für die Mathematik eingeflößt bekommen habe, die ich bis jetzt in ihren subtileren Teilen in meiner Einfalt für puren Luxus ansah!«27
Doch ausgerechnet Planck verspricht sich nicht viel davon. Während ihrer Begegnung in Zürich erkundigt er sich zwar nach Einsteins Fortkommen, kann aber weder mit Einsteins Grundideen noch mit dem bisher erarbeiteten mathematischen Überbau viel anfangen, ganz zu schweigen davon, dass Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie kaum noch an physikalisch überprüfbare Fragen anknüpft. Statt ihm Mut zu machen, versucht er sogar, ihn davon abzubringen. »Als alter Freund muss ich Ihnen davon abraten, weil Sie einerseits nicht durchkommen werden; und wenn Sie durchkommen, wird Ihnen niemand glauben.«28
Als sie sich in Zürich verabschieden, versichert ihm Planck dennoch, man werde seine Arbeit in Berlin auf großzügige Weise fördern. Dass Planck sein Versprechen umgehend einlöst und sich für eine Finanzierung einer Sonnenfinsternis-Expedition zur Bestätigung der Gravitationstheorie einsetzt, wird Einstein einigen Respekt abnötigen. Vorerst beklagt er sich bei Freunden darüber, wie passiv sich die physikalische Menschheit zu seiner Gravitationsarbeit verhalte. Kaum jemand sei den prinzipiellen Erwägungen zugänglich, auch Planck nicht, was er nicht zuletzt auf eine zu große Angepasstheit der deutschen Wissenschaftler zurückführt.29
Einstein teilt das Misstrauen vieler Schweizer Republikaner gegenüber den Deutschen. Seit er das Land seiner Vorfahren als Jugendlicher verließ, unter anderem um dem Militärdienst zu entgehen, ist seine innere Distanz zur Gesellschaft des Kaiserreichs noch größer geworden. Schon mit fünfzehn brach er aus der traditionellen Erziehungs-Maschine aus, als Zwang und Pflichtgefühl seine Neugier zu ersticken drohten. »Dies delikate Pflänzchen bedarf neben Anregung hauptsächlich der Freiheit.«30 Ohne sie gehe die Wissbegier unweigerlich zugrunde.
Nachdem Einsteins Eltern im Herbst 1894 nach Italien gezogen waren, um dort mit einer neuen Firmengründung ihr Glück zu versuchen, stand ihr Sohn, den sie weiterhin in München auf dem Gymnasium wähnten, plötzlich in Mailand vor ihrer Tür. Er hatte sich ein ärztliches Attest besorgt sowie ein Empfehlungsschreiben eines Lehrers, um später an einer anderen Schule aufgenommen zu werden, und war getürmt. Sein verwegener Plan ging auf: Er konnte die Eltern davon überzeugen, dass er den erhofften Sprung nach Zürich ans Polytechnikum auch auf anderem Weg schaffen würde. Diese Freiheitserfahrung des jugendlichen Einstein sollte prägend für sein Leben werden.
Tatsächlich studierte er später in Zürich, wo sich seine Ablehnung vorgegebener Autoritäten noch verstärkte. Nachdem er genügend Geld gespart hatte, um Staatsbürger der liberalen Schweiz zu werden, heiratete er seine serbische Kommilitonin Mileva Maric und feierte als Patentamtsangestellter seinen wissenschaftlichen Durchbruch. Seither ist er viel durch Europa gereist und nach einem Auslandsjahr in Prag erst im Sommer 1912 wieder mit seiner Frau und den beiden Söhnen Hans Albert und Eduard in die Schweiz zurückgekehrt.
Für Mileva ist Zürich zur Heimat geworden. Sie fühlt sich wie eine Taube, die zu ihrem Schlag zurückgekommen ist. Umso unglücklicher ist sie über Alberts erneute Auslandspläne. Jetzt schon wieder fort? Nur um der Karriere willen? Als Professor an der ETH hat Albert doch einen gut dotierten Posten! In Zürich genießt er alle erdenklichen Freiheiten – jedenfalls viel mehr als damals in Bern, wo ihn das Patentamt mit einem Achtstundendienst in den Fängen hielt. Warum hat er das Berliner Angebot nicht einfach ausgeschlagen?
Da in Zürich kaum jemand Anteil an seinen wechselnden Theorieentwürfen nimmt, hofft Einstein wohl insgeheim darauf, in Berlin auf Forscher zu treffen, die ihn bei seinen gedanklichen Ausflügen in höhere Dimensionen begleiten werden. Der Berliner Wissenschaftsbetrieb zieht viele talentierte Leute an. Die Metropole ist ein Mekka der Forschung und mit der Gründung mehrerer Kaiser-Wilhelm-Institute auf dem besten Weg, ihre führende Rolle in den Wissenschaften weiter auszubauen. Nicht zuletzt von einer Zusammenarbeit mit den Astronomen verspricht sich Einstein Rückendeckung für seine Gravitationstheorie.
Außerdem möchte er alle leidigen Verpflichtungen loswerden, die ein Lehrauftrag und andere Ämter mit sich bringen. Dass er in den zurückliegenden Jahren mehrfach die Stelle wechselte, lag nicht zuletzt am Bürokratismus. »Die Tintenscheisserei im Amte ist endlos – alles, wie es scheint, um dem Tross von Schreibern in den Staatskanzleien einen Schein von Daseinsberechtigung zu geben«, klagte er in Prag.31 Im Grunde könne er gänzlich auf ein Institut verzichten. Ein Theoretiker müsse dieses im Kopf tragen. Zum Forschen benötige er höchstens ein paar Bücher.32
Sosehr ihm am Austausch mit angehenden Wissenschaftlern gelegen ist – Vorlesungen sind ihm lästig. Seine Studenten dagegen schätzen die auffallend unkonventionelle Art ihres Professors durchaus. »Als er in seiner etwas abgetragenen Kleidung mit den zu kurzen Hosen und der eisernen Uhrkette das Katheder betrat, waren wir eher skeptisch«, erinnerte sich Hans Tanner, einer seiner Züricher Studenten. Statt mit einem ausgearbeiteten Vortrag zu erscheinen, hat Einstein selten mehr als einen Zettel von der Größe einer Visitenkarte dabei. Seine Rede entwirft er oft ad hoc anhand von zwei oder drei Stichwörtern, was er selbst als »Akt auf dem Trapez« empfindet.33 »Aber schon nach den ersten Sätzen hatte er sich durch die ungewohnte Art, in der er die Vorlesung hielt, unsere spröden Herzen erobert.«34 Im Anschluss an die wöchentlichen Kolloquien lädt Einstein die jungen Leute gelegentlich sogar ein, mit ihm ins Café »Terrasse« zu kommen, um dort über aktuelle Forschungsfragen zu diskutieren.
Die Berliner Gesandtschaft kennt seine Nöte. Einstein sei so sehr in seine Forschungen versenkt, dass er in Zürich »gerne auf das große Kolleg verzichten würde, das er pflichtgemäß liest«. Die deutschen Forscher sichern ihm zu, seinen wissenschaftlichen Studien in Berlin ohne jeglichen Lehrauftrag nachgehen zu können.35 Er werde eine hauptamtliche Stelle an der Akademie bekommen, die einzige derart privilegierte Stelle, die die Akademie in ihrer Physikalisch-Mathematischen Klasse zu vergeben hat. Eine Anstellung auf Lebenszeit. Als Universitätsprofessor werde er zwar das Recht, nicht aber die Pflicht haben, Vorlesungen zu halten. Ein unwiderstehliches Angebot.36
Berlin ist auch Elsa
Einstein reagiert überschwänglich. »Es ist eine kolossale Ehre, die mir da zuteil wird«, schreibt er seiner Cousine Elsa Löwenthal, nachdem er mit Planck und Nernst handelseinig geworden ist. Schon im nächsten Frühjahr werde er für immer nach Berlin kommen. »Ich freue mich schon sehr auf die schönen Zeiten, die wir zusammen verbringen werden!«37
Fünf Tage später bekommt Elsa einen weiteren Brief: Der regelmäßige Verkehr mit ihr werde ihm das Schönste sein, was ihn in Berlin erwarte.38
Weitere fünf Tage danach – inzwischen hat er auch Post von ihr erhalten – das nächste Schreiben: Er kann sein Glück immer noch nicht fassen, endlich mit ihr zusammenzukommen. »Und eine der Hauptsachen, die ich will, das ist, Dich oft zu sehen, mit Dir herumzulaufen und mit Dir zu plaudern.«39
Drei schwärmerische Briefe an seine Cousine binnen zwei Wochen legen ein beredtes Zeugnis ab, dass er nicht allein der Wissenschaft wegen nach Deutschland gehen will. Gut ein Jahr zuvor war er Elsa in Berlin wiederbegegnet, nachdem sie sich viele Jahre nicht gesehen hatten. Sie kannten sich seit Kindheitstagen, als sie gemeinsam im heimischen Elternhaus miteinander gespielt hatten. Inzwischen war sie Mitte dreißig, geschieden und Mutter zweier Töchter.
Einstein, in dessen Ehe es längst kriselte, gewann sie in den wenigen Tagen, die sie in Berlin zusammen verbrachten, so lieb, »dass ich Dirs kaum sagen kann«.40 Wenn er an ihre gemeinsame Tour an den Wannsee zurückdachte, war er selig. Jammerschade, dass sie nicht in derselben Stadt wohnten! Die Aussicht, nach Berlin berufen zu werden, stufte er damals als recht gering ein. In Erinnerungen schwelgend, schrieb er Elsa eine Zeitlang liebevolle Briefe, ehe er sich ins Unvermeidliche ergab: das von ihm so empfundene Joch seiner bestehenden Ehe.
Einige Monate nach seinem Abschiedsbrief flammte die Korrespondenz erneut auf, was auf Elsas Initiative zurückging. Nachdem sie ihm zum Geburtstag gratuliert und ihn um ein Foto gebeten hatte, lud Einstein sie sofort ein, ihn in Zürich zu besuchen. Er würde viel darum geben, einige Tage mit ihr verbringen zu können – ohne Mileva, sein »Kreuz«. Besser noch, er würde selbst nach Berlin kommen, um sie wiederzusehen.41
Mit ihrem Stellenangebot sind Planck und Nernst mitten in sein neuerliches Werben um Elsa hineingeplatzt. Mit einem Mal fließen zwei große Leidenschaften zu einem verheißungsvollen Lebensentwurf zusammen. Seine Korrespondenz ist frei von jenen Bedenken, derentwegen er sich damals von ihr abgewandt hatte. In seinem Abschiedsbrief hatte er Elsa zutiefst bekümmert erklärt, »dass es uns beiden und andern nicht zum Guten gereicht, wenn wir uns enger aneinander anschließen«.42 Nun will er seinem Herzen folgen. Seiner Frau Mileva bleibt keine andere Wahl, als erneut die Koffer zu packen und nach Berlin mitzukommen.
Wie unbeirrbar er seinen Weg geht, zeigt auch seine Haltung den künftigen Kollegen gegenüber. Von seinem Ziel, die Relativitätstheorie zu erweitern, können ihn weder Plancks gut gemeinte Ratschläge abbringen noch die Erwartungen, die die Preußische Akademie an seine Mitgliedschaft knüpft. Nichts erschüttert seinen Glauben daran, mit seinen bisherigen physikalischen Überlegungen und seinem mathematischen Entwurf auf dem richtigen Weg zu sein.
In Deutschland erhofft man sich von ihm Impulse für eine neue Theorie der Materie an der Schnittstelle zwischen Physik und Chemie:43 Wie sieht das Innenleben der Atome aus? Wie lässt es sich mathematisch beschreiben? Einstein ist zwar nicht taub gegen die Fragen, die an ihn herangetragen werden, aber für ihn ist Berlin ein Sehnsuchtsort, an dem er dem Strom der eigenen Gedanken folgen möchte. Er gehe in die deutsche Hauptstadt »als Akademie-Mensch ohne irgendeine Verpflichtung, quasi als lebendige Mumie«, schreibt er einem Kollegen, wenige Tage, nachdem Planck und Nernst abgereist sind. »Ich freue mich sehr auf diesen schwierigen Beruf.«44
Seine Leidenschaft und Zuversicht bestimmen auch den Ton jenes Briefes an die Preußische Akademie der Wissenschaften, mit dem er die Stelle in Berlin schließlich offiziell annimmt: »Wenn ich daran denke, dass mir jeder Arbeitstag die Schwäche meines Denkens dartut, kann ich die hohe mir zugedachte Auszeichnung nur mit einer gewissen Bangigkeit hinnehmen. Es hat mich aber der Gedanke zur Annahme der Wahl ermutigt, dass von einem Menschen nichts anderes erwartet werden kann, als dass er seine ganze Kraft einer guten Sache widmet; und dazu fühle ich mich wirklich befähigt.«45
2. Forscherpaare
Zusammen mit der Nobelpreisträgerin Marie Curie bricht Einstein zu einer Bergtour auf. Mit von der Partie, doch stets in seinem Schatten, seine Frau Mileva, die ebenfalls Physik studiert und von einer gemeinsamen Wissenschaftlerkarriere geträumt hat. Mileva stammt aus einer serbischen Familie. Als die Wanderung ausklingt, geht auf dem Balkan ein grausamer Krieg zu Ende.
Freie Bahn für Frauen
1913 kreuzen sich die Wege von Mileva Einstein und Marie Curie. Sie lernen sich im Frühjahr kennen, als Mileva ihren Mann zu einer Vortragsreise nach Paris begleitet, in die Stadt des Eiffelturms, der Libertins und jener Frauen, die ihre Röcke abgelegt haben und in neumodischen Hosen ausgehen, auch wenn sie kein Fahrrad mitführen. Dass Madame Curie die Gäste aus der Schweiz während ihres touristischen Programms begleitet, erhöht den Reiz der französischen Metropole noch.
Nach einer wunderbaren Fülle von Eindrücken fahren Mileva und Albert Einstein nach Zürich zurück, schreiben der Nobelpreisträgerin einen warmen Dankesbrief und laden sie zu einer gemeinsamen Wanderung in der östlichen Schweiz ein. So reist Marie Curie Anfang August mit ihren beiden Töchtern, neun und fünfzehn Jahre alt, und mit einer Gouvernante nach Graubünden. Dort begegnet sie Mileva noch einmal, der Frau ihres hochgeschätzten Physikerkollegen, die sich, wie sie, in jungen Jahren vorgenommen hatte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eine naturwissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.
Beide haben einschlägige Erfahrungen mit der akademischen Männerwelt gemacht. In ihren Jugendjahren war es Frauen in Serbien und Polen, in Österreich-Ungarn oder im Deutschen Reich kaum möglich, eine Universität zu besuchen. Abgesehen von Ausnahmeregelungen für einzelne Studentinnen blieben die Behörden stur. Frauenvereine und internationale Frauenverbände kämpften für Reformen der Bildungssysteme, für den Zugang zu allen Berufen und das Frauenwahlrecht und verschafften sich mit öffentlichen Vortragsveranstaltungen und Petitionen Gehör. Aber nur hier und da erhielten sie Unterstützung von prominenter Seite. So fragte sich der deutsche Schriftsteller und Bühnenautor Ludwig Fulda, »wie überhaupt noch ein moderner Mensch, der diesen Namen verdiene, die Berechtigung und Befähigung der Frau zum akademischen Studium bestreiten« könne. Seine Forderung: »Freie Bahn für alle!«46
Abb. 1: Berlin 1916. »Freie Bahn« für Studentinnenverbindungen.
Damit stand Fulda in einer Umfrage unter deutschen Gelehrten aus dem Jahr 1897 mit dem Titel »Die akademische Frau« ziemlich alleine da. Nur wenige Universitätsprofessoren sprachen sich für eine behutsame Öffnung der Hochschulen aus oder, lieber jedoch, für die Einrichtung von reinen Frauenuniversitäten. Zu groß waren die Widerstände innerhalb der Institutionen. Max Planck zum Beispiel, der fünfzehn Jahre später mit der Physikerin Lise Meitner selbst eine Frau zur Universitätsassistentin ernennen sollte, war 1897 noch der Ansicht, die Natur selbst habe der Frau ihren Beruf als Mutter und Hausfrau vorgeschrieben. »Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet naturwidrig.«47
Maria Sklodowska, in Warschau geboren, sollte noch vor Planck den Physik-Nobelpreis erhalten. Die Tochter eines Lehrerehepaars absolvierte das Gymnasium mit Auszeichnung. Danach schloss sie mit ihrer älteren Schwester einen außergewöhnlichen Pakt: Um dieser zunächst ein Medizinstudium in Frankreich zu ermöglichen, wollte Maria Sklodowska als Gouvernante arbeiten. In wechselnden Anstellungen als Erzieherin hielt sie sechs Jahre lang durch, ehe sie ihrer Schwester im Herbst 1891 nach Paris folgte. Sie quartierte sich bei ihr ein, immatrikulierte sich unter dem französischen Namen »Marie« an der Sorbonne und widmete sich, nun ihrerseits von der Schwester unterstützt, dem Physikstudium, das sie allen Sprachproblemen zum Trotz als Jahrgangsbeste abschloss. Nach dem Examen heiratete sie den Physiker Pierre Curie, der beharrlich um sie geworben hatte.
Zur selben Zeit brachen Frauen in ganz Europa mit ähnlichen Lebensentwürfen zu neuen Ufern auf. Ein Studium im Ausland war für viele von ihnen die einzige Möglichkeit, eine höhere Ausbildung zu erhalten, auch für Mileva Maric, die in der Vojvodina aufgewachsen war, einer Grenzregion im südlichen Ungarn, die sie selbst ihr »Räuberländchen« nannte. Milevas Mutter entstammte einer montenegrinischen Familie, ihr Vater, ein Serbe, hatte als Verwaltungsbeamter die deutsche Sprache erlernt. Sie selbst wurde zweisprachig erzogen, besuchte eine serbische Mädchenschule, erhielt dann jedoch eine Sondererlaubnis, auf ein Jungengymnasium zu wechseln. Schließlich verließ sie ihre Heimat in Richtung Zürich, wo sie sich 1896 im Alter von 20 Jahren als einzige Frau in der Abteilung VI a des Polytechnikums zum Mathematik- und Physikstudium einschrieb – in jener Sektion, in der auch Albert Einstein studierte.
Mileva und Albert
Mileva war eine stille, ernsthafte Studentin, klein, schlank und mit dunklem Teint, die infolge einer Hüftluxation leicht hinkte, was sie aber nicht von Spaziergängen am Zürichsee und von Ausflügen ins Gebirge abhielt. Wenn sie zusammen mit ihrer besten Freundin Helene Kaufler, die in derselben Pension wohnte, an freien Nachmittagen musizierte, gesellte sich Albert gerne zu ihnen. Er spielte Violine, Mileva die »Tamburitza«, ein der Mandoline ähnliches Instrument, Helene Klavier.48
Nach zwei, drei Jahren langsamer Annäherung wurden er und Mileva ein Paar. Albert schrieb glühende Liebesbriefe an sein »Lüderchen« und »Frätzchen«, sein »Alles«: »Ohne Dich fehlt mirs an Selbstgefühl, Arbeitslust, Lebensfreude – kurz ohne Dich ist mein Leben kein Leben.«49 Ohne die Physik allerdings auch nicht, sodass er im selben Atemzug von der kinetischen Gas-Theorie schwärmen konnte. Seine »süße Kloane« und »geliebte Hex« teilte seine Begeisterung für die Forschung.
Den Eltern gab der heißblütige Student schon bald zu verstehen, dass er seine »Zigeunerin« heiraten wolle. Pauline Einstein, von der er nicht nur die widerspenstige Haarpracht geerbt hatte, sondern auch seine spöttische Art, war von Beginn an gegen die Verbindung mit einer Akademikerin, noch dazu mit einer Frau, die dreieinhalb Jahre älter war als er. »Du vermöbelst Dir Deine Zukunft und versperrst Dir Deinen Lebensweg«, schimpfte die Mutter. »Sie ist ein Buch wie Du«, wetterte sie, noch bevor sie Mileva überhaupt kennengelernt hatte. »Du solltest aber eine Frau haben.«50
Auch sein Vater betrachtete die Frau als Luxus des Mannes, den sich dieser erst gönnen könne, wenn er ein solides Einkommen habe. Albert war eine solche Auffassung über das Verhältnis von Mann und Frau zuwider. Vielmehr schwebte ihm vor, seine berufliche Zukunft gemeinsam mit Mileva zu gestalten. Er war glücklich, in ihr eine ebenbürtige und selbstständige Partnerin gefunden zu haben, konfrontierte sie allerdings geradeheraus mit der feindseligen Haltung seiner »Alten«, um ihr dann ebenso detailliert zu schildern, wie energisch er seine Liebe zu ihr im eigenen Elternhaus verteidigte.
Seine Willensstärke und seine grenzenlose Zuversicht imponierten ihr, vermutlich beneidete sie ihn um seine Selbstsicherheit. Beide schrieben eine Diplomarbeit über die Wärmeleitung von Stoffen. Kurz darauf bestand Albert seine Diplomprüfung als schlechtester von vier männlichen Kandidaten. Mileva hingegen, die schon die Zwischenprüfung hatte nachholen müssen, fiel durch. Wie viele in diesem Studiengang scheiterte sie an der Mathematik.
Da er selbst einmal die Schule geschmissen hatte, beunruhigte Albert der Rückschlag nicht sonderlich. Er hatte wenig Zweifel daran, dass sie die Wiederholungsprüfung bestehen würde. »Wie stolz werd ich sein, wenn ich gar vielleicht ein kleines Doktorlin zum Schatz hab & selbst noch ein ganz gewöhnlicher Mensch bin!« Lustig würden sie drauflosarbeiten und Geld haben wie Mist.51
Die Realität sah anders aus. Nach der bestandenen Abschlussprüfung stellte seine Verwandtschaft jegliche finanzielle Unterstützung für ihn ein. Und sosehr er sich von da an um eine Stelle bemühte und die akademische Welt von der Nordsee bis an die Südspitze Italiens mit Bewerbungsschreiben bedrängte – mit seinem mittelmäßigen Abschluss fand der später heiß umworbene Physiker nirgends eine Assistentenstelle.
Im Sommer 1901 fiel Mileva ein zweites Mal durch die Prüfung, zu einem Zeitpunkt, da sie bereits wusste, dass sie ein uneheliches Kind erwartete. Selbst in der Schweiz galt dies für Frauen als Schande. Inzwischen verdingte sich Einstein als Lehrer in wechselnden Positionen, verschlang eifrig Fachzeitschriften, verfasste seinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz und mischte sich keck in aktuelle Debatten ein. Nur eine Familie konnte der Forscher in spe nicht ernähren.
Vermutlich um kein öffentliches Aufsehen zu erregen und ihrer beider Zukunftspläne nicht zu gefährden, zog sich Mileva zu ihrer Familie zurück. Dort brachte sie ein Mädchen zur Welt, das der Vater des Kindes aus völlig unerklärlichen Gründen nie zu sehen bekam. Weder zur Geburt reiste Albert in die Vojvodina noch in den Monaten danach. Schließlich verschwand das »Lieserl« auf mysteriöse Weise völlig aus ihrem Leben. Trotz intensiver Nachforschungen muss offen bleiben, ob das Mädchen in die Hände von Verwandten gelegt oder zur Adoption freigegeben wurde oder ob es vielleicht in früher Kindheit starb. Was auch immer sich damals ereignete, es legte sich wie ein Schatten über Milevas weiteres Leben. Die Begeisterung für die Wissenschaft und die Heiterkeit der Zürcher Studentenjahre kehrten trotz ihrer baldigen Hochzeit und der Geburt zweier Söhne nie wieder in ihr Leben zurück.52
Marie und Pierre
Ganz anders verliefen die beiden Schwangerschaften von Marie Curie. Während sie auf die Geburt ihrer Töchter wartete, durchlebte sie äußerst kreative Schaffensphasen. Ihre Doppelrolle als Wissenschaftlerin und Mutter erfüllte sie gleichermaßen. Einstein bescheinigte ihr nach ihrer ersten Begegnung eine »sprühende Intelligenz« und beschrieb sie als »ehrliche Person, der ihre Pflichten und Lasten fast über den Kopf wachsen«.53
Der größte Lohn für ihre unermüdlichen Laborstudien war die Verleihung des Physik-Nobelpreises im Jahr 1903. Als erste Frau erhielt sie eine derartige Auszeichnung zusammen mit ihrem Mann Pierre für die Erforschung der natürlichen Radioaktivität. Keiner von beiden hatte zu diesem Zeitpunkt einen universitären Lehrstuhl inne. Den richtete die Sorbonne bald darauf für Pierre Curie ein, Marie wurde seine Laborleiterin. Im Alter von 37 Jahren erhielt sie für ihre wissenschaftliche Arbeit zum ersten Mal ein festes Gehalt.54
Als 1911 der Nobelpreis für Chemie folgte, war Pierre Curie bereits tot. Fünf Jahre zuvor war er als Fußgänger im Pariser Straßenverkehr unter die Räder eines Fuhrwerks gekommen. Marie Curie, auf sich allein gestellt, hatte nun erst recht gegen gesellschaftliche Widerstände anzukämpfen. Unter anderem verweigerte man ihr die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften. Mochte sie auch Frankreichs berühmteste Forscherin sein, ihre Bewerbung schlug in der Pariser Szene »wie eine Bombe« ein.55 Es hagelte Einwände, nicht nur weil sie eine Frau und Polin war, sondern auch weil sie angeblich jüdische Wurzeln hatte. Mehr noch: Diese Frau, die ihre Vorlesungen am liebsten in einem schlichten schwarzen Kleid hielt, hatte fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes eine Liebesaffäre mit einem verheirateten Forscher und Vater von vier Kindern, mit dem auch Einstein persönlich gut bekannten Physiker Paul Langevin.
Die französische Presse machte eine Skandalgeschichte daraus. Die öffentliche Häme traf den untreuen Gatten genauso wie die »Radiumcirce«, die ihn verführt hatte. Sogar die »New York Times« druckte die Liebesbriefe ab, die Marie und Paul miteinander gewechselt hatten und die dessen Ehefrau einem Journalisten zugespielt hatte, den der bloßgestellte Gatte schließlich zum Duell herausforderte. Es verlief unblutig, sollte aber nicht das einzige Pistolengefecht im Rahmen dieser »Liaison dangereuse« bleiben.
Kaum hatte das Nobelpreiskomitee in Stockholm davon erfahren, gab man Marie Curie zu erkennen, dass sie den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium wohl nicht bekommen hätte, wenn die Geschichte vorher bekannt gewesen wäre, und legte ihr nahe, den Preis nicht anzunehmen und nicht zur Verleihung nach Schweden zu reisen, was Marie Curie allerdings ablehnte. In Begleitung ihrer ältesten Tochter Irène fuhr sie nach Stockholm, wo sie couragiert auftrat.
Auf ihre Rückkehr folgten eine Nierenerkrankung, die möglicherweise auf die hohe Strahlenbelastung während ihrer Forschung zurückzuführen war, und ein psychischer Zusammenbruch mit Krankenhausaufenthalten. Sie kehrte Paris und dem öffentlichen Leben den Rücken. Vor allem der intensiven Pflege durch eine Krankenschwester und Frauenrechtlerin in Großbritannien, wo Suffragetten inzwischen einen regelrechten Bürgerkrieg um das Stimmrecht für Frauen entfacht hatten, war es zu verdanken, dass sich Marie Curie im Laufe des Frühjahres 1913 so weit erholt hatte, dass sie wieder an eine Wanderung im Gebirge denken konnte.56
Mileva und Albert Einstein hatten die in Fachkreisen heiß diskutierte Affäre von Anfang an mitverfolgt. Für die gemeinsame Wanderung haben sie eine Route ausgewählt, die selbst für ihren »Eisbär«, den neunjährigen Sohn Hans Albert, und für die gleichaltrige Eve, Marie Curies jüngste Tochter, zu meistern ist. Sie führt durch ein hoch gelegenes Bergtal, wo der Inn durch wilde Schluchten und enge Felswände rauscht, vorbei an malerischen Seen und schroffen Gipfeln über den Malojapass hinunter in Richtung Comer See. »Eine der schönsten, die man machen kann«, schwärmt der Physiker.57
Mileva hat einzigartige Erinnerungen an diese Gegend. Als 25-jährige Studentin war sie erstmals nach Como gereist, wo Albert mit offenen Armen auf sie wartete. Von Como aus fuhren sie mit dem Schiff bis nach Colico, spazierten durch blühende Gärten und gerieten dann von einem Tag auf den anderen vom herrlichen Frühling in den tiefsten Schnee, der bis zu sechs Meter hoch lag. In einem schmalen Schlitten, gerade breit genug für zwei Verliebte, fuhren sie hinauf zum Splügenpass, hüllten sich ein in Decken und Schals und fuhren eng umschlungen durch die Kälte. Der Kutscher sprach sie mit »Signora« an. Nach vier Stunden Fahrt setzten sie ihre Tour schließlich zu Fuß durch die weiße Landschaft fort. Sie war so glücklich, dass sie die Anstrengung der Schneewanderung kaum merkte.
Wehmütig denkt sie an jene Reise zurück, eine der wenigen Phasen ihres Lebens, in der sie ihren Liebsten ganz für sich hatte. Seither ist ihr Albert von Jahr zu Jahr fremder geworden. Anders als bei dem Forscherpaar Curie beschränkte sich ihre kreative Zusammenarbeit auf die Zeit des Studiums und klang nach der ersten Schwangerschaft ab. Eine Gemeinschaft zweiter Ordnung, »die auf geteilten logischen Erlebnissen und auf der Eidgenossenschaft der Wahrheitssuche beruht«,58 hat es seither nicht mehr zwischen ihnen gegeben – zur beiderseitigen Enttäuschung.
Albert habe für sie nicht mehr viel Zeit, schrieb Mileva ihrer Freundin Helene nach sechs Jahren Ehe. Da war ihr Mann gerade Professor an der Universität Zürich geworden. »Was kann man machen, der eine bekommt die Perlen, der andere die Schachtel ... Ich bin sehr hungrig nach Liebe und würde vor Freude, ein Ja zu hören, so außer mir sein, dass ich fast glaube, die böse Wissenschaft ist schuld.«59
Was sie einst miteinander verband, trennt sie inzwischen voneinander. Albert arbeite unentwegt und lebe nur noch für seine Wissenschaft, hat Helene zuletzt zu hören bekommen. Wenn er über drängende physikalische Probleme spricht, versteht Mileva ihn nicht mehr. Die mathematischen Zeichen in seinen Notizheften kann sie längst nicht mehr deuten. Sie weiß nicht, was in ihm geschieht.
Helene Savic kann sich im Herbst 1913 bei einem Treffen in Wien, wo Albert Einstein zu einer Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte eingeladen ist, selbst ein Bild davon machen, wie groß die Distanz zwischen den Eheleuten bereits ist. Während der Tagung hält man mehrfach sie und nicht Mileva für seine Gattin. Denn Mileva geht nicht mehr neben ihrem Mann, sondern hinter ihm her.60
Er vermeidet es inzwischen, alleine mit der Frau zu sein, die er einst so liebte, wie er keine andere mehr in seinem Leben lieben sollte. Nachts teilt er kein gemeinsames Schlafzimmer mehr mit ihr, morgens bleibt er lange im Bett, spielt gelegentlich mit den Kindern und musiziert in seiner Freizeit mit anderen. Nur in dieser Form halte er das »Zusammenleben« noch aus, schreibt er nach Berlin, wo die neue heimliche Freundin auf ihn wartet. Mileva habe sich in eine freud- und humorlose Kreatur verwandelt, die selbst nichts vom Leben habe und anderer Leute Lebensfreude durch ihre bloße Anwesenheit untergrabe.61
Gespräche über Gravitation
Zwar brechen sie im August 1913