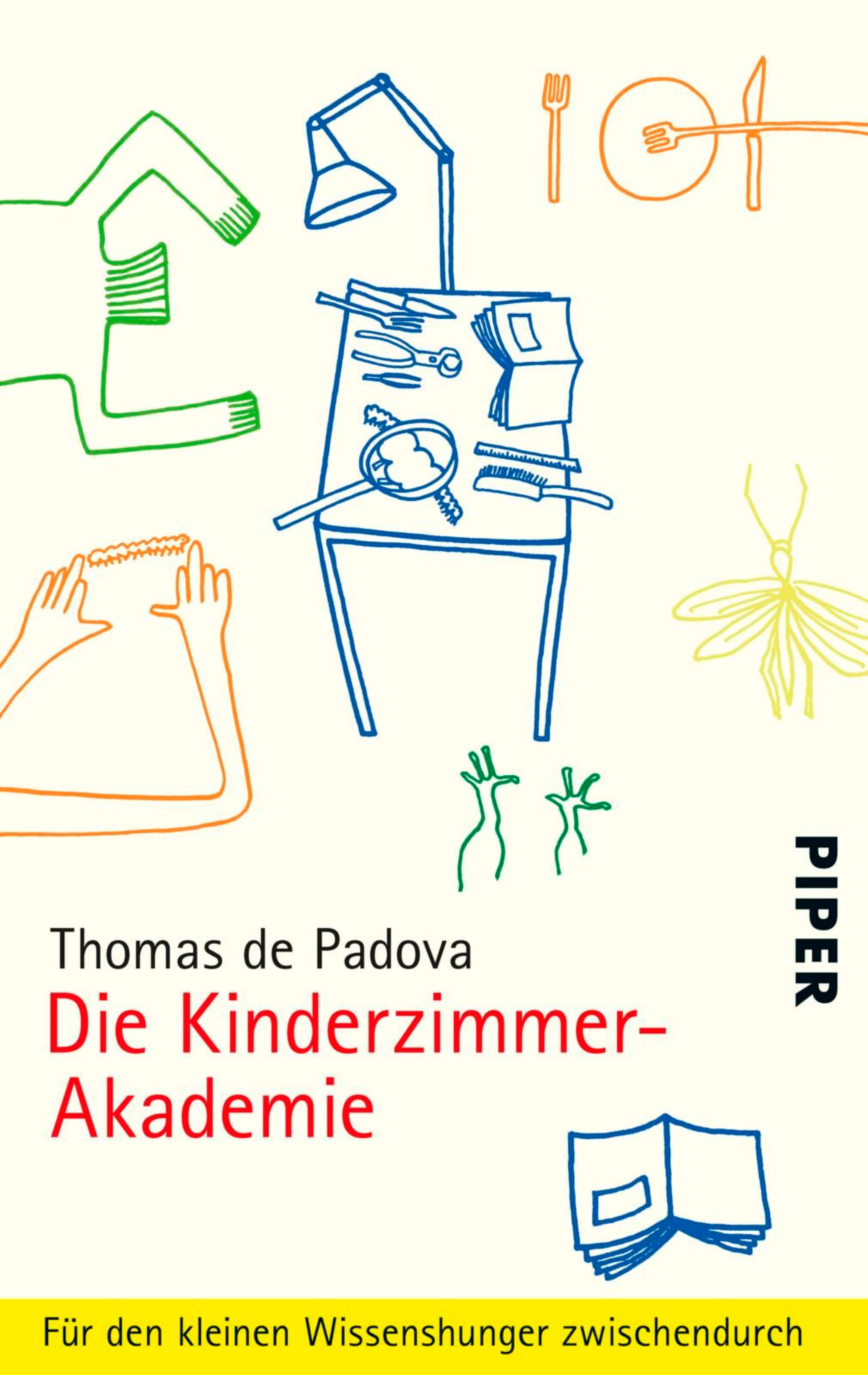Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Jeden Sommer verbrachte Thomas de Padova in einem Dorf am Meer in Apulien, Geburtsort seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters – drei Männer, die irgendwann aus Italien aufbrachen in die Welt. Seine Großmutter blieb. Jahr für Jahr erwartet sie ihn, still auf einem Stuhl sitzend, im Dunkel ihres Zimmers: eine alte, schwarz gekleidete Frau, die ohne Kühlschrank lebt. Warum hat der Großvater seine Frau immer behandelt, als existierte sie nicht? Was hat die beiden vor mehr als einem halben Jahrhundert aneinandergebunden? Diese Geschichte ist eine Schatzkammer: Erfüllt vom hellen Licht der Adria und durchzogen von uralten Geheimnissen, bewahrt sie in knappen, leuchtend klaren Szenen eine ganze Welt in sich auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Kindesbeinen an verbrachte Thomas de Padova die Sommerferien in einem Dorf in Apulien, Geburtsort seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters – drei Männer, die alle irgendwann ihre Koffer packten und aufbrachen in die Welt. Seine Großmutter dagegen blieb. Jahr für Jahr erwartet sie ihn, still auf einem Stuhl sitzend, im Dunkel ihres Zimmers: eine schweigsame, in Schwarz gekleidete Frau, die ohne Kühlschrank lebt und ihn – er habe doch studiert – fragt, durch welche Pforte Jesus in den Himmel gekommen sei. In der Atmosphäre der Vergangenheit steigen Fragen auf: Warum hat der Großvater seine Frau immer behandelt, als existiere sie nicht? Was hat die beiden vor mehr als einem halben Jahrhundert aneinander gebunden?
Hanser Berlin E-Book
Thomas de Padova
Nonna
Hanser Berlin
Unter dem Portal bleibt er stehen. Auf seinem Kopf ein dunkles Barett, sein Oberkörper wirkt gedrungen. Der hohe Bund der Hose lässt ihn unnatürlich kurz erscheinen. Hinten und an der Seite ist sie mit tiefen Taschen versehen, für Spachtel und Maurerkelle. Jetzt stecken Zigaretten darin.
Er hat zuletzt noch öfter danach gegriffen als sonst und hält auch jetzt einen glimmenden Stummel in der hohlen Hand, während er ins Innere der Kirche sieht. Beim Altar brennen Lichter auf einem Opferkerzentisch. Die Bänke sind leer. Nur in der ersten Reihe zeichnen sich die Silhouetten einiger Personen ab, drei auf der einen und eine auf der anderen Seite. Reglos sitzen sie da. Sie warten auf ihn.
Der Amerikaner, wie ihn alle im Dorf rufen, kehrt ihnen den Rücken zu und schaut die Straße entlang, über die er gekommen ist, als würde er an diesem Novembermorgen selbst noch auf jemanden warten. Doch da kommt niemand. Irgendwann lässt er den Zigarettenstummel auf den Treppenabsatz fallen, ballt beide Hände zu Fäusten und schließt die feucht gewordenen Augen.
Als er sie wieder öffnet, sieht ihn sein Großvater an, sein Nonno. Ihn also haben sie vorgeschickt! Mit dem kurz geschorenen Haar und jenem spitzen Ansatz, an dem man alle Männer in der Sippe erkennt, die Augen milchig, die Lippen blass, unter dem glattrasierten Hals eine von silbernen Fäden durchwirkte Krawatte.
Schweigend tritt sein Nonno an ihn heran, legt die Hand an seinen Arm und steht nun gemeinsam mit ihm unter dem Portal, unter einem Architrav mit dem lateinischen Schriftzug: »Pulcrum reddre templum vota vovere migrantes. Factis non verbis, contribuere simul.« Den Tempel schön zu gestalten, gelobten die Migranten. Mit Taten trugen sie bei, nicht mit Worten.
Mitte der 1920er Jahre, die Familie war soeben aus Amerika zurückgekehrt, spendete auch sein Vater für die Ausschmückung der Kirche. Heute bleibt er ihr fern, am Tag der Hochzeit seines Sohnes, die er selbst angeordnet hat.
Mit einem Machtwort? Ihrem Willen hat er sich gebeugt, nachdem sie wie eine Furie mit dem Messer auf seinen Sohn losgegangen war. Jetzt sitzt sie in der ersten Reihe und trägt einen dunklen Mantel anstelle des Brautkleids, an dem sie so lange gearbeitet hat.
Er ringt nach Worten, will seinem Nonno etwas sagen, da spürt er, wie dessen Hand seinen Oberarm umfasst. Und mit einer Bestimmtheit, die etwas absolut Zwingendes hat, führt der Vater seines Vaters ihn in die Kirche, den Amerikaner, der nicht weiß, ob er dem alten Mann an seiner Seite folgen oder weglaufen will, ob er ihn liebt oder hasst. Er weiß nur, dass er nichts versteht. Nicht einmal, warum er hier ist.
Noch bevor die Zeremonie beendet und der Segen gesprochen ist, erscheint er wieder unter dem Portal, doch diesmal bleibt er nicht stehen, sondern geht in seinen klobigen Schuhen mit schnellen Schritten die Treppe hinunter, über den Vorplatz und dann die Kirchstraße entlang bis zur Kreuzung, wo er kurz innehält und sich fragt, ob er den längeren Weg ums Dorf herum nehmen soll, um nach dem Spießrutenlauf der letzten Tage niemandem mehr zu begegnen, entscheidet sich jedoch für den corso, denn es ist schon spät, er beginnt zu laufen, die Dorfstraße hinunter, bis er den Bus erblickt, der gerade in Richtung Foggia abfährt, nachdem im letzten Moment noch eines dieser Schwarzhemden aufgesprungen ist, woraufhin er noch schneller rennt und die Mütze schwenkt, denn er will unbedingt zur Baustelle, nach Foggia, weg von hier, weit weg, Gott weiß wohin, doch der Fahrer sieht ihn nicht, auch das Faschistenschwein will ihn nicht sehen, und als er die Haltestelle endlich erreicht, biegt der Bus bereits auf die Landstraße ein.
»Merda!«
Er wirft das Barett in den Staub und verflucht den Vater, der ihn hierher geschleppt hat in dieses Drecksnest, dieses Scheißkaff, wo die Leute am Morgen ihre Pisse auf die Straße schütten, wo die Weiber hinter ihren Gardinen gaffen, bis sie irre werden, und sich das Schicksal an einer vermaledeiten Türschwelle entscheidet.
1
Meine Nonna trägt immer Schwarz. Seit ich denken kann. Wenn ich sie im Sommer in Süditalien besuche, habe ich kurzärmelige Hemden und Shorts, Badehose und Flip-Flops in meinem Koffer. In Mattinata, dem Geburtsort meines Vaters, erwarten mich Sonne, Meer und weiße Adriastrände. Und meine Nonna in schwarzer Kluft.
Als kleiner Junge konnte ich diese dunkle Gestalt, von der es hieß, sie sei meine Oma, nur schwer einordnen. Mit Beginn der alljährlichen Sommerferien lebte ich plötzlich zusammen mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern unter ihrem Dach. Ihr Andersseins spürte ich bereits, bevor mir bewusst wurde, dass sie eine andere Sprache sprach als meine Verwandten in Deutschland.
Die längste Zeit des Tages saß sie in ihren vielschichtigen Kleidern auf einem Stuhl: vom Kopftuch, das ihr kurzes, silbergraues Haar bedeckte und ihre hängenden Augenlider einfasste, bis hinunter zum Rocksaum, unter dem dicke schwarze Wollstrümpfe und ausgetretene Hausschlappen hervorschauten. Sie betete, verrichtete Hausarbeiten, verteilte Aufträge. Ihr fokussierter Blick folgte meinen Bewegungen und dem Geschehen in der Wohnung wie ein Schatten.
Mein Nonno starb, als ich sieben Jahre alt war. Fortan dachte ich, meine Nonna trüge Schwarz aus Trauer über den Verlust ihres Mannes. Längst hatte ich den Trauerflor auch bei anderen Frauen in Mattinata bemerkt. Übers ganze Dorf verteilt saßen sie auf Holzstühlen vor den weißen Häusern. Allein, in Zweier- oder Dreiergruppen hockten sie da wie Krähen auf der Stange, schwatzten und hüteten das Gedenken an die Verstorbenen.
Später wurde mir klar, dass meine Nonna dieselbe Rolle in der Dorfgemeinschaft einnahm wie sie: die der ehrbaren Witwe, die die Trauer als christliche Lebensform praktiziert. Doch warum hatte sie den Kleiderwechsel schon vor dem Eintritt in die Witwenschaft vollzogen? Warum hatte sie bereits Schwarz getragen, als ihr Mann noch lebte?
Im Ort sah man sie selten. Meine Nonna blieb im Haus. Statt draußen vor der Tür saß sie fast immer drinnen in ihrer Wohnstube. Und wie sie so dasaß in dem hohen Raum vor einer kalkweißen Wand, die Hände in den Schoß gelegt, hatte sie etwas von einer Statue an sich. Noch in meiner Jugend, in der ich selbst eine schwarze Phase existentieller Trostlosigkeit durchlief, starrte ich sie manchmal wie gebannt an. Sie kam mir wie ein Relikt aus der Vergangenheit vor, eine Frauenfigur, die mir unbekannte Zeiträume durchlebt hatte, eine Hüterin dunkler Erinnerungen.
Abgesehen von meiner Nonna ist das Italien meiner Kindheit in blaues Licht getaucht. Ich schaue auf Sommerwochen am Meer zurück, in denen ich mit meiner Luftmatratze auf den Wellen ritt und unter ihnen hindurchtauchte. Unermüdlich ließ ich mich von der Brandung ans Ufer spülen, um mich herum wirbelnde Luftblasen, das Rasseln der Kieselsteine, badende Kinder. An Mattinatas Stränden fühlte ich mich geborgen.
Frage ich meine Nonna nach einem Ort, nach dem sie sich sehnt, hat sie nicht das Meer vor Augen. Sie trägt keinen Sommer in sich, sondern das verblichene Bild einer frommen Mutter, mit der sie als kleines Mädchen gemeinsam betete. Ihre Mutter, die ihrerseits ohne Mutter aufgewachsen war und schon als junge Frau Schwarz getragen hatte, starb kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, als meine Nonna gerade sieben Jahre alt geworden war. Über fast ein Jahrhundert hinweg hat sie sich mit ihr verbunden gefühlt. »Wenn ich noch einmal zu leben hätte, würde ich ins Kloster gehen.«
2
Wieder nähert sich der Bus dem Gargano, dem Sporn des italienischen Stiefels. Hinter mir liegt die fruchtbare Ebene von Foggia, ein schier endloses Tafelland, in dem knapp die Hälfte der Tomaten reifen, die die Italiener Jahr für Jahr konsumieren. Vor mir ein Kalksteinmassiv, das steil aus der Ebene emporragt. Irgendwo dahinter muss das Meer sein.
Das weiße Gebirge, ausgewaschen vom gleißenden Licht, bildet einen Riegel zur Adria, als wäre es nachträglich ans Festland gesetzt worden. Tatsächlich gehört der Gargano, geologisch gesehen, nicht zum Apennin, sondern zum westlichen Balkan. Schon vor zwanzig Millionen Jahren, als weite Teile Italiens noch unter Wasser lagen, schaute er aus dem Meer heraus.
In völliger Abgeschiedenheit entwickelte sich hier eine ganz eigenartige Flora und Fauna. Wissenschaftler haben im Gargano die Überreste eines Fünfhorns gefunden sowie die eines gigantischen Igels, so groß wie ein Wildschwein. Es war eine Insel wundersamer Kreaturen, die nach und nach verschwanden, als das Mittelmeer vor fünf Millionen Jahren austrocknete.
Seinen Inselcharakter hat der Gargano bis heute bewahrt. Seine entlegenen Bergdörfer sind Orte heidnischer Kulte und des Mönchtums, der Erscheinung von Erzengeln und Heiligen mit Stigmata. Über Straßen, die sich an steilen, kargen Hängen entlangwinden, ziehen Jahr für Jahr Abertausende Pilger zum Grottenheiligtum auf dem Monte Sant’ Angelo und zur ehemaligen Wirkungsstätte Padre Pios, jenes wundmaltragenden Kapuzinermönchs aus San Giovanni Rotondo, der zu Italiens populärstem Heiligen avanciert ist.
Der Bus schlägt eine andere Richtung ein als die Wallfahrer. Seine Route führt nicht in Serpentinen hinauf ins Gebirge. Anders als noch in meiner Kindheit, als wir uns über ehemalige Eselspfade in langsamer Kurvenfahrt bergan in den Karst bewegten und der Küste später von oben entgegenrollten, das Blau der Adria mal rechter Hand, dann wieder linker Hand vor Augen, läuft die Straße heute geradewegs auf einen kilometerlangen Tunnel zu.
Plötzlich wird es dunkel wie vor Beginn eines Kinofilms, wenn der Vorhang zugezogen wird. Hinter mir erlischt Italien. Und noch ehe mein Herz am anderen Ende des Tunnels angelangt ist, wo das Dorf Mattinata aufscheinen wird, fliegen mir die alten Geschichten entgegen, als wären Vergangenheit und Gegenwart nur durch diesen schmalen Stollen voneinander getrennt: erinnerte Geschichten aus Kindheit und Jugend, in denen ich jeweils für etwa drei, vier Wochen im Jahr einer anderen Welt angehörte, die dann die restlichen elf Monate in mir fortlebte. Weitererzählte Geschichten, die von Aufbruch und Ausharren handeln, von Männern, die von Mattinata fortgingen, und Frauen, die blieben. Geschichten von Entfremdung und Einsamkeit.
»Wann kommst du wieder?«
»Wir sehen uns im September.« Zu einer Jahreszeit, in der Feigen und Kaktusfrüchte reifen und der Ort sich fürs Patronatsfest schmückt, in der die ersten Strandbars abgebaut werden und die Sommerresidenzen sich allmählich leeren.
Es ist die alljährliche Reise zu meiner Nonna, die sich nie von ihren Traditionen entfernt hat. Sie ist fest eingebunden in die Geschichte des Gargano, verstrickt in tausend Angelegenheiten, von denen sich mein Vater, mein Großvater und meine Urgroßväter durch einen neuen Anfang in der Fremde losmachen wollten. Drei Männergenerationen, die sich mit einem Koffer voller Hoffnungen ins Offene hinausbegaben.
Meine Nonna hat sie alle überlebt. Sie ist die Einzige, die mir noch von meinen Urgroßvätern erzählen kann, die das Dorf und die Landarbeit hinter sich ließen, um ihr Glück in Amerika zu suchen; vom Aufbruch meines Nonno, den es noch spät in seinem Leben, in den 1960er Jahren, nach Deutschland zog, wo Handwerker wie er gesucht waren; und vom Weggang meines Vaters, der Mattinata bereits mit achtzehn verließ und dessen frühen Tod meine Nonna genauso wenig verwunden hat wie ich.
Mein Vater hatte immer nur Deutsch mit mir gesprochen. Meine ganze Kindheit und Jugend über war ich weder imstande, meine italienischen Verwandten zu verstehen, noch, mich ihnen verständlich zu machen. Mit Beginn meines Physikstudiums belegte ich dann Italienischkurse an der Universität Bonn, las Bücher italienischer Autoren und schrieb mich für ein Studienjahr in Bologna ein, um das Land meiner Vorfahren kennenzulernen, von dem ich bis dahin kaum mehr als eine 6000-Seelen-Gemeinde an der Adriaküste gesehen hatte.
Das fette, gelehrte Leben alla bolognese glich in keiner Weise dem kargen, ländlichen Leben in Mattinata. Außerhalb der Vorlesungszeiten jobbte ich für eine Zeitarbeitsagentur, lief als uomo sandwich, als wandelndes Werbeplakat, durch die Arkaden der Bologneser Innenstadt, half Menschen bei Umzügen und Renovierungen. Mit meinen Ersparnissen ging ich auf Reisen, fuhr nach Padua und Venedig, Florenz und Rom, Siena und Neapel und dann per Anhalter bis hinunter nach Palermo, mit dem Schiff nach Stromboli und Lampedusa, um irgendwann wieder im Gargano, dieser einzigartigen Bergregion, dem schönsten Abschnitt der italienischen Adriaküste, anzukommen, vor meiner schwarz gekleideten Nonna zu sitzen und enttäuscht festzustellen, dass wir uns nach wie vor kaum verständigen konnten.
Kurz vor Abschluss meines Studiums starb mein Vater. Unmittelbar nach seiner Beerdigung im Rheinland fuhr ich nach Mattinata, mitten im Winter, diesmal auch ich in Schwarz, bereit, mit seiner Mutter zu trauern, und gewillt, das Familiengedächtnis wachzurufen, das meine Nonna mit sich herumträgt. Wie schon bei vorherigen Besuchen schnappte ich nur Satzbruchstücke auf, stieß aber auf ein Wörterbuch, das auf Mattinata und den Gargano eingegrenzt ist.
Mit diesem schmalen Bändchen machte ich mich daran, mir die Sprache meiner Nonna anzueignen, einen aussterbenden Dialekt. Ich erfuhr, dass das Verb azzuppé, das sie häufig verwendet, im Italienischen guadagnare (verdienen) bedeutet. Das mattinatesische fatijé steht für lavorare (arbeiten), meine Nonna sagt vagnune anstelle von ragazzi (Kinder) und picc statt poco (wenig).
Da sie nie zur Schule gegangen ist, hat sie allenfalls eine vage Vorstellung davon, was es bedeutet, eine fremde Sprache zu lernen. Frage ich sie etwa, was a tutte vanne heißt, wiederholt sie laut und schrill a tutte VAAANNE, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit, dass a tutte vanne überall a tutte vanne heißt, dabei sagt man auf Italienisch dappertutto (überall).
Die Verständigung mit ihr ist mühevoll geblieben, eine Annäherung in kleinen Schritten. Doch Vokabel für Vokabel, Satz für Satz hoffe ich, die Lücken zu schließen und die Wehmut über all die nicht geführten Gespräche zu lindern.
»Wann kommst du wieder?«
»Wir sehen uns im September.«
Eine Markierung im Zyklus der Zeit, die immer wieder aufs Neue danach fragt, was erinnert und wie es erzählt wird, was verschwiegen und was mir womöglich für immer rätselhaft bleiben wird. Und wo ich meinen eigenen Platz finde in dieser zerklüfteten Familiengeschichte, die wie die Felsformation des Gargano ins Meer der Gegenwart hineinreicht.
3
Das Haus meiner Nonna ist das letzte in einer kurzen, ansteigenden Straße. Es schließt die Zeile mit einem niedrigen Vorbau ab. In diesem Winkel liegt ihre Küche, eng und düster, hier sitzt sie oft bis in den Nachmittag hinein auf einem ihrer winzigen Holzstühle. Womöglich kauert sie auch jetzt hinter dem dunklen, mit einem Fliegengitter verhangenen Küchenfenster, das geradewegs zu der Kreuzung zeigt, auf der ich verschwitzt herumstehe und einen letzten Schluck aus der Wasserflasche nehme, die ich am Bahnhof in Foggia gekauft habe.
Das kalkweiße Dorf schläft in sengender Mittagsstille. Nur von einem Plakat lacht mich, altmodisch wie der Wirt einer Berliner Eckkneipe, der Sänger Antonello Venditti an, der irgendwann einen Auftritt in dieser Gegend hatte. Die angeschlagenen Titel, Sotto il segno dei pesci und Sara, gehörten wie Transistorradio und Kassettenrecorder zum Strandleben der siebziger und achtziger Jahre. Hinter dem verstaubten Transparent öffnet sich eine umzäunte Baugrube.
Ihr Küchenfenster ist undurchdringlich wie eh und je: ein kleines, graues Rechteck in einem hellen Mauervorsprung, vor dem eine angeklammerte weiße Plastiktüte tanzt. Wie ein Salamander in der Sonne harrt meine Nonna in ihrer Kammer aus, stumm und regungslos, bis sie eins wird mit ihrer Umgebung, als würden Wachheit und Schlaf ineinanderfließen. Sie wird sich nicht zu erkennen geben, wird sich nicht rühren, ehe ich nicht vor der Haustür stehe und nach ihr gerufen habe.
In Erwartung meiner Ankunft wird die Erinnerung sie weit zurückgetragen haben, in die Zeit vor dem Tod meines Vaters, zu jenen drei oder vier Wochen im Jahr, in denen wir ihre Wohnung zu unserem Ferienlager machten, in denen es laut und lebendig war, wo jetzt Stille herrscht. Schon damals trat sie nicht vor die Tür, wenn wir mit dem Auto vorfuhren und uns nach vierundzwanzigstündiger Reise nacheinander aus den feuchten Kunststoffsitzen unseres weißen Ford 17 M schälten. Meine Nonna wartete drinnen in ihren schwarzen Kleidern, ein goldenes Amulett um den Hals.
Wir begrüßten sie einer nach dem anderen, meine Mutter und meine beiden Schwestern oft vorneweg, dann mein Vater. Möglich, dass sie in mir nun diesen zögerlichen, unentschlossenen Jungen wiedererkennt, der sich ihr damals, beim Antreten der Familie, als Letzter näherte, die Furcht in den Augen, die ihrem festen Kniff in meine Wange vorausging. Noch heute habe ich Mitleid mit den bambini Süditaliens, den vielen unschuldigen Opfern dieser permanenten Kneiferei.
Seinerzeit schlug ich einen Bogen um meine Nonna, weil mir ihre rauen Gesten und kreischenden Laute unheimlich waren. Sie dagegen machte sich aus meiner einmal offenbarten Scheu einen Spaß, kniff mich noch häufiger und kräftiger in die Backe als meine Schwestern. Geriet ich in die Nähe ihre Stuhls, gab sie das Ungeheuer, riss beide Arme hoch und schrie: »U papònne!« In der dunklen Küche: »U papònne!« Im finsteren Kelleraufgang: »U papònne!« Ständig gaukelte sie mir vor, ein Gespenst würde sein Unwesen im Haus treiben, vor dem ich mich freilich weniger fürchtete als vor ihr.
Der Spuk ist vorüber. Doch etwas Ungewisses und Düsteres ist bis zum heutigen Tag geblieben.
Ich stecke die Wasserflasche zurück in den Rucksack und schaue, geblendet von der Lichtfülle des Septemberhimmels, über Olivenhaine zum Meer hinunter. Von zwei Felsvorsprüngen eingerahmt, liegt die Bucht, Kulisse zahlloser Fotos aus den Familienalben, in ihrer ganzen Schönheit vor mir. Alles sieht noch so aus wie vor dreißig, vierzig Jahren. Nur drei funkelnagelneue Müllcontainer in einer Biegung der Straße, die zum Meer hinunterführt – Gelb für Plastik, Weiß für Papier, Grün für Glas –, passen nicht ins Bild.
Seit eh und je lag eine Müllhalde in dieser Kurve. Dort warfen die Dorfbewohner all das ab, was sie nicht mehr gebrauchen konnten: Blecheimer und Bauschutt, Matratzen und Fernsehgeräte, Plastikflaschen und Unterwäsche. Auf dem Weg zum Strand gab es mehrere solcher Schuttabladeplätze. Umso drolliger wirkt das Arrangement der farbigen Container, deren einziger Sinn und Zweck darin zu bestehen scheint, deutlich zu machen, dass an dieser Stelle für den eigentlichen Müll kein Platz mehr ist.
Ziellos wehen Blütenblätter und Eispapier, Zigarettenschachteln und Plastiktüten über den Asphalt bergan. Tag für Tag sammelt sich solcher Unrat vor dem Haus meiner Nonna und wirbelt auf dem Vorplatz ihrer Küche herum. In ihrem Winkel hat sie sich vom Meer abgewandt. Ihr Küchenfenster zeigt auf jene Straßenflucht, die aus dem Ort direkt auf das Haus zuläuft.
Gleich werde ich das gleißende Licht und das glitzernde Blau des Meeres gegen das Halbdunkel ihrer Wohnung eintauschen. Meine Nonna wird mich in die Wohnstube, den salotto, hereinbitten, kein Licht einschalten, mir keinen Kaffee, kein kühles Getränk und auch sonst nichts anbieten, weil es in ihrem Haushalt nichts anzubieten gibt. Sie wird mir auch keine Fragen stellen, sondern mir ohne Umschweife und ganz selbstverständlich jenen Platz in ihrem Alltag einräumen, den ich schon so oft für die Dauer eines Sommerurlaubs eingenommen habe.
Links über mir, hinter einem schmiedeeisernen Balkon, zieht jemand den Vorhang ein Stück zurück. Vielleicht eine jener Bekannten meiner Nonna, die sich am Nachmittag manchmal zu ihr setzen und den Rosenkranz mit ihr beten? Hinter der Brüstung regt sich nichts mehr.
Eben erst bin ich, mehr als tausendsiebenhundert Kilometer von meinem Wohnort Berlin entfernt, glücklich aus dem Bus gestiegen und habe den unverwechselbaren Geruch des Ortes wahrgenommen, den würzigen Duft, den der allgegenwärtige Rosmarin und andere Kräuter verströmen, und einen mir ebenso vertrauten Hauch verbrannter Erde. Plötzlich aber fühle ich mich klein am Fluchtpunkt der zu mir abfallenden Straße, an der nichts unbeobachtet bleibt, wo immer jemand hinter einem Vorhang sitzt und nach draußen schaut.
Die Glocken läuten. Zwei hohe Töne, ein tiefer Schlag. Dann wieder das unablässige Ts-Ts-Ts der Zikaden.
4
Meine Nonna ist klein, noch kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte. Als sie zum ersten Mal von ihrem Stühlchen aufsteht, reicht ihr Kopftuch gerade bis zur Türklinke. Ist sie wieder ein wenig geschrumpft?
Ich weiß nicht, was sie vorhat. Vermutlich hätte ich diesen Gang für sie machen können. Sie hätte mich dirigieren können, was sie in den kommenden Tagen auch unbeirrt tun wird. Jetzt aber stützt sie sich auf ihr Gehgestell und schlurft durch die Wohnung. Ihren krummen Rücken wie den Panzer einer Schildkröte tragend, schiebt sie das viel zu große vierrädrige Metallgestänge zielstrebig vor sich her. Sie geht so langsam, dass ich die Luft anhalte.
Offensichtlich macht ihr das Laufen noch mehr Mühe als im vergangenen Sommer. Da hätte sie die Gehhilfe an der Schwelle zum Schlafzimmer stehen lassen und sich den nötigen Halt an Tür und Kommode verschafft. Nun verschwindet sie mitsamt dem rollenden Gestänge im Schlafzimmer und zieht die Tür geschickt hinter sich zu. Ich höre, wie sie eine Schublade der Kommode öffnet, dann lausche ich nur noch meinem wieder einsetzenden Atem.
In der Wohnung sieht alles aus wie immer. Seit der Renovierung des Hauses vor dreißig Jahren hat nichts mehr seinen Platz gewechselt. Der kleine, krummbeinige Stuhl mit den weißen Farbflecken an den Füßen, auf dem sie eben noch gesessen hat, stand vom ersten Tag in Reichweite der Haustür. Sitz und Rückenlehne sind grün umhäkelt, darüber, eingeklemmt hinter einer Holztafel, auf der zwei Messinghände betend aneinanderliegen, kriecht ein Plastikzweig mit Efeublattwerk die Wand empor.
Rechts neben dem Stuhl die alte Singer-Nähmaschine. Eine Plastikdecke verhüllt ihr gusseisernes Gestell. Mit dieser Tretmaschine nähte meine Nonna früher Nachthemden, Schlafanzüge und Schuluniformen, am Ende des Zweiten Weltkriegs auch Regenmäntel aus den Fallschirmen der amerikanischen Soldaten. So bestritt sie ihren Lebensunterhalt.
Weiter im Uhrzeigersinn, an der Wand gegenüber der Haustür, prunkt die Vitrine: bunte Schnapsgläser in der obersten Reihe, darunter weiße Espresso-Tassen und Flitterkram, wie ihn jeder Gast bei italienischen Hochzeiten vom Brautpaar geschenkt bekommt, versilberte Tabletts, nie benutzte Kaffeekannen, Bilderrahmen und allerlei mit buntem Tüll umwickelte Bonbonnieren voller steinharter eingezuckerter Mandeln, Jahrzehnte alt. Ebenfalls stirnseitig die Eingänge zu den beiden Schlafzimmern und neben der Küchentür schließlich ein ausklappbarer Esstisch, auf dem ein Telefon steht sowie eine Uhr in hellem Holzgehäuse, deren Zeiger entweder stillstehen oder den Kirchturmglocken mehr als eine Stunde hinterherhinken.
Die Tür geht wieder auf, und mit der stickigen Luft aus dem fensterlosen Schlafzimmer strömt der Geruch nach Mottenpulver in die Stube. Mit winzigen Schritten bewegt sich meine Nonna zu ihrem Sitzplatz zurück, den Blick nach unten gerichtet, einen weißen Briefumschlag zwischen ihren blassen, zusammengepressten Lippen.
Als sie ihren Stuhl erreicht, legt sie zuerst das Kuvert auf der Nähmaschine ab, hält sich an der Lehne eines zweiten, eigens dazu postierten Hilfsstuhls fest, dreht sich langsam um, bis ihr Rücken so zur Wand zeigt, dass sie nunmehr mit der zweiten Hand den stabilen Rahmen der Nähmaschine erreicht. Gestützt auf die beiden assistierenden Möbelstücke lässt sie ihren Körper auf den grünen Bezug fallen und hat endlich ihre sichere Position neben der Haustür zurückerobert, von der aus sie nacheinander zuerst den dienstwilligen Lehnstuhl, danach das Gehgestell beiseiteschiebt und nach der Briefhülle greift, um sie mir in die Hand zu drücken.
»Was ist das?«
»Legg!« Lies!