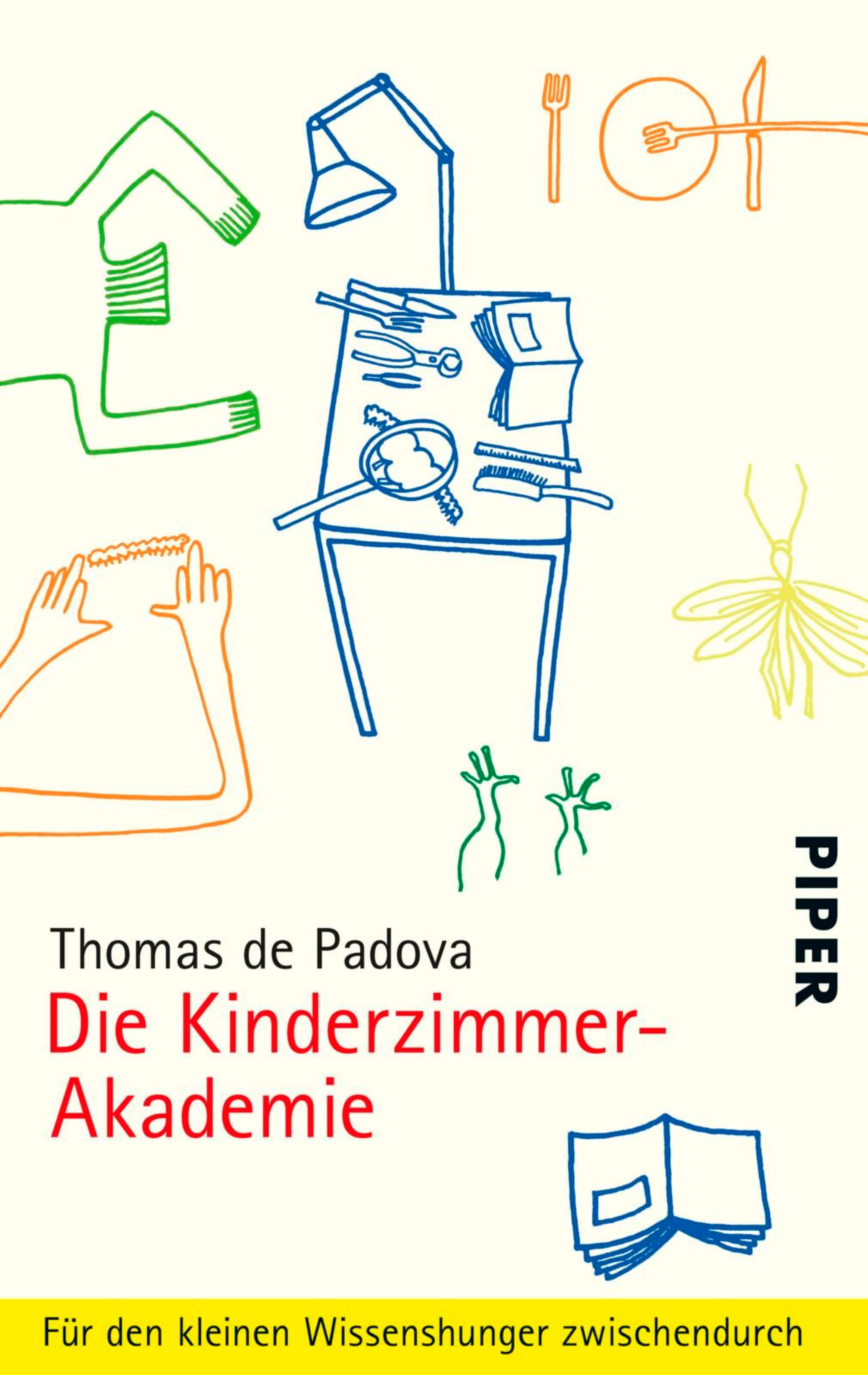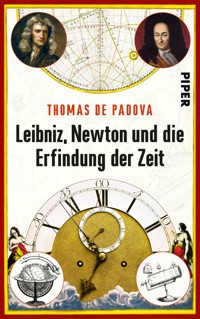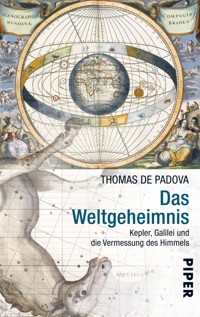
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1609 baut Galileo Galilei in Padua ein Teleskop, und Johannes Kepler veröffentlicht in Prag seine Planetengesetze. Thomas de Padova zeigt ihr Leben und die große Epochenwende in ganz neuem Licht. Glänzend geschrieben und gestützt auf den kaum beachteten spannungsvollen Briefwechsel der beiden so unterschiedlichen Forscher, erzählt er, wie sie gleichzeitig, doch jeder auf seine Art, nach den Sternen greifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95698-7
© 2009 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von Büro Jorge Schmidt, München Umschlagabbildung: Bridgeman Art Library
EINLEITUNG
»Drei große Ereignisse stehen an der Schwelle der Neuzeit und bestimmen die Physiognomie ihrer Jahrhunderte: die Entdeckung Amerikas und die erstmalige Erforschung und Inbesitznahme der Erdoberfläche durch die europäische Menschheit; die Reformation und die von ihr veranlasste Enteignung der Kirche und der Klöster …; schließlich die Erfindung des Teleskops und die Entwicklung einer neuen Wissenschaft, welche die Natur der Erde vom Gesichtspunkt des sie umgebenden Universums aus betrachtet.«
(Hannah Arendt)
Galileo Galilei ist sechzehn Jahre alt, Johannes Kepler acht, als im Herbst 1580 die Nachricht von der zweiten Weltumseglung umgeht. Francis Drake und seine Mannschaft haben mit ihren Schiffen Südamerika umfahren und sind bis nach Kalifornien vorgedrungen. Wieder müssen die Weltkarten neu gezeichnet werden. Drake und andere Seefahrer vermessen den Erdball von Grönland bis hinunter zu den Falkland Inseln, ganze Flotten englischer, spanischer und niederländischer Schiffe folgen ihnen, um die fremden Länder in Besitz zu nehmen und den globalen Handel unter sich aufzuteilen.
Europa bereichert sich mit Silber aus Argentinien, der »Terra Argentea«, Edelmetalle aus allen Teilen der Neuen Welt überschwemmen den Markt. Wirtschaftszweige wie der Farbstoffhandel mit Kermesrot brechen ein, weil in der unüberschaubaren Artenvielfalt in Übersee eine bisher unbekannte Schildlaus aufgetaucht ist, die einen neuen, ergiebigen Farbstoff liefert. Selbst Kardinäle wechseln nun die Farbe.
Die Republik Venedig gerät durch die Globalisierungswelle unter Druck. Zum Atlantik, dem Meer der Zukunft, haben ihre Schiffe keinen Zugang. An der Schwelle zum 17.Jahrhundert werden bereits deutlich weniger Geschäfte als zuvor über die prächtige Metropole an der Adria abgewickelt, wo Galileo Galilei seine fruchtbarsten Jahre als Wissenschaftler verbringt, Instrumente baut und physikalische Experimente durchführt.
Im Gegensatz zu Venedig profitiert Prag zumindest für ein paar »goldene« Jahrzehnte von der Verschiebung der Machtverhältnisse. Aus Furcht vor den Türken hat der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches seine Residenz von Wien nach Prag verlegt. Rudolf II. holt Künstler und Architekten, Alchemisten und Wissenschaftler an seinen Hof. Auch den Mathematiker Johannes Kepler zieht es hierhin, nachdem er aus Graz vertrieben wurde, wo für die Anhänger lutherischen Glaubens kein Platz mehr war.
Unter dem Schutz des toleranten Kaisers kann Kepler in Prag einer wissenschaftlichen Theorie frei nachgehen, die unter dem Verdacht steht, der Bibel zu widersprechen. Ähnliche Freiheiten genießt Galilei in der unabhängigen Republik Venedig, die alle Einmischungen der römischen Kirche strikt ablehnt. Aber die religiösen Spannungen und politischen Machtkämpfe verschärfen sich hier und an anderen Brennpunkten Europas – der Kontinent steht kurz davor, sich in einem grausamen Krieg zu zerreiben.
Im Vorspann dieses Dreißigjährigen Krieges erlebt die Wissenschaft einen ungeahnten Aufbruch. Der Beginn des 17.Jahrhunderts steht wie kaum ein anderer Zeitabschnitt in der Geschichte der Naturwissenschaften beispielhaft dafür, wie neue Techniken und das Auffinden universeller Gesetze den Erkenntnishorizont verschieben und den Blick auf uns selbst und unseren Platz im Universum verändern.
Im Sommer 1609 stellt Galileo Galilei auf dem Markusplatz in Venedig ein Fernrohr vor, das er innerhalb weniger Monate zu einem Forschungsinstrument perfektioniert. Das Teleskop lenkt sein Interesse in eine unerwartete Richtung. Durch zwei Linsen sieht er plötzlich Tausende dem bloßen Auge verborgene Gestirne, erkennt Gebirge auf dem Mond und kann den Lauf der Venus um die Sonne verfolgen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft wird auf derart frappierende Weise deutlich, dass die Forschung nicht nur durch gedankliche Konzepte, sondern auch durch technische Entwicklungen vorangetrieben wird.
Ebenfalls im Sommer 1609 veröffentlicht Johannes Kepler in Prag seine wegweisenden Planetengesetze. Er ist ein Freigeist und Querdenker, der darüber spekuliert, dass bis dahin unbekannte Anziehungskräfte die Planeten an die Sonne binden. Außerdem hat er in jahrelanger, mühseliger Rechenarbeit herausgefunden, dass die Planeten auf Ellipsenbahnen um die Sonne ziehen. Keplers neue Himmelsphysik und sein Glaube an streng mathematische Gesetze im Kosmos öffnen ein weiteres Fenster zur modernen Astronomie.
Sein Weltentwurf und Galileis Beobachtungen machen plausibel, warum die Sonne als Zentrum des Kosmos betrachtet werden muss, die Erde dagegen als randständiger Planet. Im selben historischen Augenblick wird die neue Stellung des Globus sowohl durch die Brille der Mathematik als auch durch das Fernrohr sichtbar. Keplers Begeisterung für die Schönheit und Einfachheit des Universums und Galileis Faible für Instrumente und Experimente werden programmatisch für eine Forschung, die die Wirklichkeit durch universelle Gesetze zu beschreiben versucht und durch präzise Techniken in alle Belange unseres Alltags eingreift.
Dieses Buch zeichnet den Aufstieg der neuen Wissenschaft und die damit verbundenen Umbrüche nach. Im Mittelpunkt steht der Dialog, der sich zwischen dem Italiener und dem Deutschen entspannt und den Kepler voller Enthusiasmus beginnt. Er hat auch mich in die Gedankenwelt und das soziale Netz der beiden Protagonisten hineingezogen.
In ihren Briefen begegnen sich Kepler und Galilei auf einem schmalen Grat zwischen schwärmerischer Begeisterung und nüchterner Analyse, zwischen offenem Gedankenaustausch und Geheimhaltung, zwischen Kooperation und Konkurrenz. Die bisher wenig beachtete Korrespondenz wirft auf beide Forscher ein neues Licht: Im Spiegel des jeweils anderen zeigen sich ihre Weitsicht und Engstirnigkeit, ihre gedankliche Schärfe und Ignoranz.
Eine Gegenüberstellung der beiden schillernden Figuren eignet sich in besonderer Weise dazu zu erkunden, was Forscher bis heute dazu treibt, vertraute Sichtweisen hinter sich zu lassen und ein unbekanntes Terrain zu betreten. Und wie das Neue in die Welt kommt.
Teil I
DER BLICK DURCHS FERNROHR
DIE WELT HINTER DEN GESCHLIFFENEN GLÄSERN
Wie Galilei das Fernrohr noch einmal erfindet
Große wissenschaftliche Entdeckungen verdanken sich oft dem Wagnis einzelner Forscher, sich einer Idee ganz zu widmen. Der Physiker Wolfgang Ketterle zum Beispiel verbrachte die kreativsten Jahre seines Lebens damit, außergewöhnliche Kühlschränke zu bauen. Er wollte Atome in einen hypothetischen, von Albert Einstein vorhergesagten Kältezustand versetzen. Das Gespräch über seinen langen Weg zum Nobelpreis, das ich im Frühjahr 2002 am Massachusetts Institute of Technology in den USA mit ihm führte, ist mir bis heute lebhaft in Erinnerung geblieben. Vielleicht liegt das an einem einzigen Wort, einer Nebensächlichkeit, auf die der Vierundvierzigjährige plötzlich zu sprechen kam, nachdem er sich warmgeredet hatte: sein Feldbett.
Der hoch aufgeschossene Wissenschaftler hatte einen provisorischen Schlafplatz in seinem Labor. Er schlug dieses Feldbett in jenen Nächten auf, in denen sein Experiment nach vielen Stunden des Justierens und der Feinabstimmung endlich so lief, wie es sollte. Wenn die in einer magnetischen Falle eingesperrten Gasatome, von Laserlicht gebremst, eine Temperatur erreicht hatten, die nur noch wenige Milliardstel Grad vom absoluten Kältepunkt entfernt war, dann konnten er und seine Mitarbeiter unmöglich nach Hause gehen. Das Team kühlte mit anderen Forschergruppen der Welt um die Wette.
Es war ein äußerst knappes Rennen. Aber selbst nachdem Ketterle die kälteste Insel im Universum erreicht hatte, ging der Wettstreit weiter. Der ehemals ambitionierte Marathonläufer setzte nun alles daran, sich einen Überblick über das unbekannte Terrain zu verschaffen. Würden sich beim Tanz der tiefgekühlten, nie ganz zur Ruhe kommenden Atome neue physikalische Gesetzmäßigkeiten zeigen?
Das Feldbett versinnbildlicht Ketterles Ausdauer und Hartnäckigkeit bei dieser Entdeckungsreise. Für mich ist es zu einer Metapher für die Hingabe und Leidenschaft geworden, mit der sich Wissenschaftler verschiedener Zeiten und Fachrichtungen ihrer geistigen und handwerklichen Arbeit gewidmet haben. Um es mit Ketterles Worten zu sagen: »Pionierleistungen vollbringt man mit einer neuen Maschine, kurz bevor man todmüde umfällt.«
Galileis neue Leidenschaft
Im Sommer 1609 stürzt sich Galileo Galilei auf den Bau des Fernrohrs. Von einem Tag auf den anderen legt er seine vielversprechenden mechanischen Experimente zur Seite und beschäftigt sich nur noch mit dem neuen Vergrößerungsinstrument, das Brillenmacher ein Dreivierteljahr zuvor in den Niederlanden erfunden haben. Es ist ein Entschluss, der seiner Forschung eine völlig neue Richtung geben und in einen jahrelangen Wettlauf um immer neue Entdeckungen einmünden wird.
Zu dieser Zeit ist Galilei Mathematikprofessor an der Universität Padua, einer ausgesprochen internationalen Hochschule, die zur Republik Venedig gehört und deren geistiges Klima von der nahen Handelsmetropole geprägt wird. In den Jahren 1546 bis 1630 studieren hier unter anderen rund 10000 Deutsche. Trotz der sich ausweitenden konfessionellen Auseinandersetzungen in Europa und trotz der zunehmenden Aufspaltung in katholische Universitäten wie Bologna, lutherische wie Leipzig oder calvinistische wie Leyden dürfen sich in Padua Anhänger verschiedener Religionszugehörigkeiten einschreiben.
Die Mathematik ist kein besonders angesehenes Fach. Seit siebzehn Jahren hält Galilei immerzu dieselben Vorlesungen über Geometrie und Himmelskunde. Seine Lehrverpflichtungen beschränken sich auf wenige Stunden, zeitaufwendiger ist dagegen sein Privatunterricht. Um einen stattlichen Palazzo zu unterhalten, regelmäßige Aufenthalte in Venedig und die Aussteuer für seine Schwestern finanzieren zu können, erteilt der fünfundvierzigjährige Patrizier Lektionen zum technischen Zeichnen und zu den Grundlagen der Geometrie, zum Bau von Festungen und Maschinen.
Adlige aus Italien und Deutschland, Frankreich und Polen kommen zu dem wortgewandten Dozenten. Aus den erhaltenen Unterrichtslisten geht hervor, dass Galilei permanent zehn oder mehr Studenten bei sich beherbergt, von denen einige auch gleich ihr Dienstpersonal bei ihm einquartieren. In seinem Wohnhaus herrscht ständig Trubel, manchmal selbst in der vorlesungsfreien Zeit. Graf Alessandro Montalbano zum Beispiel wohnt seit fünf Jahren mit zwei Begleitern bei ihm. Jetzt steht er kurz vor seinen Abschlussprüfungen und bleibt die ganzen Ferien über in Padua. Von wegen einsamer Forscher!
Um den 20.Juli herum bricht Galilei nach Venedig auf, um den Lehrverpflichtungen für eine Weile zu entkommen. Seit er in Padua lebt, hat er eine besondere Affinität zur Lagunenstadt an der Adria, deren prachtvolle Paläste am Canal Grande den unermesslichen Reichtum der venezianischen Kaufleute widerspiegeln, die hier seit Jahrhunderten Handel mit Salz, Pfeffer und Gewürzen, mit Wolle und Seide, Silber und Edelsteinen treiben. Am Rialto, dem Manhattan der Renaissance, treffen sich Finanziers und ihre Agenten aus allen Teilen der Welt, rund um das Bankenviertel machen Goldschmiede und Tuchhändler ihre Geschäfte, haben Obst-, Fisch- und Weinhändler ihre Stände.
In dieser geschäftigen und sinnenfreudigen Atmosphäre hat Galilei vor mehr als zehn Jahren Marina Gamba kennengelernt, eine junge Venezianerin, mit der er drei Kinder hat. Die nicht standesgemäße Beziehung spielt sich von Anfang an im Verborgenen ab. Marina Gamba ist zwar nach Padua umgezogen, Galilei teilt seine Wohnung jedoch nicht mit ihr, sondern führt sein Junggesellenleben unbehelligt fort. So auch jetzt: In Venedig ist er bei Adelsfreunden und ehemaligen Schülern zu Gast, streift durch die Schiffswerft, das Arsenal, besucht erlesene Salons, hält sich über das Weltgeschehen auf dem Laufenden und schnappt die neuesten Gerüchte auf.
Eine Nachricht zieht ihn im Sommer 1609 in ihren Bann. Der einflussreiche Politiker und Gelehrte Paolo Sarpi dürfte ihm als Erster Genaueres von den »Occhialini« erzählt haben, einem Instrument, mit dem man ferne Gegenstände vergrößern und ganz nah ans Auge des Betrachters heranholen kann.
Sarpi hat schon mehr als ein halbes Jahr zuvor von dem »neuartigen Sehglas« erfahren. Die Nachricht ist über diplomatische Kreise zu ihm durchgesickert. Dass es sich dabei nicht bloß um ein Gerücht handelt, ist soeben noch einmal brieflich aus Frankreich bestätigt worden. Seit dem Frühjahr verkaufen Händler in Paris Fernrohre mit schwacher Vergrößerung, in Mailand kann man die »Occhialini« inzwischen erwerben und selbst der Papst hat schon ein Exemplar erhalten!
Galilei würde gerne mehr über die Sache erfahren. Er hat eine Schwäche für technische Neuerungen und ist weitsichtig genug, den Wert eines solchen Geräts zu begreifen. Den Marktwert wohlgemerkt, denn Galilei ist kein Mathematiker im engeren Sinn: Er ist nicht nur ein theoretisch geschulter Kopf, sondern auch Ingenieurwissenschaftler und Erfinder. Als solcher hält er ein Patent auf eine Wasserpumpe, hat mit einer hydrostatischen Waage und einem Thermoskop aus Glas, einem Vorläufer des Thermometers, von sich reden gemacht. Vor allem aber mit einem nützlichen Recheninstrument, einem »geometrischen und militärischen Kompass«.
Dieser vielseitigen, für Offiziere gut handhabbaren Rechenhilfe in Form eines Zirkels verdankt er einen nicht unerheblichen Teil seiner Einkünfte und seines Rufs. Mit Marco Antonio Mazzoleni hat er einen fähigen Handwerker angestellt, der samt Familie bei ihm wohnt und kostbare Instrumente aus Messing anfertigt, für Kunden wie Cosimo II. de’ Medici, den Großherzog der Toskana auch aus reinem Silber. Neben dem Kompass baut Mazzoleni Apparaturen für Galileis mechanische Experimente, die dieser seit Jahren verfolgt.
Einige von Galileis Schülern kommen eigens zu ihm, um den Umgang mit dem Kompass zu erlernen. Er hat dafür ein umfassendes Handbuch geschrieben, seine bis dahin einzige gedruckte Schrift. Mit fünfundvierzig Jahren hat der Professor noch keine explizit wissenschaftliche Arbeit publiziert.
Die technische Anleitung aber verkauft sich gut. Er sei genötigt, die Schrift zum Gebrauch des geometrischen Kompasses nachzudrucken, weil keine Kopien mehr zu finden seien, hält er in einem Brief an den toskanischen Staatssekretär fest. Das Instrument sei in aller Welt so beliebt, dass gegenwärtig gar keine anderen Geräte dieser Art mehr gebaut würden. Er habe schon einige Hundert davon produzieren lassen.
Wenn ihm der Kompass bereits ganz ordentliche Gewinne beschert, sollte sich ein Fernrohr, mit dem man feindliche Truppen oder Schiffe beizeiten sichten kann, erst recht versilbern lassen. Dazu müsste Galilei jedoch innerhalb kürzester Zeit nicht nur irgendein Fernrohr bauen, es müsste ein erheblich besseres sein, als es anderswo bislang zustande gebracht worden ist.
Warum hat er nicht eher Wind davon bekommen? Womöglich ist es schon zu spät. Denn während sich Galilei noch in Venedig aufhält, ist in Padua ein ausländischer Geschäftsmann mit einem Fernrohr im Gepäck aufgetaucht.
In den ersten Augusttagen fährt Galilei nach Padua zurück. Ob er dem Fremden noch begegnet und das Instrument in Augenschein nehmen kann, wissen wir nicht, denn dieser reist nun seinerseits nach Venedig, um die »Occhialini« dort für die stolze Summe von 1000 Zecchini – das Vierfache von Galileis Jahresgehalt – zum Verkauf anzubieten. Paolo Sarpi rät der venezianischen Regierung jedoch von dem Kauf ab. Man solle erst einmal abwarten, ob Galilei nicht ein besseres Fernrohr zuwege bringe.
Tatsächlich kommt der erfahrene Experimentator schnell hinter das Geheimnis, besorgt sich die erforderlichen geschliffenen Gläser und informiert Sarpi darüber, dass er einen Entwurf in den Händen hält. Nicht einmal drei Wochen später, am 21.August 1609, tritt er mit einem Fernrohr an die Öffentlichkeit, das die venezianische Regierung und alle, die Gelegenheit bekommen, hindurchzuschauen, in Staunen versetzt.
In Padua baut Galilei Instrumente wie den »geometrischen und militärischen Kompass«, dessen Handhabung er in seiner ersten gedruckten Schrift erläutert. Hier das Titelblatt des Manuskripts.[1]
Nachdem er von dem Gerücht gehört hatte, sei ihm, auf die Lehre von der Strahlenbrechung gestützt, die Erfindung eines ähnlichen Instruments gelungen, so Galilei rückblickend. »Ich bereitete mir zuerst ein Bleirohr, an dessen Enden ich zwei Sehgläser anbrachte, beide auf der einen Seite eben und auf der anderen das eine konvex, das andere konkav; dann legte ich das Auge an die konkave Seite und sah die Gegenstände ziemlich groß und nah, sie erschienen nämlich drei Mal näher und neun Mal größer, als man sie mit bloßem Auge sieht. Später baute ich mir ein genaueres Instrument, das die Gegenstände mehr als sechzig Mal größer zeigte.«
Galileis knappe Darstellung vermittelt uns keinen Eindruck von seiner wirklichen Leistung. Eher wundert man sich darüber, warum es ihm im Gegensatz zu vielen anderen, die das Gleiche versuchten, in solch einer kurzen Zeitspanne gelingt, bei der Konstruktion des Fernrohrs derartige Fortschritte zu erzielen. Sein Landsmann Girolamo Sirtori zum Beispiel hat sich ebenfalls darum bemüht. Ausführlich beschreibt er, wie er durch halb Europa gereist ist, um an Glaslinsen für ein gutes Teleskop heranzukommen – vergeblich.
Erfolgreicher ist Thomas Harriot in London. Noch bevor Galilei seine Arbeiten am Fernrohr überhaupt aufgenommen hat, hält er schon eines mit mindestens sechsfacher Vergrößerung in den Händen. Er ist vermutlich der erste Wissenschaftler, der mit einem Teleskop den Mond beobachtet. Galilei aber läuft nicht nur ihm den Rang ab. Er lässt die ganze europäische Konkurrenz hinter sich und sichert sich innerhalb weniger Monate für die Vermarktung des Fernrohrs und seine späteren Entdeckungen einen entscheidenden Vorsprung, ein glänzender Coup, der bezeugt, wie sehr sein Forscher- und sein Unternehmergeist in der Republik Venedig gewachsen und zusammengewachsen sind.
Die Brille der Wissenschaft
Venedig ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der Glasindustrie. Schon im Jahr 1270 gab es hier eine Glasmacherzunft mit besonderen Statuten. Den Arbeitern war es etwa verboten, die Republik zu verlassen, um die Monopolstellung nicht zu gefährden. Wegen der Feuergefahr durch die Glasöfen wurde die Glasproduktion auf die Insel Murano verlegt, wo einer von Galileis engsten Freunden, Girolamo Magagnati, eine Glasmanufaktur betreibt. Magagnati schreibt ihm deftige Briefe in malerischem Dialekt, erinnert ihn an ihre gemeinsamen Bankette und Trinkgelage und dürfte seinem gern gesehenen, neugierigen Gast einiges zur venezianischen Glasmacherkunst erzählt haben.
Die ersten Brillengläser für Altersweitsichtige kamen an der Schwelle zum 14.Jahrhundert serienmäßig aus venezianischen Fabriken. Man schnitt die konvexen Linsen aus einer geblasenen Glaskugel heraus. Mit der Größe der Kugel veränderte sich die Krümmung der Linsen. Auf diese einfache Weise war es den Glasbläsern möglich, Brillengläser einer Stärke von etwa zwei bis vier Dioptrien herzustellen.
Um möglichst klares, transparentes Glas zu erzeugen, achten Magagnati und alle venezianischen Glasfabrikanten auf die Reinheit der Rohstoffe. Wie ihre Vorgänger besorgen sie sich feinen, siliziumreichen Sand aus den Flüssen im Tessin, importieren die Asche getrockneter Pflanzen von den salzreichen Küstenregionen Syriens und greifen auf ein chemisches Reinigungsverfahren zurück, das Angelo Barovier im 15.Jahrhundert in Murano entwickelte, um die oft gelb-grünliche Trübung des Glases nahezu völlig zu eliminieren.
Kristallklares Murano-Glas zählt zu den Luxusgütern der frühen Neuzeit. Venezianische Kelchgläser mit Diamantgravuren und solche, die mit feinen, weißen, eingeschmolzenen Glasfäden gemustert sind, finden ebenso reißenden Absatz wie die mit Quecksilber belegten Spiegel. Die Glasindustrie ist einer jener boomenden Wirtschaftszweige, durch die Venedig einen Teil der finanziellen Einbußen kompensieren kann, unter denen die Metropole zunehmend leidet.
Seit der Umschiffung Afrikas und der Überquerung des Atlantiks ist die Welt größer geworden. Spanische, britische und niederländische Schiffe befahren nun die Ozeane, der Kolonialhandel blüht, die Sklaverei wird zum lukrativen Geschäft, die Weltmarktpreise für Gewürze oder Edelmetalle gehen zeitweise unkontrollierbar auf und ab. In dieser schwierigen Zeit der Globalisierung versucht Venedig, seine Wirtschaft durch den Export hochwertiger Produkte zu stärken, darunter Kristall-, Achat- oder Milchglas.
Um ein gutes Fernrohr anzufertigen, benötigt Galilei aber nicht nur erstklassiges Glas. Er braucht Glaslinsen, deren Krümmungen präzise aufeinander abgestimmt sind, um sie als Okular und Objektiv einsetzen zu können.
Die alte Technik venezianischer Glasbläser ist inzwischen längst überholt, die Nachfrage nach Brillengläsern seit der Erfindung des Buchdrucks enorm gestiegen. Um den Gläsern eine vorbestimmte Form zu geben, schleifen und polieren eigens dafür ausgebildete Brillenmacher flache Glasrohlinge nun in einer vorgefertigten Metallschale mit einer feinen Schmirgelmasse.
Diese Kunst beherrschen Handwerker nicht nur in Venedig, sondern auch in der Toskana, in Nürnberg, Regensburg und anderswo in Europa.
Das erste aus zwei Linsen bestehende Fernrohr kommt aus Middelburg, wo die Glashütte seit 1605 von einem Venezianer betrieben wird. Middelburg ist zu dieser Zeit die nach Amsterdam zweitgrößte Stadt in den Niederlanden. An der Grenze zu Flandern gelegen, hat sich ihre Bevölkerung durch die Flüchtlingsströme aus dem Süden binnen weniger Jahrzehnte verdreifacht. Im langwierigen Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier haben die Niederländer im Süden zunächst eine Stadt nach der anderen verloren, darunter das überaus reiche Antwerpen. Unter den Flüchtlingen befand sich auch der Besitzer der dortigen Glasmanufaktur. Wie viele andere wohlhabende Bürger zog er von Antwerpen fort und gründete in Middelburg ein neues Unternehmen.
Im Herbst 1608 macht ein deutscher Brillenmacher in Middelburg das Geschäft seines Lebens. Der in Wesel geborene Hans Lipperhey habe ein Instrument entworfen, mit dem man »alle entfernten Dinge sehen kann, als ob sie in der Nähe wären«, heißt es in einem Empfehlungsschreiben vom 25.September. Nur eine Woche später beantragt Lipperhey bei den Generalstaaten in Den Haag ein Patent für das Sehglas und weist auf dessen militärische Bedeutung hin. Er möchte es »für die nächsten 30Jahre« unter Schutz stellen lassen.
Noch während in Den Haag Friedensverhandlungen laufen, mit denen nach 40Jahren Krieg gegen die Spanier zumindest ein vorübergehender Waffenstillstand erreicht wird, nimmt sich ein Komitee umgehend der Sache an. Lipperhey führt sein kleines Rohr von einem Turm aus vor und wird damit beauftragt, weitere Ferngläser zu bauen, durch die man nicht nur mit einem, sondern mit beiden Augen schauen kann. Außerdem bittet man ihn, Bergkristall statt Glas für die Linsen zu verwenden – und die Angelegenheit geheim zu halten. Dafür bekommt er einen Vorschuss von 300Gulden, genug, um ein ganzes Haus zu bauen.
Ein Patent wird ihm nicht zuerkannt, denn auch der Brillenmacher Jakob Adriaanszon, genannt Metius von Alkmaar, beansprucht die Erfindung für sich. Er hat von Lipperheys Patentantrag gehört und sofort seine eigenen Ansprüche geltend gemacht. Schon vor Jahren habe er ein solches Instrument entworfen. Später aufgetauchte Dokumente bringen sogar noch einen dritten Kandidaten als potenziellen Erfinder ins Spiel, den Optiker Zacharias Janssen, ebenfalls aus Middelburg.
Hans Lipperhey aber gelingt es als Erstem, ein brauchbares Fernrohr vorzuführen. Drei Monate später erhält er noch einmal 300Gulden für das gewünschte Binokular, ein Instrument, das außerordentlich schwer herzustellen ist, weil die Linsen für beide Augen in exakt der gleichen Weise geschliffen werden müssen.
Trotz Lipperheys herausragenden handwerklichen Fähigkeiten, lässt sich nicht mehr rekonstruieren, wer der geistige Urheber des Fernrohrs ist. Zu Beginn des 17.Jahrhunderts liegt die Erfindung in der Luft. Die technischen Voraussetzungen sind vielerorts gegeben, der gedankliche Sprung, zwei geschliffene Linsen zu einem Fernrohr zusammenzufügen, erscheint im Nachhinein klein. Und als die Idee dann einmal in der Welt ist, wird sie zu einer Inspirationsquelle für Geschäftsleute, Erfinder und Wissenschaftler.
Imagepflege
Galilei zufolge verdanken wir das Fernrohr in seiner einfachen Form einem Glücksfall: Ein einfacher Brillenmacher habe mit diversen Linsen herumhantiert und sei zufällig dazu gekommen, einmal gleichzeitig durch zwei von ihnen hindurchzusehen, die eine konvex, die andere konkav und in jeweils unterschiedlicher Entfernung vom Auge. Auf diese Weise habe er den Vergrößerungseffekt bemerkt und das Instrument entdeckt. »Ich aber«, so Galilei«, »angespornt durch besagte Nachricht, entdeckte dieselbe Sache durch vernünftige Überlegungen.«
Im »Sternenboten« stellt Galilei das Fernrohr auf kaum mehr als einer Seite vor. Im Gegensatz zu Kepler hat er sich mit der Theorie der Optik nie eingehend befasst.[2]
Er erzählt dies 1624 aus einem Abstand von fünfzehn Jahren. Auch zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, von welchen »vernünftigen Überlegungen« er spricht. Ist nicht auch er in erster Linie durch einfaches Ausprobieren zum Ziel gelangt? Schiebt Galilei hier nicht Überlegungen vor, die er im Nachhinein gerne gemacht hätte?
»Ich sage, dass mir jene Nachricht nur insofern half, als sie in mir den Wunsch weckte, mich mit meinen Gedanken dieser Sache hinzuwenden, an die ich sonst möglicherweise niemals gedacht hätte; aber dass mir die Nachricht darüber hinaus die Erfindung irgendwie erleichtert hätte, glaube ich nicht. Vielmehr behaupte ich, dass es einer viel größeren geistigen Anstrengung bedarf, die Lösung eines vorgezeichneten und bekannten Problems zu finden, als die eines Problems, an das niemand zuvor gedacht und das niemand benannt hat, denn dabei kann der Zufall die größte Rolle spielen, jenes aber ist ganz und gar eine Leistung der Vernunft.«
Man kann diese gespreizten Sätze immer wieder lesen und versteht doch nicht viel mehr, als dass hier jemand um seinen Anspruch auf Originalität ringt und an seinem Selbstbild meißelt. Worin die »Leistung der Vernunft« bestanden hat, verschweigt der stolze Mathematiker. Zwar kündigt er 1610 an, der Öffentlichkeit »eine vollständige Theorie dieses Instruments« vorzulegen, dieses Versprechen jedoch löst er nie ein.
Mit den theoretischen Grundlagen des Fernrohrs hat sich Galilei nie eingehend befasst. Obschon er seinen intellektuellen Abstand zum »einfachen Brillenmacher« derart hervorhebt, ist der Schlüssel zu seinem Erfolg nicht das angebliche, tief gehende Verständnis optischer Phänomene. Anders als seine selbstgefälligen Zitate vermuten lassen, schaut der Akademiker nicht auf Brillenmacher und Handwerker herab. Gerade weil er ihre Fertigkeiten für sich nutzbar macht und weiterentwickelt, erarbeitet er sich den entscheidenden Vorsprung in der Optimierung des Instruments.
Der nötige Schliff
Galilei habe ein außerordentliches Gespür dafür gehabt, den Wert von Geräten zu erkennen, die bereits in rudimentärer Form existierten, schreibt der Wissenschaftshistoriker Silvio Bedini. »Indem er sie verbesserte und revolutionäre Anwendungen für sie fand, machte er aus ihnen vielseitige Instrumente für die neue Wissenschaft.« Das gilt für seinen militärischen Kompass, der auf Arbeiten anderer zurückgeht, ebenso wie für das Fernrohr.
Im Besitz der nötigen Vorabinformationen bedarf es keiner großen Anstrengungen mehr, um herauszufinden, dass die gewünschte Vergrößerungswirkung mit zwei Linsen erreicht werden kann, von denen eine konkav, die andere konvex geschliffen ist: »Nimmt man ein Brillenglas von zirka 30 bis 50Zentimetern Brennweite, wie es normale Alterssichtige zum Beispiel in einer Lesebrille benötigen, und entfernt es langsam vom Auge, so erscheinen entfernte Objekte mehr und mehr vergrößert, aber auch zunehmend unschärfer«, erzählt Rolf Riekher, ein profunder Kenner der Teleskopgeschichte. »Bringt man gleichzeitig ein stark zerstreuendes Brillenglas, wie es höhergradig kurzsichtige Brillenträger benötigen, dicht vor das Auge, so gibt es einen bestimmten Abstand für die beiden Brillengläser, wo entfernte Objekte nicht nur scharf und deutlich, sondern auch vergrößert erscheinen.«
Gleich in der ersten Nacht nach seiner Rückkehr aus Venedig nimmt Galilei diese Hürde. Danach sucht er systematisch nach besseren Linsenkombinationen, um möglichst bald ein mustergültiges Gerät vorführen zu können.
Rasch stellt er fest, dass Gläser, wie er sie für ein gutes Fernrohr wünscht, im Handel nicht ohne Weiteres erhältlich sind. Sie sind bei Brillenträgern kaum gefragt. Galilei muss daher entweder die Magazine der Brillenmacher durchforsten, die Linsen für das Fernrohr eigens von ihnen fabrizieren lassen oder, besser noch, sie selbst herstellen.
Er verfolgt im Laufe der Zeit alle drei Strategien. Anders als seine Professorenkollegen kennt Galilei nicht nur Bibliotheken und Hörsäle, sondern knüpft Beziehungen zu Venedigs Handwerkern und hat eine gut funktionierende Werkstatt im eigenen Haus. In einer Ära, in der es noch keine Forschungslabors an den Universitäten gibt und die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Technik noch nicht besonders ausgeprägt sind, stellt sich dies als unschätzbarer Vorteil heraus. Seine Werkstatt wird zum Dreh- und Angelpunkt bei der Teleskop-Entwicklung. Er ist ein Bastler und macht sich mit der Technik vertraut, um die Gläser sukzessive den besonderen Ansprüchen anzupassen.
Bei der Bearbeitung der Linsen legt Galilei selbst Hand an. Aus einer kleinen erhaltenen Einkaufsliste vom November 1609 geht hervor, dass er alles bestellt, was man dazu braucht: Linsen, Spiegelglas, Bergkristall, zum Polieren Tonerde, Pech und Filz, zur Formgebung der Linsen Kanonenkugeln und eine Metallschale aus Eisen. Ein halbes Jahr später teilt er einem Briefpartner mit, er habe sich »einige Apparate« zur Herstellung und Verfeinerung der Linsen ausgedacht.
Vermutlich fertigt er die nach innen gewölbten Okulare im eigenen Labor an. Diese direkt vor dem Auge platzierten, stark gekrümmten Linsen lassen sich auf der Oberfläche einer Kanonenkugel schleifen, die es seinerzeit in allen möglichen Größen gibt. Da letztlich immer nur ein kleiner Ausschnitt des Okulars für eine gute Sicht benötigt wird, sind die Qualitätsanforderungen hier nicht ganz so hoch.
Die Crux ist die nach außen gewölbte Objektivlinse, für die man eine entsprechende Schleifschale als Passform benötigt. Bei einem Fernrohr sammelt sie das Licht über die gesamte Fläche ein. Eine gleichmäßige, extrem sanfte Krümmung ist maßgeblich für ihre Vergrößerungswirkung und die Qualität des Bildes.
Aus Galileis Briefen geht hervor, dass er noch in späteren Jahren große Mühe hat, an geeignete Objektive heranzukommen. So berichtet sein Freund und Gönner Giovanni Francesco Sagredo im April 1616 aus Venedig, ein Linsenschleifer namens Bacci habe 300Linsen für ihn hergestellt, von denen dem Handwerker nach eigenen Angaben 22 »ausgezeichnet« gelungen seien. »Unter diesen«, so Sagredo, »habe ich jedoch nicht mehr als drei gefunden, die meinem Urteil nach die Bezeichnung ›gut‹ verdienen, wenn sie auch nicht perfekt sind.« Drei halbwegs gute Linsen unter 300! Es erscheint beinahe wie ein Glücksspiel, ein passendes Objektiv zu finden.
Galilei spielt dieses Spiel mit hohem Einsatz. Er scheut bei der Beschaffung der Linsen »weder Kosten noch Mühen«. Um geeignete Exemplare aufzutreiben, nimmt er Kontakt zu den besten Handwerkern in Venedig, später auch in Florenz und Neapel auf und macht ihnen konkrete Vorgaben. Objektivlinsen sind plötzlich begehrt. Sie werden so hoch gehandelt, dass Galileis eigene Mutter im Januar 1610 versucht, seinen Diener Alessandro Piersanti zu bestechen, aus dem Labor ihres Sohnes »drei oder vier« dieser Gläser zu entwenden.
Leider ist nur eine einzige Linse erhalten geblieben, die zweifelsfrei von einem Fernrohr Galileis stammt. Es handelt sich um ein zerbrochenes Objektiv von 5,8Zentimetern Durchmesser. Mit Methoden der modernen Laseroptik haben Giuseppe Molesini und seine Kollegen aus Florenz die Linse in einem Reinraumlabor auf einer optischen Bank durchleuchtet. Ihre von einem Computer generierten Diagramme zeigen, wie formvollendet die Oberfläche der Linse ist, wie gut sie geschliffen wurde – allerdings nur in dem 3,8Zentimeter breiten zentralen Sektor. Der Randbereich ist minderwertig, was für Brillen keine Rolle spielte, für Fernrohrbeobachtungen aber sehr wohl.
Dieses Problem löst Galilei auf praktische Art. Er verwendet für seine Teleskope große Objektivlinsen und blendet ihren Rand mit einem Ring ab. Um ein weites Gesichtsfeld zu bekommen, könne man zwar auf eine solche Blende verzichten, verrät er dem Jesuitenpater und Mathematiker Christopher Clavius aus Rom. Dann jedoch würde man entfernte Objekte nur verschwommen sehen.
Die Verwendung der Blende gilt als einer von Galileis Schlüsseln zum Erfolg. Der Schweizer Rolf Willach hat jedoch einigen Grund zu der Annahme, dass schon Lipperhey solche Blenden benutzte und dass ausgerechnet dieser kleine Ring dem Fernrohr Anfang des 17.Jahrhunderts zum Durchbruch verhalf. Willach ist durch ganz Europa gereist, um die noch auffindbaren Brillengläser und Linsen der damaligen Zeit zu untersuchen. Bei allen von ihm betrachteten Linsen nehmen die Fabrikationsfehler zum Rand hin zu, was angesichts der Massenproduktion von Brillengläsern nicht weiter verwunderlich ist. Selbst die besten Gläser waren demnach nur bedingt fernrohrtauglich.
Galilei erkennt die praktische Bedeutung der Blende im Gegensatz zu Clavius und anderen Kollegen schnell. Wieder ist er seinen Konkurrenten einen Schritt voraus. Er testet das Zusammenspiel der Linsen in seinem Labor, stimmt ihre Stärke und Abstände aufeinander ab und lässt sie von seinem Handwerker zu kunstvollen Instrumenten zusammenbauen.
Welche Rolle sein Wohnort für den Anfangserfolg spielt, lässt sich erahnen, wenn man bedenkt, dass der erste Beobachter, der Galileis teleskopische Entdeckungen im Jahr 1610 bestätigt, ebenfalls aus Venedig kommt: Antonio Santini konstruiert nur zwei Monate, nachdem Galilei seine ersten Fernrohrbeobachtungen veröffentlicht hat, ein Instrument mit der nötigen Vergrößerung ohne jegliche Hilfe des Meisters.
Aussichten vom Markusplatz
Am 21.August 1609 finden sich einige Patrizier am Fuß des Glockenturms von Venedig ein. Der Campanile, zwischen Dogenpalast und Markusplatz gelegen, ist das höchste Bauwerk der Stadt und ragt 99Meter in die Höhe. Seine roten Ziegel streben in vertikalen Linien nach oben, ehe sie in den mit weißem Marmor verkleideten Glockenstuhl übergehen.
Alle Aufmerksamkeit ist auf das armlange, karmesinrote Rohr gerichtet, das Galilei behutsam trägt. Angeführt von Senator Antonio Priuli schreiten die hochrangigen Vertreter erwartungsvoll die Stufen zum Eingangstor hinauf und verschwinden durch einen schmalen Gang im dunklen Innern des quadratischen Turms. In acht Windungen führt der Weg nach oben, immer an der Wand des Gemäuers entlang, nur ab und zu können die Männer durch einen Lichtschlitz einen kurzen Blick nach draußen werfen. Als sie oben angekommen wieder ins Freie treten, schweben über ihnen die Glocken, die in Venedig Beginn und Ende eines jeden Arbeitstages einläuten.
Voller Zuversicht justiert Galilei das neue Instrument, das aus zwei gegeneinander verschiebbaren Rohren zusammengesetzt ist. Seine Begleiter genießen derweil die wunderbare Aussicht vom Campanile, schauen hinunter auf die fünf blitzenden Kuppeln des Markusdoms, die in Form eines griechischen Kreuzes angeordnet sind, lassen ihre Blicke über die Dächer und Säulenreihen des Dogenpalastes schweifen, sehen im Hintergrund die hohen Mauern des Arsenals und den Lido, von wo aus Anfang des 13.Jahrhunderts jener Kreuzzug begann, der den Venezianern ihr Kolonialreich im Mittelmeer sicherte, und haben schließlich die vielen Inseln der Lagune vor Augen – hier die Toteninsel San Michele, dort die Glasmacherinsel Murano –, die sich in der Ferne verlieren. Was für ein Panorama!
Wie klein dagegen wird das Gesichtsfeld beim Blick durch Galileis langes Rohr, dessen Öffnung nur so groß wie eine Münze ist! Aber wie nah sind plötzlich all die Inseln!
»Wenn man das Rohr vor das eine Auge hielt und das andere schloss, sah jeder von uns deutlich … bis Chioggia, Treviso und Conegliano, aber auch den Glockenturm sowie die Kuppeln und die Fassade der Kirche von Santa Giustina in Padua«, schwärmt Priuli. »Man konnte sogar diejenigen unterscheiden, die in der Kirche San Giacomo in Murano ein und aus gingen … und erkannte viele andere, wirklich erstaunliche Einzelheiten in der Lagune und der Stadt.«
Drei Tage nach der Präsentation führt Galilei das Teleskop der versammelten venezianischen Regierung vor. Noch am selben Tag schreibt er in einem Brief an den Dogen Leonardo Donato: »Galileo Galilei, Euer Durchlaucht ergebenster Diener, … tritt nun mit einem neuen Instrument vor Euch hin, einem Fernrohr, dem Resultat hintergründiger Betrachtungen zur Perspektive, welches die sichtbaren Objekte so nahe ans Auge heranbringt und sie so groß und so klar zeigt, dass etwas, das zum Beispiel neun Meilen weit weg ist, uns so erscheint, als wäre es nur eine Meile entfernt.«
Galilei bietet dem Dogen sein Fernrohr zum Geschenk an und hebt, wie zuvor der Brillenmacher Hans Lipperhey aus Middelburg, dessen Bedeutung als Kriegsgerät hervor. Man könne damit auf dem Meer aus viel größerem Abstand als üblich Schiffsrumpf und Segel des Feindes erkennen, »sodass wir ihn gut und gerne zwei Stunden früher entdecken, als er uns ausfindig machen wird, und indem wir Zahl und Ausstattung der Schiffe auskundschaften, können wir seine Kräfte ermessen, um uns auf die Verfolgung, den Kampf oder die Flucht einzurichten. In gleicher Weise können wir auf dem Land Einblick in die Befestigungen, Quartiere und Deckungen des Gegners nehmen, ob von einem entfernten Hügel aus oder auf offenem Feld, und so zu unserem größten Vorteil jede seiner Bewegungen und Vorbereitungen verfolgen.«
Seine Worte gegenüber dem Dogen sind klug gewählt. Der Republik Venedig fällt es immer schwerer, die eigenen Handelsinteressen im Mittelmeer zu wahren. Trotz des Sieges der christlichen Allianz gegen die 80000 Mann starke türkische Flotte in der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571 sind die Insel Zypern und andere venezianische Handelsstützpunkte inzwischen an das Osmanische Reich gefallen.
Venedig sieht sich eingeklemmt zwischen den Türken im Osten und den allgegenwärtigen Spaniern, die den Süden Italiens bis hinauf zum Kirchenstaat beherrschen und ihren politischen Einfluss in Rom geltend machen. Selbst das Herzogtum Mailand wird von einem spanischen Gouverneur verwaltet. Angesichts dieser Lage setzt die venezianische Regierung genau wie zuvor die niederländische einige Hoffnungen in das neue Instrument. Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung der optischen Medien – und in Galileis beruflicher Laufbahn.
Ein explosiver Augenblick
Mit der neunfachen Vergrößerung der Gläser gibt er sich nicht zufrieden. Es steckt noch mehr in dieser Erfindung. Seine Aussicht auf lukrative Aufträge und seine spielerische Neugier spornen ihn dazu an, die Möglichkeiten des Instruments weiter auszuloten. Abermals vertieft sich Galilei in technische Details, versucht, Abbildungsfehler zu korrigieren, und testet massenhaft Linsen.
Noch ahnt er nicht, dass ihm dieses Instrument die Geheimnisse des Weltalls offenbaren wird. In seinen Briefen gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass ihn der Gedanke antreibt, die Gläser zu astronomischen Zwecken zu verwenden. Das Rohr hat sein Gesichtsfeld verengt. Galilei kann damit weiter schauen als jeder andere, sieht aber vor allem das Nächstliegende: den militärischen Nutzen und die ökonomische Verwertbarkeit des Fernrohrs, das er bereits in großer Stückzahl zu produzieren begonnen hat. »Seinen Vorsprung«, so der Wissenschaftshistoriker Matteo Valleriani, »hat er sich nur erarbeitet, weil er an den militärischen Erfolg des Geräts glaubte.«
Es geht ihm in dieser Hinsicht ähnlich wie Kolumbus, der 1492 auf dem Westweg nach Indien gelangen möchte, stattdessen aber einen neuen Kontinent entdeckt, oder wie Luther, der zu Beginn des 16.Jahrhunderts für die Gewissensfreiheit eintritt, letztlich aber die Kirche spaltet. Genauso wenig denkt Galilei zunächst daran, dass erst der wissenschaftliche Gebrauch des Fernrohrs der jungen Erfindung ihre herausragende Bedeutung geben wird.
Wann er das Instrument erstmals in den Himmel richtet, ist nicht bekannt, ob zunächst beiläufig, während er neue Linsen testet, oder aus einer abendlichen Laune heraus im Kreis seiner neugierigen Studenten. Sicher ist nur, dass er irgendwann im Herbst oder Winter 1609 mit einem Fernrohr von nunmehr zwanzigfacher Vergrößerung in den Sternenhimmel schaut.
Es ist einer jener, um Stefan Zweigs Worte zu benutzen, »explosiven Augenblicke« der Menschheitsgeschichte. Der Himmel über den Dächern Paduas zeigt ein völlig neues Gesicht. Galilei sieht die Milchstraße als ein Band aus bis dahin größtenteils unbekannten Sternen und Nebeln. Es sind unzählbar viele. Er richtet sein Fernrohr bald hierhin, bald dorthin, Nacht für Nacht, entdeckt neue Himmelskörper und beobachtet den Mond, der durch die schmale Öffnung des Fernrohrs nicht nur größer, sondern auch anders erscheint – so wie ihn nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Seine Erfolgsmeldungen kommen nun Schlag auf Schlag:
Schon Ende 1609 beginnt er mit sorgfältigen Zeichnungen der Mondoberfläche. Am 7.Januar 1610 entdeckt er den ersten von vier Jupitermonden und kündigt an, ein Teleskop mit dreißigfacher Vergrößerung sei so gut wie einsatzbereit. Bis einschließlich zum 2.März 1610 beobachtet er die Jupitermonde und dokumentiert ihre Bewegungen um den Planeten, nur zehn Tage später liegt seine Veröffentlichung, der Sternenbote, bereits gedruckt vor! Zu diesem Zeitpunkt hat Galilei nach eigenen Angaben außerdem schon sechzig Fernrohre gebaut beziehungsweise anfertigen lassen.
Vor allem die außergewöhnlich schnelle Publikation seiner Ergebnisse verdeutlicht, welch starkem Konkurrenzdruck sich Galilei ausgesetzt sieht. Ihn verfolgt dieselbe Angst, die Wissenschaftler heute noch dazu antreibt, die Resultate ihrer Arbeit möglichst schnell in irgendeiner Fachzeitschrift unterzubringen: die Befürchtung, ein anderer könnte ihnen zuvorkommen.
Mehrfach entschuldigt er sich für die schlechte Qualität der Abbildungen, die erst im letzten Moment eingefügt worden seien, »weil ich die Publikation wahrlich nicht aufschieben wollte, um nicht das Risiko einzugehen, dass jemand anderes auf dasselbe stoßen und mir zuvorkommen würde«. So gewinnt Galilei den vielleicht bedeutendsten Wettlauf zu Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft.
Wie viel bei der sukzessiven Verbesserung und Vervielfältigung des Fernrohrs seiner eigenen praktischen Begabung und wie viel dem Wissen anderer geschuldet ist, lässt sich nur schwer ermessen. Galileis Ausführungen verschleiern dieses Zusammenspiel eher, als es zu erhellen. In seinem Sternenboten macht er weder nähere Angaben zu dem Instrument, das ihm seine Entdeckungen doch erst ermöglicht hat, noch erwähnt er irgendeinen Helfer oder Helfershelfer.
Zurück im Labor
Seine Vorgehensweise ist aber beispielhaft für die spätere Physik. Im Unterschied zu Wissenschaftlern vieler anderer Fachbereiche bauen Physiker und Astronomen die meisten ihrer Geräte bis heute selbst. Was dabei quasi als Rohstoff aus Handwerk und Industrie in ihre Forschungslabore wandert, wird – ähnlich wie die Glasrohlinge und geschliffenen Linsen für Galileis Fernrohr – als Baustein in neue Geräte integriert.
Wer einen Forscher wie Wolfgang Ketterle im Labor besucht, trifft dort auf viele erfahrene Experimentatoren. Seine Mitarbeiter bringen hochgradig spezialisiertes Wissen ein und treiben die Technik zur Perfektion, um sich dem absoluten Temperatur-Nullpunkt bis auf ein halbes Milliardstel Grad zu nähern. Die einen kümmern sich um die Vakuumtechnik, damit möglichst alle Fremdatome aus der Kältefalle ferngehalten werden. Andere brillieren in der Laserforschung und lenken präzise aufeinander abgestimmte Laserlichtstrahlen über eine Vielzahl kleiner Spiegel auf die zu kühlenden Atome.
Nur dank der Kreativität vieler einzelner Wissenschaftler sind solche Teams dazu in der Lage, die technischen Komponenten jederzeit zu verändern und zu optimieren. Das macht die besondere Dynamik der physikalischen Forschung aus. Und wie bereits Galilei sind auch heutige Forscher ein ums andere Mal selbst davon überrascht, wofür ihre Apparaturen letztlich zu gebrauchen sind. Die Mittel sind allgemeiner als die Zwecke und können in völlig anderen, unabsehbaren Zusammenhängen Verwendung finden.
Das Fernrohr ist ein vergleichsweise einfaches Instrument. Schon dieses Beispiel zeigt jedoch, an wie vielen Stellen ein Forscher während seiner Arbeit auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen kann: ob beim Einkauf oder Schleifen der Linsen, beim Ausblenden der nicht passend geformten Randzonen der Gläser oder beim Auftreten farbiger Bildverzerrungen.
Galilei lässt sich durch solche Hindernisse nicht aufhalten. Sie fordern vielmehr seine Erfindungsgabe heraus. Auf seinem Weg zum Ruhm wird er noch viele Widerstände ganz anderer Art auf virtuose Weise meistern.
EINE MATHEMATISCHE HIMMELSLEITER
Keplers Traum vom Mond
Hat er das alles zu Papier gebracht? Hunderte Seiten voller Berechnungen, Tabellen mit den Entfernungen der Planeten von der Sonne, Sinustafeln und Triangulationen?
Als Johannes Kepler im Sommer 1609 mit seiner Neuen Astronomie nach Prag zurückkehrt, an der er sechs Jahre gearbeitet und auf deren Druck er weitere drei Jahre gewartet hat, sind ihm die eigenen Worte und Gedanken beinahe fremd. Selbst die Übersichtstafel, die er dem Leser als Leitfaden an die Hand gegeben hat, um sich in dem Labyrinth aus insgesamt siebzig Kapiteln zurechtzufinden, erscheint ihm verwickelter als der gordische Knoten.
Es sei heutzutage ein hartes Los, mathematische Bücher zu schreiben. »Wahrt man nicht die gehörige Feinheit in den Sätzen, Erläuterungen, Beweisen und Schlüssen, so ist das Buch kein mathematisches. Wahrt man sie aber, so wird die Lektüre sehr beschwerlich.«
Der Kreis möglicher Adressaten ist klein, Kepler macht sich diesbezüglich keine Illusionen. »Ich selber, der ich als Mathematiker gelte, ermüde beim Wiederlesen meines Werkes mit den Kräften meines Gehirns.«
Diesmal hat der leidenschaftliche Mathematiker besonders dicke Bretter gebohrt. Seit er vor neun Jahren mit seiner Familie von Graz nach Prag gezogen ist, hat er den verwickelten Lauf der Gestirne anhand der besten verfügbaren Beobachtungsdaten entwirrt.
Es waren Jahre des fieberhaften Grübelns. Mal dachte er, die Ordnung des Planetensystems mithilfe der physikalischen Grundannahmen erklären zu können, dann wiederum vertiefte er sich ganz in die Mathematik. Gegen tausend Wände sei er bei seinen Überlegungen gestoßen, für einen einzigen kleinen Schritt in seiner Argumentationskette habe er »mindestens in 40Fällen je 181Mal die gleiche Rechnung ausführen« müssen.
Hätte er sich wenigstens in Ruhe auf sein Werk konzentrieren können! Doch Kepler ist kaiserlicher Mathematiker, und seine Aufgaben am Hof – astrologische Gutachten und die Verwaltung des umfangreichen Erbes seines berühmten Vorgängers, des Astronomen Tycho Brahe – halten ihn immer wieder von seinen Studien ab. »Ich glaube, sie nehmen die halbe Zeit in Anspruch.« Mehr Zeit, als dem Hofmathematiker lieb ist.
Der Herrscher und sein Hof
Als er noch in der Prager Neustadt nahe beim Emmaus-Kloster wohnte, dauerte allein der tägliche Fußmarsch zur Burg eine Stunde. Inzwischen lebt er mit seiner Frau und den drei Kindern in der Altstadt, von seiner Wohnung aus sind es nur ein paar Schritte bis zur Karlsbrücke, über die er den Hradschin schnell erreicht.
Die über Jahrhunderte gewachsene Burgstadt ist eine Welt für sich. Auf dem Hügel liegt, umringt von den Palästen böhmischer Adelsfamilien, das Machtzentrum der Habsburger. Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit hat Rudolf II. seinen Amtssitz von Wien nach Prag verlegt, hier kann er sich vor den Türken sicherer fühlen.
Rudolf II. ist Kaiser eines Reiches, das unüberschaubare Interessenkonflikte zersplittert haben. Seit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 ist die konfessionelle Spaltung Deutschlands besiegelt, die teils katholischen, teils protestantischen Kurfürsten- und Herzogtümer, Grafschaften, Bischofssitze und Reichsstädte raufen sich selbst dann kaum noch zusammen, wenn sie sich gegen äußere Feinde wehren müssen.
Er hat ein schwieriges Erbe angetreten. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ist Rudolf II. den Interessen der katholischen Kirche verpflichtet, in seinem Königreich Böhmen aber sind von zehn seiner Untertanen neun Protestanten. Immer wieder fühlt er sich von den Regierungsgeschäften überfordert und sitzt die sich auftürmenden Probleme aus. Zwar hat er dem Reich nicht zuletzt durch seine Passivität mehr als 30Jahre den inneren Frieden bewahrt, seine Herrschaft aber bröckelt. Inzwischen sogar in Böhmen, der einzigen ihm verbliebenen Hausmacht.
Botschafter und Gesandte aus aller Welt umlagern die Hofburg. Besonders einflussreich sind die spanischen und päpstlichen Diplomaten, momentan jedoch geben die böhmischen Barone den Ton an, die wie viele andere die Schwäche des Kaisers für ihre eigenen Zwecke nutzen möchten.
Anstatt sie zu empfangen, widmet sich Rudolf II. lieber der Malerei, der Alchemie und den Wissenschaften. Von überall her hat er herausragende Künstler und Gelehrte nach Prag geholt. Johannes Kepler steht mit seiner Leidenschaft für die Astronomie am Hof längst nicht so alleine da wie zuvor in Graz. In der Weltstadt Prag verkehrt er mit brillanten Mathematikern wie dem Instrumentenbauer Jost Bürgi und wissenschaftlich gebildeten Hofräten wie Matthäus Wackher von Wackenfels.
In die Politik mischt sich Kepler nicht gerne ein, obschon er immer wieder um sein astrologisches Urteil gebeten wird. Rudolf II. verspricht sich, von den Sternen zu erfahren, wie es um Zukunft des türkischen Reiches und um sein eigenes Schicksal bestellt ist. Keplers Vorgänger, Tycho Brahe, hat dem abergläubischen Kaiser seinerzeit prophezeit, Opfer eines Attentats zu werden. Seither interessiert sich der Kaiser noch brennender für Horoskope.
Kepler sagt von sich selbst, er lebe auf der Weltbühne wie ein einfacher Privatmann. Er sei in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und über eine Reihe von glücklichen und unglücklichen Zufällen an den Prager Hof gelangt. Adelstitel bedeuten ihm wenig. Er sei zufrieden, wenn er dem Hof einen Teil seines Gehalts entreißen könne.
Aber selbst das erweist sich als schwierig. Die Reichskasse ist ständig leer. Um die finanzielle Unterstützung für den Druck seiner Neuen Astronomie hat er ähnlich lange ringen müssen wie um die Eingliederung des Planeten Mars in ein geordnetes Weltbild.
Rudolf II. hatte ursprünglich vierhundert Gulden für die Publikation bewilligt, »zur erweitterung unserer und unserer hochgeehrten Vorfahren am Hauss Österreich angewohnten lieb zur befürderung der Astronomiae«. Der Betrag reichte für den Druck nicht aus. Erst nach langem Hin und Her machte der Herrscher noch einmal fünfhundert Gulden locker.
Die Summe entspricht einem vollen Jahresgehalt seines Hofmathematikers – nur dass Kepler seinen Lohn kaum noch ausbezahlt bekommt. Während der Kaiser seine vielen Zahlungsverpflichtungen seltener und seltener einhält, muss die Familie den Lebensunterhalt immer öfter aus den spärlichen Rücklagen seiner Frau Barbara bestreiten, was zu gelegentlichen Streitereien im Hause Kepler Anlass gibt.
Seine Gattin wolle nicht »Hand an ihr geringes Schatzgeldlin legen, als würde sie darüber an den Bettelstab kommen«. »Frau Sternseherin«, wie sie in Prag gelegentlich genannt wird, ist unglücklich über die miserable Lage, sieht sich genötigt, an ihrer Kleidung und allem anderen zu sparen. Ihr Mann, in seine Studien vertieft, reagiert gereizt, wenn sie ihn zu Unzeiten mit häuslichen Dingen belästigt. Doch habe er sich in Geduld geübt und meine es gut mit ihr, so Kepler. »Es hat wohl viel Beißens und Zürnens gesetzt, ist aber nie zu keiner Feindschaft kommen, … wir haben zu beiden Teilen wohl gewusst, wie unsere Herzen gegeneinander seien.«
Im Dickicht der Gestirne
Als er im Juli 1609 von einer dreimonatigen Reise zurückkehrt, hadert der Mathematiker weder mit der Knauserigkeit seiner Frau noch mit dem Kaiser und seinem für die Finanzen zuständigen Kammerpräsidenten. Er kommt von der Drucklegung seiner Neuen Astronomie in Heidelberg und hat zuvor die Frankfurter Frühjahrsmesse besucht. Nun hält der Siebenunddreißigjährige einen großformatigen, prächtigen Band in den Händen, und einmal mehr erscheint es ihm als glückliche Fügung, vor neun Jahren nach Prag gekommen zu sein, wo ihm sämtliche Beobachtungsdaten seines Vorgängers, des von Messinstrumenten besessenen Sternenguckers Tycho Brahe, zugefallen sind.
Kepler hat diesen Schatz gehoben. In aufreibender Kleinarbeit hat er Brahes präzise Daten ausgewertet und mit eigenen physikalischen Hypothesen verbunden. Seinen Berechnungen zufolge ziehen sämtliche Planeten, inklusive der Erde, in elliptischen Bahnen um die Sonne. Sie ist der Motor des ganzen Planetenkarussells: über riesige kosmische Distanzen hinweg wirkt eine Sonnenkraft auch auf die Erde ein. Gleichzeitig hebe die Anziehungskraft des sehr viel näheren und kleineren Mondes die Weltmeere an und verursache auf diese Weise Ebbe und Flut. Nicht einmal Galilei wird ihm das abnehmen.
Die Neue Astronomie gründet auf astronomischen Beobachtungen, physikalischen Überlegungen, mathematischen Beschreibungen und nicht zuletzt auf Keplers tiefen religiösen Überzeugungen. Der gebürtige Schwabe hat Theologie studiert. Er wollte Pfarrer werden, ehe man ihn als Mathematiklehrer nach Graz schickte. Am Anfang seiner Begeisterung für die Himmelskunde steht sein fester Glaube, dass das Universum ein wohlgeordnetes Ganzes bildet: Gott habe den Kosmos nach rationalen Kriterien entworfen, die für den Menschen einsichtig sind. Als Mathematiker hat Kepler es sich zur Aufgabe gemacht, diese rationale Struktur des Universums zu erkennen und die disparaten Himmelserscheinungen zu einem einheitlichen, einsichtigen Bild zusammenzufügen.
Genau darum haben sich vor ihm schon viele Gelehrte bemüht. Sie alle aber haben sich im Dickicht der Planetenbewegungen mehr oder weniger verrannt. Von der Erde aus betrachtet, malt zum Beispiel ein Planet wie der Mars bei seinen nächtlichen Wanderungen wundersame Schleifen an den Himmel. Immer wieder kommt es vor, dass der Planet seine Bewegungsrichtung umkehrt und kurzzeitig den entgegengesetzten Kurs einschlägt.
Solche Unregelmäßigkeiten in Gottes Schöpfungsplan nimmt Kepler nicht hin. Zumal die Marsschleifen verschwinden, sobald man die von Nikolaus Kopernikus aufgestellte Theorie ernst nimmt und konsequent weiterdenkt: Nicht die Erde bildet das Zentrum des Kosmos, um das der Mars und alle anderen Planeten kreisen, sondern die Sonne. Und es ist auch nicht die ganze Sternenschar, die sich Nacht für Nacht um unseren Globus dreht, sondern lediglich die Erdkugel, die in 24Stunden einmal um ihre Achse rotiert.
Für seine Zeitgenossen ist das eine bizarre Vorstellung. Selbstverständlich hält jedermann die Erde für den Mittelpunkt der Welt. Keine alltägliche Erfahrung deutet darauf hin, dass der Globus in rasender Fahrt durch das Universum jagen könnte.
Wohl aber die Ergebnisse der astronomischen Studien Keplers. Er hat die kopernikanische Theorie anhand der seinerzeit präzisesten und umfangreichsten Beobachtungsdaten geprüft. Um als Zuschauer auf einer sich drehenden Erde die »wahre« Bahn des Mars um die Sonne zu ermitteln, hat er mathematisch äußerst anspruchsvolle Berechnungen angestellt. Die Schlussfolgerungen daraus sind ihm zunächst alles andere als willkommen gewesen.
Er hat sich gegen die eigene Vernunft gesperrt und die Daten immer wieder hin und her gewendet. Erst in einem jahrelangen Kampf, seinem »Kampf gegen den Mars«, hat er sich zu der These durchgerungen, dass die Planeten nicht in Kreisen, sondern auf weniger schönen Ellipsenbahnen um die Sonne ziehen. Und das nicht einmal gleichmäßig. Auf ihrem Weg ändern sie auch noch ihre Geschwindigkeiten.
Kepler bricht mit den traditionellen Vorstellungen vom Aufbau des Kosmos, die das Denken der Astronomen über zweitausend Jahre geprägt haben. Seit der Antike ist die gleichförmige Kreisbewegung Ausdruck für die Regelmäßigkeit und Perfektion sämtlicher Abläufe am Himmel gewesen. Sie gilt als »natürliche« Bewegung der Gestirne, die sich ohne jegliche Veränderung bis in alle Ewigkeit fortsetzt. Kopernikus und Brahe haben an diesem Gedanken festgehalten und den Kosmos in ein unübersichtliches Räderwerk aus ineinander geschachtelten Kreisen verwandelt, um den Beobachtungsdaten gerecht zu werden.
Nur widerstrebend hat sich Kepler von dieser Denkfigur verabschiedet. Fieberhaft hat er versucht, das Spiel der Bewegungen mit derselben Mathematik zu beschreiben wie seine Vorgänger, sich dadurch aber nur in immer neue Nöte gestürzt. Doch anders als Galilei lacht Kepler über die eigenen Fehler, um sich kurz darauf über seine Erkenntnisfortschritte zu freuen. Wer nie verzweifle, sei sich nie einer Sache sicher, so sein Kommentar zu den letzten Verirrungen im theoretischen Gestrüpp.
In seinem Brief an den Mathematiker David Fabricius vom Oktober 1605 sah er dann bereits das rettende Ufer vor Augen. »Nun aber habe ich das Ergebnis, mein Fabricius: Die Planetenbahn ist eine vollkommene Ellipse.« Es ist das unbedingte Vertrauen in die Präzisionsmessungen Tycho Brahes, das ihn schließlich zu diesem Resultat gebracht hat.
Damit hat Kepler das kopernikanische Modell in eine völlig neue Form gegossen. Er hat die Sonne tatsächlich ins Zentrum der Welt gerückt, die Bewegungen der Planeten erstmals auf Anziehungskräfte, also auf physikalische Ursachen zurückgeführt und jedem Planeten eine klar definierte Bahn zugeschrieben. Sein epochales Werk ist die Basis der modernen Astronomie, auf der Isaac Newton achtzig Jahre später die allgemeine Gravitationstheorie formulieren wird.
Bis ins kleinste Detail hinein beschreibt Kepler seine langjährige Odyssee. Sie liegt nun glücklicherweise hinter ihm, das Buch, die Neue Astronomie, das er Seiner Majestät, dem Kaiser, gewidmet hat, ist endlich gedruckt.
Der Kaiser in Nöten
Als Kepler Rudolf II. das Werk überreichen möchte, steckt dieser in einer der schwersten Krisen seiner Regierungszeit. Der Streit mit seinem Bruder Matthias hat sich so weit zugespitzt, dass die Zukunft des ganzen Reiches auf dem Spiel steht. Der wechselseitige Hass der beiden Habsburger setzt Kräfte frei, die die Bevölkerung in Böhmen und anderen Teilen des Reiches aufwiegeln und ein paar Jahre später im Dreißigjährigen Krieg eskalieren.
Matthias hat sich mit den protestantischen Ständen von Österreich, Ungarn und Mähren verbündet und seinem Bruder auf diese Weise einen Großteil der Macht entrissen. Um wenigstens in Böhmen Herr zu bleiben, muss Rudolf II. dem protestantischen Adel nun auch in seinem Hoheitsgebiet weitreichende Zugeständnisse machen. Die unangenehmen Verhandlungen hat er lange hinausgezögert und dabei so ungeschickt agiert, dass ihm die böhmischen Stände nun mit den Waffen drohen.
Am 9.Juli 1609, dem siebten Geburtstag von Keplers Tochter Susanna, kann endlich eine Einigung erzwungen werden. Im sogenannten Majestätsbrief tritt Rudolf II. einen Teil seiner Macht ab und sichert den Protestanten zu, dass sie »ihre Religion frei und unbehindert ausüben dürfen«. Während die Jesuiten im Zuge der Gegenreformationen landauf, landab katholische Schulen und Universitäten gründen und immer mehr Menschen dazu bewegen, zum alten Glauben zurückzukehren, gestattet der Kaiser den Protestanten, neue »Gotteshäuser und Kirchen zum Gottesdienst oder auch Schulen zur Bildung der Jugend« zu errichten.
Unter Beifallsstürmen der Bevölkerung wird der Majestätsbrief am Rathaus ausgehängt. Ganz Prag feiert ein Freudenfest. Auch Kepler, der seines Glaubens wegen seinen vorherigen Posten in Graz verloren hat, nimmt die Nachricht begeistert auf. »Wir haben durch Gottes Gnade gesiegt«, schreibt er an den Theologieprofessor Stephan Gerlach in Tübingen. »Man hält öffentlich deutsche Predigten in Kirchen und Wohnhäusern.«
Die katholische Fraktion am Hof dagegen ist in heller Aufregung. Wie lange wird sich der Kaiser nach dieser Demütigung noch halten können? Hinter den Kulissen spricht man von seiner baldigen Ablösung, einige Diplomaten träumen sogar von einem neuen katholischen Bündnis unter spanischer Führung, um das zerfallene Reich Karls V. wieder zu errichten, in dem die Sonne nicht unterging.
Nicht nur die Souveränität Rudolfs II., auch seine moralische Integrität ist angeknackst. Neben dem Majestätsbrief wird am Hof der mysteriöse Tod Don Julios heiß diskutiert, über den erst nach und nach Einzelheiten durchsickern.
Don Julio war der Lieblingssohn Rudolfs II., eines seiner zahlreichen unehelichen Kinder. Aber je älter er wurde, umso weniger Freude hatte der Kaiser an ihm. Insbesondere Don Julios sexuelle Neigungen nahmen krankhafte Züge an. In seiner Residenz auf Schloss Krumau an der Moldau führte er sich auf wie ein Tyrann.
Eine seiner Geliebten warf er, nachdem er sie zusammengeschlagen und mit Messerstichen traktiert hatte, in den Schlossteich. Die Tochter des Krumauer Baders überlebte das Verbrechen – und Don Julio forderte sie nach ihrer Genesung sofort zurück. Er ließ den Vater einkerkern, drohte ihm mit dem Galgen und bewog das Mädchen dadurch dazu, zu ihm zurückzukehren, was sie schließlich mit ihrem Leben bezahlte. Im Februar 1608 ermordete Don Julio sie auf brutale Weise und zerstückelte ihren Leichnam.
In ganz Europa empörte man sich über das grausame Verbrechen. Rudolf II. ließ seinen wahnsinnig gewordenen Sohn zwar einsperren, aber man lastete ihm die fehlgeschlagene Erziehung an, führte sie auf seine mangelnde Frömmigkeit, seine undurchsichtigen Frauengeschichten und seinen Umgang mit Alchemisten und Zauberern zurück.
Don Julio lebte nach dem Mord noch etwas mehr als ein Jahr, wusch sich nicht mehr und bedrohte seine Diener mit dem Messer. In der letzten Juniwoche 1609 ist er unter ungeklärten Umständen gestorben. Hat Rudolf II. seinen Sohn womöglich ermorden lassen? Don Julios grässliche Tat und die Rolle des Kaisers werden nun noch einmal in allen Details aufgerollt.
Die Mondfahrt
Angesichts der dramatischen Ereignisse hat Rudolph II. wenig Sinn für das Werk seines Mathematikers. Keplers großartige Denkleistung geht in tagespolitischen Wirren unter. In Prag ruft die Neue Astronomie so gut wie keinen Widerhall hervor.
Matthäus Wackher von Wackenfels ist einer der Wenigen, die sich nach dem Werk erkundigen. Der zwanzig Jahre ältere Hofrat stammt wie Kepler aus Süddeutschland, hat unter anderem in Padua Jura studiert, ist zum Katholizismus konvertiert, vom Kaiser geadelt und zu einem seiner wichtigsten Berater in rechtlichen Fragen geworden. Mit ihm spekuliert Kepler über die Konsequenzen aus dem neuen Bild des Universums.
Wackher möchte wissen, ob nicht auch der Mond und die Gestirne von Lebewesen bevölkert sind. Wenn die Erde nur ein Himmelskörper unter vielen ist, die um die Sonne laufen, warum sollte der Kosmos dann allein für den Menschen geschaffen sein?
Was die beiden in jenen Sommertagen umtreibt, ist der Nachwelt nur in groben Zügen bekannt. Ihre Debatten aber gehen in einen der bemerkenswertesten und kurzweiligsten Traktate ein, die Kepler je zu Papier gebracht hat. Seinem Freund Wackher zuliebe schreibt er noch im selben Jahr seinen Traum vom Mond nieder.
Während Galilei in Padua intensiv an einer Verbesserung des Fernrohrs arbeitet, stellt der acht Jahre jüngere Kepler eine gedankliche Leiter zum Mond auf. Jahrelang hat er die Bewegungen der Planeten von der Erde aus studiert. Nun verlässt er seinen Heimatplaneten und betrachtet ihn vom fiktiven Standpunkt des Mondes aus.
Der kopernikanischen Sichtweise zufolge dreht sich die Erde nicht nur um ihre eigene Achse, sondern auch um die Sonne. Um die Diskrepanz zwischen unserer alltäglichen Erfahrung und der rotierenden Erde zu überwinden, wechselt Kepler die Perspektive. Dem Leser, den er auf die Reise mitnimmt, vermittelt er die fremde Vorstellung von der doppelten Bewegung des Globus dadurch, dass er den Erdball neu vor ihm in Stellung bringt.
Keplers Traum vom Mond ist ein Paradebeispiel dafür, wie mathematisch-abstraktes Denken der Wissenschaft neue, überraschende Einblicke eröffnet. Der wunderbare Text ist heute kaum noch bekannt. Vielleicht liegt das an seiner phantastischen Rahmenhandlung. Ein Dämon tritt darin auf und wird zum Erzähler. Er schildert die Reise zum Mond als gefährliches Abenteuer, für das ein besonderes Auswahlverfahren vonnöten sei, denn schon der Aufstieg sei lebensgefährlich. »Keinen von sitzender Lebensart, keinen Wohlbeleibten, keinen Wollüstling nehmen wir mit, sondern wir wählen solche, die ihr Leben im eifrigen Gebrauch der Jagdpferde verbringen oder die häufig zu Schiff Indien besuchen und gewohnt sind, ihren Unterhalt mit Zwieback, Knoblauch, gedörrten Fischen und anderen von Schlemmern verabscheuten Speisen zu fristen.«
Ende der Leseprobe