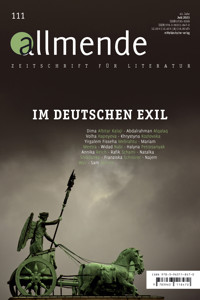
Allmende 111 – Zeitschrift für Literatur E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Auch für Künstler*innen und Schriftsteller*innen sind aufgrund der Repressionen und Kriege die deutschsprachigen Länder seit Jahrzehnten zum Exilort geworden. Waren es zunächst vereinzelte Künstler*innen, so ist die Zahl die Exilsuchenden in den letzten zehn Jahren erheblich angestiegen. Wir fragen nach den Erwartungen, der Lebensrealität und dem Selbstverständnis in einer global veränderten Welt. Wir fragen auch danach, welche Rolle der Kunst zukommen kann angesichts des Elends der Kriege in der Ukraine und Syrien. Was bedeutet es, der Repression entkommen zu sein, im Iran, Irak, der Türkei, in Belarus und weiteren Staaten und Regimen? Wie wurden die intellektuellen Debatten und die Themen der Literatur verändert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriftstellerinnen und Schriftsteller leisten Widerstand, setzen sich für Gerechtigkeit und freie Gesellschaften ein. Dafür werden viele verfolgt, bedroht, angegriffen, eingekerkert, verbannt und nicht selten getötet. Solange eine oder einer von ihnen irgendwo nicht frei ist, ist niemand frei.
Najem Wali
Ein Land des Exils ist die Bundesrepublik seit Beginn ihres Entstehens. Das Recht auf Asyl steht festgeschrieben im Grundgesetz. Mit den weltweiten Krisen und der Unterdrückung in vielen Ländern steigerte sich jedoch die Zahl der Exilantinnen und Exilanten. Iran, Irak, Türkei und Syrien können dafür seit den sechziger Jahren stellvertretend stehen. Damit entstand auch eine deutschsprachige Exilliteratur, Rafik Schami steht dafür als ein Beispiel, auch dafür, dass die Literatur von Exilanten ein Teil der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur werden konnte. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich seit 2015 potenziert, das gilt mit Blick auf den arabischen und afrikanischen Raum und mit Blick auf die osteuropäischen Länder wie Belarus und natürlich die Ukraine. „Zwischen mir und Damaskus und Aleppo liegen Tausende von Kilometern“, schreibt Widad Nabi, „ein Mittelmeer aus Tränen, die es zu überfluten drohen. Wir haben es überquert, um zu überleben.“ Es ist diese Leiderfahrung, die wir aus den Texten des erzwungenen Exils zumindest erahnen können, auch welcher Anstrengung es bedarf, sich neu einzurichten, eine Gesellschaft erst einmal zu begreifen lernen, allein, mit Partner oder Partnerin, mit Kindern und mit dem traurigen Bewusstsein des Verlustes des Zurückgelassenen. Nabi betont, dass mit jedem Tag ein „zurück“ unwahrscheinlicher wird. Die Distanz zwischen denen, die im Exil leben, und denjenigen, die dortgeblieben sind, wird kaum zu überwinden sein, auch nicht, wenn es zukünftig scheinbar politisch möglich erscheint – die Diktatoren und ihre Schergen haben ihr „Volk“ fest in ihrem Würgegriff, die Gefängnisse sind überbelegt. Man kann gar nicht genug daran erinnern, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller seit Jahren weggesperrt sind, oder wie die ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelina durch einen russischen Raketenangriff in diesem Juli getötet worden ist. Sie wollte nicht den Weg ins Exil gehen, sondern berichtete von den „Schlachtfeldern“ in der Ukraine – der Krieg als Thema der europäischen Literatur im 21. Jahrhundert! Gerade deswegen sind die Texte der neuen Exilanten so wichtig, sie dokumentieren die Kraft der Literatur, so ohnmächtig wir auch angesichts der globalen Krisen sind. Daher sind auch literarische Plattformen wie Weiter Schreiben notwendig. Sie vernetzen mit großem Erfolg die Exilautorinnen und -autoren mit den deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Annika Reich, eine der Initiatorinnen: „Dabei präsentieren wir die Autor*innen als Teil der deutschen Literaturszene und nicht als etwas ihr Äußeres“. Wenn das gelingt, dann gibt es doch noch Hoffnung, der Barbarei zu widerstehen.
Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Matthias Walz
allmende Nr. 111
Juli 2023 • 43. Jahr
Redaktion
Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Matthias Walz
Herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmannim Auftrag der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe
Literarische Gesellschaft
PrinzMaxPalais • Karlstr. 10
76133 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721 133-4087
www.literaturmuseum.de
Verlag
mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH
Am Steintor 23
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 (0) 345 233 22-0
Telefax: +49 (0) 345 233 22-66
www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung
mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH
Bezug & Abo
mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH
Telefon: +49 (0) 345 233 22-0
Telefax: +49 (0) 345 233 22-66
Eine Kündigung ist innerhalb eines Vierteljahres nach Lieferung des letzten Heftes möglich.
Preise
Einzelbezug 12,00 €/12,40 € (A)/16,80 sFr
Abobezug 10,00 €/10,80 € (A)/14,70 sFr
epub 9,49 € / 9,80 € (A) / 13,30 sFr
allmende erscheint 2 × jährlich
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung dess Verlages.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.
ISSN 0720-3098
Einzelbezug: ISBN 978-3-96311-847-0
Abobezug: ISBN 978-3-96311-848-7
epub: ISBN 978-3-96311-849-4
Quadriga auf dem Brandenburger Tor: © picture alliance / ZB | Arno Burgi
Franziska Schnürer: © privat
Hansgeorg Schmidt-Bergmann: © FotoFabry
Matthias Walz: © MLO
Franziska Schnürer: AUFLÖSUNG, 2014, Zusammengesetzter Holzschnitt, 100 × 150 cm
Rafik Schami: © privat
Rafik Schami: © privat
Rafik Schami: © privat
Rafik Schami: © MLO
Rafik Schami: © Root Leeb
Rafik Schami: © Arne Wesenberg
Franziska Schnürer: NEUE ALTE MUSTER, 2017, Holzschnittcollage, 100 × 70 cm
Yirgalem Fisseha Mebrahtu: © privat
Franziska Schnürer: PLUSSIEBEN (GEISTER VII), 2018, Schablithographie Kleingraphik, 30 × 45 cm
Natalka Sniadanko: © Katheryna Slipchenko
Franziska Schnürer: RESTENERGIEN II, 2018, Schablithographie, 30 × 40 cm
Volha Hapeyeva: GESTERN WAR ALLES ANDERS, 2023, Monotypie. Acryl auf Papier, 29,7 × 21 cm
Volha Hapeyeva: BLÜTENSTAND, 2023, Aquarell, 29,7 × 21 cm
Volha Hapeyeva: MORGEN, 2023, mixed Media, 29,7 × 21 cm
Volha Hapeyeva: VOGEL, 2022, Kohle, 15 × 23 cm
Volha Hapeyeva: IM ABSTAND, 2022, Aquarell, 14,8 × 21 cm
Volha Hapeyeva: © Claudia Stranghöner
Franziska Schnürer: INSOMNIA 1, 2018, Bleistift, 50 × 70 cm
Café: © Heike Steinweg
Arbeitsplatz Widad Nabi: © Heike Steinweg
Widad Nabi: © Heike Steinweg
Widad Nabi: © Heike Steinweg
Franziska Schnürer: SPIEGEL 2, 2020, Schablithographie (3er Auflage), 13 × 19 cm (Druck)
Annika Reich: © Heike Steinweg
Franziska Schnürer: SPIEGEL 3, 2020, Schablithographie, 13 × 19 cm (Druck)
Dima Albitar Kalaji: © Juliette Moarbes
Franziska Schnürer: SPIEGEL 4, 2020, Bleistiftzeichnung, 20 × 25 cm
Abdalrahman Alqalaq: © privat
Franziska Schnürer: RÜCKZUG, 2022, Bleistiftzeichnung, 20 × 25 cm
Mariam Meetra: © privat
Franziska Schnürer: WIRRUNGEN1, 2023, Linolschnitt 3er Auflage, 30 × 42 cm (Druck)
Khrystyna Kozlovska: © privat
Halyna Petrosanyak: © Juri Rylchuk
Franziska Schnürer: XPARIETINA, 2022, Bleistiftzeichnung, 70 × 100 cm
Aubrey Beardsley: A Platonic Lament, 1894
Sam Zamrik: © Paula Winkler
Franziska Schnürer: PATIENCE, 2015, zusammengesetzter Holzschnitt, 240 × 260 cm
Najem Wali: © Emanuela Danielewicz
Jagoda Marinic: © christian-dammert.de
Anna Baar: © Johannes Puch
Gerhard Henschel: © Jochen Quast
Maria Stepanova: © Ekko von Schwichow/Suhrkamp Verlag
Esther Kinsky: © Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag
Jan Faktor: © Joachim Gern
Lutz Seiler: © Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag
Fridolin Schley: © Juliane Brückner
Judith Zander: © Sven Gatter
Slata Roschal: © Ammy Berent
Juri Andruchowytsch: © Stefan Klüter/Suhrkamp Verlag
Abbas Khider: © Peter-Andreas Hassiepen
Michael Krüger: © Foto Meinen /Suhrkamp Verlag
Victoria Amelina: © Osabadash, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Dank für die großzügige Unterstützung an
Prof. Dr. Matthias Siegmann,Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof
IM DEUTSCHEN EXIL
Rafik Schami
Meine sechste Erzählschule
Fragen – Antworten
Yirgalem Fisseha Mebrahtu
Fülle blieb mir versagt
Fragen – Antworten
Natalka Sniadanko
Unterwegs mit Koffern voll Angst
Fragen – Antworten
Volha Hapeyeva
protokoll „ELILENTI“
Fragen – Antworten
Widad Nabi
Ich schreibe euch aus dem Exil
Fragen – Antworten
Annika Reich
Fragen – Antworten
Dima Albitar Kalaji
Forced Displasment.
Zwangsentwurzelung
Fragen – Antworten
Abdalrahman Alqalaq
Die Halboktave des Deutschkurses B2
Fragen – Antworten
Mariam Meetra
Die Heimat war deine Brust
Fragen – Antworten
Khrystyna Kozlovska
Ich war zu spät
Kleine Ra
Halyna Petrosanyak
Compressio
ohne Titel
Gespräch zwischen Halyna Petrosanyak und Khrystyna Kozlovska
Sam Zamrik
Liebste
Fragen – Antworten
Najem Wali
Neues Warnmärchen von Scheherazade
Fragen – Antworten
Rezensionen
kurzform
FRANZISKA SCHNÜRER: AUFLÖSUNG, 2014, Zusammengesetzter Holzschnitt, 100 x 150 cm
RAFIK SCHAMI
Meine sechste Erzählschule
Literatur produzieren in einer fremden Sprache
Darüber habe ich viel geschrieben.1 Im Grunde wollte ich nicht auf Deutsch schreiben, denn ich hatte ja eine (als berechtigte Hoffnung perfekt getarnte) Illusion nach Deutschland mitgebracht:
Die Emigrantenliteratur hat in den arabischen Ländern, vor allem aber in Syrien, dem Libanon und Ägypten, einen hohen Stellenwert. Wegen des Hungers nach Brot, Freiheit und Gerechtigkeit unter den Osmanen emigrierten tausende Araber nach Nord- und Südamerika. Dort entstanden starke arabische Gemeinden mit eigenen Zeitungen und eigener Literatur. Khalil Gibran ist der weltbekannteste unter Hunderten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die im Ausland lebten, aber immer auf Arabisch schrieben. Sie konnten ihre Werke ungehindert in Kairo, Beirut, Bagdad oder Damaskus veröffentlichen. Das war die Grundmauer meiner Hoffnung. Ich würde in Deutschland in Freiheit leben und in Arabien veröffentlichen.
Doch die arabischen Diktaturen lernten schnell. Man unterschätzt sie, aber auch ein erfolgreich putschender Unteroffizier, der gerade noch seinen Namen richtig schreiben kann, kann nach einiger Zeit und mit einem Stab lupenreiner opportunistischer Experten sowie mit der „Entwicklungshilfe“ aus dem damaligen Ostblock und dank der Gleichgültigkeit des Westens Entscheidungen treffen, die seine Herrschaft unantastbar machen. Eine dieser Maßnahmen ist die Einigung mit den anderen arabischen Diktatoren, jedwede Literatur von Exilanten zu verbieten.
Jahrelang versuchte ich meine Hoffnung zu retten. Ich habe Manuskripte verschickt und kaum Antworten bekommen. Ein ägyptischer Verleger, dem ich meinen späteren Welterfolg Erzähler der Nacht geschickt habe, war immerhin ehrlich. Er sagte mir auf der Frankfurter Buchmesse:
Rafik Schami als Zehnjähriger.
Chemiestudium in Heidelberg: Rafik Schami (in der Mitte sitzend) im Doktoranden-Team der Universität. Abschluss des Studiums 1979 mit der Promotion.
„Der Roman ist gut, aber Sie sind Syrer, warum veröffentlichen Sie nicht in Syrien? Wir wollen die Beziehung unseres Verlags zu Syrien nicht verderben.“
Die Verlage unter einer Diktatur werden ein Teil von ihr. Lassen Sie sich nicht täuschen, ein irakischer „Exilautor“, der in Damaskus veröffentlicht, ist kein Exilautor, sondern Anhänger des Assad-Regimes, das mit Saddam Hussein verfeindet war. Auch syrische oder ägyptische Islamisten, die in Saudi-Arabien das mörderische Könighaus loben, sind keine Exilautoren, sondern charakterlose Menschen, die nur die Stiefel eines anderen Herrschers lecken.
Es vergingen Wochen, bis ich den Hass wieder aus meinem Herzen vertreiben und nüchtern nach einer Lösung suchen konnte. Sie lag eigentlich auf der Hand: Ich lebte in Deutschland, und eine Rückkehr würde in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Meine Freundinnen und Freunde sprachen mit mir Deutsch, unabhängig von ihrer Nationalität. Worauf sollte ich warten?
Also beschloss ich, auf Deutsch zu schreiben. Ich promovierte in Heidelberg im Fach Chemie, aber ich wollte mehr als das wissenschaftliche oder das alltäglich gebrauchte Deutsch verwenden können. Ich hatte eine große Aufgabe, ich wollte die arabische mündliche Erzählweise mit all ihrem Reichtum, ihren vielen Möglichkeiten und frei von Kitsch ins Deutsche übertragen. Literatur schreiben heißt, den höchsten Anspruch an die Sprache zu stellen.
Die beste Methode zum Speichern eines Textes, einer chemischen Formel oder fremdsprachiger Wörter besteht darin, sie mit der Hand ab- oder aufzuschreiben. Mit den Augen allein gelingt das in der Regel nicht. Deshalb plädiere ich auch dafür, Handschrift in den Schulen beizubehalten und zu fördern.
Ich nahm mir also die Buddenbrooks vor, nach der Meinung vieler damaliger Freunde Thomas Manns bester Roman. Mich faszinierte er, weil er ein für mich wichtiges Thema berührte, das ich später vor allem in meinem Roman Die dunkle Seite der Liebe behandelt habe, wo ich vom Verfall der arabischen Sippe erzähle. Ich schrieb den Roman Satz für Satz ab, hielt immer wieder inne und fragte mich, wie der Autor die Atmosphäre mit so wenigen Adjektiven erzeugt hat. Arabisch lebt von den Adjektiven. Auf Deutsch dagegen klingen zu viele Adjektive kitschig.
Rafik Schami in Heidelberg schreibend. Seit 1977 schreibt er auf Deutsch. Seine Bücher sind bisher in über 30 Sprachen erschienen.
Woher kommt aber diese Neigung der arabischen Sprache zu Adjektiven? Rainer Malkowski hat darauf eine kuriose und zugleich geniale Antwort gegeben:
„Wir leben im schönen Garten der Adjektive. Licht und Schatten arbeiten an den Erscheinungen die charakterisierenden Abweichungen heraus, die nach Benennung verlangen. Wem die Augen keine Worte mehr stiften, weil er im Nebel, in der Unschärfe lebt, der muss sich mit Gattungszuordnung zufriedengeben. Die Sprache wird substantivisch: Baum, Hund, da drüben, wie es scheint, geht ein Mensch.“2
Als Gegengewicht zu Thomas Manns ewig langen Sätzen wählte ich als Nächstes den Dichter Heinrich Heine, danach diverse Satiren von Kurt Tucholsky sowie auch Das Liebeskonzil von Oskar Panizza, eine giftige Satire gegen die katholische Kirche. Nach vielen kleinen Erzählungen, die ich als Fingerübung abgeschrieben habe, war meine letzte Station die große Autorin Anna Seghers. Ihr Roman Transit ist für mich eines der wichtigsten deutschen Exilwerke. Sie erzählt vom Leid der deutschen Flüchtlinge, die in Marseille festsitzen und versuchen, nach Mexiko zu entkommen, vom endlosen Warten auf eine Rettung. Anna Seghers musste damals selbst in Marseille unendlich lange ausharren, doch der Roman ist mehr als eine Autobiografie.
Fest des Erzählens: Rafik Schami nimmt bei einer Veranstaltung im Konzerthaus Karlsruhe am 21.11.2014 das Publikum mit auf einen poetischen Spaziergang durch Damaskus, seiner Heimatstadt.
Ich begann nach all diesen Übungen meine ersten zwei Romane Eine Hand voller Sterne und Erzähler der Nacht sowie die Kurzgeschichten, die ich mitgebracht hatte, aus dem Arabischen ins Deutsche zu übersetzen. Langsam aber begriff ich, dass mir bei allem Fleiß manche Gebiete der deutschen Sprache nie zugänglich werden würden. Sicher, man kann viele Lücken schließen, doch es gibt, wie ich einmal geschrieben habe, Kämmerlein im Haus der Sprache, die einem immer verschlossen bleiben, wenn man als Kind nicht darin aufgewachsen ist.3 Manche Angeber möchten unbedingt als geniale Ausländer gelten und tun so, als hätten sie erst in Deutschland Deutsch gelernt. Eine kleine Recherche zeigt aber, dass sie das Privileg hatten, entweder eine deutsche Mutter oder schon in frühen Jahren einen deutschen Kindergarten und eine deutsche Schule besucht zu haben.
Ich habe Aramäisch, Arabisch, Französisch und Englisch gelernt, und deshalb war der Zugang zur deutschen Sprache sicher leichter für mich als für jemanden, der nichts als seine Muttersprache kennt. Trotzdem gibt es immer wieder kleine Fehler, die ich allein nicht entdecken kann. Darunter litten z. B. auch der Franzose Adelbert von Chamisso, der auf Deutsch schrieb, und der Pole Joseph Conrad, der seine Romane in englischer Sprache verfasste. Das stellte aber für beide kein Hindernis dar, Weltliteratur zu schaffen.
Bei allem Bedarf an Hilfe im Exil konnte ich von Anfang an den „Mitleidsbonus“ nicht ausstehen. Nein, entweder sollten die Verleger meine Literatur annehmen, oder sie wegen des Inhalts und der Form ablehnen, aber niemals wegen sprachlicher Defizite. Daher habe ich eine Woche nach Beendigung meiner Studien per Anzeige einen Lektor oder eine Lektorin gesucht. Und von da an erschien kein Werk von mir ohne die Korrekturen eines Privatlektorats. All denen danke ich für die Sicherheit, die sie mir schenkten. An erster Stelle Root Leeb und später auch Emil Fadel und heute meiner Lektorin Tatjana Michaelis, die sich schon viele Jahre im Hanser Verlag bewährt hat.
Zurück zu meinen Anfängen. Mit Hartnäckigkeit und vor allem Geduld habe ich zwei mitgebrachte Romane, zwei Sammlungen von modernen satirischen Kurzgeschichten sowie einige magische, märchenhafte Geschichten ins Deutsche übersetzt. Ich begann, sie an Verlage zu schicken, und erntete nur Ablehnungen. Die deutschen Verleger antworten fast immer, auch wenn sie das Manuskript (bzw. die Zusammenfassung und Leseprobe von nicht mehr als zehn Seiten) gar nicht gelesen haben. In diesem Fall waren ihre Antworten verlogen.
„Sehr geehrter Herr Schami, ihr Roman ist sehr schön, leider passt er nicht in unser Programm.“
Dabei warteten diese Verlage mit einem unglaublich diversen Angebot auf, angefangen bei Koch-, Bastel- und Gartenbüchern über Romane, Lyrik und Sachbücher bis hin zu Büchern über die Anarchie. Nur mein Romane passten angeblich nicht hinein.





























