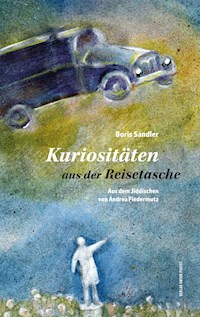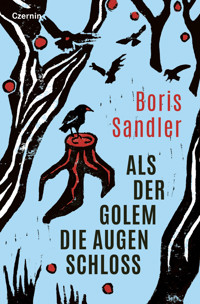
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1903 ereignet sich im damaligen russischen Kaiserreich ein Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung, das als »Massaker von Kischinew« in die Geschichtsbücher einging und heute weitgehend vergessen ist. In »Als der Golem die Augen schloss« erinnert der auf Jiddisch schreibende Boris Sandler an die 49 Toten und hunderten Opfer des Pogroms und ergründet die ihm vorausgegangenen Hetzkampagnen und ihre nicht nur in Osteuropa bis heute spürbaren Nachwirkungen. Sein historischer Roman zeugt aber nicht nur von antisemitischen Ressentiments und Gewaltbereitschaft der Täter und Zuschauer, sondern entwirft zugleich ein lebendiges und unsentimentales Zeugnis vom einstigen Leben im Schtetl und dem multikulturellen Reichtum der jüdischen Kultur- und Geistesgeschichte. »Die Städte und Dörfer ruhten. Menschen und Tiere hatten sich nach den Anstrengungen eines Tages endlich in einem Traum verloren, lang wie die Nacht und kurz wie das Leben. Selbst Gott schien nach seinen Mühen für die Welt einen Moment ein Nickerchen zu machen … Ein stiller unschuldiger Augenblick am Vorabend eines blutigen Massakers.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BORIS SANDLER
ALS DER GOLEM DIE AUGEN SCHLOSS
Aus dem Jiddischen übersetztvon Andrea Hanna Fiedermutz
Mit einem Nachwortvon Mikhail Krutikov
Boris Sandler
ALS DERGOLEM DIE AUGENSCHLOSS
Aus dem Jiddischen übersetztvon Andrea Hanna Fiedermutz
Mit einem Nachwort vonMikhail Krutikov
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur, des Zukunftsfonds der Republik Österreich und des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Sandler, Boris: Als der Golem die Augen schloss / Boris Sandler
Wien: Czernin Verlag 2025
ISBN: 978-3-7076-0886-1
© 2025 Czernin Verlags GmbH, Kupkagasse 4, 1080 Wien, Österreich
Die Originalausgabe erschien 2004 in Tel Aviv bei
Leyvik Publishing House.
Übersetzung aus dem Jiddischen: Andrea Hanna Fiedermutz
Satz, Umschlaggestaltung: Mirjam Riepl
Autorenfoto: Wikicommons
Druck: GGP Media, Pößneck
ISBN Print: 978-3-7076-0886-1
ISBN E-Book: 978-3-7076-0887-8
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne des Urheberrechtsgesetzes behalten wir uns ausdrücklich vor.
Und als die Zeit kam, da der jüdischen Gemeinde keine Gefahr mehr drohte, rief der Prager Rabbiner Jehuda Löw ben Bezalel seinen Schwiegersohn Itzchak und seinen Schüler Jakow zu sich, die ihm bei der Erschaffung des Golem geholfen hatten, und sagte zu ihnen: »Jetzt ist der Golem nicht mehr nötig, weil wir keine Furcht mehr vor all den Blutanklagen haben müssen, deren man uns beschuldigt. Also werden wir ihn auslöschen.«
Aus der Prager Legende über den Golem
Aus Stahl und Eisen,
kalt und hart und stumm,
schmiede ein Herz für dich, du Mensch –
und komm!
Aus Chaim Nachman Bialik: Im Schlachthaus
DIE PRAGER GOLEM-SAGE
Rabbi Löw, oberster Richter der Gemeinde von Prag, bedrückte die unablässig von christlichen Priestern vorgebrachte Verleumdung des Blutgebrauchs so sehr, dass er den Beistand des Himmels erflehte. In einem nächtlichen Traum bekam er Folgendes aufgetragen:
»Mache ein Menschenbild aus Ton, und Du wirst der Böswilligen Absicht zerstören.«
So machte er sich mit einem Schüler und seinem Diener auf den Weg zu einem Fluss außerhalb der Stadt, an dessen Ufer eine Lehmgrube lag. Hier kneteten die drei Männer aus der formlosen Masse eine menschliche Figur, die durch das jeweils siebenmalige Umschreiten des Schülers und des Dieners sowie das Hersagen von vorgesetzten Formeln zum Leben erweckt wurde. Der Golem war von sehr großer Statur und besaß ungeheure Kräfte. Nach ihrer Heimkehr lebte der Golem zumeist reglos zurückgezogen in einem Winkel der Stube des Rabbis. Nur wenn dieser einen Auftrag an ihn hatte und der Rabbi ihm ein mit Zauberformeln beschriebenes Pergament in den Mund legte, erwachte der Riese zum Leben. Auch bekam er ein Amulett aus Hirschhaut um den Hals gehängt, das ihn für die anderen unsichtbar machte, während er aber alles sah.
Rabbi Löw setzte den Golem vor allem dazu ein, die Blutbeschuldigung zu bekämpfen. Sobald das Passahfest nahte, patrouillierte der Golem während der Nächte durch die dunklen Straßen der Judenstadt und hielt jeden auf, der eine Last auf dem Rücken trug. War darunter ein totes Kind, das vor eine Synagoge gelegt werden sollte, band er den Übeltäter und die Leiche mit einem Strick zusammen und brachte sie zum Stadthaus, wo er sie der Obrigkeit übergab.
Nachdem es wieder ruhig auf den Straßen von Prag wurde und ein Gesetz die Blutbeschuldigung nicht mehr unter Anklage stellte, da sie grundlos war, beschloss Rabbi Löw, den Golem wieder den Elementen zu übergeben. Wieder rief er seine Schüler um sich und dieses Mal vollbrachten sie die Rituale seiner Erweckung in umgekehrter Reihenfolge. Danach war der Golem wieder leblos. Man wickelte ihn in zwei alte Gebetbücher und verwahrte ihn in der Dachstube des Rabbis.
Für Rabbi Löw hatte der Golem Anteil am ewigen Leben, weil er Israel so oft vor schwerer Not bewahrt hat, und wenn er dereinst mit den anderen Toten zusammen wieder zum Leben erwachen sollte, wird er in einer ganz anderen Gestalt fortleben.
https://prag-to-go.com/golem-sage
INHALT
KAPITEL EINSMichail Ribatschenko wird vermisst
KAPITEL ZWEIUntersuchung in Dubossary
KAPITEL DREIAm Vorabend des Pogroms
KAPITEL VIERDas Pogrom von Kischinew
KAPITEL FÜNFDas Ende der Dubossary-Affäre
ANMERKUNGEN
NACHWORTAnatomie des Antisemitismus
KAPITEL EINS Michail Ribatschenko wird vermisst
1
Es war schon gegen vier Uhr in der Früh, als Serafim Kirilow von Dubossary1 in sein Dorf Ustia2 heimkehrte, das sich am anderen Ufer des Dnjestr3 befand.
Er saß auf seinem Wagen, den Pelz aufgeknöpft, die hohe Schaffellmütze tief in die Stirn gerückt. Auf seinem Fuhrwerk lugte unter einem Bündel Stroh ein kleines Fässchen hervor. Die letzten Tropfen hatte Serafim schon vor einer Weile ausgetrunken. Ein Mann war ihm auf dem Weg begegnet, ein Mann mit einem schweren Sack auf dem Rücken. Als er ihn sah, freute sich Serafim sehr, obwohl er ihm nie im Leben zuvor begegnet war. Wenn ihr jetzt Serafim fragen würdet, wie jener Mensch geheißen hat, wüsste er es nicht. Andererseits, um mit jemandem ein wenig guten Wein zu trinken, ist es nicht wichtig, zu wissen, wie jener heißt. Noch dazu an einem Tag wie diesem!
Sein Herz und seine Füße klopften im Takt eines fröhlichen moldauischen Volkstanzes. Immer wieder schrie er ein wildes »Haa-uuu!«, riss dazu seine Fellmütze vom Kopf und ließ sie in der Luft kreisen: »Haa-uuu! So eine Freude!«
Das rote Pferd trabte fröhlich durch die schmalen Seitengässchen und nickte dabei beipflichtend mit dem Kopf, als ob es seinem betrunkenem Herrn zustimmte: »Ganz genau, so ist es, eine Freude!«
Eine Freude? Heute war bei Serafim Kirilow ein richtiger Feiertag! Gedankt sei Gott, nach vier Töchtern hatte er nun endlich einen Sohn bekommen. Meint nicht etwa, dass Serafim seine vier Töchterchen nicht liebt, Gott bewahre, aber ein Sohn bleibt ein Sohn. Gut hat er daran getan, dass er nicht auf seine Frau gehört hat und sie nach Dubossary gebracht hat. Hätte er das bloß auch zehn Jahre früher getan, als seine Maria das erste Mädchen geboren hatte. Die Hebamme Großmütterchen Jewdokia hat zwar eine geübte Hand, aber offensichtlich den bösen Blick. Vier Kinder hat sie von seiner Frau entbunden und alle vier waren Mädchen! Das ganze Dorf lacht schon über ihn:
»He Serafimule, vielleicht hat sie was gegen dich, die alte Hexe, ha?«
Dieses Mal hatte er einen Beschluss gefasst: Sobald Marias Zeit kam, würde er sie nach Dubossary ins Spital bringen. Sollen die gelehrten Doktoren dort ihre Sache machen. Wieviel muss er denn schließlich noch ertragen?! Es ist ja schon wie ein Fluch. Und da haben gestern Mittag bei Maria die Wehen eingesetzt. Serafim dachte nicht zweimal nach, spannte seine rote Stute ein, warf einen Sack Stroh in den Wagen, setzte seine Frau darauf und »Hüh-hott, Pferdchen!« – Punkt acht Uhr abends wurde Serafim Kirilow Vater eines Sohnes.
Jetzt wird er es den Lästermäulern in Ustia schon zeigen. Und die Großmutter Jewdokia, die üble Hexe, wird er in einem Weinfass ertränken!
»Ha-hü! Ein langes Leben!« So pflegten die Burschen am Weihnachtstag zu rufen und durch das ganze Dorf zu ziehen. Ei, war das ein Spaß! Einer schlüpfte zum Beispiel in den Schaffellmantel des Vaters mit der verkehrten Seite nach außen an und verkleidete sich so als Bär. Ein anderer maskierte sich als Türke – mit einem Turban auf dem Kopf und einem Krummsäbel an der Seite, über den er immer wieder stolperte. Ein Dritter ging mit einem langen Stab in der Hand herum, auf dem der Kopf eines Ziegenbockes steckte, aus Lumpen gebastelt, aber mit echten gedrehten Hörnern und einem echten spitzen Ziegenbart. Alle singen, tanzen, schreien … Der Klang trägt sich über das ganze Dorf: »Wir würden noch weitermachen, aber wir fürchten, dass es bald finster wird; wir sind nicht von hier, sondern kommen aus dem Dorf Chirzapirza4, wo man eine Mamaliga5 in Nussgröße kocht und wenn einer nur einen Krümel verliert, erhält er gleich einen Klaps mit einem Scheit über den Kopf …« Unerwartet kommt plötzlich ein Mädchen aus einer Gasse gelaufen. Ihr Gesicht glüht vom Frost und ihrer robusten Gesundheit. Die lustige Gesellschaft umringt sie und da fängt erst die richtige »Bescherung« an: Man kitzelt sie, küsst sie, fasst sie von allen Seiten an, sie kreischt – ihr gefällt das ganz und gar nicht!
Der Wagen wurde durchgeschüttelt. Serafim erwachte, offensichtlich war er eingenickt. Der Wein aus dem Fässchen machte sich bemerkbar. Das war nur angebracht, zu diesem Zweck hatte er ihn schließlich mitgebracht. Alle, die im Hof des Spitals anwesend waren, hatten seinen Wein probiert und auf seinen neugeborenen Sohn angestoßen und ihm gewünscht, er möge stark und gesund heranwachsen. Ein Moldawier, der sich ohne einen Tropfen Wein auf den Weg macht, ist kein echter Moldawier … In der Ferne war Hundegebell zu hören. Wohin hatte er sich da nur verfahren? Hier begannen schon die Obstgärten, das hieß, dass er schon aus der Stadt hinausgefahren war. Auf seine rote Stute kann er sich eben verlassen. Dort unten ist schon die Überfahrtsstelle zu sehen, an der der Fluss schmäler und das Eis dicker war. Bevor er sich aber hinunterbegeben wird, muss er für ein paar Minuten anhalten. Etwas rumort da stark in seinem Bauch …
Serafim lenkte den Wagen etwas nach rechts, damit er nicht den Weg versperrte, und zog die Zügel an: »Brrrr!« Nachdem er hinuntergeklettert war, gab er seiner Stute einen leichten Klaps auf die magere Kruppe, als wollte er ihr sagen: »Bald kommen wir nach Hause, dann bekommst du eine Extraportion Hafer. Die hast du dir heute ehrlich verdient.« Dann sah er sich einen Moment zwischen den Bäumen um und als er dichtes Gebüsch entdeckte, stapfte er dorthin und band den roten Stoffgürtel auf.
Als er schon unter dem Busch hockte, sah Serafim plötzlich einen lebenden schwarzen Fleck auf dem Schnee: Ein Schwarm Krähen und Elstern flatterte dort am Ende des Obsthains umher. Die Vögel stritten untereinander, schubsten sich, jagten einer den anderen … (Später konnte Serafim um keinen Preis erklären, warum er plötzlich zu dieser Stelle hinging. Welcher Teufel hatte ihn dorthin getrieben?)
Er hielt mit beiden Händen seine Hosen fest, während er sich dem Vogelschwarm näherte. Die oberste gefrorene Schneeschicht knirschte unter seinen Stiefeln und als die Vögel fremde Schritte hörten, wurden sie unruhig. Ein Teil von ihnen flog auf die Bäume, andere ließen sich auf dem Zaun aus geflochtenen Zweigen nieder. Die Frechsten schüttelten ihr Gefieder, trippelten auf die Seite und warfen schräge unzufriedene Blicke auf den Menschen.
Das Bild, das sich Serafim bot, sollte ihn danach bis an sein Lebensende verfolgen. Und wann immer er sich daran erinnerte, packte er seine Hosen, als hätte er Angst, sie zu verlieren.
Gleich beim Zaun lag neben einem breiten Baumstumpf auf der Seite, den Kopf zu Serafim gedreht, ein Toter. Das gesamte Umfeld des Leichnams, auch er selber, war in Blut getränkt. Serafim verharrte wie angewurzelt auf der Stelle. Er fühlte nicht einmal, wie sich seine Finger lösten und er nur mehr in den langen weißen Unterhosen dastand.
Wie er danach zum Wagen stapfte und über den Dnjestr fuhr, wusste Serafim nicht mehr. Er kam erst am anderen Ufer wieder zu sich, als seine Stute plötzlich anhielt, als wollte sie damit fragen: »Nu, Serafim, was sollen wir jetzt weiter tun?« Da erst wurde ihm bewusst, dass auf der anderen Seite des Dnjestr etwas Grauenhaftes passiert war und dass er jetzt nicht einfach nach Hause zurückkehren durfte – er musste jemandem erzählen, was er im Obsthain gesehen hatte. Wem und wo, konnte sich Serafim noch nicht klar vorstellen. Auf jeden Fall wendete er aber nun das Gefährt und fuhr zurück nach Dubossary.
2
Das alles geschah am 13. Februar 1903. Am 9. Februar, einem Sonntag, war der vierzehnjährige Michail Ribatschenko, Enkel des Bürgers Konon Ribatschenko von Dubossary, verschwunden.
Michails Vater war zehn Jahre zuvor umgekommen, die Mutter wohnte nun mit ihrem zweiten Mann in Grigoriopol6 – 18 Werst7 von Dubossary entfernt –, sodass Michail, oder Mischa genannt, von frühester Kindheit an bei seinen Großeltern aufwuchs.
Konon Ribatschenkos Gehöft stand in der Siedlung »Große Fontäne«. Im Haus, das sich tief in den Hof hineinduckte, wohnte außer dem alten Konon und seiner Frau Jelisaweta auch der Enkel Iwan Timoschtschuk, ein geistig beschränkter junger Mann von 22 Jahren, schwerhörig und mit einem starken Sprachfehler. Iwan war wie sein kleiner Cousin Michail eine Waise und wuchs ebenfalls auf dem Hof seiner Großeltern auf. Obwohl sie Iwan liebten, wenn auch mehr aus Mitleid, so legten die beiden Alten doch ihr ganzes Herz, ihr Leben, in Mischa. Mehr noch: Konon Ribatschenko war sogar bereit, Mischa als seinen Sohn zu adoptieren. Dessen Mutter erhob dagegen sicher keinen Einspruch – was hätte sie auch dagegen haben können, dass ihrem Sohn nach dem Tod des Großvaters ein ganzes Vermögen zufallen würde: das Gehöft mit zweieinhalb Dessjatine8 Land, der Weinberg und der Obsthain. Konon war vor kurzem, nach Weihnachten, beim Notar gewesen, um ihn zu fragen, welche Papiere er dafür vorbereiten müsse. Er machte kein Geheimnis daraus; alle seine Nachbarn wussten davon.
Natürlich würde er auch nicht auf Iwan vergessen – er würde ihm ein 25 Saschen9 breites Grundstück vermachen. Dieses Stück Land hatte Konon einst der verstorbenen Tochter zugeteilt, als jene Iwans Vater Michail Timoschtschuk heiratete. Nach ihrem Tod wurde Timoschtschuk Iwans Vormund. Er heiratete aber rasch wieder und bekam mit seiner zweiten Frau eine ganze Stube voll kleiner Bälger. Er wohnte ebenfalls auf Konons Hof, in demselben Häuschen, das sie beide, der Schwiegervater und der Schwiegersohn, zusammen gebaut hatten, als Konons Tochter noch am Leben war. Während der fünfzehn Jahre seit ihrem Tod hatte sich Timoschtschuk so sehr an den Gedanken gewöhnt, dass Haus und Land nur ihm gehörten, dass er sich schon wie der alleinige Eigentümer benahm.
Iwan hatte ein Jahr zuvor geheiratet. Damals begann zwischen Vater und Sohn ein Streit. Der Sohn forderte, dass der Vater aus dem Haus ausziehen solle, da er, Iwan, alle Rechte auf das Haus besitze. Der ältere Timoschtschuk wollte aber keineswegs davon hören: Hatte er denn nicht eine Menge Arbeit in das Stück Land gesteckt, seinen Schweiß dafür vergossen? Sollte er das alles etwa jetzt seinem schwachsinnigen Sohn und dessen Weib, diesem Aas, überlassen und mit Frau und vier Kindern ohne Heim bleiben? Er würde es ihm schon ordentlich besorgen! Und der alte Konon stichelte noch dazu: »Du, Iwan, bist hier der wahre Eigentümer! Das ist das Erbe deiner Mutter!«
Ein Wort gab das andere und eines Tages endete die ganze Streiterei um das Haus mit einem wahren Wutausbruch. Michail Timoschtschuks Frau, eine jähzornige Moldawierin, stieß ihren Mann zur Seite, machte mit drei Fingern das obszöne Zeichen der »Feige«, spuckte darauf und zeigte es dem jungen Ehepaar:
»Da, für euch!«, rief sie, »teilt das zwischen euch und erstickt beide daran!«
Iwan, der nicht viel brauchte, um einen Wutanfall zu bekommen, und nicht mehr klar denken konnte, glotzte und warf sich dann mit einem dumpfen Brüllen auf seine Stiefmutter. Der Vater packte seinen Arm, riss ihn mit Gewalt zurück und schlug dem Sohn ins Gesicht. Für eine Weile blieb Iwan stumm. Aus seiner verletzten Nase tropfte Blut und er schluchzte kläglich. Mit blutverschmiertem Gesicht hob er seine Mütze vom Boden auf und schleppte sich ins Haus des Großvaters. Seine junge erschrockene Frau folgte ihm.
Am nächsten Tag reichte Iwan Timoschtschuk beim Stadtrichter Klage ein, in der er forderte, dass sein Vater, Michail Timoschtschuk, das Haus innerhalb von drei Tagen räumen und ihm, Iwan, Miete für alle fünfzehn Jahre nachzahlen solle, die er dort gewohnt hatte. Bis der Richter aber ein Urteil fällte, blieben Iwan und seine Frau bei den alten Großeltern.
3
An jenem Sonntag, dem 9. Februar, machte Konon Ribatschenko sich mit seinem gesamten Hausgesinde früh am Morgen auf nach Dubossary, um den Gottesdienst in der Kirche zu besuchen. Beim Hinausgehen aus dem Haus steckte die Großmutter Jelisaweta vier Nüsse in Mischas Jackentasche. Dann warf sie einen kurzen Blick auf den Alten, gab ihrem Enkel rasch zwei Kopeken und flüsterte:
»Da, versteck sie, der Großvater soll sie nicht sehen. Später kannst du dir davon etwas auf dem Markt kaufen!«
Konon bemerkte es aber doch.
»Aj, wie du ihn verwöhnst!«, brummte er in seinen Bart hinein.
Alles sah er, alles hörte er, der alte Konon. Er war schon in seinen Achtzigern, sah aber noch bedeutend jünger aus. Er war von mittelgroßem Wuchs, grobknochig, mit dem offenen Gesicht eines Bauern, mit einer breiten Nase und fleischigen Nasenlöchern. Mit eiserner Hand hielt er die Wirtschaft seines Hofs zusammen. Als er und die anderen Jungen in seiner Jugend sich unten beim Dnjestr zu treffen pflegten, um sich Mann gegen Mann und Viertel gegen Viertel zum Kampf aufzustellen, machte nicht nur einer Bekanntschaft mit seinen Fäusten. In seinen Adern pulsierte Kosakenblut. Sein Vater hatte sich vor vielen Jahren in dieser Gegend niedergelassen, bald nach den Napoleonischen Kriegen.
Konon hatte es mit dem Heiraten nicht eilig. Zuerst sparte er ein wenig Geld, legte Kopeke für Kopeke und Rubel für Rubel beiseite, schuftete im Steinbruch, arbeitete in einer Mühle, schnitt Tabakblätter und plagte sich in einem fremden Weinberg. Mit 34 Jahren heiratete er endlich die blutjunge Jelisaweta. Sie war fast neunzehn Jahre jünger als er und die einzige Tochter ihrer Eltern. Zart und schwach wie sie war, taugte sie nicht zur Arbeit auf einem Bauernhof. Und Arbeit gab es dort bis über beide Ohren. Das Stück Land, das Konon von einem deutschen Kolonnisten mit Jelisawetas Mitgift und seinem Ersparten gekauft hatte, forderte eine Menge Blut und Schweiß. Er allein, Konon Ribatschenko, hatte sich mit seinen dickadrigen Händen und seinen eisernen Fäusten von Sonnenaufgang bis in die Nacht geschunden und seinen Besitz aufgebaut; nun würde er es niemandem erlauben, ihn zu verschleudern, solange er noch aufrecht auf der Erde stand …
Jetzt ließ er den Hund von der Kette, versperrte das Hoftor und sammelte die Bewohner seines Hofes um sich. Von ihrer Siedlung bis zur Kirche waren es an die drei Kilometer. Bis Dubossary gingen sie alle zusammen: Konon und Jelisaweta, Mischa und Iwan mit seiner Frau Marusia. Dort trennten sie sich dann: Das junge Paar ging nach links in die griechischorthodoxe Kirche, während die Alten und Mischa weiter zur russisch-orthodoxen Sobor-Kirche gingen. Bald gesellte sich Mischas Freund Grischa Kasimirov zu ihnen …
(Am darauffolgenden Tag sollte Grischa Kasimirov erzählen, dass er und Mischa gar nie bis zur Kirche gekommen waren, sie stattdessen am Anfang der Gasse, die den alten Marktplatz vom neuen teilte, bei Ljubkas Haus stehen blieben. Ljubka war der Beiname der Jüdin Pesje Kogan; sie verkaufte billigen Kautabak und darüber hinaus auch billige Liebe. Und genau zu Ljubka hatte sich Mischa laut Grischas Aussage hineingestohlen. Grischa selber wollte nicht zu Ljubka hineingehen, er sei zum Markt weggerannt, so sagte er. Wie sich später klar herausstellte, war diese Geschichte nur belangloses Geschwätz, das die Ohren der Halbwüchsigen erregte, die so neugierig auf derartige Dinge waren. Mischas Großmutter hingegen sagte unter Eid aus, dass alle drei die Kirche gemeinsam betreten hätten: Konon, der Enkel und sie. Drinnen habe sie aber Mischa aus den Augen verloren. Und doch spielte Grischa Kasimirovs Geschwätz eine gewisse Rolle in den folgenden Geschehnissen.)
An jenem Sonntag feierte man nach den Morgengebeten auch den Nachmittagsgottesdienst. In der Pause zwischen dem ersten und zweiten Gebet strömten die Gläubigen hinaus in den Kirchhof. Man stand in kleinen Gruppen zusammen und tauschte untereinander die letzten Neuigkeiten aus. Einige schafften es sogar, schnell zum Marktplatz zu laufen, der nicht weit von der Kirche lag, und etwas einzukaufen, sich nach Preisen zu erkundigen. Die tagtäglichen Sorgen ließen den Menschen selbst in der kurzen Pause zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen nicht in Ruhe: Gott erhielt seines und der Mensch auch seines. Und die Kinder wiederum hatten »ihres« im Sinn. Sobald die Morgengebete beendet waren, rannten sie schon hinaus in die Freiheit und alle zusammen hinunter zum Fluss zum Eislaufen.
Von der russisch-orthodoxen Kirche war es nur ein Katzensprung zum Dnjestr. Man gelangte dorthin entweder entlang des Kanals, durch den die Abwässer der Stadt zum Fluss flossen, oder durch die Paromer Gasse, die von den Obsthainen bis zur Anlegestelle verlief.
Im Frühling blühten hier die Obstgärten ganz prächtig – jeder Baum hatte seine eigenen Blüten und seinen besonderen Duft. Im Herbst begannen die Hausfrauen ab Oktober mit dem Einkochen von Pflaumen-, Apfel- und Marillenmarmelade – direkt dort im Obsthain. Ein Feuer wurde angeheizt und man stand von in der Früh bis in die Nacht neben den großen Kupferpfannen mit den langen hölzernen Kochlöffeln in der Hand und rührte ununterbrochen um. Der Rauch biss und trieb den Frauen die Tränen in die Augen. Aber sie hielten ihre Kochlöffel fest in den Händen – man stand und rührte weiter, die Marmelade durfte, Gott behüte, nicht in den Pfannen anbrennen.
Jetzt, im Winter, war es hier einsam und leer. Nur hier und da zog eine Rauchfahne von den Wächterhäuschen zum bewölkten Himmel hinauf.
Mischa Ribatschenko lief mit einigen Kameraden durch die Paromer Gasse zum zugefrorenen Fluss hinunter. Dort verteilten sie sich auf dem Eis, der eine schlitterte gleich in Ufernähe, die Mutigeren wagten sich weiter hinaus, andere wollten überhaupt nicht eislaufen, sondern standen nur da und sahen aus der Entfernung zu, wie die Jungen spielten.
Mischa ging in der Nähe der Anlegestelle mit seinem besten Freund Stepan Grinko, genannt Stiopka, schlittern. Sie hatten sich im Kirchhof getroffen und waren mit den anderen Jungen zum Fluss hinuntergelaufen.
Menschen auf Schlitten und zu Fuß zogen von einem Ufer zum anderen, von Dubossary nach Ustia und von Ustia nach Dubossary. Als die Kirchenglocken wieder zum Gebet riefen, begriff Stepan, dass es Zeit war, umzukehren.
»Komm, Mischa, ich habe dem Vater versprochen, nicht zu lange wegzubleiben.«
»Wo läufst du hin?«, versuchte Mischa seinen Freund zu überreden, »erst jetzt ist es doch hier lustig geworden. Alle Jungs sind schon weg. Keiner schubst mehr oder stört dich …«
»Nein, Mischa, ich muss gehen!«
»Dann geh allein, ich will noch ein wenig auf dem Eis rutschen.«
Stepan Grinko lief zum Ufer und Mischa blieb beim Anlegeplatz …
In den Verhörprotokollen war zu lesen:
Stepan Grinko, geboren 1891. Nach den Angaben seines Vaters und anderer Zeugen ist er ein ruhiger bescheidener Knabe, aufrichtig und nicht lasterhaft. Laut seiner beglaubigten Aussage wurde Michail Ribatschenko von ihm das letzte Mal am 9. Februar gegen zehn Uhr morgens auf dem Fluss Dnjestr, in der Nähe des Paromer Anlegeplatzes gesehen.
Und weiter hieß es:
Als sie sich von der Kirche zum Fluss hinunterbegaben – so wiederholte Stepan einige Male –, habe Mischa ihm die vier Nüsse gezeigt, die die Großmutter ihm vor seinem Weggehen von zu Haus gegeben hatte.
4
Zu Mittag aß man ohne Mischa. Konon war wütend:
»Glaubt, dass er schon erwachsen ist, der Rotzbengel! Der fasst heute noch Prügel von mir aus!«
Er drehte sich zu Jelisaweta um, die am Ofen hantierte, und sagte vorwurfsvoll zu ihr:
»Das ist allein deine Schuld! Du hast ihn viel zu sehr verwöhnt!« Und er plärrte, indem er die Alte nachmachte: »Mischenka, mein lieber Mischenka!«
Jelisaweta schwieg und stellte wortlos den Topf mit Kascha10 auf den Tisch. Wie üblich, hörte sie zu und schluckte alles hinunter. Es war eigenartig: Obwohl sie schon so lange zusammenlebten, fühlte sie bis heute manchmal die Furcht, die sie als Mädchen verspürt hatte, als Konon sie aus ihrem Elternhaus wegführte, weg aus ihrem Nest. Und obwohl man sie gut behandelte – die erste Zeit wohnten sie noch mit den Schwiegereltern zusammen –, fühlte sie sich dort trotzdem einsam. Wie oft wachte sie mitten in der Nacht auf, das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie verstand nicht, wo sie war. Wer war der Mann, der neben ihr im Bett lag? Danach bekreuzigte sie sich immer, vergrub ihr Gesicht im Kissen und brach in lautloses Weinen aus.
Ihr erstes Kind verlor sie. Dann bekam sie Katherina, Iwans Mutter, ein dürres, kränkliches Kind, das Konon nicht liebte. Ständig brummte er: »Die kommt nach dir! Einen Kosaken brauche ich im Haus, einen Kosaken!« Nach zwei Jahren gebar sie ihm einen Kosaken und sie nannten ihn Wassili. Weitere Kinder wollte Gott ihr nicht schenken. Selbst diese beiden hatte sie unter großen Schwierigkeiten geboren, besonders bei Wassili wäre sie fast gestorben. Wer hätte je ahnen können, dass ausgerechnet sie, die schwache Jelisaweta, ihre beiden Kinder überleben würde. »Ach, Gott im Himmel, unser Vater, ist das denn gerecht?«
Konon schob seine Schüssel mit Kascha zur Seite. Er hatte keinen rechten Appetit. Eine seltsame Last legte sich plötzlich auf sein Herz. Nach dem Tod seines Sohnes war Mischa zu seinem einzigen Trost geworden. Nur für ihn lebte er und trug die schweren Mühen seiner Landwirtschaft. Alles würde er ihm übergeben, was er im Laufe vieler Jahre mit seinen eisernen Fäusten zusammengetragen hatte. In Michail sah er den künftigen Herrn des Gehöftes. Wenn er nur genug Kraft hatte, ihn auf seine Füße zu stellen! Dass Jelisaweta ihrem Enkel gegenüber so nachsichtig war, bedeutete nichts, eine Großmutter war nun mal eine Großmutter. Er selber aber, Konon, erzog Michail mit Strenge. Wer, wenn nicht er, der Großvater, sollte schließlich dem Enkel das Gefühl einpflanzen, ein echter Hofbesitzer zu sein?!
Die Schwere in seinem Herzen verflog nicht, im Gegenteil, sie wurde immer drückender. Konon war ruhelos, schließlich legte er sich auf den kleinen Taptschan11 und versuchte, ein wenig zu dösen. Eine dumpfe Traurigkeit umhüllte sein Herz. Er ging daran, Mischas Netze auszubessern, doch das Garn riss immer wieder ab. »Andererseits«, dachte er, »warum ärgere ich mich derart? Von dem Geld, das Jelisaweta ihm in der Früh gegeben hat, hat Mischa sich wahrscheinlich ein paar Kringel gekauft und treibt sich jetzt irgendwo mit den anderen Jungen herum. Und vielleicht ist ihm eingefallen, seine Mutter zu besuchen?« Konon erinnerte sich, dass so etwas schon einmal mit Mischa vorgekommen war. Der Alte hatte ihm damals einen Hieb über den Nacken versetzt, natürlich nicht ohne Grund. Mischa war schwer beleidigt, sprach mit niemandem und rannte weg zu seiner Mutter nach Grigoriopol. Es war nur gut, dass Sofia an jenem Tag zu Hause war und Konon gleich Bescheid gab.
»Soll er sich nur nach Hause trauen, der Rotzbengel!«
Konon sagte das laut, obwohl Jelisaweta schon vorher hinausgegangen war, um nach den Schweinen zu sehen. Nein, noch länger tatenlos herumsitzen konnte er nicht! Er zog seinen Pelzmantel an, schnappte die Pelzmütze und ging in den Hof hinaus.
5
Bis spät in die Nacht hinein streifte Konon durch die Siedlung. Er ging in jeden Hof und ließ kein einziges Haus aus. Er befragte die Jungen, ob nicht vielleicht einer von ihnen Mischa gesehen oder etwas über ihn gehört habe. Stepan Grinko erzählte dem Alten, dass er zusammen mit Mischa auf dem Fluss eislaufen war, nicht weit entfernt von der Anlegestelle. Das war aber noch am Morgen gewesen, danach hatte er Mischa nicht mehr gesehen.
»Und Michail hat dir nicht gesagt, ob er vielleicht heute seine Mutter in Grigoriopol besuchen wollte?«
Stepan schüttelte verneinend den Kopf:
»Davon weiß ich nichts.«
Als Konon nach Hause zurückkehrte, erzählte er Jelisaweta, dass ein Junge zufällig gehört habe, wie Mischa beim Spielen sagte: »Ich habe meine Mutter schon so lange nicht mehr gesehen. Es wäre keine schlechte Idee, bei ihr vorbeizuschauen.«
»So hat mir der Junge das erzählt«, sagte Konon wie zur eigenen Beruhigung.
»Und wer ist dieser Junge?«, fragte die Alte leise. Ihre Stimme klang zögerlich.
»Wer, wer?«, fuhr Konon unvermittelt zornig auf. »Der Teufel soll ihn kennen! Genauso ein Nichtsnutz wie dein Mischenka! Er soll nur auftauchen, der Bastard!«
Er konnte kaum abwarten, bis es draußen heller wurde, und klopfte dann bei Iwan an. Der wohnte inzwischen mit seiner Frau in der anderen Hälfte des Hauses. Früher hatten dort Wassili und Sofia gelebt. Nach Iwans Hochzeit schenkte Konon seinem Sohn die zwei Zimmer und baute eine eigene Tür ein.
Der Alte klopfte etliche Male an das Fenster, doch niemand antwortete. »Was soll's, Iwan ist ein tauber Klotz«, brummte Konon. »Aber seine dumme Kuh hört doch einwandfrei.«
Dabei war er selber, Konon, es gewesen, der seinem älteren Enkel diese »einmalige Partie« Marusia ausgesucht hatte. Er versprach ihrem Vater Filimon Ganzedarov, wenn jener seine Tochter mit Iwan verheiratete, würde er, Konon, das junge Paar mit einem Haus und mit Land versorgen.
»Wo findest du noch so einen Bräutigam für dein Töchterchen?«, redete er ihm bei einem Liter Wein ein. »Zwischen uns gesagt, Filimon, die zwei verdienen einander. Eine Ehe, wie vom Himmel beschert!« Filimon Ganzedarov musste nicht lange überredet werden. Er war ein armer Mann und noch dazu ein Trunkenbold und hätte seiner Tochter sowieso keine Mitgift mitgeben können. Wo sollte er eine Mitgift hernehmen, wenn er keinen Groschen in seinen löchrigen Taschen hatte? Obwohl er ein guter Böttcher war und auf sein Aussehen achtete, erinnerte er an einen gerupften Hahn.
»Du, Konon Wassiliewitsch, denk nur nicht …« Seine Zunge verhaspelte sich im Mund. »Wir haben zwar keinen berühmten Stammbaum, aber meine Fässer stehen beim Bürgermeister im Keller und vielleicht bei noch wichtigeren Leuten … Warum sage ich das? Ich bin doch ihr Vater. Alles hab ich mir doch für sie vom Mund abgespart … Mit einem Wort, hundert Rubel auf die Hand und die Abmachung gilt!«
Bald stellte sich heraus, dass Marusia gar kein solches Rindvieh war, wie Konon sich gedacht hatte. Gleich nach der Hochzeit, als der Streit wegen dem Haus entbrannte, begann sie sich zu beschweren: Entweder man gab ihr das, was man ihr zugesagt hatte, oder sie würde Iwan verlassen. Es war ein Hin und Her – Konon Ribatschenko wollte auch nicht gern seine schmutzige Wäsche außerhalb des Hauses waschen –, so musste er beim Notar einen Wechsel über dreihundert Rubel auf Marusias Namen ausstellen.
Wieder klopfte der Alte an das Fenster und endlich zeigte sich Iwans verschlafenes Gesicht. »Gott sei Dank«, brummte Konon, »hat sich endlich vom Busen seiner Frau losgerissen!« Er deutete Iwan mit den Händen, dass jener die Tür aufsperren solle.
Iwan stand dem Großvater gegenüber in seiner Unterwäsche, barfuß, gähnte und kratzte sich dabei seinen Strubbelkopf.
»Zieh dich an!«, rief der Alte, »wir müssen nach Grigoriopol zu Sofia, vielleicht ist Michail bei ihr!«
Iwan hörte sofort auf zu gähnen. Sein Gesicht legte sich in noch mehr Falten, er begann mit den Händen zu fuchteln und zu knurren, wie es seine Gewohnheit war. Konon unterbrach ihn aber sogleich:
»Red nicht herum! Tu, was man dir sagt!«
Iwan hasste Mischa, einerseits, weil er der Liebling der Großeltern war, andererseits, weil Mischa selber ihn ständig provozierte und als »tauber Klotz« aufzog und ihn verspottete. Dabei konnte Mischa sicher sein, dass der kranke Iwan ihn nicht mit einem Finger anrühren würde, denn jener hatte Angst vor ihm, genauer gesagt, nicht vor ihm, sondern vor dem Großvater, dem Mischa so teuer war wie ein Kreuz um den Hals. Einmal, nach Iwans Hochzeit, fing Mischa irgendwo eine Maus und warf sie durch das Fenster in den Raum seines Cousins. Das Mäuschen landete ausgerechnet genau auf dem Bett, wo das junge Paar lag. Marusia erschrak natürlich und begann zu zetern. Einige Augenblicke später kam Iwan mit einer Axt in der Hand angelaufen und verfolgte Mischa über den Hof. Hätte Konon ihn nicht aufgehalten, hätte er Mischa in Stücke gehackt!
Als der Alte ihn letzte Nacht wegen Mischa befragt hatte, hatte Iwan nur böse gelächelt und geknurrt:
»Ich bin doch nicht sein Hüter!«12
Jetzt, in der Früh, zog er sich trotzdem an und machte sich auf den Weg nach Grigoriopol.
6
Die Stadt Dubossary, die auf dem linken Ufer des Dnjestr liegt, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ziemlich große Stadt mit über 12.000 Einwohnern. Laut einer Statistik aus jener Zeit wohnten in der Stadt an die 7.000 Christen, der Rest waren Juden. Dubossary gehörte zum Distrikt von Tiraspol13 im Gouvernement Cherson14. Das Leben in der Stadt war wie zweigeteilt: Auf einer Seite die Christen mit ihrem Gott, mit ihrer Lebensweise, mit ihrem eigenen Friedhof; auf der anderen Seite die Juden, auch mit ihrem eigenen Gott, mit ihrer Lebensweise und ihrem eigenen Friedhof. Aber die gemeinsame Existenz auf einem gemeinsamen Flecken Erde, unter einem Himmel, die tagtägliche Sorge um ein Stück Brot, das gegenseitige »Reiben« der zwei Lager aneinander – das alles verband die zwei Seiten auch.
Eine besondere Rolle im Leben der Stadt spielte der Markt. Große Jahrmärkte gab es in Dubossary nicht, aber jeden Montag kamen dort alle Bauern der umliegenden Dörfer zusammen. Es muss auch erwähnt werden, dass Dubossary über zwei Märkte verfügte – den alten und den neuen. Der Beamte Roman Trofimow von der örtlichen Stadtverwaltung hinterließ eine sehr interessante Bemerkung in seinem Tagebuch:
In der Stadt gibt es zwei Märkte, auf denen die Bewohner fast ihre ganze Zeit verbringen, wobei sie einen besonderen Charakter und Kolorit von Verbissenheit und Zynismus erwerben. Ihre Grobheit und ihr Unwissen lassen die Mehrheit von ihnen auf das niedrigste intellektuelle und moralische Niveau herabsinken. Die Juden schämen sich nicht, die Christen »Gojim« zu nennen, und die Christen nennen die Juden »verfluchte Juden«. Aller möglicher Klatsch, Aberglaube, Zauberei, Wahrsagerei, Kartenlegen fallen hier auf einen fruchtbaren Boden …
Schon am nächsten Tag verbreitete sich in der ganzen Stadt die Neuigkeit, dass Konon Ribatschenkos Enkel Michail verschwunden war. Wie große grüne Fliegen trugen sich alle möglichen Gerüchte und Klatschgeschichten von einem Ende Dubossarys zum anderen und natürlich kamen sie alle aus dem Markt geflogen, wo sie ihr Nest hatten.
Frauen kamen in kleinen Gruppen zusammen, flüsterten sich die letzten Neuigkeiten zu, zerlegten und zerpflückten sie genüsslich, und diese klangen jedes Mal noch wunderlicher und geheimnisvoller und fesselten so ihre Zuhörer. Grischa Kasimirovs Geschwafel, dass Mischa auf dem Weg zur Kirche noch bei der guten Ljubka vorbeigeschaut habe, wurde bald aufgenommen und dahingehend verdreht, dass Mischa aus Ljubkas Haus gar nicht mehr herausgekommen sei. Zu dieser Geschichte wurde noch eine weitere dazu geflochten, genauer gesagt, ein Traum und nicht nur einfach ein Traum, sondern gar eine Vision: Mischa Ribatschenko lag gefesselt in einem finsteren Keller und bat denselben Grischa Kasimirov, jener solle zu Mischas Großeltern laufen und ihnen sagen, dass man ihn dort suchen solle, wo die Jungen ständig Tabak kauften. »Noch bin ich am Leben«, klagte Mischa wahrscheinlich seinem Freund, »aber heute Nacht wollen mich die verfluchten Juden peinigen und foltern …«
Die Bewandertste von allen war in dieser Angelegenheit die Klatschbase Daria. Ganze Tage verbrachte sie auf dem alten Marktplatz. Von Kindheit an hatte sie den Marktklatsch in sich aufgesogen. Die Juden betrachteten sie als »Schabbes-Goje«15. Außerdem arbeitete sie öfter für sie als Tagelöhnerin. Da sie sich so viel unter den Juden aufhielt, hatte sie gelernt, deren Sprache ein wenig zu sprechen und zu verstehen.
Auf einem Tuch hatte sie ein paar Knoblauchknollen, drei, vier Karotten und etliche Petersilienwurzeln vor sich ausgelegt und ihr Mund war ununterbrochen offen. Die neugierigen Frauen drängten sich um Daria, umringten sie von allen Seiten, als würde sie mit einem seltenen Heilmittel handeln, das vor Not und Tod rettet.
Sie war so fest in ihren großen groben Schal eingehüllt, dass sie ihren Kopf nicht mehr drehen konnte. Nur ihre schmalen scharfen Äuglein huschten hin und her, bohrten sich für einen Moment in ein Gesicht, da in ein anderes, ein drittes: Das erste war verwundert von dem eben erst Gehörten, das zweite – ein erschrockenes, das dritte war gänzlich verloren.
»Gestern ganz früh am Morgen«, erzählte Daria, »komme ich auf den Markt und stell mich mit meinem bisschen Ware hin, neben den Stand von Meir Schindl. Genau in der Zeit, als es in der Sobor-Kirche zum Morgengebet geläutet hat, sehe ich, wie zu Meir sein Neffe gelaufen kommt – er heißt Eisik, ihr kennt ihn sicher, so ein langer schmaler Junge –, und er sagt zum Onkel: ›Jetzt ist es so weit. Sedu Amalkume!‹16! Das heißt in deren Sprache: ›Wir haben einen Märtyrer!‹ Er ist im Gesicht weiß wie die Wand. Seine Augen irren nach allen Seiten, die pure Angst steht in ihnen. Ich tue natürlich, als ob ich nichts hörte, sein Onkel weiß doch sehr gut, dass ich ihre Sprache verstehe. Der unterbricht sofort seinen Neffen: ›Still, Eisik, die Goje versteht doch alles!‹ Und da ist sein Neffe weggelaufen. Damals habe ich nicht gleich verstanden, über welche ›Amalkume‹ die zwei reden, aber später, als ich gehört habe, dass der Enkel des alten Ribatschenko verschwunden ist, gab es mir plötzlich einen Stich im Herzen und mir wurde richtig schwarz vor den Augen …«
»Wozu brauchen sie denn den … Wie heißt er noch mal?«
»Amalkume?«
»Ja, ja.«
Daria rückte den Schal zur Seite, der sich vor ihrem knochigen Kinn verknotet hatte. »Was heißt: wozu?«, und sie klatschte in die Hände. »Dumme Frage! Wie kann man das denn nicht wissen!«
Die Frauen waren noch stärker fasziniert und begannen sie zu bitten:
»Erzähle, Daria! Wie sollen wir es denn wissen? Du bewegst dich doch mitten unter ihnen!«
Und Daria begann die ganze Sache in allen Einzelheiten zu erklären:
»Hört zu, Frauen: Zu ihrem Pessachfest, wie ihr wisst, backen sie solche flachen Brote – Matzes17. Sie machen zwei Sorten davon – eine Sorte für sich und eine andere, spezielle Sorte, die sie selber »Schmure-Matze«18 nennen, backen sie für den Teufel und da mischen sie den Teig nicht mit Wasser, sondern mit unserem christlichen Blut!«
Schnell bekreuzigten sich die Frauen gleichzeitig. Daria selber schwieg. Sie bedeckte ihren Mund mit der Hand, als hätte sie Angst, dass das, was sie weiter erzählen wollte, ihr noch, Gott behüte, vorzeitig entschlüpfen könnte.
»Hört weiter: In der ersten Nacht von Pessach sitzt die ganze Familie von Klein bis Groß beim Tisch, und sie stellen einen großen Teller in die Mitte und legen darauf eine Zitrone, in einen Fetzen gewickelt, den Hals eines Truthahns, ein gekochtes Ei, auf dem ein Zeichen mit Asche gemalt ist und natürlich diese ›Schmure-Matze‹. Für wen, glaubt ihr, bereiten sie das alles zu? Für ihn natürlich, für den Teufel …«
»Wie kommt er denn zu ihnen?«, unterbrach sie eine junge Frau mit einem verstörten Gesicht, »durch den Kamin?«
»Wieso denn plötzlich durch den Kamin? Nein, durch die Tür natürlich! Sie lassen alle Türen im Haus offen und erst danach fangen sie an zu beten.«
»Und der Teufel zusammen mit ihnen?«
»Ja, freilich!«
»Hast du ihn womöglich selber gesehen, Daria?«
»Wie kann ich ihn denn sehen? Ich bin doch, Gott sei gelobt, eine rechtgläubige Christin!«, antwortete Daria mit einem schelmischen Lächeln. »Den leeren Teller habe ich aber ja gesehen. Kein Brösel ist auf ihm übrig geblieben. Alles hat der Teufel aufgefressen!«
Die Frauen bekreuzigten sich wieder und spuckten dreimal aus: »Weiche, Unseliger!«
Darias Wissen hatte ihnen die Augen geöffnet:
»Jetzt fange ich schon an, etwas zu verstehen!«
»Was gibt es da zu verstehen: Sie haben Ribatschenkos Enkel entführt!«
»Ganz sicher ist es so!«
Die Stadt kochte. Die Einwohner sahen sich an und hörten einer dem anderen zu. Einfache alltägliche Dinge, auf die man früher nicht achtgegeben hatte, bekamen plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Mütter hatten Angst, ihre Kinder zum Spielen hinauszulassen, Frauen fürchteten sich, spätabends heimzugehen. Die Männer knirschten mit den Zähnen und ballten die Fäuste. Sogar die Hunde in der Stadt begannen, in der Nacht anders zu bellen – böser und verbitterter, mit endlosem Gejaule, als beweinten sie ein schuldloses Opfer.
Die Gerüchte mehrten sich und verbreiteten sich rasch über die umliegenden Dörfer und Städte. Jedes Mal kam noch ein neues Gerücht dazu:
»Habt ihr schon gehört? Meine Cousine Akulina hat mir erzählt, dass sie selber von Stefanida gehört hat, die auf dem Neuen Markt mit eingelegtem Gemüse handelt, dass Praskovia Lupus Tochter vor Mordke dem Schächter19 geflohen ist, wo sie als Dienstmädchen gearbeitet hat. Eines Nachts, so erzählte das Mädchen, das in einem Zimmer mit Mordkes gelähmter Frau schlief, wachte sie auf einmal durch Geflüster auf. Was ist geschehen? Der Schächter steht neben dem Bett seiner Frau, die Ärmel hochgekrempelt, in der Hand hält er sein Messer und die Frau fragt ihn: ›Nu, was ist? Habt ihr ihn schon erledigt?‹ – ›Noch nicht‹, antwortet ihr der Mann, ›er verspricht, hundert Rubel zu zahlen, wenn wir nur von ihm ablassen!‹ Danach geht der Schächter aus dem Zimmer, kommt aber bald wieder zurück, ohne Messer, aber sehr zufrieden und sagt zu seiner Frau: ›Fertig! Erledigt!‹ Als sie diese Wörter hörte, hat das Mädchen schnell verstanden, von wem da die Rede gewesen war und wen man da ›erledigt‹ hatte. Praskovias Töchterchen konnte kaum bis zum Morgen warten und ist dann nach Hause geflohen.«
Daria die Klatschbase verlor ebenfalls keine Zeit. Dass sie ein wenig Jiddisch konnte, kam ihr jetzt, mehr denn je, sehr zunutze.