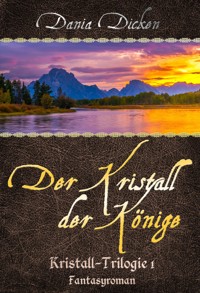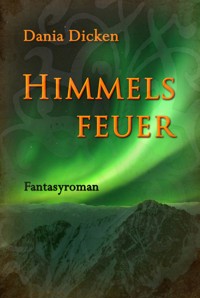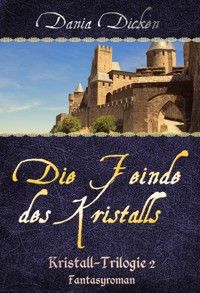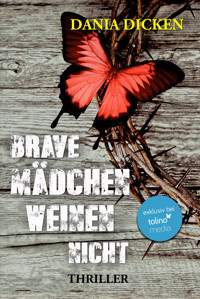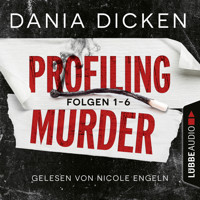4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Amerika in naher Zukunft. Rassismus, eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit und totale Überwachung kennzeichnen den Alltag seit dem letzten Regierungswechsel. Adriana Cabello, Dozentin für Sozialpsychologie und Latina, spürt jeden Tag aufs Neue, dass nur ihre Ehe mit dem weißen Regierungsmitarbeiter Eric sie vor dem Abstieg in die rote Klasse bewahrt, deren Angehörige deutlich weniger Rechte haben. Auch für ihren autistischen Sohn Anthony wird die Lage mit jedem Tag schwieriger. Nach einem Bombenanschlag einer Rebellengruppe namens Freedom Fighters ist plötzlich nichts mehr, wie es war und Adriana muss um ihre und Anthonys Freiheit kämpfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dania Dicken
Als die Freiheit starb
Resignation
Dystopischer Roman
Niemals hätten wir es für möglich gehalten – und doch sind wir jetzt mittendrin.
Prolog
Ich weiß nicht mehr, welcher der Tag war, an dem Freiheit eine Option wurde. Es kam schleichend, wenn auch nicht unbemerkt. Aber denjenigen, die davor warnten, wollte entweder niemand zuhören – oder man brachte sie zum Schweigen. Manchmal reichte die bloße Androhung, in anderen Fällen die tatsächliche Ausübung von Gewalt.
Rückblickend hätten wir viel früher kämpfen, uns zur Wehr setzen sollen. Das Undenkbare für möglich halten und nicht versuchen, die Regeln zu befolgen, obwohl der Gegner von Anfang an vorhatte, zu betrügen.
So kann man nur verlieren.
Kapitel 1
Mein Blick verlor sich zwischen den kahlen Ästen der Bäume, die den winterlichen Healy Lawn säumten. Im Sommer vibrierte der Park vor Leben, wenn die Studenten auf dem Rasen in der Sonne saßen. Im Januar war er wie ausgestorben. Der bleiern graue Himmel tat sein Übriges, den Park wenig einladend zu machen.
„Wir müssen uns an die Vorgaben halten. Es gibt bestimmte Fragestellungen, die für die Verantwortlichen interessant sind, und andere ...“ Fachbereichsleiter William Donaghue brachte den Satz nicht zu Ende, aber wir verstanden ihn auch so.
Forschung und Wissenschaft waren nicht mehr frei. Sie dienten jetzt politischen Interessen. In gewisser Weise hatten sie das mancherorts vielleicht auch früher schon getan, aber inzwischen machte niemand mehr einen Hehl daraus. Unser Team vom Fachbereich Sozialpsychologie hätte Studien zu vielen interessanten Fragestellungen durchführen können – Auswirkungen des Klassensystems auf den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt oder interpersonelle Beziehungen zum Beispiel. Stattdessen sollten wir jetzt untersuchen, welche positiven Effekte die Stärkung des traditionellen Rollenbildes in der familiären Gemeinschaft hatte. Die Formulierung war bewusst gewählt, nach negativen Effekten wurde explizit nicht gefragt.
Mit meinem Job, wie ich ihn anfangs gemacht habe, hatte das nicht mehr besonders viel gemein. Ergebnisoffenheit war nicht mehr gewünscht. Wir sollten jetzt Ergebnisse produzieren, die der politischen Linie dienten. Es war frustrierend.
William warf einen neugierigen Blick in die Runde, aber niemand antwortete. Dazu gab es nichts zu sagen. Nachdem er auf die Uhr geschaut hatte, holte er tief Luft und beendete die Runde. Mir war es ganz recht, denn ich musste ohnehin bald los. Ich griff nach meinem Tablet und meiner Tasse und verließ den Raum. Das Gemurmel meiner Kollegen hinter mir wurde leiser, als ich auf den Flur hinaustrat. Zuerst streife mein Blick den Putzwagen, der gleich vor der hohen Fensterfront stand, dann bemerkte ich Molly und blieb stehen.
Molly Perkins hatte ihre langen Rastazöpfe zu einem dicken Zopf zusammengefasst, damit sie nicht beim Putzen störten. Mit gleichmäßigen Bewegungen wischte sie den Boden. An der Brusttasche ihres hellblauen Kittels war ihre rote Identitätskarte, kurz ID-Karte, mit einem Clip befestigt. Sie war rot, was Molly einzig und allein ihrer Hautfarbe zu verdanken hatte.
„Hey“, sagte ich und Molly blickte auf. Ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen.
„Hey. Meeting erledigt?“
Ich antwortete mit einem Nicken. „Besonders aufregend war es nicht.“
„Bestimmt aufregender als das hier.“ Demonstrativ hob sie den Wischmopp in die Luft.
Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte. Sie hatte Recht. Meine Äußerung war undurchdacht gewesen. Bis vor knapp drei Jahren hatte Molly als wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem Team gearbeitet – eine fleißige, engagierte Absolventin, die mit dem Gedanken gespielt hatte, noch einen Doktortitel zu machen. Damit war von jetzt auf gleich Schluss gewesen, weil sie schwarz war. Mehr als einfache Arbeiten waren ihr nicht mehr gestattet – man hatte ihr die Befähigung abgesprochen. Ich fragte mich jedes Mal, wie es sich für sie anfühlen musste, durch das Büro zu putzen, in dem sie nicht mehr arbeiten durfte. Gefragt hatte ich noch nie.
„Wie geht es euch? Was macht Eric? Wie kommt Anthony in der Schule zurecht?“, fragte Molly in das lärmende Schweigen hinein und fuhr damit fort, den Boden feucht zu wischen.
„Alles wie immer“, erwiderte ich knapp. „Eric hat genug Arbeit … und Anthony gibt sich alle Mühe, aber es ist schwierig für ihn.“
„Kann ich mir vorstellen. Vielleicht solltet ihr ihm doch Hilfe besorgen.“
„Eric tut sich so schwer damit“, sagte ich entschuldigend.
„Womit? Seinen eigenen Sohn bestmöglich zu fördern? Hat er Vorurteile?“
„Nein, das denke ich nicht. Er liebt Anthony über alles. Ich glaube, er hat nur Angst.“
Molly hielt in ihrer Bewegung inne. „Er muss es ja wissen.“
Unbestimmt zuckte ich mit den Schultern. „Ich glaube, ich rede noch mal mit ihm. Ich weiß nicht, was ihn zurückhält.“
„Und das, wo ihr doch sogar Anspruch auf kostenfreie medizinische Versorgung habt.“
Ich konnte den unterschwelligen Zorn in ihrer Stimme hören und verstand ihn so gut. „Einer der Gründe, warum er seinen Job macht.“
„Ja, sicher. Mir ist gleich ein bisschen wohler bei dem Gedanken, dass Eric mich beobachtet anstatt irgendsoein linientreuer Genosse, dem ich nicht im Dunkeln begegnet möchte.“ Sie sagte das nicht ohne einen gewissen Spott in der Stimme.
Ich holte tief Luft und überlegte, was ich antworten sollte. Mir fiel nichts ein. Nein, mir gefiel es auch nicht, dass mein Mann bei der Security Agency of the Republic arbeitete und damit einer derjenigen war, die das Land bis ins Kleinste überwachten. Aber ich konnte damit leben, weil ich wusste, wofür er es tat.
„Ach, vergiss es. Hab keinen guten Tag heute“, murmelte Molly, als ich nichts sagte.
„Was ist los?“
„Ach, nichts … hatte nur wieder ein bisschen Stress mit Darren. Er hat keine Lust, die Kinder am Wochenende zu nehmen.“
Betreten verzog ich das Gesicht. Molly hatte in ihrem Leben viel Pech gehabt, was aber nichts daran änderte, dass sie ein positiver Mensch war. Als ich sie kennengelernt hatte, war sie noch mit Darren zusammen und hat neben ihrem Studium noch einen Nebenjob gemacht, um sich das Studium und die Betreuung für ihren kleinen Sohn James überhaupt leisten zu können. Kurz darauf war sie erneut schwanger geworden, ohne es zu wollen. Das Kind hatte sie behalten, jedoch nicht den gewalttätigen Vater. Der hatte anfangs nur sporadisch Unterhalt gezahlt und sah seine Kinder nicht besonders regelmäßig. Doch entgegen aller Widerstände war Molly eine tolle Mutter, die viel Unterstützung von ihrer älteren Schwester erhielt und durchaus fähig gewesen wäre, eine akademische Karriere anzustreben, wenn …
Wenn sich nicht vor vier Jahren unser ganzes Leben geändert hätte.
Es war nicht über Nacht passiert, sondern Schritt für Schritt. Sonst hätte es auch nicht funktioniert. So war es eher mit dem Frosch zu vergleichen, der im anfänglich kalten Wasser sitzt und nicht merkt, wie es immer heißer wird, bis er schließlich kocht.
Die Tage, an denen ich mich fühlte wie dieser Frosch, wurden immer häufiger.
Für einen Moment ging mein Blick ins Nichts, bevor ich mir einen Ruck gab und Molly wieder ansah. Ich habe ihre Abschlussarbeit betreut und darüber sind wir Freunde geworden. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, denn unsere Söhne waren beide sieben Jahre alt und wir hatten viele ähnliche Interessen und Einstellungen.
„Wie stehen die Kinder dazu?“, fragte ich, was Molly nur ein Schulterzucken entlockte.
„Sagen wir so: Sie sind Enttäuschungen gewöhnt.“
„Also wollen sie gar keinen Umgang mit ihrem Vater?“
„Jamie schon, Amanda nicht unbedingt. Ich würde es ja gänzlich lassen, aber wenn ich ihm keinen Umgang ermögliche, muss er keinen Unterhalt zahlen und wenigstens das klappt ja seit einer Weile mal ganz gut.“
Immerhin etwas Positives. Zahlungsunwillige Väter waren inzwischen eine Rarität geworden, weil sie kaum noch untertauchen konnten und empfindliche Strafen drohten, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommen wollten. Die meisten zahlten dann doch lieber Unterhalt, um nicht als Zwangsarbeiter zum Bau der Grenzmauer nach Kanada geschickt zu werden. Aktuell gab es dort einen Kälteeinbruch, hatte ich gehört. Gearbeitet wurde bestimmt trotzdem, wenn ich mir überlegte, in welcher Geschwindigkeit schon zwei Drittel der Mauer fertiggestellt worden waren.
Als hinter mir die Tür geöffnet wurde, fuhr Molly eilig mit dem Wischen fort. Die Kollegen grüßten sie freundlich beim Vorbeigehen, was sie wortkarg erwiderte. Ich war ziemlich sicher, dass sie sich schämte, jetzt für ihre früheren Kollegen putzen zu müssen.
„Also dann“, sagte ich mit Blick auf die Uhr. „Ich muss langsam los. Wir sollten uns die Tage mal treffen.“
„Gute Idee“, sagte Molly, die mir den Aufbruch nicht übel nahm. Wir lächelten einander zu, bevor ich in meinem Büro verschwand und meine Sachen packte. Wenn jetzt nichts mehr schief ging, war ich pünktlich an Anthonys Schule.
Ich versuchte, ihn abzuholen, wann immer es mir möglich war. Er hätte mit dem Schulbus fahren können, aber nach einem ganzen Schultag war ihm das meist zu viel. Eigentlich war der komplette Schultag zu viel für ihn – zu laut, zu viele soziale Anforderungen, zu viele Erwartungen. Ich vermutete schon lange, dass mein Sohn im Autismusspektrum lag, aber offiziell diagnostiziert worden war es bislang nicht.
Während ich in mein Auto stieg, wurde mir bewusst, dass das ein Privileg war, das Molly gar nicht mehr genoss. Inhaber roter und schwarzer ID-Karten durften kein Auto besitzen. Sonst wäre es wohl auch schwierig geworden, ihre Mobilität so einzuschränken, wie man es getan hatte. Molly durfte sich nur noch in Washington bewegen, weil sie dort lebte und arbeitete. Inhaber schwarzer ID-Karten durften sogar nur Wege zwischen ihrer Wohn- und Arbeitsstätte und anderen festgelegten Orten wie Supermärkten zurücklegen. Das war‘s.
Während ich den Motor startete, wurde mir wieder einmal bewusst, dass ich nur deshalb eine blaue und keine rote ID-Karte hatte, weil ich mit einem Mann verheiratet war, der für die staatliche Überwachung arbeitete. Einem Weißen. Das gab mir die Freiheit, mich im ganzen Bundesstaat zu bewegen und aufgrund der Grenznähe sogar ein wenig darüber hinaus.
Ich verließ Georgetown und überquerte den Potomac über die Francis Scott Key Memorial Bridge. Wenn ich nach links schaute, konnte ich über den Dächern der Häuser die Spitze des Washington Memorial und die Rotunde des Kapitols ausmachen. Das waren mal Symbole der Freiheit gewesen.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
Weil ich früh dran war, hatte ich keine Probleme damit, nach Falls Church zu kommen. Ich traf sogar einige Minuten zu früh an Anthonys Schule ein und wartete auf dem Parkplatz hinter den Schulbussen. Meine Blicke schweiften über den Vorplatz der Schule und blieben an den Kameras hängen, die jeden Bereich abdeckten.
Eine flächendeckende Überwachungs-Infrastruktur war ohne große Vorwarnung implementiert worden, so dass Eric und seine Kollegen von der Security Agency of the Republic jederzeit alles im Blick hatten. Natürlich hatte es deshalb einen Aufschrei gegeben, aber jeder Widerstand war entweder im Keim erstickt oder gewaltsam niedergeschlagen worden. Die SAR war allgegenwärtig – durch Videoüberwachung, Überwachungsagenten oder auch durch geheime Spitzel. Man konnte nie sicher sein, ob man gerade mit einem Freund oder einem Feind sprach.
Und mein eigener Mann war einer von ihnen.
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, weil Kinder den Vorplatz fluteten. Ich versuche, meinen Sohn zwischen ihnen zu entdecken, konnte ihn aber noch nicht ausfindig machen. Eine Lehrerin versuchte, die Kinder beim Einsteigen in die Busse zu koordinieren und Ordnung ins Chaos zu bringen. Viele Kinder kamen auch auf den Parkplatz zu den Autos ihrer Eltern. Nur von Anthony keine Spur.
Ich machte mir keine Gedanken deshalb, denn ich kannte das schon. Es waren schon fast alle Busse weggefahren, als die Eingangstür der Schule erneut geöffnet wurde und Anthony in Begleitung seiner Lehrerin Mrs. Brewer herauskam. Es wirkte, als zöge die Schultasche ihn mit ihrem gesamten Gewicht zu Boden, den Kopf hielt er gesenkt.
Ich stieg aus und ging auf die beiden zu. Anthony blickte auch dann nicht auf, als ich Mrs. Brewer ansprach.
Die Lehrerin seufzte. „Heute war kein guter Tag.“
Das hatte ich mir schon gedacht. „Was ist passiert?“
„Beim Sportunterricht hatte er einen Wutanfall. Er braucht ja sowieso immer viel zu lang beim Umziehen und kam erst nicht aus der Umkleide, weil eine Spinne an der Wand über der Tür saß. Es wurde Dodgeball gespielt und als sein Team dreimal hintereinander verloren hat, hat er ganz laut geschrien und war kaum zu beruhigen. Danach war er für den restlichen Tag nicht mehr aufnahmefähig. Er war dann bei einem Sozialarbeiter.“
„Oh nein“, sagte ich mitfühlend und ging vor meinem Sohn in die Hocke. „Das war sicher sehr anstrengend, oder?“
Jetzt sah Anthony mich an und nickte. Seine Haare fielen ihm dabei fast in die Augen, weshalb mir durch den Kopf schoss, dass ich sie noch mal schneiden musste. Das tat ich jedoch nur, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden ließ, weil es jedes Mal ein großes Drama für ihn war.
Als ich wieder zu Mrs. Brewer aufblickte, bemerkte ich, dass ihr Gesichtsausdruck sich verändert hatte. Er war hart geworden, wie eine Mauer. Verständnis war da nicht erkennbar.
„Das kann so nicht weitergehen, Mrs. Cabello“, sagte sie. Ich stand wieder auf, jedoch nicht, ohne gleich im Anschluss meine Hand auf Anthonys Schulter zu legen und ihn an mich zu drücken. Ich spürte unter meiner Hand, wie die Anspannung aus seinem Körper wich.
„Das klingt auch nicht gut“, stimmte ich ihr zu, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.
„Es ist eine Zumutung für alle. Die anderen Kinder verstehen nicht, warum er so reagiert. Wir haben kein ausgebildetes Personal, das damit umgehen kann. Und Ihr Sohn leidet auch.“
„Ich spreche heute noch mal mit meinem Mann“, versprach ich. „Da muss sich was ändern.“
„Da muss sich dringend was ändern. Es geht ihm nicht gut damit. So kann er nicht lernen. Sie müssen jetzt etwas unternehmen.“
Ich nickte und beschied knapp: „Ich komme wieder auf Sie zu.“
Anthonys Lehrerin nickte ebenfalls, aber ihr Gesichtsausdruck verriet ihre Unzufriedenheit. Ohne ein Wort des Abschieds kehrte sie zum Schulgebäude zurück und ich wandte mich mit Anthony zum Gehen. Seine Schritte waren langsam und schwer, als würde jeder einzelne ihn eine gigantische Anstrengung kosten. Was wahrscheinlich auch der Fall war.
Ich nahm ihm die Schultasche ab, stellte sie in den Kofferraum und schloss die Autotür hinter ihm, nachdem er eingestiegen war. Er schnallte sich selbst an und starrte stumm aus dem Fenster.
Ich war überrascht, dass die Schule mich nicht angerufen und gebeten hatte, ihn abzuholen. Das war auch schon vorgekommen – in letzter Zeit zunehmend häufiger.
Mein armer Junge.
„Fahren wir nach Hause“, sagte ich. „Was möchtest du gleich machen?“
Langsam wanderte sein Blick zu mir. „Bist du böse, Mum?“
Ich schüttelte den Kopf und lächelte ihm sanft zu. „Nein, bin ich nicht. Warum sollte ich?“
„Die Lehrer waren so böse mit mir. Haben gesagt, ich soll mich nicht so anstellen wegen der Spinne. Aber ich hatte Angst, dass die auf meinen Kopf springt, wenn ich durch die Tür gehe ...“
Und dann hatte man Druck auf ihn ausgeübt, weshalb er blockiert hatte. Wie immer. Ich seufzte ergeben.
„Es ist nicht deine Schuld“, sagte ich.
„Ich konnte nicht.“
„Ich weiß.“
Als er nichts mehr sagte, startete ich den Motor und trat den Heimweg an. Zum Glück waren es keine fünf Minuten Fahrt mehr.
Anthony ging jetzt seit dem Sommer zur Schule. Schon nach zwei oder drei Wochen hatten sich die ersten Probleme gezeigt. Der ganze Schulalltag war überwältigend für ihn – die Lautstärke, die vielen anderen Kinder, die Interaktionen mit ihnen, die Erwartungen der Lehrer. In der Tagesbetreuung vorher war das nicht so sehr aufgefallen, weil die Vorschullehrer deutlich verständnisvoller mit ihm umgegangen waren und das Umfeld ein ganz anderes gewesen war. Aber allmählich erhärtete sich die Vermutung, die ich schon seit fast vier Jahren hatte. Damals war mir aufgefallen, dass Anthony nicht in der Lage war, Gefühle anderer zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Zuvor hatte ich ebenfalls erste Anzeichen bemerkt – er war äußerst empfindlich, hatte Probleme mit Kleidung und mit der Beschaffenheit von Nahrungsmitteln. Er hatte verzögert mit dem Sprechen begonnen, aber er besaß eine beeindruckende Mustererkennung und hatte noch vor seinem zweiten Geburtstag angefangen, Dinge zu sortieren und zu kategorisieren. Mit seinen Spielzeugautos war er nie Rennen gefahren, sondern hatte sie immer nur im Wohnzimmer aufgereiht. Er schaffte Puzzles, die eigentlich für deutlich ältere Kinder gedacht waren und er liebte es, die tollsten Welten aus Klemmbausteinen zu erschaffen – aber damit spielen konnte er nicht, es fiel ihm nie etwas ein.
Meinen Verdacht, dass er im Autismusspektrum lag, hatte ich Eric mitgeteilt, als ich mir sicher genug war. Das war ein Jahr vor Schulbeginn gewesen. Aber davon abgesehen, dass es ewig dauerte, Termine für eine Diagnostik zu bekommen, hatte Eric sich dagegen von Anfang an gesperrt.
Aber so konnte und durfte es nicht weitergehen. Wir mussten etwas tun. Wir mussten unserem Sohn helfen.
Ich parkte am Straßenrand, um Eric die Zufahrt zur Garage nicht zu versperren, und stieg mit Anthony aus. Während wir ins Haus gingen, spürte ich, wie erschöpft er war. Er streifte seine Schuhe ab, ohne sie überhaupt richtig zu öffnen, und ging wortlos die Treppe hinauf.
Ich beschloss, ihn in Ruhe zu lassen und widmete mich stattdessen einigen Haushaltsaufgaben. Nachdem ich Dusche und Waschbecken geputzt hatte, riskierte ich einen Blick ins Kinderzimmer. Anthony saß auf seinem Bauteppich, trug seine Kopfhörer und hatte sich mit Bausteinen umgeben, aus denen er ein Schloss errichtete. Dabei hörte er ein Hörspiel.
Wenn ihm das half, runterzukommen, war das vollkommen in Ordnung für mich. Wahrscheinlich tat es ihm gut, gerade für sich zu sein, weil er dann nicht mit anderen interagieren musste.
Manchmal schüttelte ich innerlich den Kopf über diese Ironie, dass ich als studierte Sozialpsychologin einen autistischen Sohn hatte. Für Anthony war das gut, weil ich verstand, wie er tickte. Eric tat sich damit bis heute deutlich schwerer.
Eric und ich hatten uns gegen ein weiteres Kind entschieden, weil Anthony schon als Kleinkind verdammt fordernd gewesen war – und weil uns die Zukunft des Landes, in dem wir lebten, zu ungewiss schien. Im Augenblick machte ich mir mehr Sorgen denn je, ob Anthony jemals in Freiheit würde leben können.
Es war schon dunkel und ich hatte gerade begonnen, mich den Vorbereitungen des Abendessens zu widmen, als die Haustür geöffnet wurde. Geraschel im Flur, das Klimpern von Schlüsseln. Ein Reißverschluss wurde geöffnet. Ich hörte, wie Eric seine Schuhe wegstellte und keine drei Sekunden später erschien er in der Küchentür. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln und er kam näher, um mich in den Arm zu nehmen.
Er roch noch immer nach seinem Rasierwasser. Sandelholz. Ich mochte diesen Geruch. Ich erwiderte seine Umarmung und fühlte mich geborgen darin. Eric war mehr als einen halben Kopf größer als ich, schlank, hatte aber trotzdem eine sportliche Figur. Sein hellbraunes Haar trug er kurz geschnitten, seine blauen Augen wirkten immer wachsam.
Nachdem er mir einen Kuss auf die Wange gedrückt hatte, fragte er: „Wie war dein Tag?“
„Ganz okay“, erwiderte ich unbestimmt.
„Wo ist Anthony?“
„In seinem Zimmer. Können wir gleich reden? Mrs. Brewer hat mich nach der Schule abgefangen.“
„Was war los?“ Eric lehnte sich gegen den Türrahmen und signalisierte mir damit, dass er jetzt darüber sprechen wollte. Sollte mir recht sein.
Ich gab ihm einen kurzen Abriss meines Gesprächs mit Anthonys Lehrerin wieder. Dabei entging mir nicht, wie angespannt Eric zunehmend wirkte.
„Wir hätten ihn längst untersuchen lassen sollen. So geht es nicht weiter, Eric. Er braucht Hilfe.“ Ich sagte das mit besonderem Nachdruck, verfehlte mein Ziel aber. Eric schüttelte vehement den Kopf.
„Das geht nicht.“
„Was soll das heißen, es geht nicht? Warum nicht?“, fragte ich fassungslos.
Eric antwortete nicht gleich. Er holte tief Luft, wich meinem Blick aus und ich sah, wie seine Kiefer mahlten.
„Es ist nicht sicher für ihn.“
Ich verstand kein Wort. „Was soll das heißen?“
„Das, was ich sage“, erwiderte Eric gereizt.
„Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte das nicht sicher sein? So, wie es im Moment läuft, ist es nicht sicher. Er wird gehänselt, ist einsam, ist überfordert und blockiert deshalb. So kann er nicht gut lernen. Er braucht endlich eine Diagnose und entsprechende Unterstützung.“
Eric gestikulierte mit den Händen und suchte nach den richtigen Worten. Ich verstand nicht, warum er sich so schwer damit tat.
„Du hast natürlich Recht mit allem, was du sagst. Es läuft nicht gut. Aber wenn wir ihm einen Stempel verpassen, wird alles nur noch schlimmer.“
„Wie kommst du darauf? Autismus ist keine Krankheit oder Behinderung. Es ist eine andere Art, zu denken.“
„Die sich durchaus bemerkbar machen kann wie eine Behinderung.“
„Worum geht es dir? Was die Leute denken?“
Eric verzog den Mund, bevor er sagte: „Wenn es doch nur das wäre.“
„Was soll es sonst sein?“
Er atmete geräuschvoll aus. „Das kann ich dir nicht sagen.“
„Du kannst es mir nicht sagen? Es geht hier um unseren Sohn! Willst du denn nicht das Beste für ihn?“
„Doch, und genau deshalb solltest du es jetzt gut sein lassen!“ Seine Augen blitzten, als er mir das mit einer überraschenden Entschlossenheit entgegenschleuderte.
Doch ich beschloss, das nicht einfach so stehenzulassen. „Weißt du irgendwas? Droht unserem Sohn Gefahr, wenn er diagnostiziert wird?“
Mit gesenktem Blick antwortete Eric: „Ich weiß nichts Genaues, aber ich gehe davon aus. Das Risiko ist mir viel zu groß.“
„Aber das ist doch krank. Was wollen sie tun? Ihn in die schwarze Klasse stecken?“
„Damit wird es nicht getan sein.“
„Das ... das ist verrückt. Das können die nicht ernst meinen.“
„Sie meinen es ernst. Sie tun Dinge, die wir noch vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Ich weiß selbst nichts Genaues, aber man hört ja Gerüchte. Und ich möchte nicht, dass wir unseren Sohn mit einer Diagnose kennzeichnen. Im aktuellen politischen Klima ist das wirklich keine gute Idee.“
Langsam sickerte die Erkenntnis in mir durch. Ich wusste selbst, dass Autismus nicht selten als Behinderung angesehen wurde. Problembehaftet war es in jedem Fall. Und aktuell genügte der kleinste Grund, um in eine andere Klasse herabgestuft zu werden und Privilegien zu verlieren.
Überhaupt – Privilegien? Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte man diese Privilegien Grundrechte genannt. Erschreckend, wie schnell diese verhandelbar geworden waren.
Als ich schluckte, spürte ich einen dicken Kloß im Hals. Manchmal erschien es mir immer noch unglaublich, in welchem Land ich jetzt lebte. Vier Jahre lag der Regierungswechsel nun zurück. Vier Jahre, in denen Dinge geschehen waren, die ich zuvor nicht im Entferntesten für möglich gehalten hätte.
Ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie das Recht auf Abtreibung eingeschränkt worden war. Inzwischen waren Abtreibungen in der gesamten Republik streng verboten. Was nicht hieß, dass es keine mehr gab, aber man durfte sich dabei nicht erwischen lassen – sonst riskierte man alles. Wirklich alles.
Republik … das war eine Farce. Ungefähr so wie damals im geteilten Deutschland, als Ostdeutschland sich Deutsche Demokratische Republik geschimpft hatte. Das Land, in dem ich jetzt lebte, war so wenig eine Republik, wie Ostdeutschland damals demokratisch gewesen war. Es war ein totalitärer Überwachungsstaat und auf dem besten Weg in eine Diktatur. Nur hatte inzwischen niemand mehr den Mut, das laut zu sagen.
Eric kam auf mich zu und legte sanft seine Hände auf meine Oberarme. Sein Gesicht kam meinem ganz nah, seine hellen Augen schienen bis auf den Grund meiner Seele zu blicken.
„Glaub mir, Adriana, ich will auch nur das Beste für unseren Sohn, wirklich. Ich habe einfach Angst, dass wir einen Fehler machen, wenn wir ihn als Autisten diagnostizieren lassen.“
„Das sollte kein Fehler sein“, entgegnete ich mit beinahe leidenschaftlicher Wut.
„Da hast du Recht. Wirklich. Aber glaube mir, wir sollten warten.“
„Und was tun wir in der Zwischenzeit?“
„Wir finden eine Lösung“, versprach Eric mir. „Ich gehe mich mal umziehen.“
Ich nickte bloß. Dass er seinen Anzug loswerden wollte, konnte ich verstehen. Was eigentlich schade war, weil er ihm gut stand.
Das hatte er auch schon in Erics Zeit als FBI-Analyst. Als das FBI vor vier Jahren kurz nach Antritt der neuen Regierung aufgelöst worden war, hatte man sämtliche Mitarbeiter vor die Wahl gestellt: Entlassung oder ein Wechsel zur SAR, die im gleichen Atemzug gegründet worden war.
Eric hatte sehr mit sich gerungen, daran erinnerte ich mich gut. Ihm war von Anfang an klar gewesen, was die SAR werden sollte und hatte sie mit der ostdeutschen Stasi, dem KGB oder dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit verglichen – zu Recht, wie sich schnell herausgestellt hatte. Seit es die SAR gab, wurde überwacht und abgehört, die Medien wurden gesteuert, gezielt Desinformationen verbreitet. Sobald sich jemand verdächtig machte, dem Staat oder der Regierung schaden zu wollen, konnte er vorsorglich in Schutzhaft genommen werden – gleichbedeutend mit einem spurlosen Verschwinden ohne Wiedersehen.
Es drehte mir den Magen um, zu wissen, dass Eric sein Geld damit verdiente, für die amerikanische Gestapo zu arbeiten, wie ich sie heimlich bei mir nannte. Er hasste es auch, das wusste ich. Er hatte sich erst im allerletzten Moment dafür entschieden – unseretwegen, wie er mir gesagt hatte, als ich ihn sprachlos und voller Entsetzen angesehen hatte.
„Damit du und Anthony sicher seid“, hatte er gesagt. Damals hatte ich das als Hirngespinst abgetan, aber inzwischen wusste ich, was er gemeint hatte. Dass er Recht gehabt hatte. In gewisser Weise war ich ihm auch dankbar dafür, dass er seine Seele verkaufte, um meine und Anthonys Freiheit so gut es ging zu sichern. Denn meine Eltern stammten aus Venezuela und auch Anthony sah man seine lateinamerikanische Abstammung noch in ausreichendem Maße an, sodass er eigentlich eine rote ID-Karte hätte bekommen müssen. Trotzdem hatten wir blaue.
Nur deshalb musste ich nicht wie Molly in der Uni die Flure putzen.
Drei Jahre zuvor
„Es liegt nicht in meiner Hand, Molly. Ich finde es auch falsch, ganz ohne Frage. Du bist gut in dem, was du tust. Du leistest hier gute Arbeit. Aber ...“
„Jetzt schmier mir keinen Honig ums Maul, Bill, sondern sag denen, dass es so nicht geht! Dass du mich hier brauchst! Es kann doch nicht sein, dass die das einfach durchkriegen, nur weil meine ID-Karte die falsche Farbe hat ...“
Ergeben sah William sie an. Er stand im Türrahmen unseres Zweierbüros, von Molly und mir, und suchte nach den richtigen Worten.
„Du wirst ja hier weiter beschäftigt“, sagte er.
„Als was, als Putzfrau? Weil ich als Schwarze laut unserer grandiosen Regierung nichts anderes kann? Die wurden doch als Kinder alle zu heiß gebadet!“ Wutentbrannt sprang Molly auf und stützte sich auf ihrem Schreibtisch ab. Mir war die ganze Szene furchtbar unangenehm, auch wenn ich voll auf Mollys Seite war.
Mit flammendem Blick starrte sie unseren Chef an. „Ich werde das nicht akzeptieren.“
„Das kannst du gern mit dem Dekan diskutieren. Ich habe gar keine Befugnisse in dem Bereich. Tatsache ist, dass du diesen Job nicht weitermachen kannst.“
„Natürlich kann ich! Was sollte ich daran nicht können? Ich habe genau so studiert wie ihr auch. Und warum – nichts für ungut – gilt das eigentlich nicht für Adriana? Worum geht es hier?“
William seufzte tief. „Es gibt einen Erlass, der besagt, dass die Inhaber roter und schwarzer ID-Karten keine mittleren oder gehobenen Tätigkeiten mehr ausüben sollen. Du hast eine rote ID-Karte. Adriana hat eine blaue. Wie gesagt, mir stinkt das auch alles. Ich brauche dich hier eigentlich. Hier am Schreibtisch und nicht irgendwo sonst. Aber mich hat leider keiner gefragt.“
„Und wenn ich einfach weitermache?“
„Komm schon, das geht nicht und das weißt du auch.“
„Warum weiß ich das? Ich weiß nur, dass ich mich verdammt verarscht fühle! Ich habe nichts falsch gemacht! Ich habe einfach eine rote ID-Karte bekommen und jetzt verliere ich auch noch meinen Job? Nicht genug damit, dass ich mich nicht mehr frei bewegen darf – jetzt auch noch das ...“
William machte ein betretenes Gesicht. „Es tut mir leid. Ehrlich. Ich finde das auch alles nicht richtig. Wirklich nicht. Aber ich muss mich auch an die Regeln halten und die besagen, dass du hier nicht weitermachen darfst. Melde dich einfach bei der Personalverwaltung und erkundige dich, wie du hier fortan beschäftigt werden kannst.“
„Das stinkt zum Himmel!“, rief Molly aufgebracht.
Ich verstand sie so gut. Am liebsten hätte ich mit ihr rebelliert. Ich fühlte mich auch furchtbar, weil ich eine blaue ID-Karte bekommen hatte und sie nicht. Das war ungerecht – und ich hatte es nur Eric zu verdanken. Nur der Tatsache, dass ich mit einem Weißen verheiratet war, der für die SAR arbeitete. Deshalb ging mein Leben weiter. Deshalb konnte ich meinen Job behalten.
Und Molly – die ich manchmal für intelligenter hielt als mich selbst und die sowohl die Fähigkeiten als auch den Ehrgeiz mitbrachte, noch einen Doktortitel zu machen – durfte jetzt ihren Job in der Wissenschaft nicht mehr machen, sondern sollte ... putzen? Alles nur, weil sie die falsche Hautfarbe hatte?
Wortlos fuhr sie ihren Rechner herunter und stapfte aus dem Raum. Minuten später kehrte sie mit einem Karton zurück, in den sie ihre persönlichen Sachen warf.
„Ich fasse es nicht“, schnaubte sie kopfschüttelnd. „Da fällt mir echt nichts mehr zu ein.“
„Mir auch nicht“, sagte ich.
„Hoffentlich weißt du, dass ich dich vorhin nicht angreifen wollte. Deine blaue Karte sei dir gegönnt, ehrlich. Ich weiß ja auch, warum du sie hast. Ich wundere mich nur, dass wir diesen Beschiss tatsächlich mit uns machen lassen. Warum stehen wir nicht alle längst auf der Straße mit einem Banner in der Hand?“
„Weil niemand Lust hat, sang- und klanglos irgendwo zu verschwinden für unbestimmte Zeit“, erwiderte ich düster, denn genau das war es ja. Die SAR war Erfüllungsgehilfe der idiotischen Gesetzgebung unserer neuen Regierung und schüchterte jeden erfolgreich ein.
Sie patrouillierten überall, meist bis an die Zähne bewaffnet. Inzwischen wurde auch alles abgehört und protokolliert, weshalb Eric mir vor kurzem einen Zugang zum Secret Web eingerichtet hatte. So konnte ich Kontakt mit Mateo halten, ohne mir Sorgen über das machen zu müssen, was ich sagte – oder er. Die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln war tatsächlich radikal eingeschränkt worden – Zugang zu Verhütung hatten nur noch Verheiratete und dann ging das alles auch nur mit Einverständnis des – wohlgemerkt – Mannes, was faktisch bedeutete, dass Unverheiratete nicht mehr verhüten konnten. Eine ganz entzückende Idee angesichts der Tatsache, dass auch Abtreibungen verboten waren. Da merkte man den puritanischen Grundgedanken hinter vielem, was unsere Regierung tat. Sie war nicht nur zutiefst rassistisch, sondern auch frauenfeindlich und mehr als erzkonservativ.
Während Molly ihre Sachen packte, musste ich daran denken, wie ich vor etwa einem halben Jahr mit Mateo gesprochen hatte, nachdem gleichgeschlechtliche Ehen verboten worden waren. Damals hatte er zum ersten Mal den Vorschlag gemacht, dass ich doch mit meiner Familie zu ihm nach Kanada kommen sollte. Ich hatte es noch heruntergespielt und gesagt, dass das alles schon nicht so schlimm werden würde ... nur um jetzt feststellen zu müssen, dass es sogar noch schlimmer ging.
Denn die Sache mit den ID-Karten hatte ich nicht kommen sehen. Faktisch hatte die Regierung damit eine Klassengesellschaft implementiert, in der jemand wie Molly nun das Nachsehen hatte. Das konnte mir nicht egal sein, denn mir war bewusst, dass es mich beinahe ebenfalls erwischt hätte.
Ich fühlte mich unwohl in meiner Haut. Buchstäblich. Es war wie ein Jucken, das ich unter der Haut spürte. Ein Fluchtreflex. Das Schlimme war ja, dass wir nicht wissen konnten, was als Nächstes kommen würde. Mit dem Abtreibungsverbot hatten wir gerechnet und auch die Auflösung gleichgeschlechtlicher Ehen war nicht überraschend gekommen. Die Implementierung der ID-Karten aber schon.
Wozu waren sie noch bereit?
Kapitel 2
Positive Effekte des traditionellen Familienbildes für den Einzelnen und die Gesellschaft. Den Kopf in die Hände gestützt, saß ich vor meiner Tastatur und starrte auf den Bildschirm. Wir mussten das Studiendesign festlegen, Hypothesen formulieren …
Dummerweise spuckte mein Kopf überhaupt nichts aus, weil ich die Vorgabe vollkommen bescheuert fand. Nicht, weil die traditionelle Rollenverteilung in der Familie für jeden schlecht sein musste – war sie nicht. Aber man musste doch die Wahl haben. Und genau die hatten wir nicht mehr, denn als verheiratete Frau konnte man nichts mehr tun ohne das Einverständnis des Ehemannes. Mein Gehalt ging auf Erics Konto, ich hatte kein eigenes mehr. In unserem Falle war das kein Problem, weil er mir alle Vollmachten gegeben hatte – doch er hätte das Recht gehabt, es nicht zu tun. Genau so, wie er das Recht gehabt hätte, mir meine Arbeit zu untersagen, damit ich meine häuslichen Pflichten nicht vernachlässigte.
Mir wurde kurz übel.
Das war in den letzten Jahren immer wieder passiert, wenn ich mir bewusst machte, dass für selbstverständlich genommene Freiheiten wie durch ein Fingerschnippen verschwinden konnten. Ich bereute jetzt, nicht so klug gewesen zu sein wie mein Bruder, der sogar noch vor dem Regierungswechsel nach Kanada gezogen war. Mateo hatte bei seinem Freund Corey in Vancouver sein wollen, denn beide waren sich darin einig gewesen, dass man als Homosexueller in Kanada friedlicher leben konnte als in den USA.
Was war nur passiert? Land of the Free, Home of the Brave. Es war einmal. Inzwischen konnte ich weder Freiheit noch Tapferkeit erkennen, denn offene Rebellion riskierte kaum jemand. Mich eingeschlossen, wie ich ehrlicherweise zugeben musste.
Während ich immer noch uninspiriert auf den Bildschirm starrte, lenkten Geräusche von draußen meine Aufmerksamkeit auf sich. Es dauerte einen Moment, bis mir bewusst wurde, dass es eine sich immer wiederholende Intonation war. Eine Protestaktion?
Noch während ich überlegte, erschien William in der Tür. „Wie geht es voran?“
„Mäßig“, sagte ich unbestimmt. „Es fühlt sich falsch an, die Hypothesen nicht frei aufstellen zu können.“
„Ja, besonders wissenschaftlich ist das nicht“, pflichtete er mir bei. „Das sehen die Demonstranten da draußen vermutlich ähnlich.“
„Also bilde ich mir die Geräusche nicht ein“, sagte ich.
„Oh, nein, überhaupt nicht. Ich nehme an, dass es Studenten sind. Sie sind noch nicht lange da draußen, haben es aber schon geschafft, die Außenwand des Audimax mit Graffitis zu beschmieren.“
„Oh“, sagte ich bloß.
„Na ja, besonders lang wird das ja vermutlich nicht gehen“, sagte William, bevor er mir zulächelte und wieder verschwand. Ich wollte mich eigentlich meiner Arbeit widmen, aber während ich die Demonstranten draußen skandieren hörte, schweiften meine Gedanken immer wieder ab.
Ich machte mich auf den Weg zu den Toiletten, aber eigentlich war das nur ein Vorwand. Die Toiletten grenzten direkt ans Treppenhaus und die Aufzüge an. Ich ging hinunter und hielt meine Karte an der Eingangsschleuse unter den Scanner. Ohne Karte konnte man weder rein noch raus, höchstens durch den alarmgesicherten Notausgang. Auch die Wissenschaft war nicht mehr frei.
Ich umrundete das Gebäude und schon sah ich die Demonstranten. Es war eine Gruppe von vielleicht fünfzig Studenten, möglicherweise mehr. Die meisten waren junge Frauen, aber auch ein paar Männer waren dabei. Sie hielten Plakate und Transparente mit verschiedenen Slogans hoch. Einer wiederholte sich auf der Wand des Audimax: My Body, my Choice. Das war es auch, was die Studenten die ganze Zeit skandierten.
„My Body, my Choice – now listen to my Voice!“
Ein Plakat zeigte das Foto einer jungen Frau, von der ich im Secret Web gelesen hatte. Aaliyah Jenkins, eine 17jährige Afroamerikanerin, die durch eine Vergewaltigung schwanger geworden war und der man die Abtreibung verweigert hatte. Klar, Abtreibungen waren ja auch verboten. Fälle von Vergewaltigung sorgten da für keine Ausnahme. Nur, wenn das Leben der werdenden Mutter zweifelsfrei in Gefahr war, durften Schwangerschaften beendet werden. Aaliyah war so verzweifelt gewesen, dass sie selbst versucht hatte, ihr Kind abzutreiben – mit Stricknadeln, so wie vor hundert Jahren. Daran war sie verblutet, weil sie es dann nicht gewagt hatte, medizinische Hilfe zu suchen – die sie als Angehörige der roten Klasse ohnehin selbst hätte bezahlen müssen.
Eine Traube von Zuschauern hatte sich gebildet, viele von ihnen filmten die Demonstranten. Erst bei genauerem Hinsehen fiel mir auf, wohl auch Guerilla-Reporter darunter waren, die mit einer kompakten Videokamera filmten und Mikrofone in die Richtung der Demonstranten hielten. Schließlich löste sich eine junge Frau mit Kurzhaarschnitt aus der Menge der Zuschauer und machte Anstalten, eine Demonstrantin zu interviewen.
In die offiziellen Nachrichten würde diese Demonstration es nicht schaffen, aber mithilfe der Guerilla-Reporter wenigstens ins Secret Web. So konnte sich diese Information verbreiten. Im Fernsehen wurde so etwas nicht gezeigt, da die SAR alles kontrollierte, was verbreitet werden durfte. Bei unseren staatlichen Zensurmaßnahmen erblassten die Chinesen doch sicher vor Neid.
Ein anderes Plakat forderte den freien Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln. Das hätte ich auch sehr begrüßt.
Während ich die Demonstranten für ihren Mut bewunderte, kehrte ich ins Gebäude zurück. Vermutlich hatte William Recht und diese Demonstration würde schon bald ein gewaltsames Ende finden. Dann war ich lieber nicht in der Nähe.
Doch ich kam mit meiner Arbeit nicht besser voran, weil ich in Gedanken bei den Demonstranten war, die ich unablässig hörte. Sie hatten Recht – und trotzdem war ihr Einsatz hoch. Zu hoch für mich. Ich hatte ein Kind, das mich brauchte.
Ich hörte die Kollegen in der Teeküche reden und fragte mich, ob es um die Demonstration ging. Weil ich mich sowieso nicht konzentrieren konnte, beschloss ich zwanzig Minuten vor meinem regulären Feierabend, es für diesen Tag gut sein zu lassen und den Heimweg anzutreten. Am besten war ich nicht mehr da, wenn SAR-Agents die Demonstration zerschlugen.
Doch als ich das Gebäude verließ, sah ich, dass es dafür zu spät war. Unter den Demonstranten kam Unruhe auf, einige legten ihre Plakate ins Gras und verließen hastig den Rasen. Keine zehn Sekunden später hörte ich Schreie, blieb stehen und drehte mich um.
SAR-Spezialkräfte in Kampfanzügen rannten auf die Demonstranten zu, die schreiend auseinanderstoben. Ein Wasserwerfer wurde auf die jungen Leute gerichtet, Fliehende wurden in eine Wand von SAR-Agents mit Gummiknüppeln und Elektroschockern getrieben. Als erste Demonstranten in meine Richtung rannten, wandte ich mich ab und begann selbst, zu rennen. Weil eine junge Frau hinter mir einen spitzen Schrei ausstieß, riskierte ich einen Blick über die Schulter zurück. Eine der Frauen lag schon am Boden, die andere erstarrte in ihrer Bewegung und fiel ungebremst auf die harten Pflastersteine. Man hatte sie mit Elektroschockpistolen gestoppt.
Ich rannte immer noch. Zum Glück war ich im nächsten Augenblick um die Hecke und hatte den Parkplatz erreicht. Mein Auto stand ganz in der Nähe, doch ich erlaubte mir erst eine Atempause, als ich es erreicht hatte und auf dem Fahrersitz saß. Keuchend lehnte ich den Kopf an, schloss die Augen und konzentrierte mich aufs Atmen. Fürs Erste war ich sicher – aber nur fürs Erste.
Ich drehte mich um und hielt Ausschau nach Ärger. Niemand war zu sehen. Schließlich startete ich den Motor und lenkte meinen Wagen zur Ausfahrt. Ich hatte gerade die nächste Hecke umrundet, als ich auf die Bremse trat. Ein Panzertruck der SAR stand quer vor der Ausfahrt – kein Zufall, wie ich wusste. Auch die benachbarte Kreuzung war blockiert. Natürlich, sie wollten den Demonstranten den Fluchtweg abschneiden.
Ich überlegte kurz, fuhr auf den nächsten freien Parkplatz und stieg aus. Dann würde ich heute eben mit der Metro nach Hause fahren. Die Blockade konnte sich noch über Stunden hinziehen und mit Pech nahmen sie mich in Gewahrsam. Die SAR war bekannt dafür, erst mal zu handeln und hinterher Fragen zu stellen.
Ich stieg aus dem Auto und verbot mir, zu rennen, auch wenn mir danach zumute war. Zügig, aber nicht übereilt machte ich mich auf den Weg zur nächsten Metro-Station und rannte erst die Treppe hinunter, als ich außer Sicht war.
Unten vor der Zugangsbarriere standen sicher zwanzig oder dreißig Personen und machten ihrem Unmut Luft, weil sie die Barriere nicht passieren konnten. Bei ihnen handelte es sich zum überwiegenden Teil um Afroamerikaner oder Latinos.
„Nur weiß, grün oder blau“, rief ein Mitarbeiter der Transportbehörde. Zwei junge schwarze Männer schlugen mit ihren bloßen Fäusten gegen die massiven Gitterstäbe aus Eisen.
„Wir haben Rechte!“, brüllten sie zornig. Ich beschloss, mich nach vorn durchzukämpfen. Noch hatte ich meine ID-Karte in der Tasche – in dieser aufgeladenen Stimmung hätte es mich auch nicht überrascht, wenn jemand versucht hätte, sie mir zu entreißen.
Schließlich hatte ich die Gitterdrehtür erreicht und schob mich zwischen einer Frau und einem Mann hindurch, um an den Scanner zu kommen. Erst dann zückte ich meine Karte, hielt sie unter den Scanner und drückte gegen das Gitter, um durchgelassen zu werden. Die Frau reagierte schnell und versuchte noch, sich hinter mich zu quetschen, was ihr auch gelang. Für uns beide war zwischen den Gittern zwar fast nicht genug Platz, aber schon waren wir hindurch. Die Frau wollte wegrennen, doch der Mitarbeiter der Transportbehörde schaffte es, sie zu packen und schleuderte sie gegen die Barriere. Ich steckte meine Karte weg und rannte zur Rolltreppe.
Mein Herz pochte heftig, während ich auf der Rolltreppe stehen blieb und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Bloß weg hier.
Als ich unten am Bahnsteig stand, schaute ich auf die Uhr. Aus Erfahrung wusste ich, dass es mir nicht gelingen würde, pünktlich an Anthonys Schule zu sein, wenn ich mit der Metro fuhr. Hier unten war gerade aber auch kein Empfang, weshalb ich Eric nicht Bescheid geben konnte. Mist.
Aber am wichtigsten war gerade, überhaupt aus der Stadt rauszukommen, ohne in Gewahrsam genommen zu werden. Ich wirkte jünger, als ich war, und auf den ersten Blick sah ich nicht aus wie jemand mit einer blauen ID-Karte, sondern eher mit einer roten. Es war mir schon einmal passiert, dass man mich festgehalten hatte und erst Eric hatte das Missverständnis aufklären können. Ich hatte kein gesteigertes Interesse daran, das noch mal zu erleben.
Kurz darauf fuhr der Zug ein. Nachdem ich eingestiegen war, prüfte ich noch einmal den Empfang. Für Mobilfunk reichte es nicht, aber in den Zügen gab es immerhin Internetzugang, weshalb ich Eric eine Nachricht schrieb. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten.
Ich kann hier nicht einfach weg. Wie stellst du dir das vor?
Ich stieß einen frustrierten Seufzer aus und schrieb: Du wirst dir etwas einfallen lassen müssen. Ich kann es nicht pünktlich schaffen. Er ist auch dein Sohn.
Diesmal brauchte die Antwort etwas länger. Ich mache mich auf den Weg.
Mir fiel keine gute Antwort ein, deshalb steckte ich mein Handy einfach weg. Im aktuellen politischen Klima hatte ich wirklich keinen Grund, mich über meinen Mann zu beklagen, weil er mir alle Freiheiten ließ und Eric ein guter Vater war. Dennoch hatte auch er sich verändert – vor allem, seit er für die SAR arbeitete. Es war, als sei er sich dessen bewusst, dass er jetzt so etwas wie das Oberhaupt der Familie war. Im Zweifel musste ich tun, was er verlangte. Das hatte er noch nie ausgenutzt, aber trotzdem lag der Hauptteil der Erziehungs- und Haushaltsarbeit bei mir. Weil er über seine Arbeit unseren Status sichern wollte, sagte Eric immer, und natürlich hatte er irgendwo auch Recht damit.
Aber trotzdem …
Auch mit mir hatten die letzten Jahre etwas gemacht. Noch als Studentin hätte ich selbst mit den Demonstranten auf dem Rasen gestanden und unsere Rechte lautstark verteidigt. Meine Eltern kamen zwar aus Venezuela, waren aber schon vor meiner Geburt in die USA eingewandert. Ich hatte mein ganzes Leben in diesem Land verbracht, das ich jetzt nicht mehr wiedererkannte und für das ich ein Mensch zweiter Klasse war, weil ich lateinamerikanische Wurzeln hatte – und weil ich eine Frau war. Das waren gleich zwei Gründe.
Und ich war jetzt Mutter. Bei allem, was ich tat, musste ich an das Wohl meines Sohnes denken. Anthony war erst sieben Jahre alt – und er war anders als andere Kinder, das machte es nicht besser. Er benötigte mehr Fürsorge.
Manchmal nahm das alles mir die Luft zum Atmen. Es fühlte sich an, als säße ich in der Falle. In einem Gefängnis.
Aber stimmte das nicht auch?
Man sperrte uns ein. Die Grenzmauer nach Mexiko hatte man gebaut, um unerwünschte illegale Einwanderer draußen zu halten. Aber dass Kanadier scharenweise die Grenze zu uns hätten überqueren wollen, wäre mir neu. Und trotzdem wurde nun auch an der Grenze zu Kanada eine Mauer gebaut, die schon zu zwei Dritteln fertiggestellt war.
An Zwangsarbeitern dafür mangelte es nicht. Angehörige der schwarzen Klasse wurden wohl scharenweise dorthin geschickt.
Offiziell existierte der Begriff Klasse nicht, aber letztlich war es genau das – ein Klassensystem, basierend auf den Befugnissen und Rechten, die die unterschiedlichen ID-Karten mit sich brachten.
Wer eine weiße Karte hatte, war entweder hochrangiger Politiker oder obszön reich. Inhaber weißer Karten durften sich im ganzen Land bewegen, es mit Ausnahmegenehmigung verlassen und genossen besondere Vorzüge bei medizinischen Behandlungen. Begegnet war mir noch nie jemand mit einer weißen Karte – auch niemand mit einer grünen. Eine grüne Karte bekamen hochrangige Militärs und Staatsdiener, wohlhabende Personen mit Einfluss oder Prominente. Auch sie durften sich im ganzen Land frei bewegen und genossen das Privileg einer kostenfreien ärztlichen Behandlung.
Als Inhaberin einer blauen ID-Karte ging es mir auch vergleichsweise gut. Ich durfte durch den Bundesstaat reisen, in dem ich lebte, und weil wir in Grenznähe lebten und ich in einem anderen Bundesstaat arbeitete, durfte ich auch in diesen reisen. Mit Ausnahmegenehmigung durfte ich die ganze Republik bereisen – aber nicht ins Ausland, und weil Mateo sich nicht mehr in die Republik traute, hatte ich ihn nicht gesehen, seit er ausgewandert war. Unsere medizinische Versorgung war okay und in den meisten Fällen kostenfrei, aber sie war in den letzten Jahren sehr eingeschränkt worden. Anthonys Förderprogramme waren ersatzlos gestrichen worden.
Dennoch war ich froh, keine rote Karte zu haben. In dieser Klasse befanden sich alle Personen mit einer anderen Hautfarbe als weiß, sofern sie nicht wie ich das Glück hatten, mit einem oder einer Weißen verheiratet zu sein. Generell war die rote Klasse ein Sammelbecken für die Mittellosen ohne guten Abschluss – so etwas wie eine Arbeiterklasse, in der es durchaus auch Weiße gab. Ihr Bewegungsradius war sehr eingeschränkt, sie durften sich nur in den Städten bewegen, in denen sie lebten und arbeiteten. Medizinische Versorgung gab es nur im Notfall – oder gegen Geld, aber daran mangelte es diesen Menschen meist. Dagegen wurde regelmäßig demonstriert, doch ohne nennenswerten Erfolg.
Eine schwarze ID-Karte bekam, wer vorbestraft war, eine Behinderung hatte und deshalb nicht arbeitsfähig war, oder jeder, der sich nicht als heterosexuell definierte. Die schwarze ID-Karte berechtigte nur zu Fahrten zwischen Arbeits- und Wohnort oder zu wichtigen Orten wie Supermärkten und Ärzten. Speziell Letzteres war eine Farce, denn selbst im Notfall mussten diese Menschen für eine ärztliche Behandlung zahlen. Diese Tatsache war bei der Einführung des Systems von Bürgerrechtlern als verdeckter Genozid bezeichnet worden, weil man damit wissentlich den Tod von Menschen in Kauf nahm, aber geändert hatte sich nichts.
Und dann gab es noch die Menschen, die gar keine ID-Karte hatten. Von Anfang an hatte das auf Gefängnisinsassen zugetroffen, die nach der Entlassung höchstens auf eine schwarze Karte hoffen konnten. Der Verlust der ID-Karte war schnell als ultimatives Druckmittel benutzt worden, denn dieser Verlust drohte jedem, der sich eines Verbrechens gegen den Staat schuldig machte, etwa indem er offen rebellierte und dafür verurteilt wurde. Damit war man offiziell so etwas wie vogelfrei. Nicht selten wurde in schweren Fällen von Rebellion die Todesstrafe verhängt und auch zügig ausgeführt.
Wenn man keine ID-Karte hatte, war man kein Mitglied der Gesellschaft mehr. Man konnte sich nicht fortbewegen, man durfte nicht mal einkaufen – ID-Karten galten als Zahlungsmittel, denn Bargeld und Kreditkarten wurden nicht mehr akzeptiert. Verbrechen, die an Menschen ohne ID-Karte verübt wurden, wurden nicht geahndet. Man hatte keinen Anspruch auf eine Wohnung oder auf Unterstützung durch die Polizei. Wenn man keine ID-Karte mehr hatte, war alles vorbei.
Genau das hatten die Demonstranten vor dem Audimax riskiert, indem sie offen rebelliert hatten. Diejenigen, die man schnappte, konnten schlimmstenfalls ihre ID-Karte verlieren. Wenn sie Glück hatten, bekamen sie eine schwarze und mussten dann auf unbestimmte Zeit als Zwangsarbeiter an der Mauer nach Kanada mitbauen. Aktuell, mitten im Winter, war das kein Spaß. Im Secret Web hatte ich Schätzungen gelesen, wie viele Menschen dort den aktuellen arktischen Temperaturen von teilweise um Minus dreißig Grad zum Opfer gefallen waren.
Das hier war kein freies Land mehr. Es tat mir unendlich weh, mir das bewusst zu machen, denn als meine Eltern damals eingewandert waren, hatten sie genau darauf gehofft – auf Freiheit und ein besseres Leben. Sie waren nach Mexiko ausgereist, als die neue Regierung an die Macht gekommen war, und seitdem hatte ich auch sie nicht gesehen.
Sie hatten gesagt, dass sie ihrer Ausweisung zuvorkommen wollten. Ausgewiesen hätte man sie wohl nicht, aber bestimmt in die rote Klasse gesteckt. Ausgewiesen hatte man kurz danach nur diejenigen, die keinen amerikanischen Pass hatten. Wer sich weigerte, den hatte man ohne Kinder in die Herkunftsländer zurückgeschickt. Tagtäglich passierten Dinge, die jegliche Menschenwürde mit Füßen traten.
Ich wurde in meinen Gedankengängen unterbrochen, weil ich umsteigen musste. Als ich im zweiten Zug saß, schaute ich auf mein Handy und entdeckte eine Nachricht von Eric, der wissen wollte, wann ich am Bahnhof eintreffen würde. Ich schrieb es ihm, erhielt aber keine Antwort mehr. Der Blick auf die Uhr verriet mir, warum das so war – er war wahrscheinlich gerade bei Anthonys Schule.
Ich verstand Erics Ängste. Er hatte auch Recht mit seiner Befürchtung, dass man Anthony möglicherweise seine blaue Karte abnahm, wenn man bei ihm Autismus diagnostizierte. Bislang wurde bei Kindern so nicht verfahren, aber wer wusste schon, was noch kam? Und dann bekam er vielleicht eine schwarze Karte, die ihn so gut wie rechtlos machte.
Wut stieg in mir auf, wenn ich mir das bewusst machte. Anthony hätte Förderung gebraucht und keine Bestrafung. Er war ein lieber Junge. Grundehrlich und gut zu allem und jedem, sehr fantasiereich, klug, ein logischer Denker, kreativ und nicht abzubringen von Dingen, die er sich in den Kopf gesetzt hatte. Er war aber auch stur und unflexibel, sensorisch überaus empfindlich und absolut nicht folgsam, wenn er nicht verstand, warum er etwas tun sollte. Dass das im schulischen Kontext für Schwierigkeiten sorgte, war offensichtlich. Durch die ersten Monate hatte er es irgendwie geschafft, aber die Anforderungen wurden ja nicht weniger. Vielleicht war es ein Vorurteil, aber ich glaubte, dass Mrs. Brewer möglicherweise bereit gewesen wäre, ihn besser zu fördern, wenn er ein Weißer gewesen wäre. Zwar hatte er deutlich hellere Haut als ich, aber sein Haar war kohlrabenschwarz, seine Augen dunkelbraun und überhaupt sah man ihm an, dass seine Mutter eine Latina war – mehr, als man den weißen Vater erahnen konnte.
Ich hatte keine Lösung für das Problem. Frustriert stieg ich in Falls Church aus dem Zug und beeilte mich, zur Bushaltestelle zu laufen. Ich hatte die Metro-Station jedoch kaum verlassen, als mir auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Auto ins Auge stach, das mir verdammt bekannt vorkam. Ein Lächeln stahl sich auf mein Gesicht und ich ging hinüber zu Erics Auto.
Er hatte mich schon längst bemerkt und lächelte ebenfalls, als er mich sah. Anthony saß auf dem Beifahrersitz neben ihm und spielte an Erics Handy. Ich sah, dass Eric ihn ansprach, und Anthony blickte mit einem Strahlen auf. Achtlos drückte er seinem Vater das Handy in die Hand, sodass es beinahe in den Fußraum gefallen wäre, hätte Eric es nicht gefangen. Ich blieb in vorsichtigem Abstand stehen, weil Anthony die Tür achtlos und mit voller Kraft aufschwingen ließ, bevor er aus dem Auto sprang und mir um den Hals fiel.
„Da bin ich endlich“, sagte ich und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn.
„Du hast mich nicht abgeholt“, stellte Anthony vorwurfsvoll fest.
„Ja, ich weiß. Es ging nicht. Deshalb hat Dad dich heute abgeholt.“
Anthony wollte mich gar nicht loslassen. Für einen Siebenjährigen war er groß und recht kräftig, deshalb bereitete es ihm keine Mühe, mich sehr fest zu drücken. Ich ließ ihn, bis er schließlich losließ und wieder hinten ins Auto stieg. Nachdem ich auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, begrüßte ich Eric mit einem Kuss und drückte damit gleichzeitig meinen Dank aus.
„Lieb, dass ihr mich abholt“, stellte ich fest.
„Als ich es vorgeschlagen habe, wollte Anthony es unbedingt“, erwiderte Eric und ich wusste nicht, wie ich das deuten sollte.
„War es sehr schwierig, früher Schluss zu machen?“
Eric ließ den Motor an und fuhr los, bevor er antwortete. Dabei sah er mich nicht an.
„Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Kurz darauf hat sich aber schon in der Abteilung herumgesprochen, was da los war. Kollegen von mir haben es beobachtet. Sie sagten, du könntest froh sein, schon weg gewesen zu sein. Da hat dann niemand mehr etwas gesagt.“
„So schlimm?“, fragte ich.
Eric nickte. „Die Freedom Fighters sind noch dazugekommen. Ich weiß nichts Genaues, aber ich gehe davon aus, dass die Situation völlig eskaliert ist. Rund um die Uni sind die Straßen gesperrt.“
Ich sagte nichts mehr. Da hatte mein Bauchgefühl ja Recht behalten.
Schweigend fuhren wir nach Hause. Nachdem Anthony in seinem Zimmer verschwunden war, zog Eric plötzlich eine kleine Schachtel aus seiner Jackentasche und reichte sie mir wortlos.
Die Pille. Auf der Schachtel klebte ein Aufkleber mit meinem Namen, aber ich hatte selbst keine Berechtigung, sie mir aus der Apotheke zu holen. Das musste Eric für mich tun. Auf diese Weise stellte die Regierung sicher, dass die Ehemänner tatsächlich einverstanden damit waren, dass in der Ehe verhütet wurde.
Irgendwie pervers.
„Danke“, sagte ich und Eric nickte mir zu. Ich hatte ihn gar nicht darum gebeten, aber er hatte wohl gesehen, dass mein Vorrat zur Neige ging. Wir waren uns ja beide einig darin, dass wir kein zweites Kind mehr wollten. Einerseits, weil wir mit einem mutmaßlich autistischen Kind ausreichend ausgelastet waren und andererseits – in diesem Land?
Während Eric sich umzog, setzte ich mich an den Computer und wählte mich ins Secret Web ein. Den Zugang hatten wir, weil Eric als SAR-Mitarbeiter genau wusste, wie er die Überwachung umgehen konnte und weil es meine einzige Möglichkeit war, mit Mateo zu kommunizieren. Eric hatte mir alles eingerichtet, damit ich meinen Bruder nicht verlor, und riskierte damit nicht nur seinen Job.
Doch um Mateo ging es mir gerade gar nicht. Noch nicht. Ich wollte wissen, was in Georgetown los war, und suchte in Messageboards aus der Gegend nach Hinweisen.
Ich wurde schnell fündig. Tatsächlich waren es fast achtzig Studenten gewesen, mit denen es begonnen hatte, und es waren auch noch spontan einige dazugekommen. Die Freedom Fighters waren erst aufgetaucht, als die SAR schon vor Ort gewesen war. Daraufhin hatte es sich zu einer richtigen Straßenschlacht entwickelt, die wohl auch immer noch im Gange war. Die SAR hatte versucht, die Demonstranten mit Wasserwerfern auseinanderzutreiben und war mit roher Gewalt gegen die Studenten vorgegangen. Sie hatten versucht, so viele festzunehmen wie möglich. Genaue Zahlen waren nicht bekannt, aber ein Guerilla-Reporter schrieb, dass es wohl deutlich schlimmer ausgegangen wäre, wäre die SAR zahlenmäßig stärker vertreten gewesen.
Was wahrscheinlich auch ein Grund dafür war, dass sie nach dem Auftauchen der Freedom Fighters zu scharfen Waffen gegriffen hatten. Die Rebellengruppe hatte mehrere Verletzte und auch einen Toten zu beklagen.
Verdammt.
Ich scrollte durch Fotos und Videos der Demonstration, aber auch der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen SAR, Rebellen und Demonstranten. Ich sah Fotos von Studentinnen, die mit Nasenbluten am Boden lagen, vor Schmerz zusammengekrümmt. Ich sah Bilder von jungen Männern, die in Handschellen von SAR-Agents in Kampfanzügen abgeführt wurden. Und ich sah eine Aufnahme, die den toten Rebellen von Weitem zeigte. Unter dem Bild stand sein Name, es war ein Schwarzer namens Michael Wheeler. Er war 23 Jahre alt gewesen.
Meine Kehle war wie zugeschnürt, als ich das sah. Es starben junge Menschen beim Kampf für ihre Freiheit. Und das in Amerika. Der Vereinigten Republik von Amerika.
Da war gar nichts einig. Überhaupt nichts.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Mateo war inzwischen sicher auch zu Hause. Ich verspürte das dringende Bedürfnis, mit ihm zu reden und tippte eine Nachricht, um ein Videotelefonat vorzuschlagen, als ich plötzlich Erics Hand auf meiner Schulter spürte.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah sein Kopfschütteln, als ich zu ihm aufblickte.
„Nicht heute, okay? Mach den Computer aus. Nach der Aktion vorhin überwachen meine Kollegen heute sicher alles ganz genau.“
Er hatte Recht. So weit hatte ich gar nicht gedacht. „Stimmt. Tut mir leid.“
„Schon gut. Ich will nur sichergehen.“
Als ich wieder auf den Bildschirm schaute, las ich meine Nachricht an Mateo erneut, bevor ich sie löschte, anstatt sie abzuschicken. Während ich das tat, ballte die Wut sich wie eine Faust in meinem Magen zusammen.
Warum durfte ich meinem Bruder nicht einfach eine Nachricht schreiben? Warum war er für unser Land ein Mensch unterster Klasse, nur weil er ein schwuler Latino war? Natürlich hätte ich ihn auch anrufen oder ihm regulär schreiben können; verboten war das nicht. Aber es wurde überwacht und war damit uninteressant.
Ich schaltete den Computer aus und begleitete Eric in die Küche, wo wir uns gemeinsam den Vorbereitungen des Abendessens widmeten. Es gab eine Hähnchen-Gemüsepfanne mit Reis und asiatischen Gewürzen. Zwischendurch zweigte ich ein wenig Reis und Hähnchenfleisch für Anthony ab, der schon immer einen sehr eingeschränkten Speiseplan gehabt hatte und sensorisch mit vielen Nahrungsmitteln Schwierigkeiten hatte. Das musste nicht unbedingt am Geschmack liegen, sondern konnte auch etwas mit der Konsistenz oder einfach nur dem Aussehen zu tun haben. Eric fand, dass ich ihn verzog, indem ich ihm gesondert etwas zubereitete, dabei wusste ich, dass es bei Anthony nichts mit Willenskraft zu tun hatte. Wenn es nichts gab, was er essen konnte, aß er im Zweifelsfall lieber nichts. Das war keine Lösung. Er war ohnehin schon recht dürr, denn er aß auch viele Dinge nicht, die bei anderen Kindern idiotensicher funktioniert hätten.
„Wie war es denn heute in der Schule?“, fragte Eric, als wir kurz darauf gemeinsam um den Tisch saßen. Argwöhnisch sortierte Anthony ein Stückchen Zwiebel aus, das noch an einem Hähnchenstück hing.
„War okay“, erwiderte Anthony wortkarg.
„Habt ihr etwas Interessantes gelernt?“
Nun zuckte Anthony unbestimmt mit den Schultern und steckte das Hähnchenstück in den Mund, nachdem er es für essbar befunden hatte.
„Mathe war langweilig“, sagte er, als beinahe schon gar nicht mehr mit einer Antwort zu rechnen war.
„Aber Mathe ist wichtig“, sagte Eric.
Wieder zuckte Anthony bloß mit den Schultern.
„Was ist los?“, fragte ich. „Bist du traurig?“
„Danny hat heute Einladungen zu seiner Geburtstagsparty verteilt. Ich habe keine bekommen.“