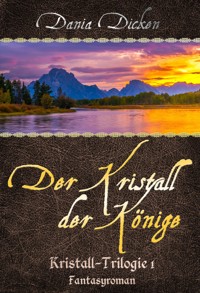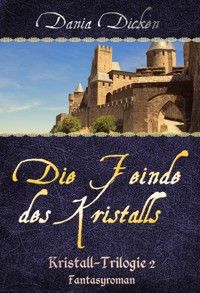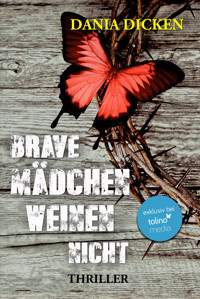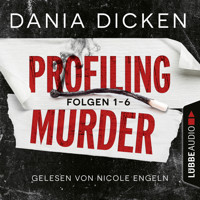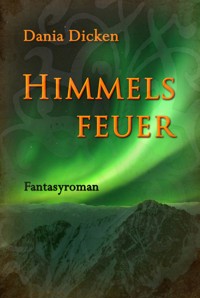
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die 18-jährige Caelidh führt ein Leben im Verborgenen: Sie gehört der Schwesternschaft der Klinge an, einer verbotenen Vereinigung von gelehrten Kriegerinnen. Ihr zurückgezogenes Leben im Exil findet ein jähes Ende, als sie von einem Überfall auf ihr Heimatdorf erfährt: Soldaten haben es verwüstet und ihre geliebte Schwester Fianna verschleppt, um sie dem König als Sklavin zu bringen. Einzig Fiannas verzweifelter Ehemann bringt den Mut auf, gemeinsam mit Caelidh das Unmögliche zu wagen: Sie wollen Fianna befreien. Doch das ist nur der Anfang eines beschwerlichen, gefahrvollen Weges ins Ungewisse... // Jetzt neu erschienen: die Fortsetzung "Grenzen überwinden"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Prolog
Gileond gürtete sein Schwert, ehe er sich prüfend im Spiegel musterte. Er schnippte einen Krümel von seinem mit Silberfäden bestickten Wappenrock und lächelte zufrieden. Seine tadellose Erscheinung würde niemals an Bedeutung verlieren - niemals, solange er Wächter des Königs war. Zwar hatte seine Mutter einmal gemeint, er sollte eher etwas Nützliches erlernen wie ein Handwerk, doch Gileond war der Meinung, daß es überaus nützlich war, das Leben des Königs zu schützen. Seit nunmehr vier Jahren ging er dieser Aufgabe nach und er tat es jeden Tag mit demselben Stolz und immer gleichbleibender Freude.
Mit polternden Schritten lief er die Treppe hinab und spähte in die Küche. Staub tanzte im Licht der Morgensonne, die durch das hohe, schmale Fenster in den zentralen Raum des kleinen Hauses fiel. Seine Mutter saß am Tisch und knetete Teig für frisches Brot.
Sie schaute auf, als Gileond die Küche betrat und aus einem Korb den Rest des Brotes vom Vortag stibitzte. „Möchtest du ein Stück Käse dazu?“ fragte sie augenzwinkernd.
Der blonde Bursche schüttelte den Kopf und biß ein Stück vom Brot ab. Zwar würde es frisches Brot im Palast geben, aber bis er dort eintraf, wäre er ohne einen Bissen im Magen elendig verhungert, da war er sicher.
Er schluckte und winkte ab. „Bin spät dran, aber danke. Ihr wißt, ihr müßt heute Abend nicht auf mich warten.“
„Das tun wir doch gern“, widersprach seine Mutter. „Und gib Acht auf dich.“
Gileond nickte beiläufig, hob die Hand zum Gruß und verschwand. Das sagte sie jeden Morgen, wurde dessen wohl niemals müde. Aber er hatte einen Eid geschworen, im Notfall sein Leben für das des Königs zu opfern.
Er warf die Tür hinter sich zu und eilte schnellen Schrittes über das unebene Straßenpflaster Samacias, der Hauptstadt des Königreiches Untosia. Aus einem offenen Fenster drang Kindergeschrei an seine Ohren, er vernahm Gelächter. Während er den Kanten Brot verspeiste, nickte er den Passanten zum Gruß zu und wich einem Händlerkarren aus, der zahlreiche Ballen grauer Wolle transportierte. Eine Frau schrubbte die Fensterläden ihres Hauses, eine andere hastete mit einem Korb in der Hand an ihm vorüber.
Es dauerte nicht lang, bis auch er den Marktplatz erreichte. Dicht an dicht drängten sich die Stände der Händler, es roch nach Rauch, Brot und einer verräterischen Spur Apfelwein, die aus einem nahen Gasthaus auf die Straße drang.
Gileond hielt sich nicht lang am Markt auf, warf den Händlern einige neugierige Blicke zu und verschwand im Gewirr der folgenden Straßen. Bald wichen die kleinen, verwitterten Fachwerkhäuser mit ihren Lehmwänden den prachtvollen Häusern der reichen Händler, die aus glattem Gestein erbaut waren und ausnahmslos Fensterscheiben aus Glas hatten. Vornehme Leute in teuren Kleidern begegneten ihm zu Fuß oder zu Pferd, eine Kutsche fuhr an ihm vorüber. Gileond atmete tief durch und schaute den Schwalben hinterher, die über seinem Kopf dahinschwirrten und lärmend in einem Dachstuhl verschwanden.
Die Straße verbreiterte sich zu einer Allee. Hier begegneten ihm keine gewöhnlichen Passanten mehr, ihm fielen nur zwei seiner Kameraden ins Auge, die sich ebenfalls beeilten, ihren Dienst anzutreten.
Gileond war eines der jüngsten Mitglieder der Wachmannschaft und nahm seine Aufgaben umso ernster. Er nickte den Torwächtern freundlich zu, als er den Hof des Palastes betrat und eilte an den Stallungen vorbei zum Hintereingang des Ostflügels, der zum Wachraum führte. Der Palast erstrahlte im Licht der warmen Morgensonne, die das riesige Gebäude aus Sandstein golden leuchten ließ. Zwei Gärtner eilten an ihm vorüber in den von Bäumen gesäumten Hof, von dem aus ein kieselbedeckter Weg zum Haupttor des Palastes führte. Auf den Mauern und vor den Türen standen Wächter, die allesamt die gleiche Kleidung trugen wie Gileond: schwarze, fast kniehohe Lederstiefel, helle Hosen, eine einfaches Hemd und darüber der nachtblaue Wappenrock mit dem Siegel des Königs.
Vor der Hintertür zum Wachraum lungerten einige Wächter herum, die gerade ihre Schicht beendet hatten; Gileond entgingen ihre müden Augen nicht. Die Nachtwache war hart, das wußte er so gut wie die anderen. Er hatte sie auch schon oft verrichtet, weil die unverheirateten Männer dafür bevorzugt wurden.
Er grüßte sie freundlich und ging hinein in den großen, kühlen Raum, in dem sie ihre Pausen oft verbrachten. Auf mehreren der Tische standen wie erwartet Körbe mit Brot und Käse, so daß der junge Mann kräftig zulangte. Er setzte sich nahe der grob gemauerten Wand zu seinen Kameraden, die ebenfalls noch frühstückten, und lauschte ohne ein Wort des Grußes ihrer angeregten Diskussion. Ihre Stimmen hallten an den hohen Wänden der schmucklosen Halle wider.
„Die Kleine ist eigenartig. Sie hat noch kein Wort gesagt, nicht einmal zu der anderen. Sie hat auch niemanden richtig angesehen. Sie sitzt einfach nur da und starrt irgendwohin“, erzählte Cunloret mit vollem Mund. Gileond hatte es längst aufgegeben, sich über diese Manieren zu beschweren.
„Dabei ist sie so ein hübsches Ding. Wäre wirklich zu schade, wenn sie sie aufhängen.“
„Allerdings. Sie hat sicher nichts verbrochen, aber die andere... seht sie euch doch nur an!“
„Wer?“ fragte Gileond interessiert.
„Du bist natürlich wieder zu spät, um irgendetwas zu erfahren!“ neckte der kleine Nelan ihn.
„Die Wache beginnt erst, wenn die Glocke acht schlägt“, sagte Gileond achselzuckend.
„Ja, sei‘s drum. Im Verlies sitzen zwei Mädchen aus Khasarud, was sagst du nun?“
Khasarud? Gileond hob fragend eine Augenbraue. „Zwei Mädchen?“
„Ja, wenn ich‘s doch sage! Eine zählt vielleicht achtzehn Sommer, die andere etwas weniger. Die Ältere scheint mir der Schwesternschaft der Klinge anzugehören.“
„Die hat Möchtegernkönig Elliut doch verboten und niedergeschlagen“, wandte Gileond ein.
„Sieh sie dir doch an“, meinte Cunloret.
„Warum nicht... aber gleich beginnt die Wache.“ Gileond steckte sich das letzte Stück Käse in den Mund und sagte nach einer Pause: „Warum sind sie denn im Verlies?“
„Sie haben einen Mann getötet.“
Das wurde ja immer merkwürdiger. Zwei Mädchen aus Khasarud waren hier, eine offensichtlich eine gelehrte Kriegerin und angeblich eine Mörderin? Gileond ärgerte sich darüber, daß er nicht gleich ins Verlies gehen und sich die beiden ansehen konnte, denn das interessierte ihn nun wirklich. Khasarud war seit fast drei Jahren vollauf damit beschäftigt, seine innere Zerrissenheit in den Griff zu bekommen und sämtliche Handels- und sonstige Beziehungen waren ausnahmslos abgebrochen. Es war, als sei von dem einst verbündeten Königreich nicht viel übrig, was noch eine nähere Betrachtung rechtfertigen würde.
Gileond trat mit den anderen auf den Hof, ließ sich aufrufen und den heutigen Posten nennen, dann begab er sich mit Arundias dorthin - sie waren eingeteilt für die Ostmauer.
„Schon wieder Mauer, wirklich großartig... die Sonne wird uns ganz schön auf den Pelz brennen“, klagte Arundias.
„Du wirst es verkraften“, meinte Gileond unbeeindruckt und erklomm die Treppe zur Mauer. Es gab Schlimmeres, als auf der Außenmauer Dienst zu schieben, denn so konnte man wenigstens auf die Stadt schauen. Er hatte schon schlimmere Dienste hinter sich gebracht - zum Beispiel Wache vor dem Gemach der Prinzessin halten, die seit einem Jahr vermählt war und gar nicht mehr hier lebte. Es war dem Kommandanten höchst peinlich gewesen.
„Und was ist jetzt mit den beiden Mädchen?“ fragte Gileond nach rechts zu Arundias, der in einigem Abstand auf der Mauer Posten bezogen hatte.
„Oh, keine Ahnung... ich habe gehört, sie seien heute Nacht hergebracht worden. Sie haben jemanden getötet, heißt es, und sie verstehen kein Wort von dem, was wir sagen. Die eine sieht aus wie eine Kriegerin und die andere ist wohl etwas eigenartig. Warum fragst du?“
„Warum kommen zwei Mädchen in diesem Alter allein nach Untosia? Sie sind scheinbar vor etwas auf der Flucht, und soweit ich weiß, ist die Schwesternschaft der Klinge nicht allein ein Bund von Kriegerinnen.“
„Was willst du damit sagen?“
„Daß ich mich frage, ob sie rechtens im Verlies stecken.“
„Warum interessiert dich das?“
Gileond zuckte mit den Schultern. „Ich bin eben neugierig.“ Das war nicht einmal gelogen. Aber warum sollten die Mädchen jemanden umbringen? Sie kamen doch sicher nicht nach Untosia, um zu töten.
Er mußte warten, bis er eine Pause machen konnte. Es war fast Mittag und er hatte Hunger, aber anstatt in den Wachraum zu gehen, machte er sich auf den Weg zum darunter gelegenen Verlies. Er mußte jetzt wissen, was es mit diesen Mädchen auf sich hatte. Frauen aus Khasarud reisten nicht allein. Es kam überhaupt niemand aus Khasarud nach Samacia. Das klang alles so eigenartig, und als Wächter hatte er gelernt, Unstimmigkeiten zu bemerken.
Die Außentür war offen. Gileond stieg vorsichtig die steilen, schmalen Stufen hinab, um ins düstere und kalte Verlies zu gelangen. Ein abstoßender Gestank empfing ihn, Unrat und Tod lagen in der Luft und schnürten ihm die Kehle zu. Aber wie sollte sich auch frische Luft dort befinden, denn es gab nur die Eingangstür und kein einziges Fenster.
Schmale Zellen reihten sich den ganzen Flur entlang aneinander, offen einzusehen durch die schweren schmiedeeisernen Gitter, die sie verriegelten. Stroh lag in den Ecken und in jeder Zelle stand ein Blecheimer, nichts weiter. Am Ende des Ganges hing eine Fackel, die kaum Trost in die Düsternis brachte. Zwei Wächter waren am Fuß der Treppe postiert. Sie grüßten Gileond freundlich.
„Was tust du hier?“ erkundigte sich einer. „Auch mal schauen, wen wir hier haben?“
Gileond winkte unwirsch ab. „Ich bin nicht hier, um sie anzustarren.“ Mehr sagte er nicht dazu. Der Wächter wies zur zweiten Zelle auf der rechten Seite und Gileond folgte der Anweisung. Nach wenigen Schritten im Staub blieb er vor der Zelle stehen und ärgerte sich, daß er kein einziges Wort Khasar beherrschte. Dann schaute er auf.
Die beiden Mädchen saßen in der Ecke. Zuerst fiel sein Blick auf die abgemagerte Gestalt einer Sechzehnjährigen, die in den schmutzigen Fetzen eines ehemals feinen Kleides steckte. Es hatte weite Ärmel, einen tiefen Ausschnitt, wie ihn nur adlige Damen trugen und war am Kragen mit Goldfäden bestickt. Am Saum war es zerrissen und beinahe schwarz vom Schmutz.
Sie starrte lethargisch ins Stroh. Ihr Blick erschreckte Gileond, denn er schien völlig seelenlos. Sie hatte ein schmales, ebenes Gesicht, aufgesprungene Lippen, tiefblaue Augen und fast hüftlanges, goldenes Haar. Sie war in der Tat hübsch, eigentlich hätte er es sogar atemberaubend schön genannt. In Ketten gelegt hatte man sie nicht, aber sie lehnte an der zweiten Gefangenen, von der Gileond auf den ersten Blick nicht viel sah.
Sie war größer und hatte eine kräftigere Statur, trug ihr dunkelblondes Haar zu einem Zopf gebunden und besaß die Kleidung, die wohl typisch für eine Schwester der Klinge war. Gileond hatte davon gehört. Über ihrem Leinenhemd trug sie einen Lederharnisch, hatte auch eine Hose - was er an einer Frau noch nie gesehen hatte - und Stiefel, die mit Lederriemen fest an die Knöchel geschnürt waren. Sie hatte dunkle Augen und obwohl sie längst nicht so atemberaubend hübsch war wie das andere Mädchen, bemerkte Gileond die Ähnlichkeit der beiden auf den ersten Blick. Sie waren Schwestern. Doch anders als die Jüngere hatte man die Kriegerin in Ketten gelegt.
Das Mädchen erwiderte seinen Blick wenig begeistert, schien zu überlegen und sagte dann mit einem harten Akzent: „Warum starrst du?“
Gileond war überrascht. „Verstehst du unsere Sprache?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Gelernt habe ich... ein wenig.“ Sie deutete es mit den Fingern an. „Sehr wenig.“
„Aber du verstehst mich.“
Sie nickte.
Er zeigte auf das Schwert, das gegenüber der Zelle an einer anderen Zellenwand lehnte, und den Dolch, der davor lag. „Gehört dir?“
Wiederum nickte sie. „Findest du seltsam?“
Er schüttelte den Kopf. „Nicht, wenn du eine Schwester der Klinge bist.“
Sie erwiderte seinen Blick starr und ohne Regung, doch dann nickte sie. „Du kennst sie?“
Er machte eine unbestimmte Bewegung. „Nicht besonders gut... ich habe davon gehört.“ Gileond machte eine nachdenkliche Pause. „Sie ist deine Schwester, nicht?“ Er deutete auf das andere Mädchen.
„Ja.“ Sie lachte leise. „Niemand hat gesagt.“
Also war er der erste, der es merkte. „Sie... sie sieht nicht gut aus. Ist sie krank?“
Das Mädchen verzog nachdenklich das Gesicht und schüttelte den Kopf. „Nein, nicht krank... sie...“ Vergeblich suchte sie nach Worten. „Sie... ist viel schlimm.“
Ratlos schaute Gileond sie an. Darauf konnte er sich keinen Reim machen. Stattdessen beschloß er, sich vorzustellen. „Mein Name ist Gileond.“
Ihr Gesicht hellte sich auf. „Mein Name ist Caelidh“, antwortete sie mit gleichbleibend starkem Akzent.
Gileond lächelte. „Warum seid ihr in Samacia?“ fragte er.
Caelidh zuckte mit den Schultern. „Meine Schwester... sie nicht sicher in Khasarud. Ich schütze sie.“
„Und stimmt es, daß ihr etwas Schlimmes getan habt? Es heißt, ihr habt einen Mann getötet.“
„Ich“, sagte Caelidh. „Ich habe Mann getötet. Mann war... Mann hat böse.“
Gileond seufzte angestrengt. Na das konnte ja noch interessant werden. „Hast du den Mann angegriffen? Oder hat der Mann euch angegriffen?“
Caelidh überlegte, was er gesagt hatte, doch dann schüttelte sie den Kopf. Fragend sah sie ihn an.
Gileond versuchte es anders. „Hast du dich verteidigt?“
Wieder zuckte sie mit den Schultern. Sie verstand ihn einfach nicht. Er hätte gern weiter gefragt, doch er wurde unterbrochen von einer Abordnung Wächter, die ins Verlies hinabstieg. Er wurde gebeten, zur Seite zu treten und tat es. Die Zelle wurde geöffnet und Caelidh erhob sich, baute sich regelrecht vor ihrer Schwester auf. Ihre Ketten wurden gelöst, dann beugte sich ein Wächter zu ihrer Schwester hinab und nahm ihre Hand.
„Karmer liadh!“ rief Caelidh und wollte ihn wegstoßen, doch sie wurde unerbittlich festgehalten und bäuchlings an die Wand gedrückt, dann fesselte ihr ein Wächter rücklings die Hände. Gileond beobachtete die Szene mit gemischten Gefühlen und wollte einschreiten, als Caelidhs Schwester unsanft ergriffen und hochgezerrt wurde. Sie begann augenblicklich in wilder Panik zu schreien und zu zappeln.
„Karmer liadh!“ schrie Caelidh wütend und schlug einem der Wächter mit dem Hinterkopf gegen die Nase. Er fiel gegen das Gitter.
„Haltet sie fest!“ brüllte er. Caelidh und ihre schreiende Schwester wurden gepackt und aus dem Verlies gezerrt.
„Was macht ihr denn?“ fragte Gileond entgeistert.
„Sie müssen zur Befragung. Vermutlich werden sie zum Tode verurteilt“, sagte einer der Wächter völlig gelassen.
Gileond erwiderte nichts und beschloß, ihnen zu folgen. Es war offensichtlich, daß Caelidhs Schwester etwas Schlimmes widerfahren war, weshalb Caelidh sie zu schützen versuchte. Vermutlich hatte sie aus Not einen Mann getötet, auch wenn er noch nicht wußte warum.
Er folgte dem Trupp Richtung Palast und als er Arundias auf dem Weg zur Wachstube sah, rief er: „Ich kann jetzt nicht zurück, in Ordnung?“
„Nein, das ist nicht in Ordnung!“ rief Arundias, aber Gileond ließ sich nicht stören. Sie betraten durch eine Seitentür den Palast und gingen einen langen Flur entlang. Wandteppiche schmückten ihn, die hohen gläsernen Fenster ließen die Sonne hinein und der Marmorboden erstrahlte in sauberem Glanz. Gileond hatte keine Augen dafür, er folgte den Männern, die die Mädchen zur Befragung brachten. Der Weg war nicht weit, schon nach kurzer Zeit betraten sie einen kleinen Saal, der unterhalb des Fensters von einem riesigen Pult gekrönt wurde. Daran saß ein Rechtsgelehrter in der typischen blauen Kutte und einige einfache Männer waren bereits zugegen, saßen auf den Bänken vor dem Pult. Gileond hörte Caelidhs Schwester laut schluchzen. Die Schwestern wurden zu einer Bank geführt, mußten sich setzen und wurden weiterhin beide festgehalten. Gileond nahm dahinter Platz.
Der Rechtsgelehrte begann gelangweilt. „Wir sind hier, um den Tod von Moram, dem Holzhändler zu untersuchen. Angeklagt sind diese beiden Mädchen aus Khasarud, ihn heimtückisch und grundlos ermordet zu haben. Wo ist die Tatwaffe?“
Ein Wächter trat vor und legte Caelidhs Dolch aufs Pult. Der Rechtsgelehrte zückte ihn und verzog das Gesicht, als er getrocknetes Blut sah.
„Was hast du dazu zu sagen?“ fragte er Caelidh. Von der Seite sah Gileond, wie sie den Blick des Mannes verständnislos erwiderte.
„Also gut. Versuchen wir es anders. Gestehst du, den Mann getötet zu haben?“
Caelidh nickte und Gileond durchzuckte es wie einen Blitz. Das war gar nicht gut.
Der Rechtsgelehrte schaute zu den anderen Männern. „Wie hat es sich zugetragen?“
Ein Mann mit wohlgenährtem Bauch und ungewaschenem Haar erhob sich. „Wir befanden uns auf der Straße vor der Stadt, als uns die beiden auffielen. Sie sahen so verloren aus, also fragten wir sie, wohin sie wollten. Sie antworteten nicht, aber die Kleine ist mit den Fäusten auf uns losgegangen und als wir sie beruhigen wollten, hat diese Furie“, er deutete zu Caelidh, „einfach Moram erstochen! Danach wurden sie verhaftet.“
Gileond glaubte ihm kein Wort. Caelidhs Schwester hatte ganz bestimmt niemanden angegriffen, sie hatte doch nur wild zu schreien begonnen, als man auf sie zugekommen war. Gewehrt hatte sie sich nicht.
„Wenn ich einen Einwand erheben darf...“ begann er und erhob sich. „Ich bezweifle, daß die beiden ein Wort von dem verstehen, was hier gesagt wird und ich habe auch Zweifel an dieser Geschichte. Seht euch das Mädchen an, sie ist völlig verängstigt! Sie...“
„Und wer seid Ihr?“ fragte der Rechtsgelehrte.
„Ich bin Wächter, ich habe im Kerker mit dem Mädchen gesprochen...“
„Und behauptet, sie würde nichts verstehen? Sie hat ihre Schuld doch eingestanden!“
„Ihr steht eine Übersetzung zu!“
Der Rechtsgelehrte winkte ab. „Setzt Euch, Ihr habt doch gar nichts damit zu tun! Nun, in Anbetracht aller Umstände verurteile ich die beiden Beschuldigten zum Tode, zu vollstrecken zur morgigen Mittagsstunde mit dem Strick.“
„Was hat denn ihre Schwester verbrochen, das den Tod verdient hätte?“ empörte sich Gileond.
„Sie ist genauso schuld“, behauptete der Rechtsgelehrte. Caelidh drehte sich zu Gileond um und schaute ihn fragend an.
„Ich kritisiere dieses Urteil!“ rief Gileond.
„Tut das... wenn Ihr mir bis morgen einen Beweis für ihre Unschuld liefert, reden wir darüber“, murmelte der Rechtsgelehrte und erhob sich. Caelidh und ihre Schwester wurden gepackt und zurück ins Verlies gebracht. Gileond sah, daß Caelidh sich heftig wehrte, dann wandte sie den Kopf zu ihm um und sah ihn an. Er konnte den Blick kaum deuten, las darin aber Verzweiflung und auch Dankbarkeit.
Irgendetwas war hier faul. Gileond hatte gewußt, daß viele seiner Landsmänner den Khasarern gegenüber nicht freundlich eingestellt waren, aber diese Befragung war eine Farce. Fassungslos starrte er dem Rechtsgelehrten und den Männern nach, die den Saal verließen. Sie zählten fast ein halbes Dutzend. Warum sollten zwei junge Frauen ein halbes Dutzend Männer angreifen?
Augenblicke später wurde ihm erst bewußt, daß er allein dastand. Nachdenklich starrte er ins Nichts. Wenn er nicht dahinterkam, was wirklich geschehen war, würden Caelidh und ihre Schwester sterben.
1. Kapitel
Ein Windstoß fuhr durch den Wald und ließ die Baumwipfel leise rauschen. Ich legte die weichen, aber robusten Armschienen in die kleine Truhe, die in einer Ecke meines Zeltes stand, schloß den Deckel und lehnte mein Schwert an die Truhe. Es ärgerte mich, daß ich nicht zu dem stehen durfte, was ich inzwischen war, aber es war zu gefährlich.
Als ich aus dem Zelt trat, vernahm ich ersticktes Prusten und drehte mich unwirsch um. Gwinnath kicherte und schüttelte belustigt den Kopf.
„Was ist so lustig?“ fragte ich gereizt.
„Dein Gesicht“, erwiderte meine beste Freundin.
„Ich habe es nur satt, ständig Verstecken zu spielen.“
„Ja, das haben wir alle. Aber wenn herauskommt, wer du bist, töten sie dich.“
Ich winkte gelangweilt ab. „Mein ganzes Dorf weiß es und ich lebe noch.“
Gwinnath seufzte. „Du weißt, was ich meine.“
Ja, das wußte ich. Aus meinem Dorf würde mich schon niemand an Fürst Elliuts Soldaten verraten, aber es war eine Tagesreise bis dorthin und wenn ich in meiner normalen Kleidung irgendwo auftauchte, würde ich gewaltige Probleme bekommen. Zu dumm nur, daß Fürst Elliuts Truppen die Schwesternschaft soweit zerschlagen hatten, daß uns kaum die Möglichkeit zu einem Gegenschlag blieb.
Und ich würde ihn niemals König nennen.
Gwinnath und Aisena warfen mir ermunternde Blicke zu. „Du wirst schöne Tage haben“, sagte Aisena, dann trat sie auf mich zu, um mich zu umarmen. Ich erwiderte ihre Umarmung und schielte neidisch auf ihre Kleidung. Sie und auch Gwinnath trugen das, was wir hier eigentlich alle trugen: Hemd, Lederhose, Schwert und vielleicht auch einen Bogen. Wir gehörten zur Schwesternschaft der Klinge. Ich hingegen trug gerade eines meiner alten Kleider und darunter meine Hose, so daß niemand sie sehen konnte. Damit ließ es sich leichter reiten.
Ich umarmte auch Gwinnath und lächelte, als sie mir mit ihren grünen Augen zuzwinkerte. Sie war größer und älter als ich und gab mir stets ein besonderes Gefühl der Wertschätzung.
„Meine Schwester wird mich wahnsinnig machen“, mutmaßte ich. „Seit Monaten kennt sie doch kein anderes Thema als ihren Iaroth.“
„Da wird sie uns etwas voraus haben“, sagte Gwinnath, während ich nach meiner Tasche griff und sie schulterte. Gemeinsam gingen wir hinüber zu den Stallungen. Graue Rauchschwaden zogen uns vom zentralen Lagerfeuer entgegen und die anderen Mädchen und Frauen winkten mir zu.
Ich stieg in den Sattel und seufzte. „Wie sagt Saia Cathernin immer: Wenn uns einmal ein Mann liebt, dann um unserer Selbst willen.“
„Das stimmt“, sagte Gwinnath. „Nun denn, ich wünsche euch eine schöne Feier. Bis bald, Caelidh.“
„Bis bald“, erwiderte ich, drehte mich um und winkte noch einmal, ehe ich meinem Pferd die Fersen in die Flanken drückte. Wie immer ergriff mich ein leichtes Gefühl der Wehmut, wenn ich auf unser Lager schaute.
Es waren jetzt fast drei Jahre, die wir schon in der Verbannung zubrachten - fast meine gesamte Zeit bei der Schwesternschaft der Klinge. Mit sechzehn war ich ihr beigetreten, damals noch in der Harlaen, der Hauptstadt. Nur Monate später hatte Fürst Elliut den König heimtückisch ermordet, den Thron an sich gerissen und war in die alte Zitadelle von Carmoth gezogen, um dort irgendwelche fragwürdigen Riten und Kulte zu praktizieren. Das alles war schon schlimm genug, aber er hatte gewußt, daß die Schwesternschaft der Klinge ihm gefährlich werden könnte. Also hat er sie erst verboten und als sich Widerstand regte, hatte er seine Soldaten auf uns gehetzt.
Wir hatten irgendwann aufgehört, die Toten zu zählen, und seither lebte ich mit allen, die auch in meiner Schule gelebt hatten, in einem Zeltlager im Wald nördlich von Harlaen. Bislang hatte uns hier noch niemand entdeckt. Wir machten weiter, Verbot und Gefahr hin oder her. Es war uns gleich. Ich war stolz, der Schwesternschaft anzugehören, und seit kurzem war die Initiierung und Ausbildung abgeschlossen und ich war ein vollwertiges Mitglied.
Mein guter Wallach Sangaiblan trottete durch den Wald, ohne darüber zu klagen, daß es keinen Weg gab. Wir brauchten keinen Pfad, denn wir kannten die Zeichen, die uns fort- oder hineinführten. So bereitete es mir keine Mühe, aus dem dichten, düsteren Nadelwald herauszufinden, der meine Heimat Khasarud in zwei Hälften teilte. Ich hatte keine Angst allein im Wald, immerhin war ich auch nicht unbewaffnet aufgebrochen. Das wäre zu leichtsinnig gewesen.
Tiere störten sich nicht an meiner Gegenwart. Ich sah Karbukhirsche grasen, hörte Spechte hämmern und wußte, es war nicht mehr weit, als ich den kleinen Kiefernwald erreichte. Ich durchquerte das lichtdurchflutete Gebiet und tätschelte Saingaiblans Mähne, als er immer wieder verärgert schnaubte. Fliegen quälten ihn.
Nicht viel später endete der Wald. Gegen Abend würde ich Hertstol erreichen, mein Heimatdorf an der Küste. Es lag an einem steilen Fjord und ich dachte wehmütig daran, wie sehr das Rauschen des Meeres mir in den vergangenen Jahren gefehlt hatte.
Sangaiblan trug mich geduldig durch die weitläufigen, hügeligen Wiesen und ihr frisches, hohes Gras. Es war Frühjahr, Bienen verrichteten ihre Arbeit und der sanfte Wind fuhr durch mein Haar. Ich trug es offen und es störte mich.
Auch hier begegneten mir Karbukhirsche. Sie hatten gewaltige, schaufelartige Geweihe und röhrten nachts furchtbar laut, aber inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt. Ebenso an die Kälte, die nachts in unseren Zelten herrschte, hatte ich mich angepaßt. Ich wußte nur nicht mehr, wie ich mein Leben lang Kleider getragen hatte, ohne zu frieren. So trug ich auch jetzt noch einen Umhang mit leichtem Pelzbesatz. Die kalten Winde, die vom Liond-Gletscher herabwehten, ließen nur im Hochsommer ein wenig nach.
Ich mochte den Sommer, denn es wurde fast nicht dunkel. Es hieß, oben in Carmoth wurde es im Winter gar nicht erst hell. Ob das stimmte, konnte ich nicht beurteilen. Nichts zog mich in den verwilderten nördlichen Teil unseres Landes, denn dort befanden sich die Anbeter Cairbothans, den wir im Süden allgemeinhin als Dämon betrachteten.
Weit und breit befand sich nichts außer grünen Hügeln, Sangaiblan und mir. Gegen Mittag machten wir an einem kleinen Rinnsal eine Rast, das Pferd graste ein wenig und ich aß etwas von meinen Vorräten. Das Brot, das wir aus dem alten Korn vom Vorjahr buken, schmeckte nicht mehr besonders schmackhaft, aber es machte satt. Ich aß noch einen Apfel, dann saß ich wieder auf und ließ Sangaiblan traben. Er schien zu wissen, was mein Ziel war, denn er suchte ganz von selbst die Straße, die nach Hertstol führte. Das ganze Dorf würde auf den Beinen sein, um die Hochzeit meiner Schwester Fianna zu feiern. Morgen war es soweit, da würde sie Iaroths Ehefrau sein und mir von Männern erzählen anstatt umgekehrt.
Fianna war jetzt sechzehn und schwer in Iaroth verliebt, schon seit einer ganzen Weile. Er war der Sohn des Schlachters und damit recht wohlhabend - das, was man eine gute Partie nannte. Fiannas Kapital war ihre Schönheit. Sie war das hübscheste Mädchen im Dorf und noch dazu hatte sie ein gutes Herz.
Wenn mir etwas an Hertstol fehlte, dann sie. Wir waren stets ein Herz und eine Seele gewesen, hatten mit einem Altersunterschied von drei Jahren einen guten Abstand. Es war nicht mehr lang bis zu meinem neunzehnten Geburtstag. Als ich sechzehn gewesen war, hatte ich vor derselben Wahl gestanden wie sie und mich fragen müssen, was ich aus meinem Leben machen wollte.
Ich war damals in einen etwas älteren Jungen verliebt gewesen, den ich zum Mann genommen hätte. Das hatte er auch gewußt, obwohl ich es ihm nicht gesagt hatte, denn das war verpönt und unschicklich. Zumindest für die meisten.
Er wußte es zwar, aber er hat nie darauf reagiert. Noch ehe ich heiratsfähig gewesen war, hat er eine andere zur Frau genommen. Es war mir schwer gefallen, das zu akzeptieren, zumal ich ihnen kaum ausweichen konnte. Nur Fianna hatte Verständnis dafür gezeigt, daß ich ein gebrochenes Herz gehabt hatte, und dann hatte ich eine Idee entwickelt.
Ich konnte seit meiner Kindheit lesen. Wie ich es gelernt hatte, wußte ich nicht mehr, aber üblicherweise lernten Mädchen es nicht. Jedenfalls konnte ich es, und ich hatte gespürt, daß mir die Zeit davonlief. Mit sechzehn mußte ich wissen, was ich wollte. In diesem Augenblick siegte meine Neugier auf die Welt und ich bekam die Erlaubnis, nach Harlaen zur Schule der Schwesternschaft der Klinge zu reisen, um dort die Aufnahmeprüfung abzulegen. Mein Vater war mit mir dort gewesen und ließ mich gewähren, so wie immer, obwohl es ihm nicht unbedingt behagte, daß seine Erstgeborene eine gebildete Kriegerin werden würde, anstatt zu heiraten und Enkel in die Welt zu setzen.
Meine Eltern hatten nie versucht, mich von diesem Weg abzubringen. Und so war ich nach Harlaen gegangen, denn ich hatte die Prüfung bestanden und wurde eine Schwester der Klinge. Ich lernte schreiben und rechnen, erhielt Geschichtsunterricht, lernte Rechtskunde und studierte die Heilkunst. Die Schwestern der Klinge waren jedoch nicht nur gebildet, sondern sie lernten auch den Umgang mit allen Waffen, die sie interessierten. Außerdem demonstrierten sie ihren Status dadurch, daß sie sich kleideten wie Männer.
Mich hatte das immer fasziniert. Ich wollte viel wissen und freute mich auf die Möglichkeiten, die ich haben würde, denn als Schwester war man geachtet und auch ein wenig gefürchtet. Die Schwesternschaft der Klinge war eine uralte Vereinigung von Frauen, die sich dazu berufen fühlte, talentierten Mädchen Möglichkeiten zu bieten, die sie sonst nicht hatten.
Allerdings hatte das seinen Preis: Um aufgenommen zu werden, mußte man seine Mitgift an die Schwesternschaft zahlen, denn man brauchte Unterkunft und Kost. Und als ob es nicht schon schwer genug gewesen wäre, als Schwester später einen Mann zu finden, wurde es ohne Mitgift schier unmöglich - wenn man sich keine neue ansparte.
Aber das war mir gleich. Die Leiterin der Schwesternschaft, Saia Cathernin, hatte uns Respekt und Achtung vor uns selbst gelehrt und uns klar gemacht, daß wir nichts anderes brauchten als uns selbst, woran ein Mann Gefallen finden konnte.
Und trotzdem blieben die meisten lange Zeit unverheiratet.
Ich fand den Namen Schwesternschaft der Klinge etwas irreführend. Er unterstützte den Irrglauben vieler, daß wir nur eine Vereinigung von Kriegerinnen waren, aber das war Unsinn. Die Kampfkunst war eine vieler Disziplinen, die wir beherrschten. Ich war gut darin, kämpfte als eine von wenigen mit dem Schwert und machte meine Sache ordentlich. Ich hatte meine Fähigkeiten noch nie ernsthaft erprobt und wollte das auch nicht. Ich amüsierte mich vielmehr darüber, wie angesehen ich auf einmal in Hertstol war. Alle wußten, daß ich noch immer bei der Schwesternschaft war, obwohl Elliut sie verboten hatte. Aber alle hatten großen Respekt und hatten mich nie verraten.
Ich ritt durch Felder aus Blumen und Gras, überquerte von der Schneeschmelze übriggebliebene Rinnsale und roch bald das Salz des Meeres in der Luft. Als ich am Himmel die ersten Möwen kreischen hörte, wußte ich, daß es nicht mehr weit war. Im fernen Dunst konnte ich bereits die steilen Klippen ausmachen, die rasant ins Wasser abfielen und ein atemberaubendes Panorama nahe meines Heimatdorfes boten.
Die Gegend war hügelig und felsig, das hohe Gras wogte im Wind und die Sonne, die immer wieder hinter den aufgeplusterten weißen Wolken hervorschaute, streichelte die grünen Halme. Als die Sonne dem Horizont entgegensank, nahm ihr Licht einen verklärten goldenen Ton an. Eine steife Brise schlug mir entgegen und ich folgte der kleinen zerfurchten Straße zwischen Felsen und Hügeln hindurch bis nach Hertstol.
Überall, wo auch nur im Ansatz Platz für Felder und Weiden waren, hatten die Dorfbewohner Getreide gepflanzt und Zäune errichtet, hinter denen die Hochlandrinder grasten. Zu meiner Rechten ragte ein schroffer Hügel in den Himmel, an dem sich der Wind brach. Mehr als Gras gab es auf dem felsigen Hügel nicht. Die nördlichen Klippen, die links von mir aufragten, waren größer und höher und auch von Bäumen bewachsen. Zwischen mir und den Klippen befand sich jedoch in beunruhigender Tiefe das tosende Wasser des Meeres, das sich an den grauen Felsen brach und gischtschäumend aufspritzte.
Ich hörte Ziegen meckern. Als ich um einen Hügel herumritt, sah ich am Horizont das bleiern wirkende Meer vor mir und davor die kleinen, reetgedeckten Lehmhäuser, windschief und an unzähligen Stellen immer wieder ausgebessert. Sie scharten sich dicht an dicht zwischen Bäumen und Hecken, die den kalten Wind brachen. Ein kleiner Steinwall schützte das Dorf ringsum zur Seite des Fjords.
Ich vernahm Gelächter und sah einige Gestalten zwischen den Häusern herumlaufen. Sangaiblan wieherte und ich versuchte, ihn zu beruhigen. „Nur Geduld, mein Guter, gleich sind wir da und du kannst grasen, was meinst du?“
Seine Ohren zuckten, so daß ich lachen mußte. Es erschien mir immer wieder wie eine Antwort. Mit einem Satz sprang ich aus dem Sattel und ging das letzte Stück mit meinem Pferd an den Zügel zu Fuß. Flötenspiel wurde vom Wind getragen, das Stimmengewirr wurde immer lauter. Ich passierte das erste Haus mit kleinem Kräutergarten und der räudige Hund des Bäckers kläffte mich mißtrauisch an.
„Ruhig, alter Klepper, ich bin es nur. Hast du mich etwa schon wieder vergessen?“ Ich schüttelte lachend den Kopf.
Als erstes erreichte ich Iaroths Elternhaus, das ein wenig abseits lag. Hinter dem Haus befanden sich tiefe Gruben, in denen das Blut der geschlachteten Tiere versickerte. Im Winter, wenn es kalt war, dampfte es unheimlich. Als Kind hatte ich immer fasziniert hingestarrt.
Eine ganze Bande junger Burschen drängte sich um die Eingangstür. Zwei hatten eine Räuberleiter errichtet und der oberste der beiden machte sich am Türrahmen zu schaffen. Als ich näher trat, sah ich, was sie im Sinn hatten. Sie hängten einen schweren grünen Kranz auf, so wie es am Vorabend der Hochzeit immer an den Häusern der Brautleute gemacht wurde. Es war ein Symbol der Freude und Fruchtbarkeit.
Mein Blick fiel auf Iaroth. Er war ein etwas schmächtiger, aber nicht kleiner Bursche mit dunklen, kinnlangen Haaren und stahlblauen Augen. Er war nicht unansehnlich; Fianna hatte eine gute Wahl getroffen. Als er Sangaiblans Hufgetrappel vernahm, drehte er sich um. „Caelidh.“
„Ich grüße dich, Iaroth“, sagte ich. Zum Gruß traten wir voreinander und legten die Hände auf das Schulterblatt des anderen, als angedeutete Umarmung.
„Schön, dich zu sehen. Fianna wartet schon sehnsüchtig! Ich glaube, ihre Freundinnen schmücken gerade eure Haustür.“
„Dann will ich doch gleich mal nachsehen“, sagte ich. Iaroth ließ es sich nicht nehmen, mich zu begleiten. Er rief seinen Kameraden etwas zu, und als sie sich umdrehten und mich bemerkten, brach ein großes Hallo über mir herein. Einige der Burschen schlossen sich uns an.
Iaroth plauderte übermütig mit mir und machte keinen Hehl daraus, wie aufgeregt er angesichts seiner Vermählung war. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Hunde rannten auf uns zu, sprangen an mir hoch und wollten mir übers Gesicht lecken, aber ich konnte sie gerade noch rechtzeitig abwehren. Auch die jüngsten Kinder kamen herbeigeeilt und bewunderten meinen Sangaiblan. Das Pferd hatte ich von der Schwesternschaft erhalten; niemand hier besaß ein solches Tier.
Iaroth sollte Recht behalten. Vor dem Haus meiner Familie hatten sich einige Mädchen um die Tür geschart, doch der grüne Kranz hing bereits.
„Caelidh!“ hörte ich meine Schwester rufen, dann stürmte sie auch schon auf mich zu und fiel mir um den Hals. Ich drückte sie an mich und küßte sie auf die Stirn.
„Hallo, Kleines“, begrüßte ich sie scherzhaft, denn Fianna reichte mir gerade bis an die Schulter. Sie war klein und zierlich, aber ihr engelsgleiches Haar und die wunderschönen Augen fielen eher ins Auge als das.
„Endlich bist du da! Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr!“
„Meine kleine Schwester heiratet, da kann es doch für mich nichts anderes geben“, sagte ich. Noch trug Fianna, genau wie wir anderen, ein einfaches Leinenkleid, aber ich wußte, für den morgigen Tag hatte sie sich ein weißes schneidern lassen. Natürlich würde sie auch den obligatorischen Schleier tragen und alles andere, was zu einer richtigen Braut gehörte.
Sie wandte sich um zu Iaroth. Er nahm ihre Hände in seine und küßte sie auf die Wange, schaute über die Schulter zu seinen Freunden und rief: „Morgen ist die schönste Frau des Dorfes die meine!“
Beifälliges Gegröle war die Antwort, worüber ich lachen mußte. Ich ließ die beiden allein, band Sangaiblan an den Zaun und klopfte an die Tür. Als ich sie öffnete, knarrte sie laut.
„Liebes!“ rief meine Mutter und umarmte mich herzlich. Ich kam mit meiner Größe nicht auf sie, denn sie war noch kleiner als Fianna. Ich beugte mich zu ihr hinab und erwiderte ihre Umarmung.
Sie trug ihr von grauen Strähnen durchzogenes Haar offen, hatte es mit einem Leinenband aus der Stirn zurückgebunden und strahlte zu mir hoch. Ich fühlte mich gleich wieder wie zu Hause, als ich in ihre braunen Augen sah.
„Meine Tochter“, sagte plötzlich mein Vater, der hinter Mutter in der Tür aufgetaucht war, und verriet mir damit seinen Stolz. Er war ein großer, hagerer Mann mit einem ruhigen Gemüt und viel Herzlichkeit. Auch er umarmte mich selig und musterte mich von oben bis unten.
„Nichts kindliches mehr“, fand er.
„Sie ist doch jetzt eine Schwester“, sagte meine Mutter mahnend und wandte sich dann mir zu. „Willst du denn ewig in den Wäldern bleiben? Du fehlst uns.“
„Wie du schon sagtest: Ich bin jetzt eine Schwester. Ich will auch nichts anderes sein, aber jetzt muß ich mich ja verstecken... leider“, erwiderte ich.
„Hängt der Kranz schon?“ wollte sie wissen.
„Ja, seit eben. Nun ist es also schon soweit.“
„Ja...“ Meine Mutter seufzt unglücklich. „Jetzt verlieren wir auch noch die andere Tochter. Ich fühle mich auf einmal so alt!“
Ich lachte. „Ach, Unsinn. Alt kannst du dich fühlen, wenn sie ihr erstes Kind bekommt.“
Mein Vater grinste. „Wer weiß, vielleicht ist es ja bald schon soweit. Du hast dich ja geschickt davongemacht, was das angeht.“
„Nicht absichtlich“, sagte ich. „Nur wollte ich es damals nicht und ich bin auch jetzt glücklich mit dem, was ich habe. Eine Familie... na, ich weiß nicht.“
„Jede Frau wünscht sich das“, behauptete meine Mutter. Ich nickte, denn das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dennoch war ich froh, mehr zu sein als die meisten Mädchen - mehr zu sein oder vielmehr mehr zu haben. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie es war, nicht schreiben oder rechnen zu können. Wie schafften manche Frauen es, von Händlern zu kaufen, ohne rechnen zu können?
„Das ist Fiannas letzte Nacht bei uns“, sagte meine Mutter traurig und seufzte. „Nun ist sie also auch schon soweit.“
„Iaroth wird ihr ein guter Mann sein“, sagte ich. „Zudem ist sein Vater wohlhabend.“
„Ich bin zufrieden mit ihrer Wahl“, tat mein Vater kund. Ich fand diesen Satz bemerkenswert, denn üblicherweise suchten die Eltern die Ehepartner für ihre Kinder aus. Als Fianna aber gestanden hatte, daß sie verliebt war, hatte niemand damit Schwierigkeiten gehabt. Wenigstens wurden wir nicht wie Adlige schon in Kindertagen verlobt.
Nein, sie hatte Glück gehabt und heiratete aus Liebe. Meist wählten junge Leute die standesgemäßesten Partner aus ihrem Umfeld und eine Ehe wurde arrangiert. Ich wußte, ich hätte das nicht gekonnt, und durch meinen Beitritt bei der Schwesternschaft war es mir erspart geblieben. Ich würde einmal aus Liebe heiraten können. Eine Schwester zu sein war die einzige Möglichkeit für ein Mädchen, einer Heirat im Alter von sechzehn bis achtzehn Jahren zu entgehen.
Die Tür wurde geöffnet und Fianna betrat die Küche. „Es ist alles so aufregend!“ sagte sie und ihre Augen strahlten dabei regelrecht.
„Das glaube ich dir“, sagte ich lächelnd. „Ich schaue eben nach Sangaiblan und dann gehen wir in unser Zimmer, was meinst du?“
„Oh ja!“ stimmte sie zu und stürmte bereits die kleine Treppe hinauf. Ich ging hinaus, nahm meine Tasche an mich und band Sangaiblan mit einer langen Leine an den Zaun, so daß er ein wenig Platz hatte, um sich zu bewegen. Er konnte sich auch unter einem Baum unterstellen, sollte es regnen.
Als ich sicher war, daß es ihm gut ging, kehrte ich ins Haus zurück und ging hinauf in das kleine Zimmer, das ich mir bis zuletzt mit meiner Schwester geteilt hatte. Anfangs, als ich noch klein gewesen war, hatte auch ein kleiner Bruder dort mit uns gewohnt. Allerdings war er mit knapp zwei Jahren in einem harten Winter gestorben und meine Eltern hatten keine weiteren Kinder mehr bekommen. Eins hatte meine Mutter auch verloren, das wußte ich. Ich erinnerte mich noch daran, wie ich sie eines Tages blutend am Küchenboden gefunden hatte. Damals war ich höchstens sechs gewesen. Glücklicherweise hatte sie es schadlos überstanden.
Ich warf meine Tasche auf meinen Strohsack und ließ mich hinein fallen. Fianna lag gegenüber auf ihrem Strohsack. Darüber hing an einem Haken ihr Hochzeitskleid.
„Du wirst wunderschön aussehen“, sagte ich.
„Neidisch?“ fragte sie augenzwinkernd.
„Ich weiß nicht... vielleicht. Ich stehe morgen nicht im Mittelpunkt, werde beschenkt und verliere meine Unschuld.“
Fianna errötete bis zu den Ohren, dann nahm ihr Gesicht einen ernsten Ausdruck an. „Ich habe Angst davor“, gestand sie.
Ich war überrascht. „Ach was. Das mußt du nicht. Was fürchtest du?“
„Daß es weh tut.“
„Das wird es nur, wenn Iaroth sich aufführt wie ein Trampel.“
Jetzt kicherte sie. „Das wird er nicht. Wir haben schon darüber geredet. Er hat mir versprochen, daß er sehr vorsichtig ist.“
„Aber dann ist doch alles bestens.“
Sie zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht... Ich weiß doch gar nicht, wie das ist! Zwar träume ich von ihm... ich stelle mir vor, wie es ist. Aber ich...“ Unschlüssig verzog sie das Gesicht.
„Es wird schon, keine Sorge. Es ist sicher sehr schön.“
Fianna seufzte. „Ich bin sehr glücklich, weißt du? Und jetzt bist du hier. Morgen wird der schönste Tag meines Lebens!“
Wie immer war ich früh auf den Beinen. Fianna schlief noch, als ich leise meine Hose und das Kleid anzog und die Stiefel an die Knöchel schnürte. Ohne einen Laut schlich ich aus dem Zimmer und ging nach unten. Da noch niemand dort war, beschloß ich, erst nach Sangaiblan zu sehen und brachte ihm einen Eimer mit Wasser, aus dem er saufen konnte, und tätschelte ihn sanft. Als ich zurück ins Haus ging, traf ich in der Küche auf meinen Vater. Auf dem Tisch standen noch immer die Körbe mit Fiannas Habseligkeiten und ihrer Mitgift, die wir am Vorabend verpackt hatten.
Augenblicke später betrat auch meine Mutter die Küche und umarmte mich. „Hast du gut geschlafen?“
„Ja, es war so still und... warm. Das hat mir gefehlt, wißt ihr?“
Sie lächelte und nickte. „Es ist sicher nicht immer leicht für euch.“
„Das stimmt. Ich hätte gar nichts dagegen, nicht mehr heimlich im Wald hausen zu müssen.“
Wir plauderten ein wenig, bis es an der Tür klopfte. Iaroth und sein Vater waren gekommen, um Fiannas Habe abzuholen. Es war ein alter Brauch, daß am frühen Morgen des Hochzeitstages der Bräutigam und sein Vater die Mitgift und den Besitz der Braut holten.
Mein Vater begrüßte beide sehr herzlich und bat sie herein. Sie ließen den kleinen Karren, den sie mitgebracht hatten, vor der Tür stehen.
Iaroth schaute mich mit funkelnden Augen an. „Hast du ihr Kleid schon gesehen?“
„Es hängt oben“, erwiderte ich.
„Oh, ich bin gespannt! Ich kann es kaum erwarten.“
Seine Ungeduld amüsierte mich. „Bald ist es ja soweit. Ich freue mich für euch.“
„Danke“, erwiderte Iaroth strahlend, dann begann er, die Körbe zum Karren zu tragen. Ich hätte den Männern gern dabei geholfen, aber es war ihnen vorbehalten. Also schaute ich nur zu.
Als sie fertig waren, unterhielten wir uns noch ein wenig und dann verabschiedeten unsere Gäste sich wieder. Ich beobachtete sie dabei, wie sie den Karren fortzogen und ging dann nach oben zu meiner Schwester, die inzwischen auch aufgewacht war.
Bald stieß meine Mutter dazu. Ich schaute dabei zu, wie sie Fianna ins Unterkleid half und es zuschnürte, dann konnte auch ich helfen. Meine Schwester zog das Hochzeitskleid über, meine Mutter richtete es überall und ich schnürte es zu. Anschließend holte meine Mutter die Schuhe, den Perlenschmuck und den Schleier, während ich Fiannas wundervolles blondes Haar bürstete und am Ansatz kleine Zöpfe zu flechten begann. Mehr war zu einer Hochzeit nicht erlaubt, denn alle Jungfrauen trugen ihr Haar offen. Bei der Hochzeit war das ein wichtiges Symbol.
Als ich mit dem Frisieren fertig war, zog sie den Schleier über und er wurde mit einem Band festgebunden, dann schlug Fianna ihn zurück und ließ sich in die Schuhe helfen. Sie legte den Schmuck an und präsentierte sich uns dann stolz.
Es rührte mich, sie so zu sehen. Sie war wunderschön, beneidenswert schön. Ich war zwar nicht unansehnlich, aber mit ihr hatte ich noch nie mithalten können.
Mein Vater hatte das Frühstück vorbereitet. Auch das war ein üblicher Brauch am Hochzeitsmorgen; während die Frauen in der Familie der Braut zur Seite standen, war es am Vater oder den Brüdern, das letzte Frühstück auszurichten.
Wir scharten uns gemeinsam um den Tisch und sprachen das Gebet, bevor mein Vater das Brot brach und uns allen ein Stück reichte. Ich mußte, während ich aß, meine Schwester nur ansehen und spürte, wie aufgeregt sie war. Nachdenklich kaute sie auf dem Brot herum und zappelte unter dem Tisch mit den Füßen herum. Das wußte ich deshalb, weil ich einige leichte Tritte spürte. Ein Glück, daß die Zeremonie schon bald stattfinden würde! Viel länger hätte meine Schwester das Warten auch nicht mehr ausgehalten. Für die Braut war die Zeit bis zur Hochzeit ein endloses Geduldsspiel, denn sie durfte sich niemandem außer ihrer Familie zeigen.
Sie ging hinauf in unser Zimmer. Als ich ihr wenig später folgte, sah sie mich wehmütig an.
„Das wird mir fehlen“, sagte sie. „Wir werden nie wieder beide hier sein.“
„Das stimmt. Aber wir sind jetzt erwachsen, irgendwann ist es immer soweit. Heute Nacht werde ich ja sehen, wie es ist, hier allein zu schlafen.“
„Du schläfst heute Nacht allein hier und ich...“ Sie seufzte. „Ich wünschte, ich hätte es schon hinter mir.“
„Das wird schon!“ sagte ich.
Als ich wieder hinunterging und aus dem kleinen Küchenfenster schaute, sah ich, wie einige der Nachbarn Tische und Stühle über die Straße trugen. Sie brachten sie zum Marktplatz, wo die heutige Feier stattfinden würde. Jeder im Dorf trug etwas zur Hochzeit bei, um dem Brautpaar zu demonstrieren, daß sie sich auf die Gemeinschaft verlassen konnten. Für das leibliche Wohl kamen meine Eltern auf, mit Ausnahme der Getränke. Das war Sache von Iaroths Vater. Es würde der letzte Tag im Leben der beiden sein, an dem die Eltern für sie sorgen würden. Deshalb wurde immer erst geheiratet, wenn fest stand, daß der Bräutigam eine Familie versorgen konnte, und Iaroth arbeitete bei seinem Vater. Wenn der Alte sich zur Ruhe setzte, würde Iaroth die Schlachterei übernehmen. Das war sein Recht als Erstgeborener in der Familie.
Fianna stand auf einmal hinter mir und beobachtete ebenfalls das rege Treiben auf der Straße. Sehnsüchtig schaute sie hinaus und wartete. Beinahe schaffte sie es, mich mit ihrer Aufregung anzustecken, was ich jedoch nicht zuzulassen versuchte. Es erfüllte mich mit Stolz, zu wissen, daß meine schöne kleine Schwester einen guten Mann gefunden hatte. Sie würde niemals Armut leiden und ich kannte Iaroth gut, er war nie ein Raufbold gewesen oder unvernünftig. Er war zuvorkommend und liebte meine Schwester, das wußte ich. Mehr konnte sie sich nicht wünschen. Mehr hatte sie auch nicht zu erwarten. Sie würde das tun, was den meisten Frauen vorherbestimmt war, und ich würde tun, wozu auch immer die Schwesternschaft mich berief. Dabei stand gar nicht fest, ob sie mich überhaupt berief. Bislang hatte ich mich durch kein besonderes Talent hervorgetan.
Endlich war es soweit und der Dorfälteste kam in Sichtweite. Fianna wurde mit einem Male noch viel nervöser, als meine Mutter herbeieilte, um ihren Schleier zu richten. Er war aus teurem Stoff gefertigt, dessen Gewebe so dünn und filigran war, daß man hindurchsehen konnte.
Beide eilten vor die Tür, als es auch schon klopfte. Mein Vater öffnete und begrüßte den Ältesten, Sai Laoden, höflich und zuvorkommend.
„Es ist soweit“, sagte Laoden und nahm Fiannas Hände in seine. „Es ist dein großer Tag, Kind.“
Meine Schwester nickte eifrig und ich sah, wie ihre Hände zitterten. Laoden legte eine Hand meines Vaters auf Fiannas, dann nickte er ihnen zu und ging voraus. Fianna und unser Vater folgten ihm, dann verließen auch meine Mutter und ich das Haus.
„Oh, das ist so aufregend“, sagte meine Mutter und griff nach meiner Hand. Ich drückte ihre fest.
Sai Laoden führte mich und meine Familie zum Dorfplatz, auf dem die Tische in einer großen Runde errichtet waren. Einen Durchgang gab es in die Mitte, und dort stand bereits Iaroth in seiner feinsten Kleidung und schaute erwartungsvoll zu uns hinüber. Seine Wangen röteten sich.
Der ganze Platz war bereits voller Menschen. Alle Dorfbewohner waren gekommen, alt und jung, einfach alle. Niemand würde heute arbeiten, denn alle feierten mit.
Sai Laoden trat neben Iaroth, während mein Vater und Fianna warteten. Iaroth stand dem Alten zugewandt, der meinem Vater schließlich einen Wink gab. Als die beiden zu ihm gingen, wurde es still. Meine Mutter und ich blieben stehen und mein Vater gesellte sich zu uns, als Fianna bei Laoden und Iaroth stand. Der Alte hielt die Hände der beiden in seinen und hob sie auf Kopfhöhe.
Meine Blicke schweiften über die mit bunten Kränzen geschmückten Tische. Kelche und Teller standen darauf, Schüsseln mit Brot und anderen guten Dingen, Obst und Krüge mit Wein und Saft. Den ganzen Tag würden wir nichts tun als essen - doch, tanzen vielleicht. Einige Burschen aus dem Dorf wollten mit ihren Instrumenten für die Musik sorgen.
„Seht, Einwohner Hertstols, diese beiden jungen Leute, die am heutigen Tage die Ehe schließen wollen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu dieser Feierlichkeit und der Zeremonie, zu der wir nun kommen wollen“, begann Sai Laoden.
Ich sah, wie Fianna ständig den Impuls unterdrücken mußte, sich zu mir umzudrehen. Iaroth schielte zu ihr. Er konnte gar nicht die Blicke von ihr lassen.
„An diesem heutigen Tage wollen Iaroth, Erstgeborener Merdars und Fianna, Drittgeborene Ainars, das heilige Bündnis schließen. Ihr alle werdet nun Zeugen der Eheschließung dieser beiden jungen Menschen, die ihren künftigen Lebensweg gemeinsam beschreiten wollen. Dies verleiht ihnen das Recht und die Pflicht, nur miteinander eine geschlechtliche Verbindung einzugehen und für die Nachkommen dessen gemeinsam und fürsorglich zu sorgen. Einmal geschlossen, wird dieses Bündnis unanfechtbar und jeder Ehebruch ist mit tiefer Schande zu ahnden.“ Laoden machte eine bedeutungsvolle Pause und schaute in die Runde. „Fortan wird niemand den Eheleuten begehrliche Blicke zuwerfen, denn sie werden es auch nicht tun. Wer die Braut unschicklich belästigt, soll davongejagt werden. Der Bräutigam schwört seiner Frau die Treue und darf die Ehe nur auflösen, wenn sie ihm keine gesunden Kinder gebärt.“
Ich seufzte. Ich hatte diesen Belehrungen schon oft gelauscht und wußte, Sai Laoden war noch längst nicht fertig. Ein Glück, daß mir diese Peinlichkeiten bislang erspart geblieben waren.
„Iaroth, nun höre deine Pflichten, die du als Ehemann hast: Du schwörst deiner Frau Treue, Sorge und Schutz. Du wirst allein sie lieben, sie und keine andere. Du wirst für sie sorgen und ihr Essen geben, wenn sie hungert, und du wirst ihr Obdach geben, wenn sie friert. Du wirst sie ehren und verteidigen, ihr Leben schützen mit deinem und zu den Waffen greifen, um sie zu retten. Du wirst dafür sorgen, daß sie dir gesunde Kinder schenkt und diese mit der nötigen Liebe und Strenge erziehen. All ihr Eigentum ist das deine und du wirst es pfleglich behandeln. Du wirst Fürsprache für sie halten und ihren Nöten mit Ernst begegnen. Du bist ab dem heutigen Tage ihr Vormund und kannst in allen öffentlichen Angelegenheiten für sie sprechen.“
Unbemerkt biß ich mir auf die Lippen und versuchte, nicht zu grinsen. Wäre Saia Cathernin hier gewesen, es hätte einen heftigen und vermutlich unschönen Disput über diese rechtlichen Vereinbarungen gegeben. Sie war die einzige Frau in Khasarud, die ein Vormund war, und das gleich über all die Angehörigen der Schwesternschaft der Klinge. Und das auch nur, weil das khasarische Gesetz einen Vormund für jeden Schutzbefohlenen verlangte - Frauen und Kinder. Ihr Vormund war der König gewesen, doch sie hatte sich bislang geweigert, Elliut die Treue zu schwören und so war sie in ihrem Exil die freieste Frau des Königreichs.
„Wenn du Fianna zur Ehefrau nehmen möchtest, dann leiste vor all diesen Zeugen deinen Schwur“, nahm Laoden den endlosen Sermon wieder auf. Ich merkte auf; endlich war Iaroth an der Reihe.
„Ich schwöre, daß Fianna vom heutigen Tage die einzige Frau für mich sein wird; die Mutter meiner Kinder, die Herrin meines Hauses. Ihr gehören mein Herz und meine Seele, ich werde für sie sorgen und sie lieben bis zum Tod.“ Seine Stimme zitterte, als er das sagte. Mir lief ein Schauer über den Rücken, denn es war immer wieder ergreifend, einen solchen Schwur zu vernehmen. Die meisten Menschen leisteten keinen zweiten in dieser Art.
Ich sah, wie Fianna zu wachsen schien und grinste. Ja, mir hätte es auch gefallen, wenn ein Mann mir so etwas geschworen hätte. Aber der einzige, bei dem ich mir das bislang gewünscht hätte, hatte es vorgezogen, es einer anderen entgegenzuhauchen. Sie war bereits mit dem zweiten Kind schwanger. Es war ungerecht...
„Fianna, nun höre deine Pflichten, die du als Eheweib hast: Du schwörst deinem Mann Treue, Ergebenheit und Respekt. Für dich gibt es fortan nur ihn als Mann, ihn allein. Du wirst stets gehorsam sein und für sein Wohl sorgen, wenn er dessen bedarf, und seinen Entscheidungen folgen. Du wirst für euer Heim sorgen und sehen, daß ihr stets zu Essen habt und es euch an nichts mangelt. Du wirst sparsam mit den Mitteln sein, die er dir gibt. Es ist deine Aufgabe als seine Frau, ihm starke Kinder zu schenken und ihnen eine gütige und liebevolle Mutter sein, die auch die nötige Strenge walten läßt. Vom heutigen Tage an gehören ihm all deine Habseligkeiten und er wird sie sorgfältig verwalten und sich um deine Sorgen mühen. Ab sofort wird er und nicht mehr dein Vater für dich sprechen und öffentlich entscheiden. Wenn du nun Iaroth zum Ehemann nehmen möchtest, so leiste deinen Schwur vor all diesen Zeugen.“
Meiner Mutter standen Tränen in den Augen. Das wunderte mich nicht, denn sie war manchmal sehr sensibel. Ich fühlte hingegen mit Fianna und war mittlerweile genauso aufgeregt, wie sie es war. Dabei wußte ich nicht, ob ich diesen Schwur je hätte leisten können. Ich war in allen kleinen Entscheidungen frei und selbst die große, zur Schwesternschaft zu gehen, hatte ich allein treffen dürfen. Das war die einzige Entscheidung, die junge Mädchen ganz allein treffen durften; das war sogar gesetzlich verankert. Die Schwesternschaft der Klinge genoß besondere Privilegien.
Als meine Schwester die Stimme erhob, stand ich plötzlich stocksteif und lauschte. „Ich schwöre, daß Iaroth vom heutigen Tage an der einzige Mann für mich sein wird. Ich werde ihm Kinder gebären und ihn für mich sprechen lassen. Ihm gehören mein Herz und meine Seele, ich werde ihm treu sein und ihn lieben bis zum Tod.“
Sai Laoden nahm seine Hand von denen der beiden und zückte seinen Dolch, so daß meine Mutter zusammenfuhr. Ich rührte mich nicht.
„Wohlan, besiegelt den Bund mit eurem Blut, auf daß ihr zahlreiche Nachkommen haben werdet und ein starkes Geschlecht daraus erwächst!“ sagte Laoden und drehte Fiannas Handfläche nach oben. Er ritzte ganz leicht in ihre Haut, nur daß es eben blutete, und wiederholte es bei Iaroth. Dann führte er die Hände der beiden wieder zusammen, um sie abschließend mit einem symbolischen Band zu bedecken und laut zu rufen: „So seien sie Mann und Frau!“
Meine Mutter lehnte sich schwer an mich und ich seufzte. Irgendwie fühlte es sich jetzt nicht anders an als vorher - zumindest für mich. Allerdings bescherte der laute Jubel mir eine Gänsehaut.
Den Familien stand die Ehre zu, die Brautleute zuerst zu beglückwünschen. Zwar versuchte Fianna, kein Blut auf ihr Kleid tropfen zu lassen, aber meist geschah es und hatte inzwischen einen symbolischen Wert, wie so ziemlich alles an diesen Riten. Nicht umsonst würde am kommenden Morgen vor ihrem Fenster das Laken hängen, auf dem sie ihre Jungfräulichkeit verloren haben würde. Es reichte ja nicht, daß sie bereits geschworen hatte, noch eine zu sein. Iaroth hatte niemand gefragt.
Ich beschloß, mich nicht daran zu stören und umarmte meine kleine Schwester. Wäre ich keine Schwester gewesen, heute hätte ich mich schämen müssen, daß sie vor mir vermählt war. Aber so war es rechtens und gut.
Ich spürte, wie sie vor Rührung weinte, als sie mir in den Armen lag. Ich umarmte auch Iaroth, obwohl sich das eigentlich nicht gehörte, aber bei mir würde niemand etwas sagen. Das gefiel mir. Ich wurde gleich darauf auch von den Gästen beglückwünscht, obwohl ich nun wirklich nichts damit zu tun hatte. Als die Stimme meiner Mutter sich beinahe überschlug, drehte ich mich um.
„Das kann man nicht auswaschen!“ rief sie bestürzt und ich sah, daß Iaroth betroffen auf seine Hand schaute. Ein kleiner Blutstropfen war auf Fiannas weißem Rock zerplatzt. Ich verdrehte die Augen. Stumm stellte ich mich neben meinen Vater, der nur den Kopf wandte und mich ansah. Dann lächelte er.
„Warum so unwirsch?“ fragte er.
Wie sollte ich ihm das erklären? Ich hatte bei der Schwesternschaft gelernt, woher diese Riten stammten und daß sie aus einer Zeit rührten, in der die Schwesternschaft noch geächtet gewesen war. Riten, so hatte ich gelernt, gaben den Menschen Orientierung und Halt. Die Schwesternschaft hatte mich gelehrt, darauf verzichten zu können. Wir feierten auch viele Feste nicht, denn unser Glaube war, daß wir Kraft aus uns selbst schöpften.
Schließlich drückte ich es genauso aus. Mein Vater nickte aufmerksam und sagte dann nachdenklich: „Du hast die Seele eines wilden Löwen, genau wie dein Großvater. Ich weiß, daß du es nicht brauchst, aber die meisten anderen brauchen es. Sei ihnen deshalb nicht gram.“
„Das bin ich nicht“, sagte ich. „Ich kenne meine Schwester. Es ist ihr schönster Tag im Leben, aber mir wäre übel angesichts ihres Schwures, wüßte ich nicht, daß Iaroth ein guter Junge ist.“
Mein Vater nickte langsam. „Da kann ich dir nur zustimmen.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen, als er das sagte. Mein Vater war stets ein gewöhnlicher Mann gewesen, aber er war sehr klug, beinahe weise. Das hatte er vielen voraus.
Es fiel mir nicht schwer, beschwingt mit den Menschen aus unserem Dorf zu feiern. Brot und Käse wurden gereicht und ich hatte die Ehre, gleich neben meiner Schwester sitzen zu dürfen, die glaubte, ich sähe ihre Freudentränen unter dem Schleier nicht. Den würde sie bis Mitternacht nicht abnehmen, und dann würde er beim Abschlußtanz zerrissen werden und Iaroth würde sie über die Schwelle tragen und...
Die Kinder rannten über den Platz, spielten Nachlaufen, aber zur Mittagsstunde wurden sie alle wieder eingefangen, denn es sollte ein großes Mahl geben. Während ich an meinem Apfelwein nippte, beobachtete ich, wie Fianna ihre Finger um Iaroths schlang und er seine Hand zögerlich auf ihr Knie legte. Mir lag schon ein Kommentar auf der Zunge, aber ich schluckte ihn herunter. Er würde bis Mitternacht warten.
Ich sah auch Conarth und seine Frau. Es war vorbei, daß ich mich an ihre Stelle wünschte, aber die Rundung ihres Bauches ließ eine brennende Sehnsucht in mir aufkeimen. Nicht nach einem Kind, sondern nach der Leidenschaft, die mit Liebe verbunden war. Bei der Schwesternschaft hatte ich viel davon gehört. So viel, daß ich eines Abends, nachdem ich in einem Gasthaus in Harlaen zuviel getrunken hatte, aus keinem besonderen Grund heraus dem eindeutigen Angebot eines gutaussehenden Burschen gefolgt war. Es war extrem dumm und riskant gewesen, denn ich war als Schwester zu erkennen und erst seit einigen Wochen dort gewesen. Hätte er gewollt, hätte er mir alles ruinieren können, denn solcherlei Kontakte waren streng verboten.
Wie auch immer, ich war zu betrunken gewesen, um mir das bewußt zu machen, und wir waren auf seinem Strohsack gelandet, er hatte mir die Hose ausgezogen und dann hatte ich meine Unschuld verloren. Ich erinnerte mich nicht mehr an viel, aber ich wußte, daß er nicht besonders vorsichtig gewesen war. Es hatte weh getan. Es war auch nicht schön gewesen. Insofern war ich froh, daß ich nicht mehr viel wußte.
Ich war wie ein geprügelter Hund in die Schule zurückgeschlichen und hätte schreien mögen, hatte es aber nicht getan. Ich hatte es für mich behalten und nie irgendjemandem anvertraut, weil mir klar war, was ich da getan hatte. Zum Glück hatte ich es bald selbst vergessen, denn der König war kurz darauf ermordet worden und wir ins Exil geflohen.
Aber ich wollte immer noch wissen, ob es so schön war, wie die Schwestern uns erzählt hatten. Viele hatten auch erzählt, daß sie ihre Erfahrungen auf ähnliche Weise gemacht hatten wie ich, nur waren sie schon initiiert gewesen und hatten es gedurft. Sie berichteten von Spaß und Leidenschaft und ich hatte nur Ernüchertung erlebt.
Vielleicht konnte ich ja bald meine kleine Schwester fragen.
Die Mittagsruhe wurde auch heute eingehalten. Alle gingen nach Hause, bis auf ein paar Unermüdliche, die den Wein nicht verlassen wollten und lautstark kundtaten, auf alles aufpassen zu wollen.
Im ganzen Dorf konnte meines Wissens niemand wirklich ein Schwert führen, aber ich hatte ohnehin andere Sorgen. Ich war, genau wie Iaroths jüngerer Bruder, dazu abgestellt, die beiden Frischvermählten nicht aus den Augen zu lassen. Das wurde aber nicht schwierig, weil wir in die Felder liefen und Fianna die Gelegenheit nutzte, ungestört mit mir zu plaudern. Iaroth legte sich derweil in die Sonne und machte ein Nickerchen.
„Das ist alles so spannend“, freute sie sich und ich sah das Funkeln ihrer Augen auch durch den Schleier. „Wir haben so viele Geschenke bekommen! Ich habe sogar schon Spielzeug für unser erstes Kind... weißt du, was Iaroths bester Freund ihm geschenkt hat?“ Ich schüttelte den Kopf. „Zermahlenen Ochsen... du weißt schon. Damit er ausdauernder wird.“
Ich prustete los. „Der weiß natürlich genau, wovon er spricht!“ Iaroths bester Freund war ein Aufschneider, fast achtzehn und noch nicht verlobt. Meines Wissens hatte er auch noch kein Mädchen betrunken genug machen können, um einschlägige Erfahrungen sammeln zu können.
„Lustig ist nur, daß Iaroth es mir stolz gezeigt hat und meinte, das müsse er unbedingt ausprobieren“, fügte Fianna hinzu.
„Ach, Unsinn. So etwas bräuchte er nicht, wenn er wüßte, was ich weiß.“
„Was weißt du denn?“ fragte sie mit leuchtenden Augen.