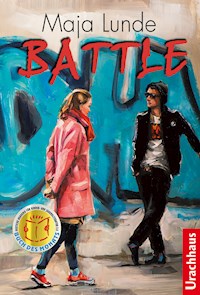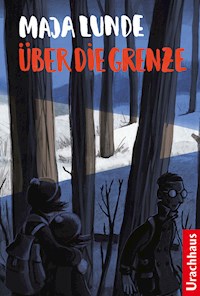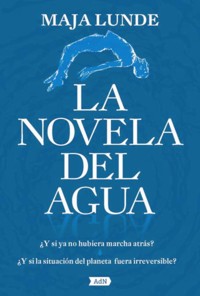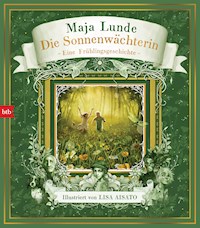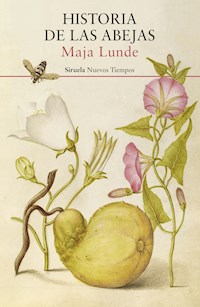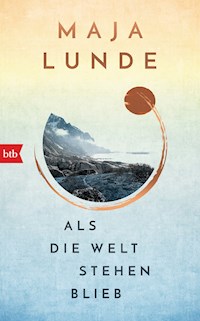
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maja Lundes bislang persönlichstes Buch.
SPIEGEL-Bestsellerautorin Maja Lunde führt uns zurück in jene Märztage, als die ganze Welt stehen blieb. Tage, die uns erschüttert haben und noch immer erschüttern. Die tiefe Risse hinterlassen haben in dem Glauben an unsere Unverletzbarkeit. Maja Lunde zeigt uns, was im Leben wirklich wichtig ist: die kleinen Dinge im menschlichen Miteinander.
Sie sind eine fünfköpfige Familie. Die Erwachsenen haben sich gerade gestritten, als die Nachricht vom Lockdown eintrifft: Von nun an werden sie zu Hause sein. Alle zusammen. Jeden Tag. Die Autorin Maja Lunde ist daran gewöhnt. Sie ist das Home Office gewöhnt. Aber nicht das Home Schooling. Sie hat große dystopische Romane geschrieben, aber sie hat nie in einer Dystopie gelebt. Doch jetzt ist die Pandemie da und die Familie muss eine neue Lebensweise finden. Wie geht so etwas?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Sie sind eine fünfköpfige Familie. Die Erwachsenen haben sich gerade gestritten, als die Nachricht vom Lockdown eintrifft: Von nun an werden sie zu Hause sein. Alle zusammen. Jeden Tag. Die Autorin Maja Lunde ist daran gewöhnt. Sie ist das Home Office gewöhnt. Aber nicht das Home Schooling. Sie hat große dystopische Romane geschrieben, aber sie hat nie in einer Dystopie gelebt. Doch jetzt ist die Pandemie gekommen und trifft die Menschen ausgerechnet da, wo sie sich am nächsten sind. Die Familie muss wie die ganze Gesellschaft eine neue Lebensweise finden. Wie aber geht so etwas?
Maja Lunde führt uns zurück in jene ersten Tage der Pandemie, als die ganze Welt für einen Moment stehen blieb. Tage, die uns erschüttert haben und noch immer erschüttern. Die tiefe Risse hinterlassen haben in dem Glauben an unsere Unverletzbarkeit. In ihrem bislang persönlichsten Buch zeigt Maja Lunde, was im Leben wirklich wichtig ist: der Zusammenhalt der Familie und die kleinen Dinge im menschlichen Miteinander.
Zur Autorin
Maja Lunde wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Ihr Roman »Die Geschichte der Bienen« wurde mit dem norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet und sorgte auch international für Furore. Das Buch wurde in 30 Länder verkauft, stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und war der meistverkaufte Roman 2017. Zuletzt erschien der dritte Teil ihres literarischen Klimaquartetts, »Die Letzten ihrer Art«.
Maja Lunde
ALS DIE WELT STEHEN BLIEB
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »De første dagene« bei H. Aschehoug & Co., Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by btb Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © plainpicture/Thomas Günther,
© Shutterstock/Vadim Georgiev; aaltair; haraldmuc
ISBN 978-3-641-27311-8V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Mittwoch, 11. März
Der Alarm schrillt. Eine Lautsprecherdurchsage fordert uns auf, das Gebäude zu verlassen, während die Bibliothekarin hektisch hin- und herläuft. Hören Sie nicht darauf, sagt sie, das ist ein Fehler, die Mitarbeiter haben jetzt Feierabend, aber Sie dürfen noch bleiben, heute gelten ja die verlängerten Öffnungszeiten. Doch die Stimme tönt weiter aus dem Lautsprecher. Die Bibliothek schließt in Kürze, bitte verlassen Sie das Gebäude. Nein, nein, wiederholt die Bibliothekarin und lächelt entschuldigend, ich weiß nicht, was los ist, die Anlage wird zentral gesteuert, Sie können einfach sitzen bleiben.
Ich sollte aber gehen. Der Jüngste kommt bald von der Nachmittagsbetreuung zurück, der Mittlere hat bestimmt wieder beim Spielen alles um sich herum vergessen und noch kein Mittagessen gehabt. Außerdem habe ich den ganzen Tag kein einziges Wort geschrieben. Ich springe von einem Dokument zum nächsten, von dem Theaterstück, das ich gerade schreibe, zu dem Roman, mit dem ich endlich anfangen will. Doch die Onlinemedien lenken mich ab, und selbst wenn ich am Laptop das Internet ausschalte, greife ich ständig nach meinem Handy. Ich kann es einfach nicht lassen, es ist zu einem Teil von mir geworden, wie eine Prothese. Nein, eine Nabelschnur … die mich mit Nährstoffen versorgt, mit den Empfehlungen und Auflagen der Gesundheitsbehörde. Aber auch mit Angst.
Schließt die Schulen, schreiben Menschen in meinem Umfeld, schließt die Schulen, bevor es zu spät ist.
Ich chatte mit Freundinnen. Versuche ein bisschen zu scherzen. Will wissen, wie es den Menschen geht, die mir am Herzen liegen, und schicke Mitteilungen in die Familiengruppe, die aus meinem Vater, meiner Bonusmutter und meinen beiden Brüdern besteht, und unseren Partnerinnen und Partnern. Ich habe ein solches Bedürfnis, von ihnen zu hören. Vor allem von meinem jüngsten Bruder. Er hat vier Kinder. Die beiden Jüngsten sind Zwillinge. Um den kleineren der beiden machen wir uns Sorgen, seit er geboren ist. Er wird viel zu leicht krank. Er kann immer noch nicht laufen. Wir ängstigen uns um ihn, auch wenn wir es nicht laut aussprechen.
Während ich chatte, trudeln die Absagen ein. Abgesagt, abgesagt, abgesagt. Alle Veranstaltungen, die ich besuchen wollte, werden abgesagt, alles verschwindet. Und dann ertönt die Lautsprecherdurchsage ein weiteres Mal. Die Bibliothek leert sich. Das Handy ist schon ganz warm in meiner Hand. Mein Daumen schmerzt. Endlich klappe ich den Laptop zu, der längst in den Standby-Modus gesunken ist, und packe meine Tasche. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Die Bücher werfen mich raus, denke ich, während die Schiebetüren hinter mir zugleiten.
Draußen weht ein kalter Wind, ich stapfe hastig bergauf nach Hause. Unterwegs rufe ich meinen Vater an. Er gehört zur Risikogruppe, ist 71 Jahre alt und hat Asthma. Er möchte in sein griechisches Ferienhaus, die Flugtickets sind schon gebucht, er will noch im März fliegen. Dorthin sehnt er sich in den langen, dunklen Wintermonaten, wenn er seine zehn Enkelkinder in Kindergärten und Horte bringt, wenn er laufende Nasen abwischt und dreckige Gummihosen reinigt. Mein Vater fährt nicht mal Ski, er denkt an nichts anderes als an das Haus dort unten, an die Insel, den Frühling, der so früh kommt. Und er freut sich. Du kannst nicht dorthin, sage ich. Lieber Papa, du kannst nicht dorthin, allein der Gedanke macht mir schon Angst. Stell dir vor, du wirst dort krank. Ich sehe es schon vor mir, wie du da liegst, auf der Insel, krank und allein. Mal abwarten, erwidert Papa, mal abwarten.
Wir legen auf, und mein Finger sucht in den Kontakten nach meiner Mutter. Sie wird am Freitag siebzig. Auch sie gehört zur Risikogruppe, aufgrund ihres Alters und einer Vorerkrankung. Wir sprechen darüber, wie wir jetzt feiern sollen. Vielleicht können wir nicht ins Restaurant gehen, wie wir es eigentlich vorhatten. Wir müssen das Beste draus machen, sage ich, du wirst immerhin siebzig. Ja, erwidert sie, stell dir vor, ich werde siebzig, das ist so unwirklich, Maja.
Donnerstag, 12. März
Die Ministerpräsidentin sagt: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir heute die einschneidendsten und härtesten Maßnahmen treffen werden, die je in Friedenszeiten in Norwegen getroffen wurden.
Mein Mann und ich sitzen im Auto. Er umklammert das Lenkrad mit beiden Händen, ich habe meine in die Hosentaschen gesteckt. Wir schweigen, haben uns gerade gestritten, über irgendeine praktische Angelegenheit, aber eigentlich ging es um uns. Der gleiche Streit wie immer, bei dem ich nachgebe und er stur bleibt, wie wir es schon immer tun, seit wir vor fast 23 Jahren zusammenkamen. Aber heute war der Streit schlimmer als sonst, und er lässt mich nicht mehr los, bringt mich zum Zittern, zum Schwitzen, während wir der Pressekonferenz der Ministerpräsidentin lauschen. Vielleicht ist es auch nicht der Streit, der mich zittern lässt, sondern es sind die Worte der Ministerpräsidentin.
Es ist zu viel, es geschieht tatsächlich und ist doch nicht zu glauben. Ich reiße mich zusammen, die ganze Zeit reiße ich mich zusammen. Aber als wir vor unserem Haus halten und sitzen bleiben und weiter zuhören, nachdem der Motor längst ausgeschaltet ist, fange ich an zu weinen.
Das erinnert an das Attentat vom 22. Juli, denke ich. Das erinnert an 9/11. Trotzdem kann man es nicht vergleichen, weil es kein einzelnes Ereignis ist. Ereignisse geschehen, Ereignisse gehen vorüber, es liegt in der Natur der Ereignisse, dass sie vorübergehen. Aber dies scheint etwas zu sein, was gekommen ist, um zu bleiben.
Kann ich den Schock beschreiben? Das Unwirkliche? Das Gefühl des Unwirklichen? Dass mir etwas widerfährt, mir, und doch einer anderen. Dass man sich selbst von außen betrachtet. Das ist ein Klischee. Und ich sehe gar nicht mich selbst von außen, ich sehe uns alle, das ist ein Film, eine fiktive Geschichte, eine Geschichte, wie ich sie selbst hätte erfinden können. Wie soll ich jetzt schreiben, keine meiner Geschichten kann das übertreffen.
Wir schließen die Autotüren und gehen hinein. Im Flur liegen lauter fremde Schuhe verstreut. Das Haus ist voll, der Älteste hat fünf seiner Freunde mitgebracht, nachdem die Schule geschlossen wurde. Ich laufe umher, versuche mich ein bisschen um jeden von ihnen zu kümmern, frage, wie es ihnen geht. Diese großen, schlaksigen Jungs mit ihren stimmbrüchigen Stimmen und ihren unbeholfenen Bewegungen haben einen großen Mitteilungsdrang. Und das Bedürfnis, zusammen zu sein. Sie hocken dicht gedrängt auf dem Sofa und gucken einen Film, eine Komödie. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen großen Körpern machen soll, die so nah beieinandersitzen. Ich rufe eine andere Mutter an. Ich will sie nicht rauswerfen, sage ich, aber vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig? Du musst ihnen sagen, dass sie gehen sollen, meint sie sehr bestimmt, sie müssen nach Hause, getrennt voneinander. So ist das jetzt. Ja, sage ich und stehe auf. Ich fühle mich nicht viel älter als die Jungs, als ich diese Ansage mache, unbeholfen und entschuldigend. Ich bringe sie zur Haustür, plaudere nett mit ihnen, erkläre, es sei am besten, wenn sie sich draußen träfen, sie könnten ja zusammen einen Spaziergang machen, kicken, solche Sachen. Ein Lagerfeuer im Wald vielleicht. Sie nicken. In den Wald gehen, ja, das können wir machen. Sie wollen tatsächlich einen Ausflug in den Wald machen, die Fünfzehnjährigen.
Ich schreibe einen Roman über eine Krankheit, der in Spitzbergen spielt. Eine kleine Dorfgemeinschaft wird im Jahr 2110 von einer Epidemie heimgesucht. Nur wenige Menschen überleben, und meine Geschichte soll von diesen Überlebenden handeln. Es ist der vierte Teil meiner Romanserie, der die drei früheren miteinander verbinden soll, wie ein Puzzlespiel, in dem alle Teile ein großes Bild ergeben, eine vollständige Erzählung, sage ich immer. Seite um Seite mit Notizen, ein klarer Erzählrahmen, eine charakteristische Hauptfigur. Ich hatte die völlige Kontrolle über dieses Buch.
Abends essen wir Tacos. Es duftet wie an einem Freitag. Mein Mann versucht, ein paar Corona-Scherze zu machen, um die Stimmung aufzulockern. Ich bin irritiert und versuche es zu verbergen. Er findet mich sicher zu ernst. Vielleicht ist auch er irritiert und verbirgt es. Das war gut, sage ich, jetzt bin ich aber satt. Allerdings habe ich schon nach zwei Stunden wieder Hunger. Es ist, als würde der Körper vor lauter Angst besonders viel verbrennen.
Nach dem Essen legt sich mein Mann hin. Mir ist ein bisschen warm, sagt er. Mir auch, sage ich, und es ist, als hätte ich einen Druck auf der Brust. Glaubst du, das geht gerade allen so? Wir umarmen uns, lächeln unsicher, mir hängt noch immer der Streit nach. Ich lege meine Hand auf seine Stirn. Bin ich warm, fragt er. Nein, antworte ich. Das innere Fieber, sagt er. Du mit deinem inneren Fieber, sage ich. Jetzt lächeln wir richtig, umarmen uns erneut. Es ist eine Umarmung ohne Hintergedanken, denke ich, eine Umarmung, die nichts wiedergutmachen muss.
Mein Vater schreibt eine Nachricht in den Familienchat: »Hallo, ihr Lieben. Norwegen hat entschieden, dass ich nicht nach Griechenland fahren sollte. Und ich habe es auch. Danke, dass ihr euch so um mich sorgt. Grüße, Opa.«
Ich bilde mir ein, die erleichterten Seufzer meiner Brüder durch den Äther zu hören, als sie beide sofort antworten: »Das klingt vernünftig!«, und: »Die Nation dankt dir!« »Gut zu hören«, schreibe ich und setze einen Punkt dahinter. Eigentlich hätten es drei Ausrufezeichen sein müssen.
Die ganze Familie schaut Nachrichten. Wir versammeln uns um den Fernseher wie um ein Lagerfeuer. So bleiben wir auch während der gesamten Sondersendung im Anschluss sitzen, und als sie zu Ende ist, wollen wir mehr. Aber die beiden Jüngeren müssen ins Bett. Wir sollten die Nacht nicht zum Tag machen, sage ich, wir müssen uns vorstellen, morgen wäre ein ganz normaler Tag. Ich lese dem Jüngsten etwas vor, zwei Kapitel, mit hektischer Stimme. Ich werde die ganze Zeit wie magisch vom Fernseher und vom Handy angezogen, will aus dem Zimmer. Der Jüngste quengelt, ich solle noch mehr lesen. Nein, sage ich, jetzt muss ich die Nachrichten sehen, gute Nacht. Ich umarme ihn und gehe zur Tür. Er ruft, er wolle noch einmal umarmt werden. Gute Nacht, sage ich, du musst jetzt wirklich schlafen. Das war kein schönes Ins-Bett-Bringen, sagt er. Ich setze mich aufs Sofa und bereue es und weiß, dass ich das anders machen müsste, aber ich schaffe es nicht, nicht heute. Stattdessen bleibe ich mit dem Handy und dem Laptop vor dem laufenden Fernseher sitzen. Mein Mann kommentiert, Jonas Gahr Støre von der Opposition würde sich in der Debatte gut schlagen, aber ich bekomme nicht mit, was er sagt. Ich bekomme gar nichts mit.
Ich kann nicht schlafen, gehe im Wohnzimmer auf und ab. Außer mir ist niemand wach. Nicht hier, aber vielleicht anderswo. Ich trage eine große Last. Es ist die Last all dessen, das ich auf uns zukommen sehe. Wir alle tragen die Last unseres gemeinschaftlichen Schocks, und es hilft nichts, dass wir sie gemeinsam tragen, wir alle, die wir in diesem Moment in einem stillen Haus von Zimmer zu Zimmer gehen.
Ich öffne die Terrassentür und gehe hinaus. Ein unglaublich heller Stern erleuchtet den Himmel im Westen. Oder ist es ein Flugzeug oder Hubschrauber? Ich bleibe lange stehen und betrachte den leuchtenden Punkt. Er bewegt sich nicht. Es ist tatsächlich ein Stern. Doch er ist so groß, so strahlend, ich kann mich nicht erinnern, ihn je gesehen zu haben.
Ich steige die Treppe hinab, trete auf den Rasen hinaus, drehe mich zu den erleuchteten Fenstern um. Ein zweistöckiges Haus, ein ziemlich verwilderter Garten, den eine Thujahecke, die wir »die Mauer« nennen, abschirmt von der Straße. Der frühere Eigentümer hatte die Hecke gepflanzt und viel zu groß werden lassen. Jetzt können wir sie nicht mehr stutzen, denn dann würde sie eingehen, so ist das mit Thuja. Überall im Garten liegen Steine, kleine und große, als hätte sie jemand wild durch die Gegend geschleudert. Das Haus, die Hecke, der Garten; das ist alles, was existiert.
Freitag, 13. März
4:03 Uhr. Ich hole tief Luft, stecke in einem Traum fest. Nein, es ist kein Traum. Es ist eine andere Wirklichkeit. Ich bleibe im Bett liegen, merke aber schnell, dass ich nicht wieder einschlafen kann, ehe ich nicht aufgestanden bin, ein bisschen in einem Buch gelesen, ein Glas Wein getrunken, eine Kleinigkeit gegessen habe. Also krieche ich aus dem Bett, esse eine Banane, trinke etwas Wasser. Aber ein Buch nehme ich nicht in die Hand. Ich schalte nur wieder das Handy ein, der Bildschirm ist das einzige Licht im Zimmer. Ich scrolle, suche nach Wörtern, die einen Sinn ergeben, finde aber keine.
A blessing in disguise. Genau diese Worte gehen mir schon seit Februar wieder und wieder durch den Kopf. Auf Englisch. Mit großem Pathos ausgesprochen, wie in einem Hollywood-Film. Wir wissen schon lange, dass wir uns verändern müssen, ohne es hinbekommen zu haben. Jetzt sind wir dazu gezwungen. Wir haben uns immer wieder gefragt, wie wir es schaffen könnten, nicht mehr Auto zu fahren, zu fliegen, zu kaufen und zu konsumieren, und das war die Antwort. Sie gefällt mir nicht.
Unser mittlerer Sohn stürzt sich noch vor dem Frühstück ins Homeschooling. Erledigt seine Aufgaben, so schnell er kann. Der Jüngste schmollt, wir müssen drängeln und drohen. Ihn locken und überlisten. Mein Mann ist in Gedanken woanders. Bei den Mitarbeitern der Firma, in der er arbeitet. Er bräuchte die Möglichkeit, sich ins Homeoffice zurückzuziehen, aber ich muss zum Arzt. Ein Knoten in der Brust. Eine Zyste, ich weiß, dass es eine Zyste ist. Ich hatte schon mal eine. Trotzdem muss sie untersucht werden, und den Termin hatte ich schon vor zwei Wochen vereinbart. Jetzt sitze ich hier, habe das Gefühl, die Zeit der Ärztin für etwas in Anspruch zu nehmen, das bestimmt nicht gefährlich ist, dabei wird sie sicher andernorts gebraucht, von anderen Patienten. Meine wunderbare Ärztin versichert mir aber, dass es trotz allem richtig war zu kommen. Die Radiologen beim Screening wissen sowieso nicht, wie man ein Beatmungsgerät bedient, erklärt sie lächelnd.
Auf dem Rückweg rufe ich meine Mutter an, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Und um mich zu erkundigen, ob sie sich ganz sicher ist, dass sie uns heute treffen will. Ich erzähle, dass mein Mann gestern leichtes Fieber hatte. Wir glauben, es ist nichts Ernstes, erkläre ich ihr, zu dieser Jahreszeit sind sowieso alle erkältet, aber zur Sicherheit? Ich werde immerhin siebzig, erwidert sie, ich möchte gern feiern. Ja, sage ich, aber das ganze Land schränkt sich ein, um Menschen wie dich zu schützen. Ich weiß, sagt sie, es ist nur so ungewohnt, meinst du denn, wir sollten es lieber bleiben lassen? Ich weiß nicht, antworte ich, ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen, das musst du bestimmen. Aber jetzt ist er wieder ganz gesund, fragt sie. Ja, heute fühlt er sich ganz normal, und ich glaube sowieso, dass er sich das nur eingebildet hat. Es wird schon nichts passieren, sagt sie. Ja, sage ich, es wird schon nichts passieren, aber du musst das entscheiden, es ist dein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie lacht.
Was ist eigentlich mit Oma, frage ich sie anschließend, hast du im Pflegeheim angerufen? Das habe ich noch vor, antwortet meine Mutter, aber es geht ihr dort sicher gut. Und sie bekommt von alldem ja ohnehin nichts mit.
Meine Großmutter erinnert sich an so wenig. Eine Stimme, ein Lächeln, manchmal. Und die Jungen, an die erinnert sie sich, dass es Jungen sind, dass sie es gern hat, wenn die Jungen kommen. Sie bringen sie immer zum Lachen.