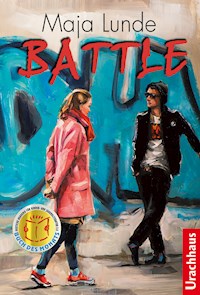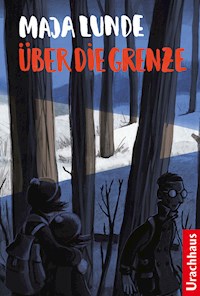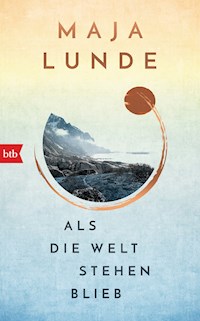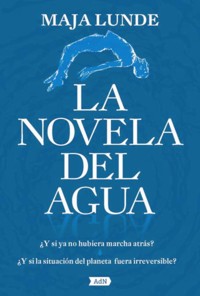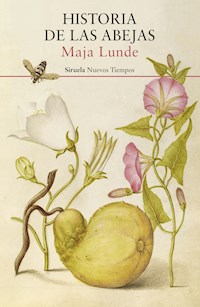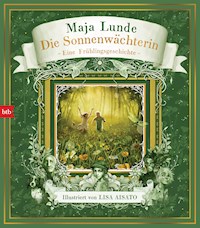
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Jahreszeiten-Quartett
- Sprache: Deutsch
Lilja hat nur eine vage Erinnerung an die Sonne. Sie lebt mit ihrem Großvater in einer Welt, in der es immer nur regnerisch und trübe ist. Der Großvater versorgt das Dorf mit Gemüse, doch der Boden ist so feucht, dass sich kaum etwas anpflanzen lässt. Eines Tages entdeckt Lilja einen geheimen Pfad in den Wald, in den die Kinder eigentlich nicht gehen dürfen. Aber Lilja ist nicht wie andere Kinder, sie schluckt die Furcht herunter und folgt dem Pfad in die Dunkelheit. Im Inneren des Waldes wartet eine ganz neue Welt auf sie, und das Abenteuer beginnt: Lilja muss sich ihren größten Ängsten stellen, findet aber auch Liebe und Freude. Und schließlich auch die Hoffnung auf einen neuen Frühling. Nach "Die Schneeschwester": ein neuer Band im großen Jahreszeitenquartett von Maja Lunde und Lisa Aisato.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eine Frühlingsgeschichte
Mit Illustrationen von Lisa AisatoAus dem Norwegischen von Ina Kronenberger
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Solvokteren« bei Kagge Forlag, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020, Text: Maja Lunde, Illustrationen: Lisa AisatoCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenPublished in agreement with Oslo Literary AgencyUmschlaggestaltung: Semper smile, München, nach einem Entwurf von Terese Moe LeinerSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-27879-3V001www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Wenn ich die Augen schloss, konnte ich auf den Wangen und der Nase noch die Sonne spüren, die prickelnde Wärme, die sich in mir ausbreitete und mit nichts zu vergleichen war, die mein Herz erweichte und meine Gedanken beruhigte. In gewisser Weise hatte ich also eine Vorstellung von der Sonne, obwohl sie vor langer Zeit verschwunden war, damals war ich gerade ein Jahr alt gewesen.
In meiner Welt gab es keine Sonne. In meiner Welt fiel der Regen schwer auf Äcker und Wald, die Tropfen hüpften auf den Dächern und klatschten tausendfach in Pfützen. Hier gab es keinen Sommer, keinen Herbst, keinen Winter und auch keinen Frühling, von dem Großvater sagte, dass es für ihn die beste Jahreszeit von allen sei. Hier gab es weder Nacht noch Tag, nur ewige Dämmerung. Über den Bergen hing ein schwaches, trübes Licht, ansonsten war alles dunkel. Die Turmuhr am Marktplatz zeigte an, wann es Zeit zum Schlafen war und wann zum Aufstehen. Meine Welt war düster und nass. Tag für Tag Regen und trübes Wetter, aber niemals Blitz und Donner. Und hätte Großvater nicht eines Tages auf dem Weg zur Arbeit sein Brot vergessen und hätte ich nicht entdeckt, welches Geheimnis er in seinem Gewächshaus vor allen verborgen hielt, wäre es vielleicht heute noch so, dunkel und trüb für alle Zeit.
Kurz nachdem er gegangen war, entdeckte ich das Brot auf dem Tisch. Ein kleines trockenes Stück, zwar nicht genug, um den Hunger eines erwachsenen Mannes zu stillen, aber trockenes Brot war alles, was wir hatten, wenn das Gemüse ausgegangen war.
Ich rannte zur Tür, um nach Großvater zu schauen, doch er war schon weg. Mit dem Brot in der Hand stand ich da und dachte nach, dann wickelte ich es in ein Handtuch, steckte es in meine Schürzentasche und schlüpfte in die viel zu große Regenjacke, die mir jemand vererbt hatte, dem ich leidtat. Sie sagten es nicht laut, aber bestimmt tat ich vielen leid. Lilja, das Waisenkind. Ich merkte es daran, wie die Erwachsenen mich ansahen, und manchmal dämpften sie auch die Stimme, wenn ich vorbeiging. Das war ich gewohnt, denn ich war elternlos, seit ich denken konnte.
Draußen fiel leiser Regen, die Tropfen wehten in Streifen vom Himmel wie lange Grashalme. Auf dem Weg vor unserem Haus gab es drei große Pfützen, sie waren so groß, dass mir keine andere Wahl blieb, als mitten hineinzutreten. Ich spürte, wie das Wasser durch die Löcher meiner altersschwachen Stiefel drang, und wie meine Füße nass wurden. In meinen Gummistiefeln gluckerte es bei jedem Schritt. Ich hasste nasse Füße. Sie waren für mich das Allerschlimmste, gleich nach nassen Schultern. Nasse Schultern bekommt man, wenn man sich zu lange im Regen aufhält, selbst mit Regenzeug. Mit der Zeit schafft es nämlich nicht einmal die beste Regenjacke, das Wasser abzuhalten, und die Tropfen suchen sich ihren Weg in den Nacken, kriechen durch die Nähte. Vor allem an den Schultern. Hat man nasse Schultern, weiß man, es ist höchste Zeit, wieder ins Haus zu gehen.
Ich war auf der Straße im Laufschritt unterwegs, blieb aber stehen, als ich Tom und Thea sah. Sie spielten an dem kleinen Bach, der zwischen unseren Häusern verlief. Thea sang, und ihr kleiner Bruder Tom versuchte mitzusummen. Das Lied kannte ich gut, alle Kinder im Dorf kannten es:
Sonne, liebste Sonne, mein
Ich vermisse dich und deinen Schein
Den Frühling, den Sommer, den Winter im Ort
Für hundert Jahre bleibst du fort
Lässt uns im Regen stehen
Der Herbst wird nie vergehen
Lässt uns im Regen stehen
Während sie sangen, bauten sie einen Damm. Die Kinder in meinem Dorf bauten oft Dämme, das konnten sie gut, und Thea konnte es am allerbesten. Heute hatte sie ganz oben am Bach einen Damm gebaut, von wo sie das Wasser in ein Wasserrad leitete, das sie aus Holzstückchen gezimmert hatte. Tom klatschte in die Hände, als sich das Rad eifrig drehte.
»Toll«, sagte ich.
Thea drehte sich um und nickte.
»Aber ich bin noch nicht fertig. Ich will eine noch größere Mühle haben«, sagte sie. »Dann können wir ihre Energie nutzen und vielleicht Licht erzeugen.«
»Licht!«, sagte Tom.
»Ganz schön schlau«, sagte ich.
»Superschlau!« Tom schniefte und wischte sich mit der Hand die Nase ab. Er war ständig leicht erkältet, was bestimmt daran lag, dass auch er dauernd nasse Füße hatte.
»Wo willst du hin?«, fragte mich Thea. »Willst du mit uns zusammen bauen?«
»Ich muss zu Großvater«, sagte ich. »Ins Gewächshaus.«
»Ach so.« Sie wirkte enttäuscht. »Willst du Gemüse holen?«
»Nein«, sagte ich. »Ich will ihm sein Brot bringen.« Ich zeigte ihnen das Brot.
»Aber Gemüse kannst du doch holen?«, fragte Tom. »Eine Karotte wenigstens?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob er heute was hat. Außerdem darf ich ihm nicht helfen. Er trägt das Gemüse immer selbst zum Markt.«
»Schade«, sagte Tom. »Und du bist noch nie im Gewächshaus gewesen?«
»Nein«, sagte ich und lächelte. »Das weißt du doch.«
»Ja«, sagte Tom. »Das weiß ich.«
Die Kapuze seiner Regenjacke war heruntergerutscht, und ich konnte sehen, wie dünn er war. Noch dünner als beim letzten Mal. Dann ging mein Blick zu Thea. Sie war ebenfalls hager, ihre Haut fast weiß. Die beiden schienen von Tag zu Tag mehr zu schrumpfen.
Auf schlammigen Wegen ging ich weiter und grüßte den Hirten Jonas, der seine Schafherde über den Marktplatz führte. Die Wolle der Schafe war voller Matsch, die Tiere blökten leise, als er sie vorwärtsscheuchte. Ich kam an der Bäuerin Anna vorbei. Sie nickte mir zu, während sie ihrem mageren alten Pferd das Geschirr anlegte und es vor den Karren spannte. Das Pferd war genauso dünn wie seine Besitzerin. Genauso dünn wie wir alle … Ich schrumpfte sicherlich auch. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt größere Stiefel gebraucht hatte. Bestimmt waren sie deshalb so löchrig. Ich hatte sie durchgelaufen, bevor ich aus ihnen herausgewachsen war.
Endlich erreichte ich das andere Ende des Dorfs. Dort lagen Äcker, auf denen sich mehrere Bauern aus unserem Dorf im Getreideanbau versuchten, und eine Weide, auf der ein paar Kühe zwischen den vielen grauen Halmen nach den wenigen grünen suchten. Ich folgte einer schmalen Wagenspur über die Felder, balancierte in der Mitte, um nicht noch nassere Füße zu bekommen. Schließlich konnte ich Großvaters Gewächshaus sehen. Es stand auf einer Wiese mit welkem Gras und dichtem Gestrüpp, und dahinter war der Wald – eine Wand aus schwarzen Stämmen und Ästen. Eine Fichte hinter der anderen, bis zu den Bergen, die wir in weiter Ferne erkennen konnten.
In den Wald gingen wir nie, das war uns verboten. Bleibt da weg, sagten die Erwachsenen nur, dort wächst nichts, und es ist so dunkel, dass du sofort die Orientierung verlierst. Wenn du in den Wald gehst, kann es sein, dass du nie mehr herausfindest.
Als wir noch kleiner waren, spielten Thea und ich hin und wieder, wir würden in den Wald gehen. Wir schlichen zwischen den schwarzen Stämmen hindurch, wo sich gruselige Lebewesen versteckt hielten, bereit zum Angriff. Die gruseligen Lebewesen waren Theas Idee. Sie war der Meinung, dass es im Wald mehr geben musste als tote Bäume und Dunkelheit – ein Ungeheuer etwa. Abends hatte sie ihre Eltern nämlich einmal miteinander flüstern hören. Ihr Vater war auf Krähenjagd gewesen und hatte zwischen den Bäumen tief im Wald eine Gestalt erspäht: zwei leuchtende Augen in einem dunklen Gesicht. Er war davongerannt, ohne sich noch einmal umzusehen. Seither jagte er nur noch auf den Feldern nach Krähen. Aber Thea und ich behielten unsere Spiele mit dem Ungeheuer im Wald bei … Es war jetzt übrigens lange her, seit wir zuletzt miteinander gespielt hatten. Thea war ein Jahr jünger als ich, und bisher war ich nie der Meinung gewesen, dass dieses Jahr eine Rolle spielte, aber in letzter Zeit schienen die dreizehn Monate, die zwischen uns lagen, plötzlich schwerer zu wiegen. Sie wollte immer noch Dämme bauen, während ich die Lust an dem Bach und den Ungeheuern im Wald verloren hatte. Ich wusste nicht, was ich stattdessen vorschlagen könnte. Was macht man eigentlich, wenn man nicht mehr spielt? Geht man spazieren? Setzt sich auf den Marktplatz, redet, tut nichts? Das konnte ich Thea unmöglich vorschlagen, da würde sie mich nur auslachen.
Endlich war ich am Gewächshaus angekommen. Durch die Glaswände fiel Licht, helles, weißes Licht, es kam von den Deckenlampen und war das einzige Licht, das die Pflanzen erhielten. Mehr konnte man nicht sehen, denn alle Scheiben waren mit Papier zugehängt, und nur Großvater durfte das Gewächshaus betreten. Ich hatte mich nie getraut, nach dem Grund zu fragen. Es gab vieles, wonach ich Großvater nicht zu fragen wagte.
Man könnte meinen, du hättest Wunderdünger, sagten die Leute im Dorf zu Großvater, dann lachten sie. Aber sie erwarteten keine Antwort oder eine Erklärung. Solange Großvater jeden dritten Tag mit frischem, kräftigem Gemüse ins Dorf kam, waren alle zufrieden. Darunter blutrote Tomaten, orangegelbe Karotten, tiefgrüne Gurken, feste Schoten, die zwischen den Zähnen knackten und kleine süße Zuckererbsen enthielten, die beim Essen sozusagen im Mund herumhüpften.
Manchmal war ich stolz, wenn ich an Großvater dachte. Womöglich war er der wichtigste Mensch im ganzen Dorf. Ohne ihn würden wir wohl allesamt verhungern. Dann lieber damit leben, dass alles, was im Gewächshaus passierte, ein Geheimnis war.
»Großvater? Bist du da?«
Ich ging zur Tür und klopfte an. Draußen an der Scheibe hing ein großes Schild: »Unbefugten ist der Zutritt verboten.«
Keine Antwort.
Ich versuchte es erneut.
»Großvater? Ich bin’s nur. Ich bringe dir dein Brot.«
Ich hielt das Ohr an die Tür und lauschte. Drinnen war es still, ich bildete mir ein, leises Rauschen zu hören, bestimmt von den Lampen, sonst hörte ich nichts.
Dann bog ich um die Ecke des Gewächshauses und ging an der Längsseite entlang. Bisher war ich selten so dicht rangekommen. Großvater hatte es mir verboten, und in diesem Punkt war er sehr streng, sonst nicht. Halte dich vom Gewächshaus fern, sagte er nur, du hast dort nichts verloren.
Ich sollte wohl besser zurückgehen.
Aber ich wollte ja nur das Brot abgeben, damit er bei der Arbeit nicht den ganzen Tag hungern musste.
An der hinteren Ecke blieb ich stehen und klopfte vorsichtig an die Scheibe.
»Hallo?«
Weiterhin keine Antwort. Ich ging mit dem Gesicht ganz dicht an das Glas heran, und jetzt entdeckte ich etwas: einen Riss im Papier. Ein Loch zwischen den Bögen, gerade so groß, dass ich hindurchschauen konnte.
Ich bückte mich und schaute hinein.
Zuerst wurde ich geblendet. Das Licht im Gewächshaus war sehr kräftig, so weiß und grell, dass ich blinzeln musste, bis ich mich daran gewöhnte.
Dann entdeckte ich direkt vor mir einen Tisch mit Pflanzen und Setzlingen.
Ich weiß nicht, wie oft ich mir Großvaters Gewächshaus vorgestellt hatte – die großen grünen Pflanzen unter den kräftigen Deckenlampen, üppige Büsche und Bäume auf dem Boden, Gemüse und Früchte in allen erdenklichen Farben, die an Zweigen hingen oder aus der Erde sprossen.
Nichts davon war jetzt zu sehen. Nur ein kleiner blasser Setzling. Ein schmächtiges Pflänzchen, nicht sehr viel anders als die, die sich manchmal auf den Äckern hervorwagten, bevor sie beim ersten Regenschauer aufgaben. Daneben lagen ein paar hellrote Knollen, das mussten Radieschen sein.
Ich bückte mich noch tiefer und suchte nach dem frischen, verlockenden Gemüse, mit dem Großvater an jedem dritten Tag ins Dorf kam. Aber es gab nichts anderes zu sehen als noch mehr blasse Setzlinge und winzige, triste Pflänzchen.
Mein Herz pochte. Schnell kehrte ich zur Tür zurück. Ohne zu zögern und ohne anzuklopfen, machte ich sie auf. Zum allerersten Mal setzte ich meinen Fuß in Großvaters Gewächshaus.
Solange ich denken konnte, hatte ich davon geträumt, es würde etwas geschehen und alles verändern. Etwas würde sich verändern, in meinem Leben und in der Welt, wodurch alles besser würde. Mein allergrößter Traum gleich nach dem Wunsch, nicht länger elternlos zu sein, war es, den Frühling zu erleben.
»Kannst du mir von den Jahreszeiten erzählen?«, fragte ich Großvater einmal, als ich ganz klein war und er auf der Bettkante saß. »Kannst du mir vom Sommer, Herbst und Winter erzählen? Vom Frühling?«
An dem Tag hatte ich gehört, wie einer der großen Jungen auf dem Marktplatz davon sprach, dass das Jahr einmal in vier Teile eingeteilt gewesen sei, die man Jahreszeiten nannte. Und zum Glück wollte Großvater erzählen. Er erzählte vom Sommer, der uns Blumenteppiche und helle Nächte im Juni, Juli und August bescherte. Vom Herbst im September und Oktober, der reichsten Jahreszeit, wenn auf den Äckern der Hafer und Weizen stand und die Gemüsebeete nur so überquollen. Er erzählte vom Raureif, der sich im November sanft über das Dorf legte, und von der dicken Schneeschicht des Winters, die in den dunklen Monaten Dezember, Januar und Februar alles Hässliche und Graue überdeckte. Er erzählte vom Frühling, der allerbesten Jahreszeit, wenn die ganze Welt aus dem Winterschlaf erwachte und sich die Natur auf einen Schlag veränderte, von den Monaten März, April und Mai, von den Samenkörnern, die keimten, von den Bäumen, die Blätter bekamen, und der Amsel, die auftauchte und ihre wunderschönen langen Triller von sich gab. Und dann erzählte er von der Sonne. Dem leuchtenden Feuerball am Himmel, der sich von Ost nach West bewegte, nachts verschwand und am nächsten Morgen zurückkehrte. Die Sonne war es, die im Frühjahr alles aus dem Nichts erwachsen ließ. Sie war es, die die Natur dazu brachte, den ganzen Sommer über vor Leben nur so zu sprühen, bevor sie sich im Winter zurückzog. Dann spielte sie Verstecken mit uns, sagte Großvater, wurde blasser und kühler, verschwand fast vollständig und überließ dem Frost das Feld. Doch im nächsten Frühjahr kam sie zurück, genauso stark und kräftig wie zuvor.
Frühling, dachte ich, glücklich ist, wer den erleben darf! Könnte ich nur erleben, dass sich tatsächlich etwas ändert, dass die Welt nicht immerzu dieselbe ist.
»Und habe ich die Sonne gesehen?«, fragte ich Großvater. »Ich habe sie gespürt, stimmt’s?«
»Ja, Lilja«, sagte er. »Das hast du.«
Großvater sprach oft langsam. Er war nach der Arbeit ständig müde und kaputt, das war bestimmt der Grund. Oder er war traurig, unendlich traurig darüber, dass wir alles verloren hatten. Er bewegte sich langsam und vorsichtig, als liefe er über eine Wiese voller Brennnesseln, eine unendlich große Wiese, aus der er nie mehr herausfinden würde.
»In deinem allerersten Lebensjahr war die Sonne da«, sagte er.
»Ich kann mich an sie erinnern«, sagte ich. »Ich glaube, ich kann mich an sie erinnern.«
»Aber du warst doch noch so klein?«
»Sie kribbelt auf der Nase, stimmt’s?«
»Das kann man tatsächlich ein Kribbeln nennen«, sagte er.
»Und dann ist sie verschwunden?«
»Ja, als du ein Jahr alt warst, ist sie verschwunden. Die Sonne ist verschwunden und nie mehr zurückgekehrt.«
Er sah mich traurig an. Dann beugte er sich vor und hob die Hände. Und für einen Moment kam er mir so nah, dass ich dachte, er würde mich in den Arm nehmen. Gleich streckt er die Arme aus, dachte ich, gleich legt er sie um mich und drückt mich an sich. Ich hatte einen Kloß im Hals, denn ich wünschte mir so sehr, dass er mich richtig fest in die Arme schloss, wie Eltern und Großeltern es mit ihren Kindern und Enkeln tun, um ihnen zu zeigen, dass sie sie lieb haben und gut auf sie aufpassen, und ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn mich seine Bartstoppeln piksen würden, und ob ich es sehr warm und ungewohnt fände.
Doch nichts geschah. Großvater blieb einfach sitzen, er streckte die Arme nicht aus, beugte sich nicht näher zu mir vor. Er hob lediglich kurz die Hand und berührte etwas unbeholfen meinen Arm. Durch den Pullover hindurch war die Berührung kaum zu spüren.
Ich schluckte den Kloß im Hals hinunter.
Großvater und ich gehörten nicht zu der Sorte Menschen, die sich umarmten.
Aber das machte nichts. Es war völlig in Ordnung.
Ich war zwar nach der hochwachsenden, sonnenhungrigen Lilie benannt, aber ein anderer Name hätte besser gepasst, der einer kleinen bescheidenen Schattenpflanze. Manche Pflanzen kommen nämlich mit sehr wenig Licht und Pflege aus, und zu diesen gehörte ich.
Großvater stand auf, er hatte wohl nicht vor, noch mehr zu erzählen. Er ging zum Kamin und legte ein Holzscheit nach. Wirkte schwermütig und traurig. Armer Großvater, dachte ich, er ist so müde, arbeitet den ganzen Tag im Gewächshaus und will niemanden dort hineinlassen. Aber ich sagte nichts. Es erschien mir leichter, nichts zu sagen.
»Die Sonne ist verschwunden, als ich noch ganz klein war, und sie wird hundert Jahre wegbleiben, stimmt’s?«, fragte ich stattdessen. »So, wie es in dem Lied heißt?«
Das Feuer erfasste das Holzscheit, und die Flammen erleuchteten Großvaters Gesicht.
»Das Lied ist uralt«, sagte er. »Wir haben uns schon immer Geschichten erzählt, wonach die Sonne einst vor langer, langer Zeit verschwunden und hundert Jahre weggeblieben ist. Aber wir hielten das für ein Märchen. Wir haben nicht geglaubt, dass es wirklich passieren kann.«
»Aber es ist passiert«, sagte ich und musste schlucken.
»Ja …«
»Wann kommt sie denn zurück? Müssen wir wirklich hundert Jahre warten?«
»Ich weiß es nicht, Lilja, niemand weiß es.«
»Ich vermisse sie«, sagte ich leise.
Großvater antwortete nicht, er seufzte nur schwer, und ich bereute sofort, dass ich so viel gesagt hatte. Ich wusste ja, dass damals nicht nur die Sonne verschwunden ist. Ich wusste, dass hier im Haus weitere Menschen gelebt hatten, dass wir ganz viele gewesen waren. Einst hatte ich eine Mama, einen Papa, zwei ältere Geschwister und eine Oma gehabt. Auf dem Dachboden stand eine Kiste, in der Großvater ihre Sachen aufbewahrte: ein Pflanzenbuch von Mama, einen Malkasten von Papa, Strickzeug von Oma. Hin und wieder nahm ich etwas davon heraus, den Malkasten benutzte ich nur ganz vorsichtig, die Farben waren von einer Kraft und Klarheit, wie ich es noch nie gesehen hatte. In meiner Welt gab es solche Farben nicht. Oder ich las in dem Pflanzenbuch. Das war meine Lieblingslektüre. Ich konnte stundenlang dasitzen und die verschiedenen Zeichnungen betrachten, dabei die Namen jeder noch so kleinen Blume, jeder einzelnen Apfelsorte lernen. Und dann gab es in der Kiste noch ein altes Herbarium. Mit Mamas Namen auf der Vorderseite. Das Herbarium enthielt gepresste Blumen und Pflanzen. Behutsam strich ich mit dem Finger darüber, um zu spüren, wie zart und trocken sie waren, und sie mit den Bildern im Pflanzenbuch zu vergleichen. Sie sahen völlig anders aus, waren einfach nur trocken und steif, und farblos.
Farblos … genau wie die Pflanzen in Großvaters Gewächshaus, in dem ich gerade stand. Ich kniff die Augen zusammen. An der Decke hingen überall Lampen. Kaltes, weißes Licht strahlte auf mich herab. So dürfte die Wintersonne geleuchtet haben, dachte ich, genauso unbarmherzig und intensiv, damals, als es noch Jahreszeiten gab, damals, als man die Zeit noch in Wochen und Monaten berechnet und ihnen Namen gegeben hatte.
Ich machte ein paar Schritte in das Gewächshaus hinein und sah mich um. An den Wänden und in der Mitte befanden sich lange Tischreihen, und auf allen Tischen standen Blumentöpfe. Es waren sicherlich tausend.
Viele waren leer. Dunkle Erde starrte mich an. Doch in manchen Töpfen wuchsen Pflanzen. Ich begann, an den Reihen entlangzulaufen, befühlte vorsichtig die kleinen Sämlinge, die aus der Erde lugten. Sie waren genauso zart und dünn wie der Flaum auf Toms Köpfchen. Irgendwo standen vier Töpfe mit Tomatenpflanzen. Die Pflanzen streckten sich nach dem Licht, aber es wuchsen lediglich kleine grüne Früchte daran. Ein Stück weiter fand ich einen Kasten mit der Aufschrift Karotten. Aus der Erde ragte kümmerliches, blassgrünes Karottenkraut. Ich zog an einer der Pflanzen. Sie löste sich bereitwillig aus der Erde, und zum Vorschein kam eine gelbweiße Wurzel. Sie hatte einen Auswuchs, wie er bei Karotten vorkommt. Der Auswuchs erinnerte an eine Nase und verlieh der Karotte das Aussehen eines hageren, traurigen Männchens.
»Du Armer«, flüsterte ich ihm zu.
Ich ging weiter. Ganz hinten in der Ecke standen drei kleine Birnbäume. Großvater brachte in seinem Korb oft Birnen mit, und wir Dorfkinder teilten sie untereinander auf, sodass jeder exakt gleich viele bekam. Frische, knackige Birnen, deren Geschmack im Mund explodierte. Die Birnen, die an diesen Bäumen hingen, konnten aber auf keinen Fall nach etwas schmecken. Sie waren mickrig und schrumpelig und sahen aus, als hingen sie schon ganz lange dort. Ich hob die Hand und strich mit dem Finger vorsichtig über eine der Birnen, daraufhin löste sie sich vom Zweig und fiel zu Boden.
»Oh, Entschuldigung«, sagte ich schnell und hob sie auf. »Entschuldigung.«