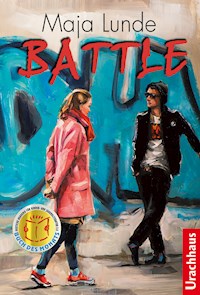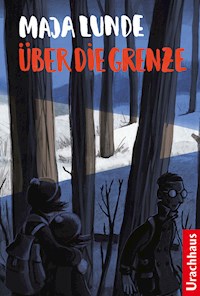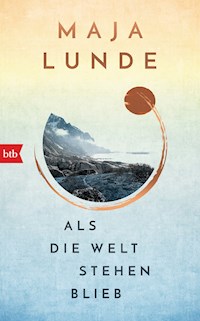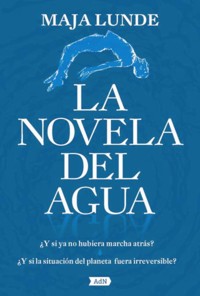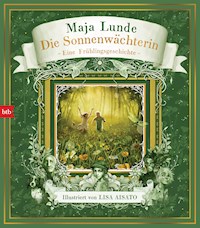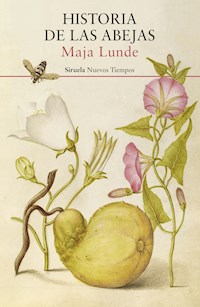11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klima Quartett
- Sprache: Deutsch
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte – die Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum. Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht: Die Bienen verschwinden.
China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte – die Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum. Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht: Die Bienen verschwinden.
China im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit.
Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu kämpfen?
Zur Autorin
Maja Lunde wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Sie ist eine bekannte Drehbuch- sowie Kinder- und Jugendbuchautorin. Die Geschichte der Bienen ist ihr erster Roman für Erwachsene, der zunächst national und schließlich auch international für Furore sorgte. Er stand monatelang auf der norwegischen Bestsellerliste und wurde mit dem Norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet.
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Bienes Historie« bei H. Aschehoug & Co., Oslo.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2015, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by btb in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Handverk/Eivind Stoud Platou
Umschlagmotiv: © iStock, Karunakar Rayker / Creative Commons
Autorenfoto: © Oda Berby
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18496-4 V006
Besuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Jesper, Jens und Linus
tao
Bezirk 242, Shirong, Sichuan, 2098
Wie verwachsene Vögel balancierten wir auf unseren Ästen, das Plastikgefäß in der einen Hand, den Federpinsel in der anderen.
Langsam, so vorsichtig ich konnte, kletterte ich aufwärts. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen im Arbeitsbezirk eignete ich mich nicht für diese Aufgabe, ich war nicht zierlich genug, meine Bewegungen waren oft zu fahrig, mir fehlte die nötige Feinmotorik. Ich war nicht geschaffen dafür, und trotzdem musste ich jeden Tag hier sein, zwölf Stunden am Stück.
Die Bäume waren ein Menschenleben alt, ihre Äste zerbrechlich wie dünnes Glas, sie knackten unter unserem Gewicht. Vorsichtig drehte ich mich, um meinem Baum keinen Schaden zuzufügen. Ich stellte mein rechtes Bein auf einen noch höhergelegenen Ast und zog das linke behutsam nach, bis ich endlich eine sichere Arbeitsposition gefunden hatte, unbequem, aber stabil. Von hier aus erreichte ich auch die obersten Blüten.
Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen, das zu Beginn des Tages exakt abgewogen und an uns verteilt wurde, jede Arbeiterin erhielt genau die gleiche Menge. Nahezu schwerelos versuchte ich, unsichtbar kleine Mengen zu entnehmen und in den Bäumen zu verteilen. Jede einzelne Blüte sollte mit dem kleinen Pinsel bestäubt werden, der aus eigens zu diesem Zweck erforschten Hühnerfedern hergestellt worden war. Keine künstliche Faser hatte sich als so effektiv erwiesen. Das hatte man wieder und wieder getestet, in meinem Bezirk hatte man dafür genügend Zeit gehabt. Hier war diese Tradition nämlich schon über hundert Jahre alt, die Bienen waren bereits in den 1980er Jahren verschwunden, lange vor dem Kollaps. Die Pflanzenschutzmittel waren schuld gewesen, und wenige Jahre später, als die Pestizide nicht mehr verwendet wurden, kehrten die Bienen zurück, doch zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits mit der Handbestäubung begonnen. So erzielte man bessere Ergebnisse, auch wenn für diese Arbeit unglaublich viele Menschen benötigt wurden, viele, viele Hände. Doch dann, als der Kollaps schließlich kam, hatte mein Bezirk einen Wettbewerbsvorteil. Es hatte sich gewissermaßen ausgezahlt, dass wir unsere Natur so sehr verunreinigt hatten. Weil wir Vorreiter in Sachen Umweltverschmutzung gewesen waren, wurden wir später zu Vorreitern der Handbestäubung. Ein Paradox hatte uns gerettet.
Obwohl ich mich so weit wie möglich streckte, blieb die Blüte ganz oben außerhalb meiner Reichweite. Ich war kurz davor, aufzugeben, doch ich wusste, dass mir dann Strafe drohte, also versuchte ich es noch einmal. Uns wurde der Lohn gekürzt, wenn wir die Pollen zu schnell oder zu langsam aufbrauchten. Das wahre Ergebnis unserer Arbeit blieb zunächst unsichtbar. Wenn wir am Ende des Tages von den Bäumen herabkletterten, war unser Einsatz nur durch rote Kreidekreuze auf den Stämmen erkennbar, im Idealfall bis zu vierzig am Tag. Erst wenn es Herbst wurde und die Äste schwer waren vom Obst, zeigte sich, wo gute Arbeit geleistet worden war. Doch da hatten wir meistens schon vergessen, wer welche Bäume bestäubt hatte.
Heute war ich auf Feld 748 eingesetzt. Wie viele es insgesamt waren, wusste ich nicht, aber meine Gruppe war eine von hunderten. In unseren beigefarbenen Arbeitsanzügen glichen wir einander wie die Bäume und hingen bei der Arbeit so dicht beieinander wie deren Blüten. Niemals allein, immer zu einer Traube gedrängt, ob hier oben in den Bäumen oder unten entlang des Pfades, wenn wir von einem Feld zum nächsten zogen. Nur in unseren kleinen Wohnungen hatten wir einige wenige Stunden am Tag für uns. Das übrige Leben fand hier draußen statt.
Es war still. Während der Arbeit durften wir nicht miteinander reden. Nur unsere vorsichtigen Bewegungen in den Bäumen waren zu hören und hin und wieder ein leises Räuspern oder Gähnen oder das Reiben der Arbeitskleidung an den Stämmen. Manchmal gab es auch einen Laut, den wir hassen gelernt hatten – ein Ast, der knackte und schlimmstenfalls sogar brach. Davon abgesehen machte nur der Wind Geräusche, wenn er durch die Zweige fuhr und über die Blüten strich oder durch das Gras auf dem Boden raschelte.
Er wehte von Süden her, aus Richtung des Waldes. Im Gegensatz zu den weißblühenden Obstbäumen, die noch kein Laub trugen, wirkte der Wald dunkel und ungezähmt, und schon in wenigen Wochen würde er eine noch üppigere, grüne Mauer bilden. Wir gingen nie hinein, hatten dort nichts zu erledigen. Und neuerdings gab es Gerüchte, dass er gerodet werden sollte, um einer neuen Plantage Platz zu machen.
Jetzt summte aus Richtung des Waldes eine Fliege heran, ein seltener Anblick, so wie ich schon seit Tagen keine Vögel mehr gesehen hatte, auch sie waren weniger geworden. Sie machten Jagd auf die wenigen Insekten, die es noch gab, und hungerten ansonsten wie der Rest der Welt auch.
Ein Geräusch durchschnitt die Stille. Es war die Pfeife, die von der Baracke der Aufseher herüberdrang, das Signal zur zweiten und letzten Pause des Tages. Erst jetzt fiel mir auf, wie trocken meine Zunge war.
Wie eine zusammenhängende Masse glitten die anderen Arbeiterinnen und ich von den Bäumen hinab. Meine Kolleginnen unterhielten sich. Kaum war es erlaubt, setzte ihr wildes Plappern ein, als hätte man einen Schalter umgelegt.
Ich blieb stumm und konzentrierte mich ganz darauf, langsam nach unten zu gelangen, ohne einen Zweig abzubrechen. Es gelang mir. Pures Glück. Ich war tollpatschig und schwerfällig, ich hatte lange genug hier durchgehalten, um zu wissen, dass ich diese Arbeit nie richtig gut beherrschen würde.
Auf dem Boden neben dem Baum stand meine Trinkflasche aus zerkratztem Metall. Ich griff danach und trank in gierigen Zügen. Das Wasser war lauwarm, es schmeckte nach Aluminium, weshalb ich weniger trank, als ich gebraucht hätte.
Zwei weißgekleidete junge Männer aus der Verpflegungseinheit teilten rasch die wiederverwendbaren Dosen mit der zweiten Mahlzeit des Tages aus. Ich blieb für mich, lehnte mich mit dem Rücken an den Baumstamm und öffnete meine Dose. Diesmal waren Maiskörner in den Reis gemischt. Ich probierte davon. Wie immer war das Essen ein wenig zu salzig und mit künstlich hergestelltem Chili und Soja gewürzt. Fleisch hatte ich schon lange nicht mehr gegessen. Für den Anbau von Tierfutter brauchte man große Flächen urbaren Bodens, und noch dazu mussten viele der traditionellen Futterpflanzen ebenfalls bestäubt werden. Das war die Mühe unseres aufwändigen Handwerks nicht wert.
Die Dose war leer, bevor ich satt war, und ich stand auf und stellte sie wieder in den Sammelkorb. Ich konnte meinen Körper nur schwer ruhig halten und joggte auf der Stelle. Meine Beine waren müde, aber trotzdem steif, und sie kribbelten, weil sie dort oben in den Bäumen so lange in starren Positionen ausgeharrt hatten.
Doch die Bewegung brachte keine Besserung. Ich sah mich verstohlen um, keiner der Aufseher beachtete mich. Rasch legte ich mich auf den Boden, um meinen schmerzenden Rücken auszustrecken.
Ich schloss für einen Moment die Augen und versuchte, die Stimmen der anderen Frauen aus meiner Gruppe auszublenden, doch ich hörte, wie ihr Geplauder stetig anschwoll und wieder abflaute. Wo kam dieses Bedürfnis nur her, warum mussten immer alle gleichzeitig reden? Das war schon so gewesen, als wir kleine Mädchen waren. Stunde um Stunde mit Gesprächen, deren Themen immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner bildeten, bei denen man nie etwas vertiefte, es sei denn, die Person, über die man sprach, war gerade nicht anwesend.
Ich dagegen zog Gespräche unter vier Augen vor oder gar keine Gesellschaft, bei der Arbeit oft Letzteres. Und zu Hause hatte ich Kuan, meinen Mann. Allerdings waren es auch nicht unbedingt ausschweifende Unterhaltungen, die uns miteinander verbanden. Kuan lebte immer im Hier und Jetzt, er strebte nicht nach Wissen, trachtete nicht nach mehr. Aber in seinen Armen fand ich Ruhe. Außerdem hatten wir unseren dreijährigen Sohn Wei-Wen, über ihn konnten wir reden.
Als mich das Geschnatter der anderen Frauen schon fast in den Schlaf gewiegt hatte, setzte es abrupt aus. Alle waren verstummt.
Ich setzte mich auf. Die anderen reckten ihre Köpfe.
Über den Pfad kam ein Tross auf uns zu.
Es waren Kinder, nicht älter als acht Jahre, viele kannte ich aus Wei-Wens Schule. Alle trugen die gleichen Arbeitskleider, dieselben synthetischen, beigefarbenen Anzüge, die auch wir trugen, und eilten in unsere Richtung, so schnell ihre kurzen Beine sie trugen. Zwei erwachsene Begleiter hielten die Gruppe zusammen, einer ging an der Spitze, der andere am Ende des Zuges. Beide hatten durchdringende Stimmen, mit denen sie die Kinder ständig zur Ordnung riefen. Sie schimpften jedoch nicht, sondern erteilten ihre Anweisungen voller Wärme und Mitgefühl. Denn auch wenn die Kinder noch nicht ganz verstanden hatten, wohin sie unterwegs waren, die Erwachsenen wussten es.
Die Kinder gingen Hand in Hand, ungleiche Paare, große und kleine, die ältesten passten auf die jüngsten auf. Ihr Gang war holperig und ungeordnet, aber sie hielten sich fest an den Händen, als wären sie zusammengeleimt. Vielleicht hatte man ihnen strengstens befohlen, einander auf keinen Fall loszulassen.
Ihre Blicke waren auf uns und auf die Bäume gerichtet. Es waren neugierige Blicke, einige kniffen die Augen zusammen und legten den Kopf schief, als wären sie zum ersten Mal hier, obwohl sie alle in diesem Bezirk aufgewachsen waren und nie eine andere Natur kennengelernt hatten als diese endlosen Reihen von Obstbäumen vor der Dunkelheit des verwilderten Waldes im Süden. Ein kleines Mädchen betrachtete mich lange mit ihren großen, engstehenden Augen. Sie blinzelte einige Male, dann schniefte sie heftig. An der Hand hielt sie einen mageren Jungen. Er gähnte laut und ungeniert und ohne die Hand vor den Mund zu halten, nicht ahnend, dass sich sein Gesicht zu einem einzigen riesigen Schlund verzog. Er gähnte nicht aus Langeweile, dafür war er zu jung. Wahrscheinlich hatte ihn die Mangelernährung müde gemacht. Ein dünnes, hochgewachsenes Mädchen führte einen anderen kleinen Jungen. Er atmete schwer und mit offenem Mund, er hatte wohl eine verstopfte Nase. Das Mädchen schleifte ihn hinter sich her, während sie ihr Gesicht in die Sonne streckte, blinzelte und die Nase kräuselte, sie hielt den Kopf immerzu in derselben Position, als wollte sie sich bräunen oder neue Kräfte tanken.
Sie kamen jedes Jahr, die neuen Kinder. Aber waren sie schon immer so klein gewesen? Waren sie jünger geworden?
Nein. Sie waren ungefähr acht Jahre alt. Wie immer. Gerade mit der Schule fertig geworden. Oder was man als Schule bezeichnete … Die Kinder lernten die Zahlen und einige Schriftzeichen, davon abgesehen war die Schule aber nur eine Form der kontrollierten Verwahrung. Der Verwahrung und Vorbereitung auf das Leben hier draußen. Die Kinder lernten, lange stillzusitzen. Und ihre Feinmotorik wurde geschult, ab einem Alter von drei Jahren knüpften sie Teppiche. Die kleinen Finger eigneten sich zur Fertigung raffinierter Muster ebenso hervorragend wie zur Arbeit hier draußen auf den Feldern.
Jetzt passierten die Kinder uns, richteten die Blicke wieder nach vorn auf die nächsten Bäume und gingen zu einem anderen Feld weiter. Der zahnlose Junge stolperte, aber das große Mädchen hatte ihn so fest im Griff, dass er nicht fiel.
Dann verschwanden die Kinder weiter den Hang hinab und zwischen den Bäumen.
»Wo kommen die hin?«, fragte eine Frau aus meinem Team.
»Sicher zu Feld 49 oder 50«, antwortete eine andere. »Da haben sie bislang noch nicht angefangen.«
Mein Magen krampfte sich zusammen. Auf welches Feld sie genau kamen, spielte doch keine Rolle. Es ging darum, was sie dort machen mussten.
Die Pfeife ertönte ein zweites Mal. Wir kletterten wieder nach oben, ich bewegte mich langsam, aber mein Herz raste. Nein, die Kinder waren nicht jünger geworden. Es war der Gedanke an Wei-Wen, der mich das glauben ließ. In fünf Jahren war er acht. In nur fünf Jahren war er an der Reihe. Hier draußen waren seine fleißigen Hände mehr wert als irgendwo sonst. Seine kleinen Finger waren bereits feinjustiert für diese Art von Arbeit.
Achtjährige an diesem Ort, tagein und tagaus, steif gewordene kleine Körper in den Bäumen. Nicht mal eine Kindheit war ihnen vergönnt, wie mir und meiner Generation, denn wir hatten in die Schule gehen dürfen, bis wir fünfzehn gewesen waren.
Es war kein Leben.
Meine Hände zitterten, als ich das Plastikgefäß mit dem wertvollen Staub anhob. Wir müssten alle arbeiten, lautete die Parole, um uns zu ernähren, damit die Nahrung angebaut werden könne, von der wir lebten. Alle sollten einen Beitrag leisten, selbst die Kinder. Denn wer brauche schon Bildung, wenn die Kornvorräte zur Neige gingen? Wenn die Rationen jeden Monat schrumpften? Wenn man abends hungrig ins Bett gehen müsse?
Ich drehte mich um, damit ich auch die Blüten in meinem Rücken erreichen konnte, nur dieses Mal bewegte ich mich zu hastig. Ich stieß gegen einen Ast, den ich nicht bemerkt hatte, verlor das Gleichgewicht und lehnte mich auf die andere Seite, um es wiederzuerlangen.
Und da war es. Dieses trockene Knacken, das wir alle so hassten. Das Geräusch eines brechenden Zweigs.
Die Aufseherin eilte herbei. Sie sah in den Baum hinauf, taxierte wortlos den Schaden und notierte rasch etwas auf ihrem Block, ehe sie wieder ging.
Der Zweig war weder lang noch dick gewesen, aber ich wusste, dass der Überschuss eines ganzen Monats dahin war. Jenes Geld, das eigentlich in die Blechdose im Küchenschrank wandern sollte, in der wir jeden Yuan sparten, den wir übrig hatten.
Ich atmete tief ein. Konnte nicht daran denken. Mir blieb nichts anderes, als weiterzumachen. Die Hand zu heben, den Pinsel in die Pollen zu tauchen, mich damit vorsichtig den Blüten zu nähern und darüberzustreichen, als wäre ich eine Biene.
Ich sah nicht auf die Uhr, ich wusste, es würde nichts helfen. Ich wusste nur, dass mit jeder Blüte, über die ich mit dem Pinsel strich, der Abend ein Stückchen näherrückte. Und mit ihm die knappe Stunde, die mir jeden Tag mit meinem Jungen vergönnt war. Diese knappe Stunde war alles, was wir hatten, und in dieser knappen Stunde konnte ich vielleicht etwas bewegen. Einen Samen säen, der ihm eine Chance geben würde, die mir selbst nie gegeben war.
William
Maryville, Hertfordshire, England, 1852
Alles um mich herum war gelb, grenzenlos gelb, die Farbe war über mir, unter mir, um mich herum, und sie blendete mich. Dieses Gelb war keine Einbildung, es war real, und schuld daran war die Brokattapete, die im Auftrag meiner Frau Thilda an die Wände gekleistert worden war, als wir dieses Haus vor einigen Jahren bezogen hatten. Damals hatten wir noch viel Platz, und mein kleines Saatgutgeschäft in der Hauptstraße von Maryville florierte. Ich war voller Enthusiasmus und glaubte, ich könnte mein Geschäft mit dem verbinden, was mir wirklich etwas bedeutete: meiner naturwissenschaftlichen Forschung. Doch das war lange her, lange bevor wir diese Unmenge an Töchtern bekamen, und vor allem lange vor meinem endgültigen Gespräch mit Professor Rahm.
Hätte ich geahnt, welche Qualen mir diese gelbe Tapete bereiten würde, ich hätte ihr nie zugestimmt. Die verfluchte Farbe begnügte sich nämlich nicht damit, in der Tapete zu stecken, sie war überall, es machte keinen Unterschied, ob ich die Augen geöffnet oder geschlossen hielt. Sie verfolgte mich bis in den Schlaf und ließ mich niemals entkommen, ganz so, als wäre sie die eigentliche Krankheit. Mein Leiden hatte keine Diagnose, aber viele Namen: Schwarzseherei, Trübsinn, Melancholie. Diese Worte wagte allerdings niemand in meinem Umfeld in den Mund zu nehmen. Unser Hausarzt gab sich ahnungslos. Andauernd warf er mit seinem Medizinerlatein um sich, faselte etwas von Dyskrasie, unausgeglichenen Körpersäften, zu viel schwarzer Galle. Zu Beginn meines Krankenlagers hatte er mich zur Ader gelassen und mir anschließend ein Abführmittel verabreicht, das einen hilflosen Säugling aus mir gemacht hatte. Jetzt wagte er offenbar keine weiteren Behandlungsversuche, weil er alle Kuren für aussichtlos hielt. Sobald Thilda das Thema ansprach, schüttelte er nur den Kopf, und wenn sie protestierte, flüsterte er eindringlich auf sie ein. Hin und wieder konnte ich Wortfetzen aufschnappen, zu schwach, würde es nicht überstehen, keine Besserung. In letzter Zeit kam er immer seltener, was vermutlich damit zusammenhing, dass ich allem Anschein nach ein für alle Mal ans Bett gefesselt bliebe.
Es war Nachmittag, und das Haus unter mir war voller Leben, der Lärm der Mädchen stieg von den unteren Zimmern zu mir herauf, wie Essensdünste drang er durch Bodenritzen und Wände. Ich erkannte die Stimme von Dorothea, der altklugen Zwölfjährigen, sie las aus der Bibel vor, salbungsvoll und zugleich stockend, doch die Worte gelangten nicht bis zu mir, so wie Gottes Worte mich neuerdings generell nicht mehr zu erreichen schienen. Die dünne Stimme der kleinen Georgiana quäkte dazwischen, und Thilda mahnte sie streng zum Schweigen. Kurz darauf war Dorotheas Vortrag beendet, und die anderen übernahmen. Martha, Olivia, Elizabeth, Caroline. Welche Tochter sprach gerade? Es gelang mir nicht, sie auseinanderzuhalten.
Eine von ihnen lachte, ein kurzes Auflachen, und erneut hallte es in mir nach, Rahms Lachen, jenes Lachen, das unser Gespräch ein für alle Mal beendet hatte wie ein Hieb mit dem Gürtel auf den Rücken.
Dann sagte Edmund etwas. Seine Stimme war tiefer geworden, sie klang geschliffener, hatte nichts Kindliches mehr an sich. Er war jetzt sechzehn Jahre alt, mein ältestes Kind und mein einziger Sohn. Ich konzentrierte mich auf seine Stimme, wünschte mir so sehr, ich könnte seine Worte verstehen, wünschte, ich hätte ihn bei mir, denn vielleicht war er der Einzige, der mich aufmuntern und mir die Kraft geben konnte, wieder aufzustehen, das Bett zu verlassen. Aber er kam nie, und ich wusste nicht, warum.
In der Küche wurde mit Töpfen geklappert. Das Geräusch der Essenszubereitung weckte meinen Magen, der sich verkrampfte, und ich krümmte mich zusammen wie ein kleines Baby.
Ich sah mich um. Eine unangetastete Brotscheibe und eine Scheibe vertrockneter Räucherschinken lagen auf einem Teller neben einem halbleeren Wasserbecher. Wann hatte ich zuletzt etwas gegessen oder getrunken?
Ich richtete mich halb auf und griff nach dem Becher, ließ das Wasser durch den Mund die Kehle hinabrinnen, spülte den faden Geschmack des Alters weg. Der salzige Schinken brannte auf der Zunge, das Brot war dunkel und würzig, und mein Magen nahm das Essen Gott sei Dank anstandslos auf.
Dennoch fand ich keine bequeme Liegeposition, mein ganzer Rücken war wund, die Haut an den Hüften dünn von der Seitenlage.
Und ich spürte eine Unruhe in den Beinen, ein Kribbeln.
Mit einem Mal wirkte das Haus so still. Waren alle gegangen?
Nur das Knacken der Kohle in der Feuerstelle war noch zu hören.
Doch dann, plötzlich: Gesang. Klare Stimmen aus dem Garten.
Hark the herald angels sing
Glory to the newborn King
Stand Weihnachten vor der Tür?
In den letzten Jahren hatten verschiedene Chöre aus der Gegend begonnen, in der Adventszeit an den Türen zu singen, nicht für Geld oder Geschenke, sondern ganz in der weihnachtlichen Tradition, den Mitmenschen eine Freude zu machen. Es gab eine Zeit, in der ich das schön gefunden habe, in der diese kleinen Auftritte ein Licht in mir entzünden konnten, das ich längst erloschen geglaubt hatte. Aber das schien mir eine Ewigkeit her.
Die hellen Stimmen strömten zu mir wie Schmelzwasser:
Peace on earth and mercy child
God and sinners reconciled
Ich setzte meine Füße auf den Boden, der sich hart anfühlte. Auf einmal war ich das Baby, das Neugeborene, dessen Füße noch nicht an den Untergrund gewöhnt waren, sondern eher für einen Tanz auf Zehenspitzen geformt schienen. So hatte ich Edmunds Füße in Erinnerung, gebogen, mit hohem Spann und einer Haut, die oben und unten gleichermaßen zart war. Ich konnte seine Füße versonnen in den Händen halten, sie einfach nur ansehen und befühlen, ja nicht allein die Füße, sondern das ganze Kind, wie man es mit Erstgeborenen tat, und dann dachte ich, dass ich einmal ganz anders für ihn sein würde, ganz anders, als es mein Vater für mich gewesen ist. So hatte ich mit ihm dagestanden, bis Thilda ihn mir unter dem Vorwand entriss, er müsse gestillt oder gewickelt werden.
Auf meinen Säuglingsfüßen stakste ich langsam zum Fenster. Jeder Schritt schmerzte. Dann breitete sich der Garten vor mir aus, und da standen sie.
Alle sieben – denn es waren keine fremden Chorsänger aus einem anderen Dorf, sondern meine eigenen Töchter.
Die vier größeren standen hinten, die drei kleineren vorn, in ihrer dunklen Winterkleidung; Wollmäntel, die zu eng und zu kurz oder zu groß und mehrmals geflickt waren, die Fadenscheinigkeit wurde mit billigen Zierbändern oder Taschen an seltsamen Stellen zu kaschieren versucht. Braune, dunkelblaue oder graue Wollhauben mit weißen Spitzenbändern rahmten schmale, winterlich blasse Gesichter ein. Ihr Gesang verwandelte sich vor ihnen in der Luft zu Frostdampf.
Wie dünn sie geworden waren.
Die Fußspuren im tiefen Schnee zeigten, wo sie gegangen waren. Er musste ihnen bis weit über die Knie gereicht haben, wahrscheinlich waren sie nass geworden. Ich konnte das Gefühl von klammen Wollsocken auf nackter Haut förmlich spüren, und den Frost, der vom Boden durch die dünnen Schuhsohlen kroch – keines der Mädchen besaß mehr als ihr eines Paar Stiefel.
Ich trat näher ans Fenster heran, erwartete noch jemand anderes dort unten, ein Publikum für den Chor, Thilda, oder vielleicht unsere Nachbarn. Doch der Garten war leer. Meine Töchter sangen nicht für irgendjemanden dort draußen. Sie sangen für mich.
Light and life to all he brings
Risen with healing in his wings
Jetzt richteten alle ihre Blicke zum Fenster, aber sie hatten mich noch nicht entdeckt. Ich stand im Schatten, und die Sonne schien auf die Fensterscheibe, sodass sie vermutlich nur die Spiegelung des Himmels und der Bäume sahen.
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Ich ging noch einen Schritt näher.
Die vierzehnjährige Charlotte, meine älteste Tochter, stand ganz außen. Sie sang mit dem ganzen Körper, ihre Brust hob und senkte sich im Takt der Töne. Vielleicht steckte sie hinter all dem. Sie hatte schon immer gesungen, hatte sich durch ihre Kindheit gesummt, ob über die Hausaufgaben oder den Abwasch gebeugt, immerzu hatte sie melodiös gesummt, als gehörten die leisen Töne zu ihren Bewegungen.
Sie war auch diejenige, die mich zuerst entdeckte. Ihr Gesicht erhellte sich. Sie stieß Dorothea an, die altkluge Zwölfjährige, die wiederum schnell der ein Jahr jüngeren Olivia zunickte, welche daraufhin mit weit aufgerissenen Augen ihre Zwillingsschwester Elizabeth ansah. Die beiden ähnelten sich nicht im Aussehen, aber in ihrem Wesen, beide waren sanft und mild, und stockdumm – selbst wenn man ihnen die Zahlen vor den Kopf genagelt hätte, wären sie im Rechnen gescheitert. Jetzt wurde auch die Reihe vor ihnen unruhig, sogar die Kleinen hatten mich bemerkt, die neunjährige Martha kniff der siebenjährigen Caroline in den Arm, und Caroline, die immerzu quengelte, weil sie wahrscheinlich am liebsten für immer die Jüngste geblieben wäre, knuffte die kleine Georgiana, die gern älter gewesen wäre, als sie war. Es stieg kein Jubelgesang zum Himmel, das erlaubten sie sich nicht, noch nicht, nur eine winzige Unregelmäßigkeit im Lied verriet, dass sie mich gesehen hatten. Das, und ein leichtes Lächeln auf ihren Gesichtern, soweit ihre singenden, o-förmigen Münder das zuließen.
Ich hatte einen Kloß im Hals und kam mir kindisch vor. Sie sangen keineswegs schlecht. Ihre schmalen Gesichter glühten, die Augen leuchteten. Meine Töchter hatten dieses Konzert für mich arrangiert, für mich ganz allein, und jetzt glaubten sie, ihr Ziel erreicht zu haben – sie hatten ihren Vater aus dem Bett gelockt. Wenn das Lied vorbei wäre, würden sie ihren Jubel zulassen, würden freudestrahlend und leichtfüßig durch den Neuschnee ins Haus springen und von ihrem ganz persönlichen Wunder erzählen. Wir haben ihn gesund gesungen, würden sie jubeln. Wir haben Vater gesund gesungen! Ein Schwall begeisterter Mädchenstimmen würde sich in die Flure ergießen und von den Wänden widerhallen: Bald kehrt er zurück. Bald ist er wieder bei uns. Wir haben ihm Gott gezeigt, Jesus – den Neugeborenen. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king. Was für eine glänzende, ja, geradezu brillante Idee es war, für ihn zu singen, ihn an all die Schönheit zu erinnern, an die Weihnachtsbotschaft, an alles, was er während seiner Bettlägerigkeit vergessen hatte, die wir Krankheit nennen, von der jedoch alle wissen, dass es etwas ganz anderes ist, obwohl Mutter uns verbietet, darüber zu sprechen. Armer Vater, es ging ihm nicht gut, er ist blass wie ein Gespenst, das haben wir durch den Türspalt gesehen, wenn wir an seinem Zimmer vorbeischlichen, ja, wie ein Gespenst, und nur noch Haut und Knochen, und den Bart hat er sich wachsen lassen, wie der gekreuzigte Jesus, nicht wiederzuerkennen ist er. Aber bald ist er wieder in unserer Mitte, bald wird er arbeiten können, und wir können uns wieder Butter aufs Brot schmieren und neue Wintermäntel kaufen. Das ist wahrlich ein echtes Weihnachtsgeschenk. Christ is born in Bethlehem!
Doch es war eine Lüge, ich konnte ihnen dieses Geschenk nicht machen, ich war ihren Jubel nicht wert. Das Bett zog mich an, meine neugeborenen Beine konnten mich nicht länger tragen, mein Magen verkrampfte sich erneut, und ich biss die Zähne zusammen, als wollte ich all das zermahlen, was soeben in mir aufgestiegen war, und draußen verstummte der Gesang. Heute gab es kein Wunder.
GEORGE
Autumn Hill, Ohio, USA, 2007
Ich holte Tom an der Bushaltestelle in Autumn ab. Er war seit dem letzten Sommer nicht mehr hier gewesen. Warum, wusste ich nicht, und hatte ihn auch nicht gefragt. Vielleicht wollte ich die Antwort nicht hören.
Die Fahrt bis zum Hof dauerte eine halbe Stunde. Wir redeten nicht viel. Seine blassen, dünnen Hände ruhten reglos auf seinem Schoß, während das Auto nach Hause rumpelte. Die Reisetasche zu Toms Füßen war schmutzig geworden. Seit ich den Pick-up gekauft hatte, war der Boden immer dreckig gewesen. Die Erdklumpen vom letzten oder vorletzten Jahr zerfielen im Winter zu feinem Staub, und als jetzt der Schnee von Toms Stiefeln schmolz, vermischte sich alles zu Schlamm.
Die Tasche war neu, sicher in der Stadt gekauft. Ihr Stoff war noch ganz steif, und schwer war sie. Als ich sie an der Bushaltestelle vom Boden aufgehoben hatte, war ich erschrocken. Tom hatte sie selbst nehmen wollen, aber ich war ihm zuvorgekommen und hatte danach gegriffen, weil er nicht gerade so aussah, als hätte er seit unserer letzten Begegnung an Muskeln zugelegt. Er hätte eigentlich nur ein paar Klamotten einpacken müssen, schließlich würde er nur für eine Woche hier zu Besuch sein, und das meiste, was er brauchte, hing schon an einem Haken im Windfang. Der Schutzanzug, die Stiefel, die Mütze mit den Ohrenklappen. Aber anscheinend hatte er einen Haufen Bücher mitgenommen. Er glaubte wohl, ihm würde Zeit fürs Lesen bleiben.
Als ich zur Haltestelle gekommen war, hatte er bereits dort gestanden und auf mich gewartet. Der Bus war zu früh gewesen oder ich zu spät, vermutlich Letzteres. Ich hatte noch auf dem Hofplatz Schnee räumen müssen, ehe ich losgefahren war.
»Übertreib es mal nicht, George. Er hat seinen Kopf doch sowieso in den Wolken«, hatte Emma gesagt, während sie mir fröstelnd und mit verschränkten Armen beim Schippen zugesehen hatte.
Ich hatte nichts erwidert, nur immer weitergeschaufelt. Der Schnee war neu und leicht und hatte sich zusammengefaltet wie ein Akkordeon, und ich war kaum ins Schwitzen geraten.
»Man könnte meinen, du würdest Präsident Bush höchstpersönlich erwarten.«
»Hier musste dringend geräumt werden. Und du kümmerst dich ja nicht darum.«
Ich sah vom Schnee auf, vor meinen Augen flimmerte es weiß. Sie lächelte ihr schiefes Lächeln, und ich musste zurücklächeln. Wir kannten uns schon seit der Schulzeit, und seither war wohl kein Tag vergangen, an dem wir uns nicht auf diese Weise angelächelt hatten.
Sie hatte natürlich recht. Ich übertrieb es. Der Schnee würde ohnehin nicht liegen bleiben, wir hatten schon die ersten warmen Tage erlebt, die Sonne wurde stärker, und überall begann es zu schmelzen. Dieser Schneefall war nur ein letzter Furz des Winters und würde schon in wenigen Tagen verschwunden sein. Genauso übertrieben war es, dass ich heute das Klo geputzt hatte. Sogar hinter der Kloschüssel, um genau zu sein. Das machte ich nicht gerade jeden Tag. Aber ich wollte, dass alles tadellos war, jetzt, wenn er endlich nach Hause kam. Dass er nur den frischgeräumten Vorplatz und die saubere Toilette sehen würde und nicht die abblätternde Farbe an der Südwand, auf die die Sonne brannte, oder die Dachrinnen, die sich im Herbstwind gelöst hatten.
Am Ende seines letzten Besuchs war er braungebrannt, stark und voller Energie gewesen und hatte mich zum Abschied ausnahmsweise lange umarmt, und ich hatte die Kraft in seinen Armen gespürt, als er mich an sich gedrückt hatte. Andere Leute redeten immer davon, dass die Kinder bei jedem Wiedersehen größer wurden und man geradezu erschrak, wenn man den Sprössling eine Weile wieder nicht gesehen hatte. Bei Tom war es anders. Diesmal schien er sogar geschrumpft. Seine Nase war rot, die Wangen blass, die Schultern schmal. Und dass er sie wie ein Schwächling nach unten hängen ließ und noch dazu fröstelte, machte die Sache nicht besser. Zwar hörte sein Zittern nach einer Weile auf, als wir auf den Hof zufuhren, aber er hing immer noch wie ein nasser Sack auf dem Beifahrersitz.
»Wie ist das Essen?«, fragte ich.
»Das Essen? Auf dem College, meinst du?«
»Nein. Auf dem Mars.«
»Was?«
»Natürlich auf dem College. Oder hast du in letzter Zeit woanders gelebt?«
Er duckte sich wieder zwischen seine Schultern.
»Ich meine ja nur … du siehst ein bisschen unterernährt aus«, fügte ich hinzu.
»Unterernährt? Papa, weißt du überhaupt, was das heißt?«
»Wenn ich mich richtig erinnere, bezahle ich deine Studiengebühren, du brauchst mir also nicht so zu kommen.«
Es wurde still zwischen uns.
Lange.
»Aber sonst läuft es gut?«, fragte ich schließlich.
»Ja, es läuft gut.«
»Also bekomme ich auch was für mein Geld?«
Ich versuchte zu grinsen, sah aber schon im Augenwinkel, dass er es nicht komisch fand. Warum nicht? Er hätte doch versuchen können, auf meinen Scherz einzugehen, und dann hätten wir die schlechte Stimmung einfach vertreiben und vielleicht für den Rest der Fahrt ein nettes Gespräch führen können.
»Und wenn die Mahlzeiten schon im Preis enthalten sind, könntest du doch vielleicht auch ein bisschen mehr essen«, sagte ich versuchshalber.
»Ja«, erwiderte er nur.
In mir begann es zu brodeln. Ich wollte ihn doch nur zum Lächeln bringen. Sein feierlicher Ernst reizte mich. Ich sollte jetzt besser nichts sagen. Meinen Mund halten. Aber ich konnte mich nicht zusammenreißen.
»Du konntest es gar nicht erwarten, endlich von hier wegzukommen, stimmt’s?«
Wurde er wütend? Waren wir wieder an diesem Punkt?
Nein. Er seufzte nur. »Papa!«
»Ja. Mach dich nur lustig.«
Ich verkniff mir den Rest, denn ich wusste, ich würde wieder Dinge sagen, die ich später bereuen würde, wenn ich jetzt weiterredete. So sollte es nicht anfangen, nicht jetzt, wo er endlich gekommen war.
»Ich meine ja nur …«, sagte ich und versuchte, möglichst sanft zu klingen, »als du weggegangen bist, hast du glücklicher gewirkt als jetzt.«
»Ich bin glücklich. Okay?«
»Okay.«
Thema beendet. Er war glücklich. Wahnsinnig glücklich. So glücklich, dass er fast einen Luftsprung gemacht hätte. Als könnte er es gar nicht erwarten, uns und den Hof wiederzusehen. Als dächte er schon seit Wochen an nichts anderes. Na sicher.
Ich räusperte mich, obwohl mein Hals frei war. Tom saß einfach nur da mit seinen ruhigen Händen. Es versetzte mir einen Stich, aber was hatte ich mir erhofft? Dass wir nach ein paar Monaten der Trennung plötzlich beste Freunde wären?
Emma umarmte Tom lange. Es gab also auch Dinge, die sich nicht verändert hatten, sie konnte ihn anscheinend immer noch drücken und liebkosen, ohne dass es ihn störte.
Der frischgeräumte Vorplatz fiel ihm nicht auf. Was das betraf, hatte Emma richtiggelegen. Allerdings bemerkte er auch die abblätternde Farbe nicht, und das war ein Vorteil – nein. Eigentlich wollte ich, dass er beides sah. Und mitanpackte, wenn er endlich mal zu Hause war. Er sollte Verantwortung übernehmen.
Emma hatte einen Hackbraten gemacht, als Beilage gab es Mais, sie tat große Portionen auf die grünen Teller, die gelben Maiskörner leuchteten, die Fleischsoße dampfte. Am Essen gab es nichts auszusetzen, aber Tom aß nur eine halbe Portion und rührte das Fleisch nicht an. Er hatte wohl keinen Appetit. War zu selten an der frischen Luft, das war das Problem. Aber dagegen würden wir jetzt etwas unternehmen.
Emma stellte eine Frage nach der anderen. Über die Schule. Die Lehrer. Fächer. Freunde. Mädchen. Bei letzterem Thema bekam sie nicht viele Antworten. Trotzdem plätscherte das Gespräch zwischen ihnen wie immer munter dahin, auch wenn sie mehr fragte, als er antwortete. So war es schon immer gewesen, ihnen gingen die Worte nicht aus. Sie plauderten und waren sich nahe, ohne dass es sie anzustrengen schien. Aber das war klar, schließlich war sie seine Mutter.
Sie genoss es, hatte rosige Wangen, den Blick immerzu auf Tom gerichtet, ihre Hände konnten nicht von ihm lassen, in ihren Fingern hatte sich über Monate die Sehnsucht angestaut.
Ich war die meiste Zeit still, versuchte zu schmunzeln, wenn sie schmunzelten, und zu lachen, wenn sie lachten. Nach dem Debakel im Auto wollte ich lieber nichts riskieren. Ich musste die passende Gelegenheit abwarten, um das sogenannte Vater-Sohn-Gespräch einzuleiten. Dieser Moment käme schon noch. Immerhin würde er eine Woche hierbleiben.
Also konzentrierte ich mich einfach nur auf das Essen und leerte meinen Teller. Immerhin einer an diesem Tisch wusste gutes Essen zu schätzen, ich wischte mit einem Stück Brot die letzte Soße vom Teller, legte das Besteck darauf und stand auf.
Aber da wollte auch Tom aufstehen, obwohl sein Teller noch fast voll war.
»Es hat gut geschmeckt«, sagte er.
»Du musst aufessen, was deine Mutter für dich gekocht hat«, sagte ich möglichst ruhig, aber mein Ton geriet wohl trotzdem etwas scharf.
»Er hat doch schon ordentlich gegessen«, entgegnete Emma beschwichtigend.
»Deine Mutter hat mehrere Stunden in der Küche gestanden.«
Genau genommen war das eine Übertreibung. Tom setzte sich wieder und hob die Gabel.
»Es ist doch nur ein Hackbraten, George«, sagte Emma. »So lange habe ich dafür nun auch wieder nicht gebraucht.«
Ich wollte protestieren. Sie hatte sich zweifellos große Mühe gegeben, und sie freute sich so, dass Tom wieder zu Hause war. Sie hatte es verdient, dass der Junge das auch zur Kenntnis nahm.
»Ich habe im Bus schon ein Sandwich gegessen«, sagte Tom zu seinem Teller.
»Du hast dich satt gegessen, kurz bevor du zu deiner Mutter gefahren bist? Hast du ihr Essen denn nicht vermisst? Hast du irgendwo sonst schon einmal einen so guten Hackbraten gegessen?«
»Schon gut, Papa. Die Sache ist nur, dass …«
Er verstummte.
Ich sah Emma nicht an, denn ich wusste, dass sie mich mit zusammengepressten Lippen anstarrte und aus ihren Augen die Stoppschilder leuchteten.
»Die Sache ist nur was?«
Tom stocherte in seinem Essen herum.
»Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen.«
»Hä?«
»Jaja«, sagte Emma schnell und räumte den Tisch ab.
Ich blieb sitzen. Dann begriff ich.
»Kein Wunder, dass du so schwächlich bist«, sagte ich.
»Wenn alle Vegetarier wären, gäbe es für alle Menschen auf der Welt genug zu essen«, erwiderte Tom.
»Wenn alle Vegetarier wären!« Ich äffte ihn nach und starrte ihn über den Rand meines Wasserglases wütend an. »Der Mensch hat immer schon Fleisch gegessen.«
Emma hatte die Teller und Schüsseln zu einem hohen Turm gestapelt. Er wackelte und klirrte bedrohlich.
»Jetzt lass ihn doch. Tom wird sich das schon gut überlegt haben.«
»Das glaube ich nicht.«
»Ich bin schließlich nicht der einzige Vegetarier«, warf Tom ein.
»Auf diesem Hof wird Fleisch gegessen!« Ich stand so abrupt auf, dass der Stuhl umfiel.
»Jaja«, wiederholte Emma und räumte mit fahrigen Bewegungen weiter den Tisch ab.
Dabei warf sie mir einen dieser Blicke zu. Diesmal sagte er nicht nur: Stopp! Sondern auch: Halt endlich den Mund.
»Du hast doch keine Schweineproduktion«, hielt Tom mir entgegen.
»Was hat das damit zu tun?«
»Es spielt wohl keine Rolle für dich, ob ich Fleisch esse oder nicht. Solange ich weiterhin Honig esse.«
Er grinste. Wohlwollend? Nein. Ein bisschen frech.
»Hätte ich gewusst, dass du auf dem College so werden würdest, hätte ich dich nie dorthin geschickt.« Ein Wort ergab das andere, ich konnte mich nicht zurückhalten.
»Ach was. Es ist klar, dass der Junge aufs College gehen muss«, sagte Emma.
Natürlich. Klar wie die erste Frostnacht. Alle mussten aufs College gehen.
»Alles, was ich zum Leben brauche, habe ich hier gelernt«, erwiderte ich und machte eine vage Handbewegung, wollte eigentlich gen Osten zeigen, wo die Wiese mit einigen Bienenstöcken lag, und merkte zu spät, dass es Westen war.
Tom antwortete nicht mal.
»Danke fürs Essen.«
Hastig räumte er seinen Teller ab und wandte sich Emma zu.
»Ich erledige den Rest auch noch schnell. Geh du nur und mach es dir gemütlich«, sagte er.
Sie lächelte ihn an. Zu mir sagte keiner etwas.
Beide wichen mir aus, sie, indem sie ins Wohnzimmer und zu ihrer Zeitung schlurfte, er, indem er sich eine Schürze umband, ja, das tat er wirklich, und die Töpfe zu schrubben begann.
Meine Zunge war wie eingetrocknet. Ich trank einen Schluck Wasser, aber es half kaum.
Sie machten einen Bogen um mich, ich war der Elefant im Porzellanladen. Nein, eigentlich nicht einmal das. Ich war ein Mammut. Eine ausgestorbene Art.
tao
Wenn ich drei Reiskörner habe und du zwei, wie viele haben wir dann zusammen?«
Ich nahm zwei Reiskörner von meinem Teller und legte sie auf Wei-Wens, der bereits leergegessen war.
Die Kindergesichter gingen mir nicht aus dem Kopf. Das große Mädchen mit dem zur Sonne gereckten Gesicht, der Junge mit dem weit aufgerissenen Mund. Sie waren noch so klein gewesen. Und Wei-Wen war plötzlich so groß. Bald wäre er im selben Alter wie sie. In anderen Landesteilen gab es Schulen für einige wenige Auserwählte. Sie sollten einmal Verantwortung übernehmen. Und sie entkamen der Feldarbeit. Wenn Wei-Wen nur fleißig genug war und sich früh als guter Schüler hervortat …
»Warum solltest du drei haben und ich nur zwei?« Wei-Wen sah feixend auf die Reiskörner hinab.
»Dann habe ich eben nur zwei, und du hast drei. So.« Ich vertauschte die Reiskörner auf unseren Tellern. »Wie viele haben wir zusammen?«
Wei-Wen legte lustlos seine kleine Faust auf den Teller und zog damit Kreise.
»Ich will mehr Ketchup.«
»Also wirklich, Wei-Wen.« Entschieden packte ich seine Faust und hob sie weg, sie war ganz klebrig vom Essen. »Das heißt Könnte ich bitte noch Ketchup haben.« Ich seufzte und zeigte erneut auf die Reiskörner. »Zwei bei mir. Und drei bei dir. So können wir sie zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf.«
Wei-Wen fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und hinterließ einen Ketchupstreifen. Dann streckte er sich nach der Flasche. »Könnte ich bitte noch Ketchup haben?«
Ich hätte früher anfangen sollen. Diese eine Stunde am Tag war alles, was wir hatten. Aber ich vergeudete sie oft, ließ die Zeit mit Essen und Gemütlichkeit verstreichen. Er sollte schon viel weiter sein.
»Fünf Reiskörner«, wiederholte ich. »Fünf Reiskörner. Stimmt’s?«
Er gab seine Versuche auf, die Flasche zu erreichen, und warf sich so heftig zurück, dass der Stuhl schwankte. Diese jähen, ungestümen Bewegungen waren typisch für ihn. Er war von Geburt an robust gewesen. Und vergnügt. Allerdings hatte er erst spät laufen gelernt, dafür verspürte er dann doch nicht die nötige Unruhe, sondern saß einfach nur gern auf seinem Po und strahlte alle an, die mit ihm redeten. Und mit ihm reden wollten viele, denn Wei-Wen war eines dieser Babys, die man schnell zum Lächeln bringen konnte.
Ich nahm die Flasche mit dem roten Ersatzprodukt und schüttete etwas davon auf seinen Teller. Vielleicht wurde er dann arbeitswilliger? »So. Bitteschön.«
»Ja! Ketchup!«
Ich nahm zwei weitere Reiskörner aus der Schüssel auf dem Tisch.
»Sieh mal. Jetzt kommen noch zwei dazu. Wie viele haben wir dann insgesamt?«
Aber Wei-Wen konzentrierte sich nur auf das Essen. Jetzt war sein ganzer Mund mit Ketchup verschmiert.
»Wei-Wen? Wie viele haben wir dann?«
Er putzte seinen Teller noch einmal leer, betrachtete ihn eine Weile und hob ihn dann in die Luft. Dazu machte er Brummgeräusche wie ein Propellerflugzeug. Er liebte die alten Verkehrsmittel, war vollkommen fasziniert von Hubschraubern, Autos, Bussen, stundenlang konnte er auf dem Boden herumkrabbeln und imaginäre Straßen, Flughäfen und Landschaften für seine Fortbewegungsmittel bauen.
»Bitte, Wei-Wen!« Ich nahm ihm den Teller aus der Hand und stellte ihn außerhalb seiner Reichweite wieder ab. Dann zeigte ich erneut auf die kalten, trockenen Reiskörner.
»Sieh mal. Fünf plus zwei. Was macht das dann?«
Meine Stimme zitterte ein wenig. Ich überspielte es mit einem Lächeln, das Wei-Wen gar nicht bemerkte, weil er sich angestrengt nach dem Teller reckte.
»Ich will es wiederhaben! Das Flugzeug! Es ist meins!«
Im Wohnzimmer räusperte sich Kuan. Er hatte die Füße auf den Tisch gelegt und hielt eine Tasse Tee in der Hand, über deren Rand hinweg er mich betont gelassen ansah.
Ich ignorierte sie beide und begann zu zählen. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und … sieben!« Ich lächelte Wei-Wen an, als wären diese sieben Reiskörner etwas ganz Außergewöhnliches. »Insgesamt sind es sieben. Stimmt’s? Siehst du es? Dass es sieben sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.«
Nur das. Wenn er nur das verstand, würde ich Ruhe geben und ihn weiterspielen lassen. Kleine Schritte, Tag für Tag.
»Ich will es wiederhaben!«
Er streckte seine mollige Hand so weit vor, wie er konnte.
»Nein, der Teller bleibt jetzt da stehen, Freundchen.« Meine Stimme wurde lauter. »Wir beide werden jetzt erst mal zählen.«
Kuan seufzte kaum hörbar, stand auf und kam zu uns herein. Er legte mir die Hand auf die Schulter. »Es ist schon acht Uhr.«
Ich schüttelte seinen Griff ab.
»Eine Viertelstunde schafft er noch«, sagte ich und starrte ihn eindringlich an.
»Tao …«
»Eine Viertelstunde schafft er.« Ich fixierte ihn weiter.
Er wurde stutzig. »Aber warum?«
Ich sah weg, hatte keine Lust, es ihm zu erzählen, ihm von den Kindern zu erzählen. Ich wusste sowieso, was er sagen würde. Sie seien nicht jünger geworden, sondern so alt wie immer, acht Jahre, wie schon im letzten Jahr. So sei es nun einmal. Seit vielen Jahren. Und wenn er dann weiterreden würde, kämen die Phrasen, die so aufgeblasen waren, dass sie gar nicht zu ihm passten: Wir müssen froh sein, hier leben zu dürfen. Es hätte schlimmer kommen können. Wir hätten in Peking landen können. Oder Europa. Wir müssen das Beste aus unserer Situation machen. Im Hier und Jetzt leben. Den Moment genießen. Es waren Worthülsen, so abweichend davon, wie er normalerweise redete, als hätte er sie irgendwo gelesen, aber er sprach sie mit einem solchen Nachdruck aus, als glaubte er wirklich daran.
Kuan strich über Wei-Wens zerzaustes Haar. »Ich würde gern mit ihm spielen«, sagte er sanft.
Wei-Wen zappelte in seinem Stuhl, einem Babystuhl, der eigentlich zu klein für ihn war, aber dadurch steckte er so fest darin, dass er meinem Heimunterricht nicht entkommen konnte. Er streckte sich erneut nach dem Teller.
»Ich will es wiederhaben! Meins!«
Kuan sah mich nicht an, er sagte nur im selben, zurückgenommenen Tonfall: »Du bekommst es nicht, aber weißt du was, die Zahnbürste kann auch ein Flugzeug sein.« Mit diesen Worten hob er Wei-Wen aus dem Stuhl.
»Aber … Kuan …«
Er schwang ihn leichthändig von einem Arm zum anderen, während er Richtung Bad ging, überhörte mich und plauderte weiter mit Wei-Wen. Er trug unseren Sohn, als würde er nichts wiegen, ich dagegen hatte schon jetzt das Gefühl, dass sein Kinderkörper allmählich schwer wurde.
Ich blieb sitzen, wollte etwas sagen, protestieren, aber die Worte kamen nicht. Kuan hatte recht. Wei-Wen war erschöpft. Es war spät. Er gehörte ins Bett, bevor er zu müde wurde und gar nicht mehr einschlafen wollte. Dann hätten wir länger mit ihm zu kämpfen, das wusste ich ja. Dann konnte er uns bis weit über unsere eigene Schlafenszeit hinaus auf Trab halten. Erst machte er Quatsch, riss immer wieder unsere Schlafzimmertür auf, spazierte herein, lachte glucksend, fangt mich doch! Dann folgten Wut und Frust, Geheule, wilde Proteste. So war er. So waren wohl alle Dreijährigen.
Wenngleich ich selbst mich nicht erinnern konnte, dass ich mich als Kind je so aufgeführt hatte. Mit drei Jahren lernte ich Lesen. Ich schnappte die Bedeutung der Zeichen auf und überraschte meine Lehrer damit, dass ich mir fließend Märchen vorlas, aber nur mir, niemals den anderen Kindern, von ihnen hielt ich mich fern. Meine Eltern sahen staunend zu, sie gaben mir weitere Märchen und einfache Kindergeschichten zu lesen, wagten es aber nie, mich mit anderen Texten herauszufordern. In der Schule aber wurde mein Talent gefördert. Die Lehrer erlaubten mir, mit meinen Büchern sitzen zu bleiben, wenn die anderen Kinder draußen spielten, und machten mich mit allem vertraut, was ihnen an ausgedienten Lernprogrammen, Texten und Filmen zur Verfügung stand. Vieles stammte noch aus der Zeit vor dem Kollaps, als die demokratischen Regierungen gestürzt worden waren, und dem darauffolgenden Weltkrieg, als Nahrungsmittel ein seltenes Gut und nur wenigen vergönnt waren. Damals waren noch so viele Informationen generiert worden, dass niemand den Überblick behalten konnte. Wortströme, die länger waren als die Milchstraße. Flächen von Bildern, Karten, Illustrationen, die so groß waren wie die Sonnenoberfläche. Auf Filmen festgehaltene Zeit, die einer Spanne von Millionen Menschenleben entsprach. Und die Technologie machte all das zugänglich. Verfügbarkeit war das Mantra der damaligen Zeit. Die Menschen konnten jederzeit, mit immer fortschrittlicheren Kommunikationsmitteln, auf all diese Informationen zugreifen.
Der Kollaps traf jedoch auch die sozialen Netzwerke. Innerhalb von drei Jahren brachen sie vollständig zusammen. Alles, was den Menschen blieb, waren Bücher, hakende DVDs, ausgeleierte Tonbänder, zerkratzte CDs mit abgelaufenen Programmen und das uralte, marode Fernleitungsnetz.
Ich verschlang die zerlesenen, alten Bücher und ruckelnden Filme. Ich las alles und merkte mir alles. Mehrmals versuchten Lehrer, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich ein begabtes Kind mit besonderen Talenten sei, aber bei diesen Gesprächen lächelten sie nur schüchtern, wollten lieber etwas über die normalen Dinge erfahren, ob ich Freunde hatte, ob ich gut rennen, klettern, flechten konnte. All die Gebiete, auf denen ich versagte. Doch die Scham darüber wurde nach und nach von meinem Wissenshunger verdrängt. Ich vertiefte mich in die Sprache und lernte allmählich, dass es zwar nicht für jedes einzelne Ding oder Gefühl ein Wort oder eine Umschreibung gab, für viele aber schon. Und ich lernte etwas über unsere Geschichte. Über das Massensterben unter den bestäubenden Insekten, über den Anstieg des Meeresspiegels, den Klimawandel, die Atomunfälle und über die alten Supermächte USA und Europa, die wegen ihrer mangelnden Anpassungsfähigkeit binnen weniger Jahre alles verloren hatten und die jetzt in tiefer Armut versunken waren – mit einer zu einem Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe geschrumpften Bevölkerung – und nur noch Korn und Mais produzierten. Wohingegen wir hier in China die Krise bewältigt hatten. Das Komitee, der höchste Rat der Partei, unsere Landesregierung, hatte uns mit harter Hand und effizient durch den Kollaps geführt und eine Reihe Beschlüsse getroffen, die das Volk oft nicht verstand, aber auch nicht in Frage stellen durfte. Das alles lernte ich als Kind. Und ich wollte immer nur weiterkommen. Immer mehr haben, mit Wissen angefüllt werden, ohne darüber nachzudenken, was ich lernte.
Erst, als ich auf eine zerfledderte Ausgabe des Buchs Der blinde Imker gestoßen war, hielt ich inne. Die Übersetzung aus dem Englischen war unbeholfen und umständlich, aber der Text zog mich dennoch sofort in den Bann. Es war im Jahr 2037 in China erschienen, nur wenige Jahre, bevor der Kollaps zur Tatsache wurde und es keine bestäubenden Insekten mehr auf der Erde gab. Ich nahm das Buch mit zu meiner Lehrerin und zeigte ihr Bilder von Bienenstöcken und detaillierte Zeichnungen von deren Bewohnern. Die Bienen faszinierten mich am meisten. Die Königin und ihre Kinder, die lediglich Larven in Zellen waren, und all der goldene Honig, der sie umgab.
Die Lehrerin hatte das Buch noch nie gesehen, ließ sich jedoch genauso davon fesseln wie ich. Wenn Passagen mit viel Text kamen, las sie diese laut vor. Es ging um Wissen. Darum, wider den eigenen Instinkt zu handeln, wenn man es besser wusste, denn um in der Natur und mit der Natur zu leben, müssen wir uns von der eigenen Natur entfernen. Und es ging um den Wert der Bildung. Denn genau davon handelte Bildung: der eigenen Natur zu trotzen.
Ich war acht Jahre alt und verstand nur einen Bruchteil. Doch ich hatte verstanden, wie ehrfürchtig meine Lehrerin gewesen war, dass das Buch sie berührt hatte. Und ich verstand die Sache mit der Bildung. Ohne Wissen waren wir nichts. Ohne Wissen waren wir Tiere.
Anschließend wurde ich zielstrebiger. Ich wollte nicht allein um des Lernens willen lernen, sondern um etwas zu verstehen. Bald überflügelte ich all meine Klassenkameraden, wurde die jüngste Jungpionierin auf der ganzen Schule und durfte das Halstuch der Parteiorganisation tragen. Damit ging ein banaler Stolz einher. Selbst meine Eltern lächelten, als man mir das rote Stoffstück um den Hals band. In erster Linie aber machte mein Wissen mich reicher. Reicher als die anderen Kinder. Ich war weder hübsch noch sportlich noch geschickt oder stark. Auf keinem anderen Gebiet konnte ich mich hervortun. Aus dem Spiegel starrte mir ein kantiges Mädchengesicht entgegen. Die Augen ein bisschen zu klein, die Nase zu groß. Dieses Durchschnittsgesicht verriet nichts darüber, was es in sich trug – etwas Goldenes, etwas, das jeden einzelnen Tag lebenswert machte. Und mir einen Weg aufzeigte, fortzukommen.
Schon als ich zehn war, hatte ich die Möglichkeiten ausgelotet. Es gab Schulen in anderen Teilen des Landes, eine Tagesreise entfernt, die mich aufnehmen würden, wenn ich fünfzehn war und eigentlich anfangen müsste, auf den Feldern zu arbeiten. Meine Schulleiterin half mir dabei, herauszufinden, wie ich mich bewerben konnte. Sie meinte, ich habe gute Chancen. Aber es kostete Geld. Ich redete mit meinen Eltern, ohne etwas zu erreichen, sie bekamen es mit der Angst zu tun und sahen mich an wie ein fremdes Wesen, das sie nicht verstanden, ja nicht einmal mehr mochten. Auch die Schulleiterin suchte das Gespräch mit ihnen, ich erfuhr nie, was sie eigentlich sagte, nur dass meine Eltern anschließend noch ablehnender waren. Sie hatten kein Geld und waren auch nicht bereit zu sparen.
Ich müsse mich anpassen, meinten sie, ich solle auf dem Boden bleiben und aufhören, kindischen Träumen nachzuhängen. Aber ich konnte es nicht. Denn ich war nun einmal so, wie ich war. Und würde es immer bleiben.
Wei-Wens Lachen ließ mich zusammenzucken. Sein lautes Jauchzen drang aus dem Bad, dessen Akustik die Geräusche verstärkte. »Nein, Papa, nein!«
Er lachte weiter, während Kuan ihn kitzelte und auf seinen zarten Bauch prustete.
Ich stand auf und stellte die Teller in die Spüle, dann ging ich zur Badezimmertür, blieb davor stehen und lauschte. Es war ein Lachen, das ich am liebsten aufgenommen hätte, um es ihm später einmal vorzuspielen, wenn er groß war und eine tiefe Stimme hatte.
Trotzdem konnte es mir kein Lächeln entlocken.
Ich legte die Hand auf die Klinke und schob die Tür auf. Wei-Wen lag auf dem Boden, während Kuan an seinem einen Hosenbein zerrte und zog. Er tat, als würde die Hose gegen ihn ankämpfen und sich nicht ausziehen lassen.
»Beeilst du dich bitte ein bisschen?«, sagte ich zu Kuan.
»Mich beeilen? Wie soll das gehen mit dieser störrischen Hose?«, antwortete Kuan, und Wei-Wen giggelte.
»Jetzt stachelst du ihn nur noch mehr auf.«
»Hör mir mal gut zu, liebe Hose, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn!«
Wei-Wen kringelte sich.
»Wenn du so weitermachst, ist er nachher viel zu aufgekratzt«, sagte ich. »Und wir kriegen ihn kaum noch ins Bett.«
Kuan antwortete nicht und sah weg, doch meine Kritik kam bei ihm an. Ich ging hinaus und schloss die Tür hinter mir. In der Küche erledigte ich rasch noch den restlichen Abwasch.
Dann holte ich die Schreibsachen hervor. Nur noch ein Viertelstündchen, das konnte er verkraften.
William
Oft saß sie hier an meinem Bett, über ein Buch gebeugt, las konzentriert und blätterte langsam um. Meine Tochter Charlotte, die mit ihren vierzehn Jahren sicher Besseres zu tun gehabt hätte, als sich in meine stumme Gesellschaft zu begeben. Trotzdem kam sie immer häufiger. Durch ihre Anwesenheit, ihr ständiges Lesen, konnte ich den Tag von der Nacht unterscheiden.
Thilda hatte heute nicht zu mir hereingeschaut, sie war jetzt seltener bei mir, nicht einmal den Hausarzt schleppte sie noch herbei. Vielleicht ging unser Geld jetzt ernsthaft zur Neige.
Rahm hatte sie nie erwähnt, nicht mit einem Wort. Das wäre mir selbst im Tiefschlaf nicht entgangen. Sein Name hätte mich von den Toten erweckt. Wahrscheinlich hatte sie nie eins und eins zusammengezählt, hatte nie verstanden, dass mein letztes Gespräch mit ihm und sein höhnisches Lachen mich hierher getrieben hatten, in dieses Zimmer, dieses Bett.
Er hatte mich damals zu sich gebeten. Ich war mir nicht im Klaren gewesen, warum er mich treffen wollte. Schon seit mehreren Jahren hatte ich nichts mehr von ihm gehört, wir hatten allenfalls ein paar Höflichkeitsfloskeln gewechselt, wenn wir uns ein seltenes Mal in der Stadt begegneten, und dann hatte stets er das Gespräch beendet.
Der Herbst war auf dem Höhepunkt, als ich mich aufmachte, Rahm zu besuchen. Die Blätter strahlten in leuchtendem Gelb, warmem Braun und tiefem Blutrot, ehe der Wind sie wegreißen und auf den Boden und in die Fäulnis zwingen würde. Die Bäume waren schwer von Äpfeln, saftigen Pflaumen, triefend süßen Birnen, und in der Erde wuchsen knackige Möhren, Kürbisse, Zwiebeln und duftende Kräuter, die nur darauf warteten, geerntet und verspeist zu werden. Das Leben schien unbeschwert wie im Garten Eden. Meine Füße flogen leicht über den efeubewachsenen Boden, als ich durch ein Waldstück auf Rahms Haus zulief. Ich freute mich darauf, ihn wiederzusehen und in Ruhe mit ihm reden zu können, so wie wir es vor langer Zeit einmal getan hatten, bevor ich Vater so vieler Kinder wurde und das Saatgutgeschäft all meine Zeit in Anspruch nahm.
Er empfing mich in der Tür, trug die Haare immer noch kurzgeschoren, war immer noch schlank, sehnig und muskulös. Er lächelte kurz, sein Lächeln währte nie lang, und bat mich in sein Arbeitszimmer, das mit Pflanzen und Glasbehältern vollstand; in mehreren davon konnte ich Amphibien erahnen, ausgewachsene Frösche und Kröten, die er vermutlich aus Kaulquappen gezüchtet hatte. Diesem Bereich der Naturwissenschaft widmete er seine ganze Aufmerksamkeit. Als ich achtzehn Jahre zuvor nach meinem bestandenen Examen zu ihm gekommen war, hatte ich gehofft, die Insekten erforschen zu können, insbesondere die eusozialen Arten, bei denen die Individuen fast wie ein großer Organismus zusammenlebten – ein Superorganismus. Ihnen galt meine Leidenschaft, den Hautflüglern und Termiten, den Hummeln, Wespen, Bienen und Ameisen. Rahm hatte jedoch gemeint, das müsse noch warten, und bald darauf war auch ich mit diesen Zwischenwesen befasst, mit denen sein Arbeitszimmer bis heute gefüllt war, Kreaturen, die weder Insekten noch Fische oder Säugetiere waren. Ich war nur sein wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, deswegen hatte ich mir keinen Protest erlauben können, und es war eine Ehre, für ihn arbeiten zu dürfen, das hatte ich gewusst und war deshalb in erster Linie damit beschäftigt gewesen, ihm meine Dankbarkeit zu erweisen, anstatt irgendwelche Forderungen zu stellen. Damals hatte ich versucht, seine Faszination zu teilen, und damit gerechnet, dass er mir, wenn die Zeit reif war und ich es auch, mehr Raum für meine eigenen Projekte gewähren würde. Doch dieser Tag kam nie, und mir wurde schnell klar, dass ich meine eigene Forschung in der Freizeit durchführen musste, indem ich mit den Grundlagen begann und mich dann langsam vorarbeitete. Doch dafür blieb trotzdem nie Zeit, weder vor noch nach Thilda.
Rahms Haushälterin servierte Tee und Kuchen. Wir tranken aus filigranen Tassen, die fast zwischen den Fingern verschwanden, ein Service, das er auf einer seiner vielen Forschungsreisen im Fernen Osten gekauft hatte, ehe er sich hier aufs Land zurückzog.
Während wir den Tee schlürften, erzählte er von seiner Arbeit. Von seiner aktuellen Forschung, seinen jüngsten wissenschaftlichen Vorträgen, seinen künftigen Artikeln. Ich lauschte nickend, stellte Fragen, bemühte mich um qualifizierte Kommentare und lauschte erneut. Ich sah ihn an und wünschte, er würde meinen Blick erwidern. Doch meistens schweifte sein Blick durch den Raum, über die Gegenstände, als spräche er zu ihnen.
Dann wurde es still, nur der Wind, der draußen die braunen Blätter von den Bäumen zerrte, war noch zu hören. Ich trank vom Tee, und mein Schlürfen ertönte viel zu laut in der Stille. Meine Wangen wurden heiß, hastig stellte ich die kleine Tasse ab. Er schien jedoch nichts bemerkt zu haben, saß nur schweigend da, ohne mich weiter zu beachten.
»Heute ist mein Geburtstag«, sagte er schließlich.
»Bitte verzeihen Sie … ich ahnte ja nicht … meinen herzlichen Glückwunsch!«
»Wissen Sie, wie alt ich geworden bin?« Jetzt sah er mir in die Augen.
Ich zögerte. Wie alt mochte er sein? Ziemlich alt. Weit über fünfzig. Vielleicht sogar an die sechzig? Ich wand mich, merkte plötzlich, wie heiß es im Zimmer war, räusperte mich. Was sollte ich antworten?
Als ich nichts sagte, schlug er den Blick nieder. »Es ist auch nicht weiter wichtig.«
War er enttäuscht? Hatte ich ihn enttäuscht? Wieder einmal?
Seine Miene verriet nichts dergleichen. Er stellte die Tasse ab, nahm einen Kuchen, wie alltäglich, einen Kuchen, obwohl sich unser Gespräch langsam in eine Richtung entwickelte, die alles andere als alltäglich schien.
Er legte den Kuchen wieder auf seinen Teller, ohne davon abzubeißen. Die Stille im Raum war quälend. Es war an mir, etwas zu sagen.
»Werden Sie feiern?«, fragte ich und bereute es sofort. Was für eine alberne Frage, als sei er ein Kind.
Und er ließ sich auch nicht zu einer Antwort herab, saß mit dem Teller in der Hand da, aß jedoch nicht, sondern blickte nur auf das kleine, trockene Kuchenstück hinab. Als er die Finger bewegte, glitt der Kuchen zum Tellerrand, aber er hielt ihn schnell wieder auf, rettete das Gebäck und stellte den Teller ab.
»Sie waren ein vielversprechender Student«, sagte er mit einem Mal.
Er holte tief Luft, als wollte er noch mehr sagen, doch die Worte kamen nicht.
Ich räusperte mich. »Ja?«
Er änderte seine Haltung, ließ die Arme nach unten baumeln und blieb einfach so sitzen, mit geradem Rücken. »Als Sie zu mir kamen, habe ich große Hoffnungen in Sie gesetzt. Ihr Enthusiasmus, ihre glühende Leidenschaft hat mich überzeugt. Denn eigentlich hatte ich gar keine Pläne, einen Assistenten einzustellen.«
»Danke, Herr Professor. Ihre Worte sind sehr schmeichelhaft.«