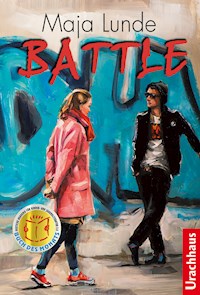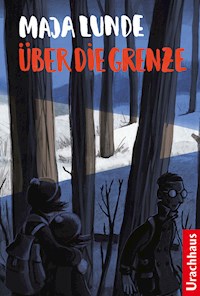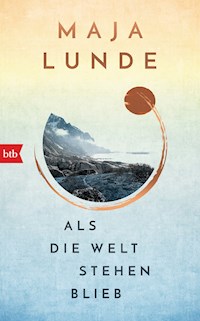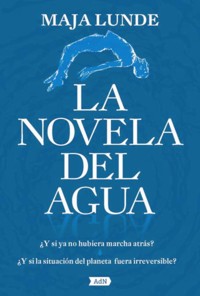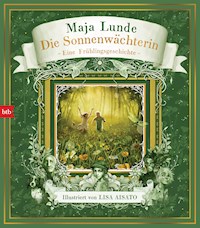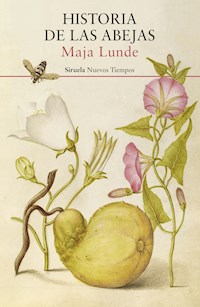11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klimaquartett
- Sprache: Deutsch
Das große Finale des Klimaquartetts
Eine Kammer hoch im Norden, gefüllt mit Pflanzensamen aus aller Welt. Drei Brüder und ihre Großmutter, vereint in der Hoffnung, dieses letzte Band zwischen Mensch und Natur zu behüten.
Tommy wächst in der kargen Landschaft Spitzbergens mit zwei Brüdern bei seiner geliebten Großmutter auf. Als wichtigste Lebensweisheit gibt sie ihm mit: In einer großflächig zerstörten Welt ist die Saatgutkammer ein Schatz, der mit allen Mitteln beschützt werden muss. Tommy soll diese Aufgabe später von seiner Großmutter übernehmen. In eindrucksvollen Bildern und mit viel Wärme erzählt Maja Lunde von der Bedeutung des Familienzusammenhalts und von unserem Umgang mit der Natur. Sie beschäftigt sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit: Wie wurde der Mensch zu einer Spezies, die alles verändert hat? Und sind wir selbst eine bedrohte Art?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Spitzbergen 2110: Tief in den Bergen liegt eine Schatzkammer, die mit Pflanzensamen aus aller Welt gefüllt ist. Tommy wächst in dieser kargen, gnadenlosen Landschaft auf, mit seinen zwei Brüdern und seiner Großmutter – der Hüterin des Saatguts. Schon vor vielen Jahren hat man hier am Nordpol den Kontakt zu den anderen Ländern abgebrochen und versucht, im Einklang mit der Natur zu leben. Doch dann wird Spitzbergen von einer Katastrophe heimgesucht – und Tommys Familie gehört zu den wenigen Überlebenden. Eine Handvoll Menschen auf einer verlassenen Insel, mit einem Schatz, den die Welt verloren glaubte.
Zur selben Zeit, aber weit entfernt, zehrt Tao von den Erinnerungen an ihren Sohn Wei-Wen, den sie zwölf Jahre zuvor verloren hat. Wie alle ihre Landsleute hungert auch sie, denn die Natur ist endgültig ausgebeutet und unzählige Arten sind vom Erdball verschwunden. Doch alles könnte sich ändern, als Tao gebeten wird, eine Expedition zu leiten. Ihr Ziel: Spitzbergen.
Zur Autorin
MAJA LUNDE wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Ihr Roman Die Geschichte der Bienen wurde ein weltweiter Erfolg und stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Es folgten die Romane Die Geschichte des Wassers und Die Letzten ihrer Art. Der Traum von einem Baum ist der fulminante Abschluss von Maja Lundes Klimaquartett.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Drømmen om et tre« bei H. Aschehoug & Co., Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Das Zitat »In alten, alten Zeiten ...« stammt mit freundlicher Abdruckgenehmigung aus: © Michael Ende: Momo. 1973, 2021 Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart.
Copyright © 2022, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Stocksy United/Haus Klaus
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22510-0V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Jesper, Jens und Linus
Longyearbyen
Spitzbergen 2097
Am Tag nach der letzten Mitternachtssonne wurde in Longyearbyen ein Baum an Land gespült. Damals war Tommy fünf Jahre alt und allein im alten Containerhafen unterwegs. Er war eine Weile zwischen den rostigen Metallwänden umhergestreift und hatte sich mit dem Rücken an einen Container gesetzt, auf dem Tollpost Globe stand, wie er mühsam entziffern konnte, und sich in den Strahlen der tief stehenden Sonne aufgewärmt.
Und während er dort saß und mit einem Stock in der sandigen Erde stocherte, entdeckte er die Blätter. Sie ragten ein Stück entfernt am Fjord auf, die grüne Farbe wirkte vollkommen fremd am steinigen schwarzen Ufer.
Er stand auf, behielt seinen Stock in der Hand, der gerade, lang und stabil war, einer der besten Stöcke, die er seit Langem gefunden hatte, und trabte den Strand hinab. Dort lag der Baum auf dem dunklen Grund parallel zur Uferlinie, mit der Krone zum Flussdelta des Adventdalen im Osten und den Wurzeln zum dunklen Isfjord im Westen.
»Ein Baum!«, rief Tommy, als würde es noch wirklicher werden, wenn er es laut aussprach.
Auf Spitzbergen trieben immerzu Bäume ans Ufer, große Stämme von Lärchen, Fichten und Kiefern, von Wind und Strömung bewegt, sie kamen weither, bis aus Sibirien. Weißgespült vom Meer, von Rinde befreit, vollgesogen mit Wasser und nach Jahren in der See von vielen kleinen Tieren erobert, keine richtigen Bäume mehr, sondern nur noch Schatten ihrer selbst.
Aber dieser war anders, er sah aus wie ein lebendiger Baum, mit großer, dichter Krone. Die Blätter waren zwar ein wenig welk und gekräuselt, aber viele saßen immer noch fest, und auch wenn ihre Farbe blass und verwaschen war, hatten sie einen deutlichen grünen Schimmer. Tommy zupfte vorsichtig an einem. Gleichzeitig ließ er den Stock los, den er eben noch so schön gefunden hatte, denn jetzt, angesichts dieses riesigen Baums voller lebender Arme, erschien er ihm trocken und tot.
Das Blatt löste sich sofort. Er strich mit dem Finger über die grüne Oberfläche, drehte es hin und her und erkannte deutlich, dass seine Vorder- und Rückseite verschieden waren, die eine viel grüner als die andere. Er nahm das Blatt zwischen Zeigefinger und Daumen und hielt es gegen die Sonne, kniff das eine Auge zu und sah mit dem anderen, wie die grüne Fläche, die an hauchdünnen Stoff erinnerte, das Licht filterte. Die Blätter saßen parallel an längeren Stängeln, wie kleine Familien. Er brach einen ganzen Stiel ab und zählte sie. Neun Blätter insgesamt.
Dann ging er am Strand ein Stück weiter und hockte sich neben den Stamm. Er legte die Hand auf die gräuliche Rinde, die hart und knorrig war, und strich behutsam an ihr entlang.
»Schöner Baum«, sagte er.
Schließlich drückte er die Nase vorsichtig an den Stamm und sog den Geruch ein.
»Rinde«, sagte er zu sich selbst. »So riecht Rinde.«
Wieder stand er auf. Trat einen Schritt vom Baum zurück, um sich einen Überblick zu verschaffen. Er hatte schon viele Bilder von Wäldern und Bäumen gesehen und wusste, dass es sie in allen Größen gab. Die größten Bäume der Welt waren einst an einem Ort namens Kalifornien gewachsen, hatte seine Großmutter ihm erklärt, Mammutbäume, die über 4000 Jahre alt und über 100 Meter hoch werden konnten.
Tommy wusste, dass zwei seiner Schritte einen Meter lang waren, und deshalb eilte er jetzt bis zum Ende der Krone und begann den Baum zu vermessen.
Es war schwierig, weil er immer wieder vergaß, dass ein Schritt nicht einen Meter maß, sondern nur einen halben. Er zählte laut, um es zu schaffen, geriet aber mit den Zahlen durcheinander und musste mehrmals von vorn anfangen. Am Ende glaubte er trotzdem zu wissen, wie groß der Baum war.
»23 Meter«, sagte er. »Ein 23 Meter langer Baum ist nach Spitzbergen gekommen!«
Ihm brummte der Schädel von der ganzen Zählerei. Er dachte, dass er seine Großmutter holen musste, denn wenn auf Spitzbergen etwas Wichtiges geschah, wusste die Großmutter am besten, was zu tun war. Doch jetzt musste er sich erst ausruhen, und deshalb streckte er sich neben dem Baum aus und legte den linken Arm um den Stamm. Er fand eine halbwegs gemütliche Position auf dem steinigen Boden und spürte, wie der Stamm gegen die Innenseite seines Oberarms drückte. Er hatte keine Vorstellung, wie lange er hier so liegen wollte, die Uhr konnte er noch nicht lesen, und soweit er wusste, wartete auch keiner auf ihn. Außerdem hatte er sowieso noch kein richtiges Verhältnis zur Zeit – für ihn war Zeit etwas, das nur dann verging, wenn er beschäftigt war. Und jetzt machte er ja nichts, er lag einfach nur da, während die Sonne genauso stark schien wie immer um diese Jahreszeit, und dachte an den Baum, den Stamm, die Blätter und daran, dass er erschöpft war.
Und dann schlief er ein.
Ein schmächtiges Kind, die Arme um einen Baum geschlungen, an einem schwarzen Steinstrand. Es ging ein leichter Wind, der das Wasser zu kleinen, steilen Wellen aufpeitschte, die eine zarte Spitzenhaube aus weißen Bläschen trugen. Dunkles Wasser schlug gegen die hohen Berge, in denen Erdrutsche erst kürzlich lange Wunden zwischen die dünnen Schichten der Vegetation gerissen hatten. Im Flachland wuchsen niedrige Büsche, Gräser und Halme, über den Südhängen lag ein Flor aus kleinen rosa und gelben Blumen. Möwen schwebten über ihm vorüber, flogen vom Tal zum Fjord und verschwanden weiter hinaus zum Vogelfelsen. Doch der Junge sah nichts von alldem, er schlief tief und fest.
Eine laute Mädchenstimme riss ihn aus dem Schlaf.
»Tommy?«
Die Stimme klang ängstlich und ratlos.
»Hallo? Schläfst du?«
Er setzte sich auf, wusste im ersten Moment nicht, wo er war. Dann wandte er den Kopf und sah das Gewirr aus Ästen um sich herum. Er spürte, wie steif sein ganzer Körper und vor allem der eine Arm war, den er um den Baum gelegt hatte.
»Tommy, was machst du denn da?«
Er drehte sich um und starrte Rakel an, die in einiger Entfernung stand, die Hände in die Hüften gestemmt, den Kopf schief gelegt und mit verwunderter Miene. Sie war genauso alt wie er, aber einen Kopf größer, dünn und schlaksig, mit knochigen Schultern. Ihre Haare sahen oft fettig aus, besonders seit ihre Eltern vor Kurzem bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen waren.
Jetzt rannte sie auf ihn zu. Kohlschwarzer Felsschutt und Steinchen lösten sich unter ihren Füßen, aber sie bemerkte es gar nicht, denn sie bewegte sich geschmeidig, fast lautlos, als hätte sie eigentlich gar keinen Bodenkontakt.
Staunend blieb sie stehen. »Haben wir einen Baum bekommen? Der ist ja riesig!«
Tommy kam auf die Beine und stellte sich schützend vor den Baum. »Den habe ich gefunden.«
»Ja. Aber deshalb gehört er dir ja nicht?«
Sie schubste ihn etwas. Er spürte die Kraft in ihren Händen, aber er stemmte die Füße in den Boden, wollte nicht weichen.
»Ich habe ihn gefunden«, wiederholte er.
Ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, die Neugier und die Freude verschwanden daraus.
»Und jetzt ist es einfach dein Baum?«
Er nickte.
»Und du hast ihn umarmt«, sagte sie langsam, und jetzt klang ihre Stimme hart und spöttisch.
»Gar nicht!«
»Doch«, sagte sie lauter. »Tommy hat einen Baum umarmt! Tommy hat einen Baum umarmt!«
Sie begann es zu singen, Tommy hat einen Baum umarmt, in einem Tonfall, als würde sie singen, er hätte jemanden geküsst. Oder sich in die Hose gemacht.
»Nein, habe ich gar nicht«, protestierte er. »Ich habe ihn überhaupt nicht umarmt.«
Doch sie sang einfach weiter: »Tommy hat einen Baum umarmt, Tommy hat einen Baum umarmt!«
Sein Herz hämmerte vor Wut, und die Wut wuchs in seinem Körper wie Zweige.
»Nein«, sagte er, jetzt leiser.
»Aber ich habe gesehen, dass du es gemacht hast«, erwiderte sie. »Ich habe es doch gesehen!«
»Nein!«, sagte Tommy.
Rakel musterte den Baum. »Und es ist nicht mal ein echter Baum, er ist mausetot, das siehst du doch wohl.«
Er drehte sich zu dem Baum um, und wie er dort lag, sah er irgendwie trauriger aus, die grüne Farbe war verblasst, viele der Blätter waren schon abgefallen und weggeweht worden.
Rakel ging näher heran und trat gegen Tommys Baum, es raschelte, als noch mehr Blätter abfielen. »Du weißt, dass du nie einen echten Baum zu sehen bekommen wirst, Tommy. Du bist ein Spitzbergenkind.«
Sie sagte es leise, wie gleichgültig. Und dann kam sie ganz dicht an ihn heran.
»Er lebt nicht«, sagte sie ihm ins Gesicht, so nah, dass er ihren Atem riechen konnte, der überraschend süßlich war. »Das ist bloß eine Leiche. Dein Baum ist genauso tot wie die Leichen, die sie im Ofen verbrennen!«
Seine Füße wollten mit ihm davonlaufen, aber die Hände wollten etwas anderes.
Er hob die eine Hand und schlug sie.
Es war kein guter Schlag, eher ein Klaps.
Aber er hatte sie schlagen wollen, und das verstand sie. Rakel erwiderte den Schlag, oder den Klaps, indem sie ihm auch einen Klaps gab.
Das reichte aus, um sich auf sie zu stürzen. Er schlang die Arme um ihren dünnen Mädchenkörper, als würde er sie umarmen, und holte mit einer Hand aus, um sie am strohigen schwarzen Haar zu packen, während sich ihre ungeschnittenen Fingernägel seinem Gesicht näherten. Sie kratzte so fest über seine Wange, dass er es ratschen hörte.
»Hör auf!«, jaulte er, ließ sie los und fasste sich an die Wange. Seine Fingerspitzen waren rot.
Er ging erneut auf sie los.
Schubste, zerrte, zog, raufte mit ihr.
Doch sie war stark und gesund.
Ohne dass er verstand, wie es ihr gelang, stellte sie ihm ein Bein, und er fiel auf den harten, steinigen Boden.
»Au!«
Im nächsten Moment hatte sie sich auf ihn gesetzt, seine Hände gepackt und über seinen Kopf gestreckt.
»Du bist eklig, Tommy!«
»Nein«, sagte er. »Nein, gar nicht.«
Er schluchzte und versuchte sich loszureißen, doch vergeblich. Sie hielt ihn fest, und sie war zwar dünner als er, aber trotzdem so schwer, dass er es nicht schaffte, sie abzuschütteln. Er zappelte und trat um sich, wand den Oberkörper, warf den Kopf hin und her und schrie.
Und während er dort lag, spürte er, dass er nicht nur verzweifelt und wütend war, sondern dass er es auf gewisse Weise auch genoss. Es tat gut, die Kontrolle zu verlieren und sich gehen zu lassen, während sie ihn vollkommen beherrschte. Etwas in ihm wollte, dass es nicht aufhörte.
Doch dann wurde Rakel von starken Armen weggezerrt.
»Jetzt reicht’s«, sagte eine Stimme, die Tommy gut kannte. »Schluss jetzt!«
Es war seine Großmutter. Er erhaschte einen Blick auf die funkelnden Augen unter der Strickmütze, den dunklen Haarschopf auf ihrer Stirn, den grünen Anorak, den sie immer trug. Sie war kleiner als die meisten anderen Erwachsenen, aber trotzdem der stärkste Mensch, den er kannte.
Die Großmutter packte Rakel unter den Achseln und zog sie hoch, ehe sie sich ihren Enkel schnappte und ihn auf die Beine stellte.
Rakels eine Wange war gerötet, er musste sie getroffen haben, ohne es zu merken. Er selbst spürte, wie ihm das Blut aus der Nase und vom Kinn troff, einiges lief ihm auch in den Mund, es schmeckte herb und metallisch.
Die Großmutter sah erst Rakel, dann Tommy an und schüttelte langsam den Kopf.
»Der Baum, Oma«, sagte er und deutete nach hinten. »Sieh dir mal den großen Baum an.«
»Ja«, sagte seine Großmutter. »Ich sehe ihn.«
Aber es schien nicht so, als hätte sie ihn wirklich gesehen, denn erst jetzt trat sie ein paar Schritte vor und riss die Augen auf.
»Das ist eine Esche«, sagte sie, ging ganz dicht heran und zupfte ein Blatt ab.
»Sie ist aus dem Meer gekommen«, sagte er.
»Ja«, sagte seine Großmutter. »Das ist mir klar.«
Sie tätschelte den Baumstamm vorsichtig. »So etwas habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.«
Dann drehte sie sich zu den Kindern um. »Habt ihr euch um den Baum geprügelt?«
»Ja«, antwortete Rakel.
»Nein«, antwortete Tommy.
»Ja und nein«, sagte die Großmutter. »Dann reden wir jetzt nicht weiter darüber.«
Doch hinterher, als sie nach Hause gingen und Rakel längst davongerannt war, wollte sie trotzdem weiter darüber sprechen.
Die Hand der Großmutter war dünn und sehnig, aber stark. Sie hielt ihn fest.
»Ich finde, du solltest dich nicht mit Rakel streiten«, sagte sie.
»Sie hat gesagt, der Baum wäre eine Leiche und man sollte ihn im Ofen verbrennen.«
»Rakel denkt viel an den Ofen«, sagte die Großmutter.
»Sie ist dumm.«
»Vielleicht war es dumm von ihr. Aber das musst du aushalten. Von Rakel. Das musst du ihr gerade jetzt nachsehen.«
»Das ist ungerecht«, sagte er.
»Ja«, sagte die Großmutter. »Aber andere Dinge sind noch ungerechter.«
Und dann gingen sie weiter, und er wusste, dass sie recht hatte. Gerade jetzt mussten sie Rakel viel nachsehen.
TOMMY
2110
Nein! Stopp!«
Das Schiff hält stetig Kurs nach Westen, Richtung offene See. Es liegt in der Mitte des Fjords, wirkt wie ein Spielzeugboot vor den Bergen.
»Henry! Hilmar!«
Sie fahren schnell, der von Solarzellen bedeckte Rumpf wankt ein wenig, wird jedoch von großen grauen Segeln stabilisiert, die dafür sorgen, dass das Schiff sicher durch die Wassermassen gleitet. Die Fenster sind zwei schmale dunkle Streifen.
»Komm zurück! Dreh um!«
Tommy steht am Ufer, das Wasser schwappt um seine Füße, er watet weiter hinein, spürt, wie seine Schuhe durchnässt werden, doch es kümmert ihn nicht, er rudert mit den Armen.
»Bitte! Henry! Hilmar!«
Doch das Schiff bewegt sich unbeirrt weiter, und er bleibt als winziger Fleck am schwarzen Strand zurück. Selbst wenn er winkt, springt, schreit, werden sie es nie und nimmer bemerken.
Die Wellen des Isfjord schäumen weiß, türmen sich über dem dunkelblauen Untergrund auf. Die Brandung schlägt gegen die Klippen, Wasser und Land kämpfen rhythmisch gegeneinander.
»Bringt mir meine Brüder zurück!«
Der Wind verschluckt seine Stimme, trotzdem ruft er weiter.
»Bitte kehrt um, jetzt sofort!«
Der Nebel wälzt sich von den Bergen herab und verschleiert den Fjord vor ihm, gleich wird er das Schiff einhüllen, bald ist es ganz verschwunden, und mit ihm seine Brüder.
SvalSat, denkt er, dreht sich um, beugt den Nacken zurück, starrt zum Platåberg. Dort oben, fast 500 Meter über dem Meer, liegt die Satellitenstation.
Er rennt los, zwingt sich dazu, den Blick vom Schiff abzuwenden, folgt dem Weg am Fjordufer entlang zurück, vorbei an den Ruinen des Leuchtturms auf Vestpynten und weiter ins Innere des Adventfjords auf Hotellneset zu. Das Herz pocht ihm in den Ohren, der Schweiß läuft ihm den Rücken hinab, und sein Hals brennt. Sie sind ohne mich gefahren, sie sind ohne mich gefahren.
Kurz hinter dem verlassenen Flugplatz gabelt sich der Weg endlich, der eine Teil führt weiter nach Longyearbyen, der andere zum Berg.
Die Steigungen schreien ihm ins Gesicht, offenbar hat sich jeder einzelne Stein gegen ihn verschworen. Nur zehn Meter, denkt er, nur zehn Meter am Stück, während er seinen Blick auf einen Punkt direkt vor sich richtet, um den Gipfel nicht sehen zu müssen, der so unendlich weit entfernt scheint.
Als er endlich oben angekommen ist, bleibt er gekrümmt stehen und japst nach Luft, während er den Fjord betrachtet. Der Nebel hat sich verzogen, aber das Schiff ist jetzt noch kleiner, nicht mehr als ein weißer Fleck vor der Dunkelheit des Fjords. Es nähert sich unerbittlich dem offenen Meer.
Tommy dreht sich zu SvalSat um. Ein Dutzend großer Satellitenschüsseln, die auf dem Berg verteilt stehen und einen großen Bereich abdecken. Sie wurden auf Betonsockel montiert, einige sind mit Planen abgedeckt. Sie leuchten weiß vor dem braunen und grauen Gestein, gleichen riesigen Pilzen in der Landschaft; fremde Elemente, die aus dem Boden emporwachsen, als hätte ein UFO dort Sporen verstreut.
Viele von ihnen wurden längst von Wetter und Wind zerstört, die Plane ist weggerissen oder flattert im Wind, übrig sind nur noch teilweise eingestürzte Skelette um große Satellitenschüsseln.
Er weiß noch, wie neugierig sie als Kinder auf die Satellitenstation waren. Keiner durfte dort hinaufgehen, keiner die Station benutzen. Sie erzählten sich gegenseitig, die Schüsseln auf dem Berg seien magische Pilze, und wenn man sie äße, könne man sich mit einer anderen Dimension verbinden. Die Satellitenstation sei ein Portal zu anderen Menschen und Orten.
Doch aus der Ferne ist sie am schönsten, die zerstörten Dächer, verrosteten Stahlgebäude und der bröckelnde Beton haben nichts Magisches mehr an sich.
Er eilt zum Hauptgebäude, versucht die Tür zu öffnen, die verzogen ist, man muss fest daran rütteln. Dann durchquert er eine schmutzige Teeküche mit zerschlissenen Sofas und einer offenen Besteckschublade und läuft einen Korridor entlang bis zum Kontrollraum. Ein leerer, hufeisenförmiger Schreibtisch nimmt den halben Raum ein, und an der Wand hängen große Monitore. Er prüft die Schalttafel des hauseigenen Mikrokraftwerks und sieht, dass es läuft. Er hat Strom, nimmt sich jedoch nicht die Zeit, das Licht einzuschalten, sondern ist schon mit zwei Schritten an der innersten Tür, die zu einem kleineren Kontrollraum führt. Hier steht die Funkausrüstung. Die einzige funktionierende Kommunikationstechnik, über die sie noch verfügen.
Er wühlt in den alten Notizbüchern auf dem Tisch, findet ein Bibliotheksbuch über Kurzwellenfunk. Rakel muss es hergebracht haben.
Die Bedienung des Funkgeräts erscheint einfach. Es hat Strom, ein kleines grünes Lämpchen blinkt. Tommy drückt fieberhaft irgendwelche Knöpfe, setzt sich das Headset auf.
»Tao!«, schreit er ins Mikrofon, noch bevor er den richtigen Knopf erwischt. »Tao, bitte, ihr müsst umkehren! Ihr müsst zurückkommen!«
Er erhält nur weißes Rauschen zur Antwort, redet trotzdem weiter. »Ihr müsst umdrehen, ihr müsst meine Brüder zurückbringen. Hilmar! Henry! Und Runa! Sie sind doch noch Kinder. Ihr könnt sie nicht mitnehmen. Sie gehören hierher, du kannst sie nicht einfach mitnehmen!«
Er glaubt einen Laut am anderen Ende zu hören, umklammert das Mikrofon, spürt, dass es schweißnass ist, versucht seine Stimme zu kontrollieren, erwachsen zu klingen. »Tao, hör mir jetzt zu. Ihr müsst sofort umdrehen.«
Doch niemand antwortet.
Er zieht den Stuhl heraus, legt das Mikrofon einen Moment zur Seite, um sich ordentlich hinzusetzen.
»Tao. Die Kinder sind Einwohner von Spitzbergen. Sie leben hier. Bei mir.«
Er hört nichts als Rauschen im Funkgerät. Und er weiß, dass das Schiff dort draußen unaufhaltsam weiterfährt, dass es auf dem Weg in eine ganz andere Welt ist, dass der Bug bald auf die großen Meereswogen trifft.
Tommy wickelt das Kabel rasch um den Mittelfinger der linken Hand, während er das Mikrofon weiter in der rechten hält.
»Komm mit meiner Familie zurück!«
Doch nur die Stille antwortet ihm. Er ist allein. Wie der Pelztierjäger, nach dem er benannt ist, der den Winter über hier in die Isolation entsandt wurde. Doch im Unterschied zu allen Jägern, die vor ihm hier waren, wird im Frühling niemand kommen, um ihn wieder abzuholen, niemand wird sich jemals die Mühe machen, nach Tommy Mignotte zu sehen, sich zu erkundigen, wie es ihm geht.
Er lässt das Mikrofon fallen, zieht die Füße auf dem Stuhl an sich, legt den Kopf auf den Knien ab. Hunderte Erinnerungsbilder von den Brüdern kreisen durch seinen Kopf. Im allerletzten Bild findet er am Ende Frieden. Die Brüder im Bett mit geschlossenen Augen, Tommy hatte den Kopf zur Tür hereingesteckt, um nach ihnen zu sehen, ehe er ins Bjørndalen aufbrach. Es war Nacht, sie schliefen tief und fest. Henry auf der Seite, wie ein Ball unter der Decke, nur das Haar lugte hervor. Hilmar auf dem Rücken, die Arme hinter dem Kopf, selbst im Schlaf geborgen. Tommy ruht in diesem Bild: Hilmar, das ruhige, schlafende Gesicht des kleinen Bruders.
Als Hilmar ihm zum ersten Mal in den Arm gelegt wurde, zitterte Tommy vor Stolz. Er hatte sich einen Bruder oder eine Schwester gewünscht, solange er denken konnte. Er kannte sonst keine Einzelkinder, was ihn unfreiwillig zu einem Außenseiter machte, und als er im Alter von acht Jahren erfuhr, dass er endlich einen Bruder bekommen würde, brach er in Tränen aus. »Das ist die größte Begebenheit meines Lebens«, sagte er ernst und merkte nicht, wie sich der Vater lächelnd abwandte und seine Großmutter halb ironisch und halb stolz murmelte: »In welchem Buch hat er denn die Formulierung aufgeschnappt?«
Tommy war bei der Schwangerschaft seiner Mutter mit ganzem Herzen dabei. Neun Monate erwiesen sich als eine unglaublich lange Zeit. Er las Bücher über Babys im Mutterleib, war immer genau im Bilde über Größe und Entwicklungsstadium des Embryos. Fasziniert betrachtete er Ultraschallaufnahmen des Ungeborenen. Der Mutterkuchen, die Nabelschnur, das seltsame Wesen, das immer mehr einem Menschen glich und immer weniger Platz hatte. Außerdem las er mit großen Augen Texte über den Geburtsverlauf und was dabei alles schiefgehen konnte.
Hilmar war klein und niedlich, Tommys Hände wirkten riesig neben dem winzigen Gesicht, seine Finger knubbelig und hässlich, mit Trauerrändern unter den Nägeln. Tommy dachte sich, seine Eltern müssten ihn abstoßend finden. Im Vergleich zu diesem überirdischen, zarten Wesen war er schmutzig, zerzaust und rau. Er begann sich die Hände zu schrubben und die Haare zu kämmen, aber das Gefühl gab sich erst wieder, als die Mutter ihn eines Abends wortlos auf ihren Schoß zog und lange und fest umarmte.
Außerdem bewies Hilmar schon nach wenigen Tagen, dass er keineswegs von einem anderen Planeten stammte, sondern überaus irdisch war. Seine Windeln stanken nach Schwefel, er pinkelte quer über den Wickeltisch, und sein kleiner Körper brachte ein so lautes Brüllen hervor, dass der Platåberg wackelte. Doch weder sein Geschrei noch die Windeln oder die Furcht davor, dass ihn die Eltern nicht mehr mochten, konnte Tommy davon abbringen, den kleinen Bruder zu mögen. Denn Tommy fand Hilmar ja auch liebenswert, und er erhob sofort eine Art Besitzanspruch auf den Kleinen. Die winzigen Finger, die kaum sichtbaren Wimpern, der Flaum in seinem Nacken und auf dem fast völlig kahlen Babykopf mit dieser unheimlichen Fontanelle, die man die ganze Zeit vor Stößen bewahren musste. Und dass alle erzählten, wie ähnlich sie sich seien. Mein Bruder, dachte Tommy oft, du bist wie ich. Doch dass sie sich ähnlich waren, machte die Liebe zu seinem Bruder nicht einfacher, sondern eher lästig, schmutzig, zwiespältig.
Einmal, Hilmar war ungefähr drei Jahre alt, saß Tommy im Wohnzimmer und wartete auf seine Mutter. Es war die Polarnacht, und sie sollte ihm etwas vorlesen, sie las Tommy fast jeden Abend vor, wenn Hilmar eingeschlafen war, denn im Winter hatten sie so viel Zeit. Es war ihre Stunde, Tommys und Mamas, auf dem Sofa, ungestört. Aber an diesem Abend kam sie nicht. Erst fand Tommy es nicht schlimm. Er las ein abgegriffenes Donald-Duck-Heft, blätterte vorsichtig um, damit die Seiten nicht rissen.
»Mama«, rief er. »Kommst du?«
Keine Antwort.
»Mama!«
Irgendwann stand er vom Sofa auf und ging in den Flur.
Die Tür zu Hilmars Zimmer war angelehnt, der schwache Schein der Nachttischlampe drang heraus.
Er schob die Tür auf, und da sah er sie. Sie schliefen beide, dicht beieinander. Die Mutter auf der Seite, das Gesicht nach unten gewandt, Hilmars Kopf zugekehrt, als hätte sie so lange mit ihm gekuschelt, bis sie eingeschlafen war.
Tommy stieß die Tür auf und marschierte ins Zimmer.
»Mama!«
Erst stupste er sie an, dann schüttelte er sie, so fest er konnte.
»MAMA!«
Die Mutter wurde abrupt wach. Sie setzte sich auf, starrte ihn an, erst verwirrt, dann wütend.
»Tommy, pssst!«, zischte sie durch geschlossene Lippen.
Doch es war zu spät, Hilmar wand den kleinen, weichen Körper, öffnete seine Kulleraugen, die alle, auch Tommy, so »niedlich« fanden, und heulte los.
»Tommy!«, schrie die Mutter, jetzt zischte sie nicht mehr.
Und mit einem Mal sah er, wie verzweifelt und wütend und erschöpft sie war, mit dunklen Ringen unter den Augen und so blass wie nur nach Monaten ohne Sonne.
Tommy wusste, wie mühsam es immer für sie war, Hilmar zum Einschlafen zu bringen.
Er wusste, dass der kleine Bruder nachts schrie. Er wusste, dass die viele Dunkelheit Hilmar verwirrte, und in letzter Zeit war es schlimmer geworden, was Tommy auch daran merkte, dass seine Mutter abends, wenn sie ihm vorlas, nur noch ein Kapitel schaffte und nicht mehrere, so wie früher.
Und an diesem Abend wurde gar nichts daraus, sie blieb dort im Zimmer, ging auf und ab, versuchte, Hilmar in den Schlaf zu wiegen, bis es irgendwann zu spät war.
Blödes Balg, dachte Tommy und wünschte sich gleichzeitig, er könnte den Kleinen so herumtragen und seine Nase in die weiche Babywange stupsen.
Hau ab, du Hosenscheißer, schrie er jedes Mal, wenn Hilmar an seine Tür kam.
Mit der Zeit brauchte er es nicht mehr zu sagen, Hilmar machte einen Bogen um das Zimmer des Bruders, als würde der bloße Anblick ihn abstoßen.
Als Hilmar anfing, sprechen zu lernen, war einer seiner ersten Sätze: Hau ab. Er stand vor Tommys Zimmer und spähte hinein, und obwohl Tommy gar nicht da war, schüttelte Hilmar den Kopf und sagte leise vor sich hin: Hau ab. Und dann stapfte er mit seinem wackelnden Windelpopo davon.
Hilmar liebte Gurken und hasste Tomaten. Er hatte Tommy einmal erklärt, ihr flüssiges Inneres sei eklig, und die Kerne, igitt! Wenn die Tomate nur aus dem Fruchtfleisch drumherum bestünde, würde er dieses Gemüse essen. Die Tomate ist eine Beere, sagte Tommy, was, fragte Hilmar, ja, sagte Tommy, kein Gemüse, sondern eine Beere. Manchmal schabte die Großmutter, die nur ja kein einziges Gramm der wertvollen Nahrungsmittel aus dem Gewächshaus vergeuden wollte, die Kerne für Hilmar heraus, aß sie selbst und schnitt dann das Fruchtfleisch in kleine Stückchen. Tommy lachte seinen Bruder deswegen aus. Als Hilmar älter wurde, versuchte er, die ganze Tomate zu essen. Mit zusammengekniffenen Augen schluckte er alles auf einmal hinunter, so schnell er konnte, während er den Bruder standhaft im Blick behielt. Sah Tommy, wie toll er das machte? Ja, er sah es, sagte aber nichts.
Später hoffte Tommy, Hilmar würde sich an nichts davon erinnern. Obwohl er aus den Psychologiebüchern in der Bibliothek erfuhr, dass schlimme Erlebnisse in der Kinderseele so tiefe Spuren hinterließen wie ein Erdrutsch an einem Hang. In diesen Furchen würde jahrelang nichts mehr wachsen. Aber Tommy war ja nur sein Bruder. So schlimm konnte es doch wohl nicht sein, wenn bloß ein Bruder hinter den schlimmen Erlebnissen steckte?
Außerdem besaß Hilmar eine enorme innere Stärke. Er redete viel von der Mutter, und Tommy glaubte, dass er die von ihr vermittelte Geborgenheit weiterhin in sich trug. An Hilmar perlte alles ab wie die Regentropfen am gelben Südwester, den er oft trug. Wenn Tommy ihn ein seltenes Mal anschrie, legte Hilmar den Kopf schief und betrachtete seinen Teenagerbruder einfach nur, als würde er verstehen, dass die Hormone in ihm arbeiteten, und sicher sein, das wäre bald überstanden.
»Das ist die Pubertät«, hörte er Hilmar einmal zur Großmutter sagen. »Wird das schön, wenn sie eines Tages vorbei ist.«
In der Schule war der Bruder bedächtig, gesprächig und fröhlich. Hilmar ist beliebt, dachte Tommy und spürte einen Anflug von Neid. Und dann schämte er sich, denn Hilmar war nicht nur beliebt, sondern auch nett zu allen.
Tommy hat Hilmars Lachen immer noch in den Ohren, ausgedehnt und glucksend. Er erinnert sich an Hilmar in seinem Südwester, an einem Regentag. Sie waren auf dem Weg zur Schule gewesen, und Hilmar war stehen geblieben, weil Tommy ihm einen Witz erzählt hatte. Die Pointe hat er längst vergessen, aber er erinnert sich an Hilmars Lachen und wie mehrere Fußgänger, die gerade vorbeikamen, stehen bleiben und mitlachen mussten. Das Lachen war eine Sonne im Licht unter dem gelben Südwester.
Das Lachen hallt in Tommy wider.
Tommy schaut auf. Er weiß nicht, wie lange er so vor dem Funkgerät gesessen hat, aber es kommt ihm so vor, als wäre es dunkler geworden. Er läuft hinaus, blickt aufs Meer. Nebel zieht von der See herein, das Schiff ist weg.
Dann geht er zurück und setzt sich wieder. Noch einmal greift er zum Mikrofon, drückt den Knopf, versucht, ruhig zu atmen.
»Mayday, mayday«, sagt er. »Kann mich jemand hören?«
Kein Schiff darf einen Notruf ignorieren, hat er gelesen, alle dort draußen sind verpflichtet, darauf zu antworten. So war es jedenfalls in alten Tagen. Er weiß, dass nur Taos Fahrzeug in diesen Fahrwassern unterwegs ist, das einzige Schiff seit fünfzig Jahren in diesen Meeresbreiten.
»Mayday, mayday, mayday. Mein Name ist Tommy Mignotte, und ich wurde allein auf Spitzbergen zurückgelassen. Meine Position ist …« Er steht auf und prüft die Koordinaten, die in halb verwischter Schrift an der Wand stehen. »78 Grad Nord, 15 Grad Ost. Mayday, mayday, mayday.«
Er hört nicht auf, sagt dieselben Wörter wieder und wieder.
Mayday, mayday, mayday.
Tommy Mignotte.
Allein auf Spitzbergen.
Und endlich hört er ein Knistern.
78 Grad Nord, 15 Grad Ost.
Und dann ein Klicken.
Mayday, mayday, mayday.
»Tommy! Wir hören dich.«
Er stützt sich schwer auf das Pult, ihm ist schwindelig, dann sinkt er auf den Stuhl, während die Erleichterung seinen Körper erfasst.
Er ringt nach Worten. »Tao, könnt ihr mich hören, seid ihr da?«
»Wir hören dich gut«, sagt sie, freundlich wie immer. Immer freundlich, selbst jetzt, da sie seine Brüder mitgenommen hat. »Wir hören dich klar und deutlich. Ich hoffe, du versuchst nicht schon länger, mit uns Kontakt aufzunehmen? Wir haben gerade erst den Funk eingeschaltet.«
Er richtet sich auf, hat seine Stimme wieder unter Kontrolle. »Ich war im Bjørndalen, als ich das Schiff gesehen habe«, sagt er. »Ich hätte nicht gedacht, dass ihr einfach losfahrt. Tao, ihr müsst umkehren. Jetzt sofort. Henry, Hilmar und Runa gehören hierher, nach Spitzbergen, ihr könnt sie nicht einfach mitnehmen.«
»Ist Rakel bei dir, Tommy? Kann ich auch mit Rakel sprechen?«
Sein Herz klopft schneller. »Tao, du musst der Kapitänin sagen, dass sie das Schiff sofort wenden soll!«
Einen Moment lang wird es still.
Er umklammert das Funkgerät und beugt sich zum Lautsprecher hinab, als könnte er so etwas vom Gespräch am anderen Ende der Leitung mitbekommen.
Dann ist Tao wieder da. »Tommy, hör mir mal zu. Die Kapitänin und ich haben miteinander geredet. Mei-Ling sitzt hier neben mir. Und Tommy, sie sagt zwar, dass es nicht geht. Es tut mir wirklich leid. Es ist zu spät, um kehrtzumachen.«
»Was?«
»Die Tage sind kalt, die Nächte noch schlimmer. Auch wenn der Nordpol den ganzen Sommer über schwarz geblieben ist, laufen wir Gefahr, dass er jetzt zufriert. Wir fürchten das Treibeis im Meer, Tommy. Das Segelschiff ist nicht für schwere Kollisionen gebaut.«
»So früh im Jahr gibt es doch noch kein Treibeis. Und ihr wollt doch Richtung Süden? Hör mal, ihr habt genügend Zeit, um zu wenden.«
Er hört eine leise, aufgeregte Diskussion am anderen Ende, versteht aber nichts. Dann ist sie wieder da.
»Hör zu, Tommy, es tut uns leid. Aber unsere Abreise hat sich ohnehin schon um mehrere Tage verzögert, weil wir auf Rakel und dich warten mussten, das weißt du ja. Und es ist nicht die Barentssee, die Mei-Ling Sorge bereitet. Es ist die ganze Reise durch das ehemalige Russland und Kasachstan, wir haben fast einen Monat für die Fahrt hierher gebraucht, mit den Gebirgsregionen ist nicht zu spaßen. Wir müssen nach Hause gelangen, ehe dort die Stürme aufkommen.«
»Aber was ist mit Henry und …«
»Henry, Hilmar und Runa geht es bei uns an Bord gut. Wir werden uns gut um sie kümmern.«
Tommy ist aufgestanden, will das Kabel zerreißen, das Funkgerät auf den Boden werfen, zwingt sich aber, mit ruhiger Stimme weiterzusprechen.
»Was machen sie gerade, wie geht es ihnen?«
»Sie sind ins Bett gegangen. Sie schlafen. Ich kann sie wecken, wenn du ihre Stimmen hören möchtest. Aber Henry hat lange gebraucht, bis er eingeschlafen war. Er braucht abends ja besonders viel Ruhe.«
Ihr Tonfall hat etwas Vertrauliches, als wäre sie eine Expertin, was seinen Bruder betrifft.
»So darfst du nicht über Henry sprechen.«
»Wie meinst du das?«
»Du weißt nichts über meine Brüder.«
»Tommy …«
»Was bildest du dir eigentlich ein? Einfach hierherkommen und drei Kinder entführen!«
»Was ich mir einbilde?« Sie redet jetzt leiser, gereizter. »Ihr habt uns doch gerufen. Uns den Saatguttresor versprochen. Wir sind um die halbe Welt gereist, um euch zu finden. Und dann seid ihr abgehauen, Rakel und du.«
»Wir sind nicht abgehauen, so war das nicht.«
»Ich stand mit drei Kindern da, aber ohne die Samen. Vier Tage sind vergangen, und es wurde jeden Tag kälter. Was hätte ich tun sollen?«
»Wir sind nicht abgehauen«, wiederholt er.
»Aber wo wart ihr dann die ganze Zeit, Tommy, was ist passiert?«
Ihre Stimme klingt jetzt wieder sanfter, voller falscher Fürsorglichkeit. Er antwortet nicht. Sie versteht es ohnehin nicht.
»Wart ihr die ganze Zeit bei SvalSat? Wir waren auch da oben, auf der Suche nach euch.«
»Nein«, antwortet er. »Wir waren in der näheren Umgebung. Vor allem im Bjørndalen. Oma hat dort eine alte Hütte.«
»Rakel und du?«
»Ja. Ja, Rakel und ich. Sie ist immer noch im Bjørndalen.«
»Aber warum seid ihr abgehauen?«
»Wir sind nicht abgehauen.«
Er hat das alles nicht genau durchdacht, weiß nicht, was er sagen soll, zermartert sich den Kopf, um eine gute Erklärung zu finden. Und glaubt schließlich, er hätte sie gefunden.
»Wir haben nach den Samen gesucht.«
»Ach?«, fragt Tao.
Er wünschte, er könnte sie sehen, weiß nicht, ob sich hinter ihrer knappen Antwort Interesse oder Misstrauen verbirgt.
»Tommy«, sagt sie leise. »Da du es mir noch nicht erzählt hast, nehme ich an, ihr habt sie nicht gefunden?«
Ist das alles, was es braucht? Wenn er sagt, was sie hören will, drehen sie dann um? Bekommt er Henry und Hilmar zurück?
Er setzt sich erneut, sein Körper lastet schwer auf dem Stuhl. »Kommt ihr dann wieder? Wenn …«, fragt er, »wenn wir die Samen gefunden haben, oder Spuren davon?«
Am anderen Ende wird es still. Sie räuspert sich leise. »Weißt du wirklich etwas über die Samen?«
Er hält seine freie Hand an den Kopf, presst die Finger so fest gegen den Schädel, dass es schmerzt.
»Tommy, sind die Samen unversehrt? Weißt du, wo sie sind?«
Ich bin der Faden, denkt er, der Faden, der alles zusammenhält.
Er muss sich nur zusammenreißen, wie er es immer schon getan hat.
Er richtet sich auf.
»Nein«, sagt er mit beißender Stimme. »Das habe ich nur so behauptet. Wir haben keine Spuren gefunden. Die Samen sind bestimmt längst zerstört.«
Er hört, wie sie frustriert seufzt, sie weiß nicht, ob sie ihm trauen kann.
Er hat jetzt die Oberhand, und wenn er nur seine Brüder zurückbekommt, können sie so weiterleben wie zuvor, sie vier, allein hier in Longyearbyen. Sie brauchen keine anderen Menschen.
Doch Tao redet weiter mit ihm, mit dieser milden, warmen Stimme. Sagt, dass sie gemeinsam eine Lösung finden werden, dass sie Rakel und ihm helfen wollen, so oder so würden sie es schaffen, ihnen zu helfen.
Nein. Zur Hölle mit ihr. Er hält das Mikrofon ganz dicht an den Mund, redet leise, aber deutlich. »Wir brauchen keine Hilfe. Du hast recht, es ist schon spät. Ich muss jetzt gehen. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit zurück nach Longyearbyen.«
»Wann bist du denn wieder da, mein Junge?«
»Ich bin nicht dein Junge.«
»Kannst du dich morgen wieder bei mir melden?«, fragt sie. »Morgen … um fünf?«
»Mal sehen«, sagt er.
»Tommy, ich bin hier«, sagt Tao. »Ich warte morgen auf dich.«
tao
Es wird still. Er ist nicht mehr da. Tao legt das Funkmikrofon an seinen Platz und dreht sich zu Mei-Ling um, die auf dem Schiffsboden auf und ab gegangen ist und das ganze Gespräch mit angehört hat.
Der Erste Offizier wartet vor dem Ruderhaus.
»Fertig?«
Mei-Ling nickt ihm zu.
»Du kannst wieder auf manuell umschalten.«
Der Erste Offizier geht hinein, und durch das Fenster kann Tao sehen, wie er den Autopiloten ausstellt und selbst das Ruder übernimmt.
Mei-Ling fröstelt und sieht Tao resigniert an.
»Was hältst du davon, was er über die Samen gesagt hat?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du verstehst schon, dass er es nur aus Verzweiflung gesagt hat, weil sie dort oben zurückgelassen wurden? Wir können nicht umkehren, ganz egal, was er sagt.«
»Aber ich glaube ihm, dass sie aufgebrochen sind, um die Samen zu suchen. Warum hätten sie sonst ihre Geschwister allein zurücklassen sollen?«
»Er lügt«, sagt Mei-Ling. »Er hat schon die ganze Zeit gelogen, genau wie Rakel. Sie hatte die Samen nicht mal gesehen und sie uns trotzdem versprochen. Ohne zu wissen, ob es sie wirklich gibt.«
»Du darfst nicht vergessen, was sie alles durchgemacht haben.«
»Nein. Aber genau das meine ich, sie haben zu viel Schlimmes erlebt, zu früh. Und sind beide verwirrt.«
Mei-Ling starrt eine Weile in die Luft. Dann seufzt sie schwer. »Dass wir das alles überhaupt angestoßen haben«, sie rudert mit den Armen, »diese ganze Expedition, das ist der reinste Irrsinn. Wir waren von der Verzweiflung getrieben. Und jetzt kehren wir von unserer großen Reise zurück, und alles, was wir dabeihaben, sind drei elternlose Kinder.«
Tao weiß, dass Mei-Ling recht hat. Und gleichzeitig vibriert eine starke Unsicherheit in ihr, sie will nicht glauben, dass es so endet. Und sie versteht nicht, warum Tommy und Rakel von ihnen weggelaufen waren. Bei Tommy wusste sie von Anfang an nicht, ob sie ihm trauen konnte, aber sie nahm zumindest an, Rakel wäre glaubwürdig.
Dabei hatte Rakel etwas Verzweifeltes an sich. Sie erinnerte Tao an die verkommenen Jugendlichen, die sie einmal in Peking angegriffen hatten; die alles verloren hatten und zu allem bereit waren, nur um des Überlebens willen, selbst zu den unmenschlichsten Taten. Tao weiß nicht, ob sie heute noch leben. Aber wenn sie leben, wäre die Saatgutbank eine Rettung für sie, für sie und für all ihre Brüder und Schwestern: wogende gelbe Kornfelder, Getreide, Mais, Reis, Soja.
Spitzbergen ist nur noch ein schwacher Umriss am Horizont, fast hinter den Wolken verschwunden. Überall sonst scheint die Sonne.
Der Koch steckt den Kopf aus der Tür heraus und ruft nach Mei-Ling. Die Kapitänin verschwindet unter Deck, während Tao allein zur Reling geht. Sie dreht das Gesicht der Feuerkugel am Himmel zu, die strahlt, ohne zu wärmen.
Auch als sie sich Spitzbergen näherten, schien die Sonne aufs Meer. Das ist erst elf Tage her, kommt ihr jedoch länger vor.
Das erste Anzeichen auf Festland war ein Vogel, weiß am blauen Himmel, eine Möwenart, wie Tao sie noch nie gesehen hatte. Die Kapitänin und sie standen gemeinsam an der Reling. Mei-Ling hob den Finger, ohne etwas zu sagen, und deutete auf einen Punkt am Himmel. Tao folgte dem Finger mit dem Blick, entdeckte die Möwe, ließ sie nicht mehr aus den Augen. Mei-Ling, sonst laut und gesprächig, schwieg ausnahmsweise.
Über Spitzbergen hingen dichte Wolken. Das Schiff hielt auf das Weiß zu. Der Vogel verschwand in weiter Ferne vor ihnen, als hätte ihn jemand weggewischt. Und dann traten die Berge hinter den schweren Wolkenschichten hervor. Zuerst hatte Tao gedacht, die hohen Felsgebilde wären noch mehr Wolken, doch schließlich entdeckte sie Formationen, die nichts anderes sein konnten als das Festland.
Tao hatte nicht mehr mitgezählt, wie viele Tage sie schon auf See waren, seit sie in einem fast menschenleeren Hafen in Archangelsk Wasser und Lebensmittel geladen hatten. Die Mitternachtssonne foppte sie, die Stunden vergingen unregelmäßig, manchmal stand sie vor der altmodischen Wanduhr in der Messe und fragte sich, ob Morgen oder Abend war. Sie schlief, wenn sie müde war, aß, wenn sie Hunger hatte, sie versuchte zu lesen, denn die Schiffsbibliothek war gut ausgestattet, blieb aber stattdessen oft sitzen, starrte ins Leere und wartete. Sie war bemüht zu verdrängen, wie sehr sie auf den Erfolg dieser Reise hoffte. Die Erwartungen Li Chiaras, der Komiteevorsitzenden, und aller anderen Landsleute lasteten schwer auf ihr, und sie wollte sich davon befreien.
Sie waren an einem milden Sommertag von Sichuan aufgebrochen, Kinder hatten Flaggen geschwenkt und ihnen Blumen geschenkt. Li Chiara drückte Tao die Hand und legte ihr dann ein neues rotes Tuch um den Hals. Als Symbol für ihren herausragenden Einsatz. »Eines Tages wirst du dich dieses Tuches würdig erweisen«, sagte sie leise zu Tao, ehe sie alle Anwesenden strahlend anlächelte und mit flacher Hand winkte.
Das Meer hatte Tao dabei geholfen, ihre Erwartungen auf Abstand zu halten. Das Leben dort draußen war ein einziges großes Nichts. Meer und Himmel, alles bewegte sich, die Wolken über ihr, das Wasser unter dem Kiel, das Schiff, das unablässig voranglitt, auf den Wellen aufschlug und sich vom Wind ziehen ließ. Der Horizont war das einzig Stabile, das Einzige, an das man den Blick heften konnte.
Doch dann waren die Berge da, eine Erholung für die Augen. Und das Erste, was Tao empfand, war Erleichterung über diese Veränderung, über das Ende der Monotonie. Sie kamen näher, und die Brutalität der Landschaft erschreckte sie. Spitzbergen war eine Wand aus Fels. Während die Größe des Schiffs auf See veränderlich gewesen war – klein bei hohem Seegang, groß und schwer, wenn der Meeresspiegel glatt dalag –, schrumpfte es angesichts dieser Berge. Es war, als käme seine wahre Dimension zum Vorschein. Es wirkte kaum größer als das Spielzeugboot, mit dem Wei-Wen früher beim Baden gespielt hatte.
Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte zu den Gipfeln auf, die mindestens tausend Meter hoch sein mussten.
Das Schiff glitt lautlos voran, und ein weitläufiger Fjord offenbarte sich zwischen den Felsmassiven. Tao drehte sich zum Ruderhaus um und sah, wie sich der Steuermann nach Steuerbord lehnte und wie sich seine Bewegung auf das Ruder übertrug, das wiederum dafür sorgte, dass sich der Kurs des Schiffs um etliche Grad änderte.
Als sie in den Fjord einfuhren, legte sich die hohe Dünung. Ein schwacher Wind wehte und peitschte das Wasser zu kleinen, steilen Wellen auf, doch je tiefer sie hineingelangten, desto ruhiger wurde es.
Die Fahrt dauerte mehrere Stunden, und Tao blieb an Deck sitzen. Sie konnte den Blick nicht von der Landschaft wenden, in der immer neue Details zum Vorschein kamen. Wie sich herausstellte, war das, was sie zunächst nur für Gestein gehalten hatte, von einer spärlichen Vegetationsschicht überzogen. Wellige braune, graue und grüne Texturen bedeckten die Hänge.
Das Schiff passierte eine leuchtend grüne Fläche an Backbord, an den steilen Felswänden wimmelte es nur so von Leben. Hier musste auch die Möwe zu Hause sein. Die Vögel flatterten auf und landeten wieder, in einem System, das nur sie selbst verstanden, sie flogen zum Meer, tauchten nach Fischen, kehrten mit vollen Schnäbeln zurück. Dort oben am Vogelfelsen musste es Tausende Nester geben, aus denen sich winzige Schnäbel gen Himmel reckten, ganz instinktiv, denn diese kleinen, flaumigen Körper hatten noch keine andere Bewegung gelernt, als den Kopf zurückzulegen und den Schnabel zu öffnen.
Bald war das Schiff vorbeigefahren, und die Vegetation strahlte nicht mehr so saftig grün, denn hier war der Boden ärmer an Nährstoffen als unter dem Vogelfelsen. Direkt am Wasser konnte sie dennoch Bereiche mit niedrigen Büschen, Gräsern und Halmen sehen.
Noch einmal wendeten sie nach Steuerbord, und jetzt lag der Adventfjord vor ihnen. Tao hatte erst gestern noch über der Karte gesessen und versucht, sich im Geiste ein Bild von ihrem Fahrtziel zu machen, doch nichts hätte sie auf diesen Anblick vorbereiten können. Sie stand erneut auf und ging zur Reling.
Mei-Ling kehrte zurück und stellte sich breitbeinig neben sie, obwohl das Meer ruhig war, so stand sie immer, die Füße sicher auf dem Schiffsboden verankert, weit auseinander.
»Mickrig und bescheiden«, sagte sie und betrachtete die Landschaft prüfend durch ein Fernglas, das an einem Riemen um ihren Hals hing. »Macht im Grunde nicht viel her.«
Tao lächelte.
»Aber auch beängstigend«, sagte Mei-Ling schaudernd. »Kein einziger Baum. Hier gibt es ja nichts, wo man sich verstecken kann.«
Jetzt entdeckten sie weitere Spuren menschlichen Lebens. Kleine Hütten entlang des Fjords, die meisten vollkommen zerstört von Wind und Wetter. Dahinter ein eingestürzter Tower, Überreste von Asphalt, dort, wo einmal die Landebahn gewesen sein musste.
Plötzlich lachte Mei-Ling überrascht auf.
Sie reichte Tao das Fernglas, der Riemen war so kurz, dass sie die Köpfe zusammenstecken mussten.
»Siehst du das?«
»Wo denn? Nein?«
Aber dann, hinter dem Flugplatz, tauchte sie auf, eine seltsame Betonformation am Hang.
»Doch!«
Ein schmaler grauer Rücken. Scharfe Kanten. Über der Tür an der Vorderseite glitzerte eine kaputte Dekoration.
Tao hatte alte Fotos der Saatgutbank studiert, die Fassade war einmal glänzend gewesen, ein Kunstwerk aus Glas und Licht hatte das Dach und auch die sichtbare Seitenwand bedeckt. Eigentlich bestand das Gebäude nur aus einer einzigen Tür. Dahinter führte ein langer Tunnel in den Berg hinein, wo sich drei Lagerräume befanden. Lange Regalreihen, mit Kisten gefüllt. In diesen Kisten lagerten die Samen, sorgfältig in aller Welt geerntet, getrocknet und in Papiertüten gefüllt, jedes Land hatte seine Kiste, sein Erbgut. Samen von Pflanzen, die von der Welt vergessen worden waren, derer sich das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter, längst entledigt hatte.
In Taos Welt gab es nur noch die genmanipulierten Generalisten. Doch in diesem Tresor wurde ihr Ursprung aufbewahrt. Mithilfe der Samen dort drinnen konnte man die Zeit zurückdrehen und jene landwirtschaftliche Vielfalt wiedererschaffen, die der Mensch einmal besessen hatte, spezialisierte Nutzpflanzen, die sich an alle Verhältnisse anpassen konnten, die bei Hitze, Dürre, Kälte und Feuchtigkeit gediehen und die Welt in ihrem gegenwärtigen Zustand aushalten würden. Dieser Variantenreichtum würde sie retten, würde alle Hungernden ernähren.
»Dass er noch steht«, sagte Mei-Ling. »Wer hätte das gedacht?«
»Du jedenfalls nicht«, erwiderte Tao und lachte erleichtert.
Niemand hatte daran geglaubt, dass die Samen nach wie vor existierten. Man hatte genug damit zu tun, all diese Jahre zu überleben, die seit dem Kollaps vergangen waren. Keiner hatte sich die Zeit genommen, es zu prüfen, man hatte wohl gedacht, es sei der Mühe nicht wert, denn Spitzbergen war so lange isoliert gewesen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Die Samen waren vergessen oder abgeschrieben worden. Bis die Kinder mit ihnen Kontakt aufnahmen.
»Du hattest recht«, sagte Mei-Ling. »Jetzt finden wir die Kinder und leeren die Saatgutbank. Ich gebe uns zwei Tage hier, dann stechen wir wieder in See und sehen verdammt noch mal zu, dass wir nach Hause zurückkommen, ehe der Winter uns einholt.«
TOMMY
Er geht in Richtung Ort, vorbei an den alten Lagerhäusern, die von Möwen erobert wurden, sie hocken in allen Fenstern, haben die Fassade mit ihrem Kot besprenkelt, fliegen mit Futter für ihre Jungen hin und her. Langsam senkt sich die ungewohnte Herbstdämmerung auf die Landschaft herab. Die plötzliche Dunkelheit überrascht ihn jedes Jahr aufs Neue.
Er hat nichts dabei, kehrt mit ebenso leeren Händen zurück wie vor vier Tagen, als er sich mitten in der Nacht aus dem Staub machte.
Auch der Ort, der ihn erwartet, ist leer.
Tommy hat sich immer vorgestellt, dass Longyearbyen Widerstand gegen die Landschaft von Spitzbergen leistet; an den Häusern kann sich der Blick festhalten, die Bewegungen der Menschen bilden ein Gegengewicht zur starren felsigen Umgebung. Den Gebäuden sieht man den ständigen Kampf gegen die Naturgewalten an. Die Holzverkleidungen wurde von Wind und Wetter grau gewaschen, einige Häuser sind ganz eingestürzt, als der instabile Boden unter ihnen nachgab. Zwischen den Häusern schlängeln sich noch alte Wege, die jedoch alle von Gras überwuchert sind. Neben den vielen Gebäuden, die die Natur längst erobert hat, gibt es aber auch gepflegte Häuser. Die Schäden und Abnutzungserscheinungen wurden mit einem Flickenteppich aus Materialien repariert, mit Sperrholzplatten und Treibholz. Und überall finden sich Spuren von Menschen. Ein verlassenes Hochbeet, Trockenfisch, der unter einem Dach hängt, ein Fahrrad und ein Schlitten. An einigen Stellen kann man Gardinen hinter den Fenstern erahnen, Gemälde an den Wänden, Nippes und Bücher.
Doch mittlerweile sind diese menschlichen Spuren nichts als Reliquien. Die Leere hat sich endgültig im Ort breitgemacht, und die Häuser sind nichts als Schalen, verlassene Schneckenhäuser an einem riesigen Strand, die bald vom Meer weggespült werden. Und aus jedem Schneckenhaus, an dem Tommy vorbeikommt, quillt die Leere hervor wie unsichtbarer Rauch, presst sich durch seine Haut und dringt in seine Blutbahn.
Nicht nachdenken, einfach nur gehen, nach Hause kommen.
Als er die Tür öffnet, spürt er seinen Hunger. Von der Decke der Speisekammer hängt noch Trockenfleisch herab, in einem Korb findet er eine verlassene Karotte.
Er isst im Stehen, das Krachen, als er in die Karotte beißt, wirkt ohrenbetäubend. Die Bissen finden nur schwer ihren Weg durch den Hals. Er hat das Gefühl, sie würden sich festsetzen, ihn ersticken lassen. Das Heimlich-Manöver, denkt er. Doch wenn ihm jetzt etwas im Hals stecken bleibt, gibt es hier niemanden mehr, der die Arme um ihn legen und versuchen könnte, es wieder hochzupressen.
Als er aufgegessen hat, öffnet er die Tür zum Bad. Tommy schreckt zusammen, als er sich selbst im Spiegel sieht, sein Gesicht ist dunkel von Dreck, Erde und getrocknetem Lehm. Er blickt auf seine Hände, die ebenso schmutzig sind, und voller Schrammen und Wunden. Er schält sich aus seinen Anziehsachen und lässt sie in einem Haufen auf dem Boden liegen, kann sich aber nicht dazu aufraffen, sich zu waschen, er trinkt nur ein Glas Wasser, geht in sein Zimmer, fällt auf das Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und schließt die Augen.
Der Schlaf ist wie eine Grube, in der er verschwindet, hier gibt es nicht einen Lichtstrahl, nur die ewige Dunkelheit und den Stillstand der Berge.
Er wird von einer Stimme geweckt. Sie spricht laut zu ihm, klingt fremd, heiser und dunkel. Er setzt sich auf, denkt kurz, jemand wäre im Zimmer, doch dann begreift er, dass er allein ist und seine eigene Stimme gehört hat. Was sie gesagt hat, weiß er jedoch nicht mehr.
Es ist so still. Er versucht ein paar Strophen zu summen, Bruder Jakob, das hat er Henry immer vorgesungen. Doch die Töne, die seine Stimmbänder hervorpressen, sind zu kläglich, sie erfüllen den Raum nicht. Er schüttelt den Kopf, was machst du hier eigentlich, reiß dich zusammen, dann geht er wieder ins Bad, füllt das Waschbecken mit Wasser, taucht einen Waschlappen hinein, wringt ihn aus und fährt sich mit entschlossenen Bewegungen über das Gesicht, schließt die Augen und wünscht, es wäre ein anderer Mensch, der ihn mit dem Lappen wäscht, der ihn berührt. Reiß dich am Riemen. Er zwingt sich dazu, die Augen zu öffnen, schmeißt den Lappen ins Waschbecken, wartet, bis er sich mit Wasser vollgesogen hat, ehe er ihn erneut auswringt, damit er seine Arbeit fortsetzen kann. Es ist nur ein Lappen, ich bin es, der ihn lenkt, es ist nur ein Lappen.
Früher war es immer seine Mutter gewesen, die ihn gewaschen hatte. Sie tauchte den Lappen in das dampfend heiße Wasser, er verstand nie, wie ihre Finger das aushielten, aber anschließend schwenkte sie ihn immer kurz in der Luft, damit er abkühlte, ehe sie Tommy damit über das Gesicht fuhr.
Sie strickte die Lappen selbst, jeden Abend saß sie an ihrem Sofaende und bewegte die Finger flink hin und her, während das Knäuel unter ihren Füßen immer kleiner wurde und das Werk zwischen ihren Händen größer.
Die Mutter mit einer anderen Strickarbeit in den Händen, einem weißen Kaninchen. Ihre Hände arbeiten hastig, sie muss fertig werden, denn ihr Bauch ist schon groß, und das Baby kommt bald. Doch als Tommy zu ihr geht, legt sie das Strickzeug dennoch beiseite.
»Komm her«, sagt sie. »Komm auf meinen Schoß.«
»Da ist doch kein Platz«, erwidert er.
»Doch, für meinen Tommyjungen habe ich immer Platz.«
Sie hatte gelogen, denn zusammen mit ihr war auch der Platz auf ihrem Schoß verschwunden.
Er hat rund um die Uhr Sehnsucht nach ihr; seit sie gestorben ist, weiß er, was es bedeutet, jemanden zu vermissen. Aber das ist nichts Schlimmes, denkt er, Sehnsucht ist bloß ein Gefühl, nichts als Gedanken, elektrische Impulse im Hirn.
Oder ein singender Delfin, vibrierende Töne, die sich unter Wasser kilometerweit übertragen, die alles durchdringen können.
Nein. Vergiss den Delfin, sagt Tommy sich. Er wringt den Lappen aus und hängt ihn an den Haken, sucht saubere Kleidung heraus, zieht ein Wollunterhemd und einen Pullover über den Kopf, schlüpft in lange Unterhose und Hose und geht in das Zimmer der Brüder.
Ihre Klamotten sind verschwunden. Die Bücher, Henrys Holzpferde und Hilmars rissiges Lego. Er hebt die Bettdecken an. Ganz unten in Hilmars Bett findet er einen einsamen Wollstrumpf. Das ist alles.
Sie hatten so eifrig gepackt. Rakel hatte schon an dem Nachmittag begonnen, als sie die Nachricht erhielten, dass die Fremden unterwegs waren. Sie verteilte ihre Anziehsachen auf ihrem Bett, hob jedes einzelne Teil hoch, als würde sie abwägen, ob es gut genug für das neue Land wäre.
Henry stopfte Spielsachen in den alten Rucksack des Vaters. Er bediente sich auch in den Häusern der Nachbarn, war im Gegensatz zu Rakel vollkommen unkritisch. Nur einige wenige Holzspielsachen waren noch in einem guten Zustand, ansonsten hatte er vor allem hundert Jahre altes Plastikzeug gefunden.
»Bist du sicher, dass du das alles mitschleppen willst?«, fragte Tommy, als Henry ein weiteres kaputtes Auto in den Rucksack steckte.
»Was ist, wenn es da, wo wir hinfahren, kein Spielzeug gibt?«, fragte Henry ernst. »Nicht, dass es mir ausgeht.«
»Das wird schon nicht so schnell passieren«, antwortete Tommy.
»Man kann nie wissen«, gab Henry zurück. »Willst du denn gar nicht packen?«
»Das eilt nicht«, sagte Tommy.
»Nein? Bist du sicher?«
Der kleine Bruder blickte mit gerunzelter Stirn zu ihm auf.
Tommy sieht jedes Detail in dem kleinen Gesicht vor sich.
Henry.
Der Delfin singt, unsichtbar dort unten in der Tiefe, gleitet voran, wirft einen dunklen Schatten auf den Meeresgrund und stößt die Töne mit einer solchen Kraft hervor, dass man sie unmöglich ignorieren kann. Tommy setzt sich auf die Bettkante, will schlafen, doch er ist so wach, so klar im Kopf. Das ist nur die Sehnsucht, sagt er sich immer wieder, das bin ich gewohnt.
Als die Mutter noch lebte, war ihr Familienleben mit Unnützem angefüllt, wie Tanzen im Wohnzimmer, Gäste am Küchentisch, die schnellen Finger des Vaters auf den Gitarrensaiten oder auf Tommys Bauch, wenn er ihn durchkitzelte.
Der Vater, David, war damals noch unbekümmert und draufgängerisch. Die Küche bot ihm ein Ventil für seine Kreativität. Oft übernahm er sich beim Kochen, schmiedete ehrgeizige Pläne. Dann war er stundenlang zugange und klapperte frustriert mit Töpfen und Pfannen, doch wenn das Essen irgendwann auf dem Tisch stand, strahlte er vor Stolz.
Außerdem war das Leben voller Ausflüge und Expeditionen, die sie nur zum Spaß unternahmen. Sie fuhren nachts mit dem Boot hinaus, im Oktober, wenn es schon kalt und dunkel geworden war, nur um zu sehen, wie sich der Mond im Wasser spiegelte und das Meeresleuchten um die Ruderblätter funkelte. Sie wanderten die Gletscher hinauf oder unter dem Eis entlang, um die Grotten zu sehen, die die Flüsse dort drinnen ausgehöhlt hatten. Sie liefen in der frischen Märzsonne auf Langlaufskiern, wenn der Schnee noch hoch lag, sie glitten ruhig voran und spürten, wie die ungewohnten Strahlen den Körper aus dem Winterschlaf weckten.
Das Leben war von der Mutter erfüllt. Er erinnert sich, wie sie ihn unter dem Polarlicht an sich drückte. Er hatte Angst gehabt vor den grünen Wellen dort oben am Himmel. Sie machen so viel Licht, sagte er zur Mutter, wie können sie so still sein, wenn sie so viel Licht machen?
Einst war das Polarlicht, Aurora borealis, gefürchtet gewesen; das Licht sei die Seelen der Toten, erzählte man sich, und deshalb dürfe man nicht darüber sprechen. Wenn man unter dem Polarlicht sang, würde es einen sehen, seine leuchtenden Arme um einen schlingen und einen in den Himmel hinaufziehen. Nicht pfeifen, flüsterte Tommy, wir müssen darauf achten, ganz still zu sein. Ja, das stimmt, flüsterte die Mutter zurück, und denk daran, dass ich immer auf dich aufpasse.
Manche Erinnerungen strahlen besonders hell. Wie der Vater ihn einmal am späten Abend weckte. Tommy war ganz benommen und so müde, wie man sich nur fühlt, wenn man gerade erst in Tiefschlaf versunken ist, aber der Vater fuhr ihm sanft durch das Haar, bis er aufwachte.
»Ich will dir etwas zeigen«, sagte er.
Die vergangenen Wochen waren verregnet und nebelig gewesen, aber in den letzten Tagen hatte der Frost Einzug gehalten, und sie hatten klares Wetter mit Sonne, Frost und Eis auf den Schlammpfützen gehabt; dünne Gemälde auf gefrorenem Wasser, die die Kinder zertrampelten, sobald sie sie entdeckten, nur um sich an dem Krachen unter ihren Füßen zu erfreuen.
Tommy setzte sich im Bett auf.
»Ich wollte mich gerade hinlegen«, sagte der Vater, »aber dann habe ich entdeckt, dass es draußen schneit, und gedacht, das willst du bestimmt sehen.«
Tommy stand auf, ging zum Fenster und zog die Vorhänge beiseite. Draußen war es ganz dunkel, aber im Licht der Wohnzimmerfenster konnte Tommy sehen, dass der Boden weiß war. Die Familie wohnte in Gruvedalen, jenem Gebiet von Longyearbyen mit dem geringsten Risiko für Erdrutsche, in einem alten Reihenhaus mit schiefen Wänden, die sich im Einklang mit dem instabilen Grund bewegten, auf dem das Haus erbaut worden war.
Doch jetzt war der Boden gefroren und still.
Tommy drehte sich zu seinem Vater um, der lächelte.
»Denkst du dasselbe wie ich?«
»Ich weiß nicht«, sagte Tommy, »was denkst du denn?«
»Dass wir rausgehen sollten und testen, ob der Schnee gut ist?«, fragte der Vater.
»Ja«, sagte Tommy, »das denke ich auch.«
»Aber jetzt sieh dich doch mal an, du bist ja bloß im Schlafanzug. Komm.«
Der Vater nahm ihn auf seine Arme. Eigentlich war Tommy zu groß, um getragen zu werden, aber der Vater trug ihn trotzdem, in den Flur hinab und zu der Garderobenleiste mit den Jacken.
»Guck mal hier.« Der Vater hielt seinen alten Schneeanzug hoch, den er immer nur anzog, wenn es richtig kalt war. Er war geflickt, aber sauber und warm.
Der Vater half Tommy in den Anzug, der so groß war, dass er sich kaum bewegen konnte. Tommy kicherte.
»Pssst«, machte der Vater fröhlich und legte einen Zeigefinger an die Lippen. »Mama schläft.«
Der Vater zog sich eine Skihose und seine dicke Jacke an, suchte ihnen Fäustlinge und Mützen heraus, und dann öffneten sie vorsichtig die Tür und gingen hinaus.
Die Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit. Tommy blieb stehen und versuchte die Umgebung zu erkennen.
Dann ging er die Treppe hinunter in den Schnee hinaus, in Richtung des gelben Vierecks vom Licht des Wohnzimmerfensters. Er ließ seinen Blick auf dem Boden ruhen, auf seinen eigenen Spuren im Schnee. Die Kristalle waren leicht und trocken, der Schnee beinahe schwerelos. Bei jeder seiner Bewegungen wirbelten kleine Wolken auf und mischten sich mit den herabschwebenden Flocken.
»Wollen wir Schneeengel machen?«, fragte der Vater und stellte sich mitten in das gelbe Viereck.
»Mhm«, gab Tommy zurück und ließ sich fallen.