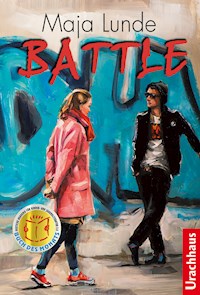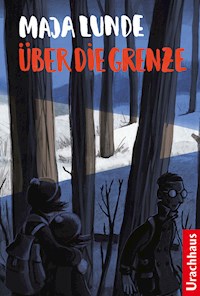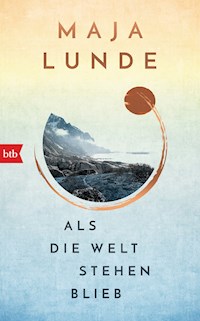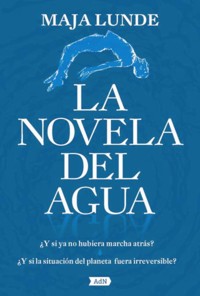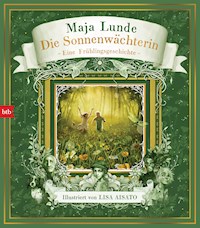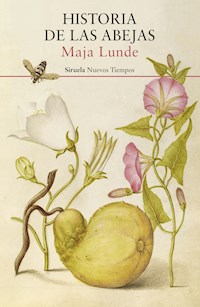10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klima Quartett
- Sprache: Deutsch
Norwegen, 2017. Die fast 70-jährige Umweltaktivistin Signe begibt sich auf eine riskante Reise: Mit einem Segelboot versucht sie die französische Küste zu erreichen. Dort will die den Mann zur Rede stellen, der einmal die Liebe ihres Lebens gewesen ist.
Frankreich, 2041. Eine große Dürre zwingt die Menschen Südeuropas zur Flucht in den Norden, es ist längst nicht genug Trinkwasser für alle da. Doch bei dem jungen Vater David und seiner Tochter Lou keimt Hoffnung auf, als sie in einem vertrockneten Garten ein altes Segelboot entdecken. Signes Segelboot.
Virtuos verknüpft Maja Lunde das Leben und Lieben der Menschen mit dem, woraus alles Leben gemacht ist: dem Wasser. Ihr neuer Roman ist eine Feier des Wassers in seiner elementaren Kraft und ergreifende Warnung vor seiner Endlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Norwegen, 2017
Die fast 70-jährige Umweltaktivistin Signe begibt sich auf eine riskante Reise: Mit einem Segelboot und einer ganz besonderen Fracht versucht sie die französische Küste zu erreichen. Dort will sie den Mann zur Rede stellen, der einmal die Liebe ihres Lebens gewesen ist.
Frankreich, 2041
Eine große Dürre zwingt die Menschen Südeuropas zur Flucht in den Norden, es ist längst nicht genug Trinkwasser für alle da. Doch bei dem jungen Vater David und seiner Tochter Lou keimt Hoffnung auf, als sie in einem vertrockneten Garten ein altes Segelboot entdecken. Signes Segelboot.
Woraus alles Leben gemacht ist:
Virtuos verknüpft Maja Lunde das Leben und Lieben der Menschen mit dem, woraus alles Leben gemacht ist: dem Wasser. Ihr neuer Roman Die Geschichte des Wassers ist nach Die Geschichte der Bienen der zweite Teil eines großen »Klima-Quartetts«, das sich den wichtigsten Fragen unserer Zeit widmet – den Folgen unseres Handelns für Klima und Natur, für das Miteinander der Menschen und die kommenden Generationen.
Zur Autorin
MAJA LUNDE wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Ihr Roman Die Geschichte der Bienen wurde mit dem Norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet und sorgte auch international für Furore. Das Buch stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in 30 Länder verkauft.
Für Jesper, Jens und Linus
Signe
Ringfjorden, Sogn und Fjordane, Norwegen 2017
Nichts hielt das Wasser auf, man konnte es den Berg hinab zum Fjord verfolgen; vom Schnee, der aus den Wolken fiel und sich auf die Gipfel legte, bis zum Dampf, der aus dem Meer aufstieg und wieder zu Wolken wurde.
Jeden Winter wuchs der Gletscher, er sammelte den Schnee, jeden Winter wuchs er, wie es sein sollte, und jeden Sommer schmolz er, leckte, gab Tropfen frei, die zu Bächen wurden und ihren Weg nach unten fanden, von der Schwerkraft angezogen, und die Bäche sammelten sich, wurden zu Wasserfällen und Flüssen.
Wir waren zwei Gemeinden, die sich einen Berg und einen Gletscher teilten, wir hatten sie geteilt, solange wir denken konnten. Die eine Wand des Bergs fiel senkrecht ab, hier tosten die Schwesternfälle 711 Meter in die Tiefe, zum See Eide, einem tiefgrünen Gewässer, das dem Dorf seinen Namen gab und den dort lebenden Tieren und Menschen Fruchtbarkeit brachte.
Eidesdalen, das Dorf von Magnus.
Die Leute in Eidesdalen sahen den Fjord nicht, sie hatten keinen Salzgeschmack auf den Lippen, der Salzgeschmack wurde nicht vom Wind weitergetragen, er reichte nie bis dorthin, nie rochen sie das Meer dort oben. So war er aufgewachsen.
Aber sie hatten ihr Wasser, Wasser ohne Geschmack, Wasser, das alles zum Wachsen brachte, und er habe das Meer nie vermisst, sagte Magnus später einmal.
Die andere Seite des Bergs war milder, sanfter abfallend, hier sammelte sich das Wasser im Fluss Breio, dem Fluss des Lachses und der Süßwassermuschel und der Wasseramsel, es zwängte sich durch einen Spalt in der Landschaft, formte ihn mit Millionen von Tropfen, mit seinen Fällen und Stromschnellen und seinen ruhigen, glatten Abschnitten. Wenn die Sonne schien, wurde er zu einem leuchtenden Band.
Der Breio setzte seinen Weg fort bis nach Ringfjorden, und dort, in der Gemeinde auf Höhe des Meeresspiegels, mündete der Fluss ins Salzwasser, dort wurde das Gletscherwasser eins mit dem Meer.
Ringfjorden, mein Dorf. Von da an waren sie vereint, das Gletscherwasser und das Meerwasser, bis die Sonne erneut die Tropfen an sich zog, sie als Dampf in die Luft hob, weiter hinauf, bis zu den Wolken, wo sie die Schwerkraft überlisteten.
Jetzt bin ich zurück, der Blåfonna zwingt mich dazu, der Gletscher, der einmal uns gehörte. Es ist windstill, als ich in Ringfjorden ankomme, auf dem letzten Stück muss ich den Motor anwerfen, das Tuckern übertönt alles andere, die Blau gleitet durch das Wasser und hinterlässt kleine Kräuselungen.
Ich kann diese Landschaft nicht vergessen. Sie hat dich erschaffen, Signe, hat Magnus einmal gesagt, er meinte, sie habe sich in mir festgesetzt, in der Art und Weise, wie ich gehe, mit nachgiebigen Beinen, als würde ich immer eine Steigung bezwingen, ob aufwärts oder abwärts. Ich bin nicht für gerade Wege gemacht, hier komme ich her, und trotzdem überwältigt es mich, das alles wiederzusehen: die Höhenzüge und Felswände, das Senkrechte vorm Waagerechten.
Die Leute kommen von weither für diese Landschaft und finden sie herrlich, phantastisch, amazing. Sie stehen auf Schiffdecks von der Größe eines Fußballfelds, während gigantische Dieselmotoren ihre Abgase in die Luft blasen, stehen dort und zeigen mit dem Finger und betrachten das klare, blaue Wasser und die schillernd grünen Hänge, an denen sich überall dort, wo die Steigung weniger als 45 Grad beträgt, kümmerliche Häuser festklammern, und mehr als tausend Meter darüber hinaus erheben sich die Berge, diese zerklüfteten Zacken der Welt, brechen in den Himmel aus mit ihrem weißen Puderzucker, den die Touristen so lieben, wow, it’s snow, der auf den nach Norden gerichteten Hängen liegt, im Winter wie im Sommer.
Aber die Touristen sehen die Schwesternfälle nicht und auch nicht Sønstebøs Berghütte, sie ist längst weg, und auch den Fluss Breio können sie nicht sehen, der als Allererstes verschwand, lange bevor die Schiffe kamen, lange bevor die Amerikaner und Japaner mit ihren Telefonen und Kameras und Teleobjektiven kamen. Die Röhren, die einmal der Fluss waren, liegen unter der Erde, und die Schäden, die der Natur bei den Baggerarbeiten zugefügt worden sind, wurden allmählich von der Vegetation überwuchert.
Ich halte die Pinne in der Hand und drossle das Tempo, während ich mich dem Ort nähere und am Kraftwerk vorbeituckere, einem großen Ziegelgebäude, das für sich allein unten am Wasser steht, schwer und dunkel; ein Monument für den toten Fluss und den Wasserfall. Von dort aus erstrecken sich Leitungen in alle Richtungen, einige spannen sich sogar über den Fjord. Selbst das hat man zugelassen.
Der Motor übertönt alles, aber ich erinnere mich noch genau an das Geräusch der Stromleitungen, das schwache Surren bei feuchtem Wetter, Wasser auf Strom, ein Knistern, von dem ich immer Gänsehaut bekam, vor allem im Dunkeln, wenn man die Funken sah.
Alle vier Gastplätze am Landungssteg sind leer, für Touristen ist es noch zu früh, sie belegen die Plätze nur im Sommer, ich habe freie Wahl, nehme den äußersten, vertäue achtern und am Bug, lege sicherheitshalber auch eine Spring aus, weil der Westlandwind schnell aufziehen kann, ziehe den Gashebel zurück und höre das widerwillige Gurgeln des ersterbenden Motors. Dann schließe ich die Luke zum Salon, stecke den Schlüsselbund in die Brusttasche meines Anoraks, er ist groß und hat einen Korkball, damit er auf dem Wasser treibt, und beult meine Jacke am Bauch aus.
Die Haltestelle ist immer noch dort, wo sie immer gewesen ist, vor dem Lagerhaus, ich setze mich hin und warte, weil der Bus nur einmal in der Stunde fährt, so ist das hier, alles findet nur selten statt und muss deshalb gut geplant werden, das hatte ich nach all den Jahren wohl vergessen.
Endlich taucht er auf. Eine Gruppe Jugendlicher gesellt sich zu mir, sie kommen von der weiterführenden Schule, die Anfang der Achtziger gebaut wurde, eine neue, schöne, nur eines von vielen Dingen, die sich die Gemeinde leisten konnte.
Sie reden ununterbrochen über Klassenarbeiten und Sport. So glatte Stirnen, so zarte Wangen, sie sehen verblüffend jung aus, ohne jede Spur, ohne Überreste gelebten Lebens.
Sie würdigen mich keines Blickes, und ich verstehe sie gut. Für sie bin ich nur eine alternde Frau, ein bisschen wirr und ungepflegt, mit einem abgetragenen Anorak und grauen Zotteln, die unter der Strickmütze hervorschauen.
Sie selbst haben neue, fast identische Mützen mit dem gleichen Markenlogo auf der Stirn. Ich beeile mich, meine eigene abzusetzen, und lege sie auf meinen Schoß, sie ist furchtbar fusselig geworden, ich zupfe die Fusseln ab, einen nach dem anderen, bis meine Hand voll davon ist.
Doch es nützt nichts, es sind einfach zu viele, und jetzt weiß ich nicht, wohin damit, und bleibe mit den Fusseln in der Hand sitzen, bis ich sie am Ende doch auf den Boden fallen lasse. Beinahe schwerelos fliegen sie über den Boden, den Mittelgang hinab, aber die Jugendlichen beachten sie gar nicht, warum sollten sie auch, einen grauen Wollklumpen.
Mitunter vergesse ich, wie ich aussehe. Hat man eine Weile an Bord gelebt, kümmert man sich nicht mehr um Äußerlichkeiten, aber wenn ich mich ein seltenes Mal an Land im Spiegel betrachte, erschrecke ich. Wer ist die Frau da, denke ich, wer um alles in der Welt ist dieses alte, magere Weib?
Es ist merkwürdig, abstrakt, nein, surreal ist das passende Wort, dass ich eine von ihnen bin, den Alten, wo ich doch immer noch so durch und durch ich bin, dieselbe, die ich immer war, ob mit fünfzehn, fünfunddreißig oder fünfzig, eine konstante, unveränderliche Masse, wie ich es in meinen Träumen bin, wie Stein, wie tausendjähriges Eis. Das Alter existiert von mir losgelöst. Nur wenn ich mich bewege, lässt es sich unmöglich ignorieren, dann gibt es sich zu erkennen mit all seinen Wehwehchen, den knirschenden Knien, dem steifen Nacken, den schmerzenden Hüften.
Aber die Jugendlichen denken nicht daran, dass ich alt bin, weil sie mich nicht einmal sehen, so ist das, niemand sieht alte Damen, es ist schon viele Jahre her, dass mich zum letzten Mal jemand sah, sie lachen einfach nur hell und jung und sprechen von einer Geschichtsarbeit, die sie gerade geschrieben haben, über den Kalten Krieg und die Berliner Mauer, aber sie unterhalten sich nicht über den Inhalt, nur über ihre Noten, ob eine 2 minus besser sei als eine 2-3. Und keiner erwähnt das Eis, nicht ein Wort über das Eis, den Gletscher, obwohl er das Thema sein müsste, über das alle hier zu Hause reden.
Zu Hause … nenne ich diesen Ort immer noch mein Zuhause? Ich fasse es nicht, nach bald vierzig, nein, fünfzig Jahren Abwesenheit. Ich war immer nur kurz hier, um mich nach Todesfällen um die Formalitäten zu kümmern, erst starb meine Mutter, dann mein Vater. Zusammengenommen zehn Tage bin ich in all diesen Jahren hier gewesen. Ich habe zwei Brüder, die noch hier leben, Halbbrüder, aber mit ihnen habe ich nur selten Kontakt. Sie sind die Söhne meiner Mutter.
Ich lehne den Kopf an die Scheibe und betrachte die Veränderungen. Die Bebauung wird dichter, am Hang ein neues Bauprojekt bestehend aus weißen Fertighäusern mit Sprossenfenstern, der Bus passiert das Schwimmbad, das ein neues Dach bekommen hat und ein großes blaues Schild am Eingang, Ringfjord Water Fun. Alles ist besser auf Englisch.
Der Bus klettert aufwärts, ins Landesinnere, einige der Jugendlichen springen bei der höchstgelegenen Siedlung hinaus, aber die meisten bleiben sitzen, die Straße steigt weiter an, wird schmaler und ist plötzlich voller Schlaglöcher, fast genau ab dem Moment, als wir die Grenze zur Nachbargemeinde passieren. Erst hier steigen die meisten anderen aus, hier drüben gibt es anscheinend immer noch keine weiterführende Schule und auch kein Schwimmbad, hier in Eidesdalen, beim kleinen Bruder, dem Verlierer.
Ich verlasse den Bus gemeinsam mit den letzten Jugendlichen und gehe langsam in Richtung Zentrum. Der Ort ist noch kleiner, als ich ihn in Erinnerung habe, der Tante-Emma-Laden hat zugemacht. Während Ringfjorden gewachsen ist, hat Eide nur noch einen Bruchteil seiner ursprünglichen Größe … aber ich bin heute nicht Eidesdalen wegen gekommen, kann nicht noch mehr darüber trauern, dieser Kampf ist schon seit vielen Jahren verloren, jetzt bin ich des Eises wegen gekommen, wegen Blåfonna, und ich nehme den Kiesweg zum Berg.
Sogar die Zeitungen in der Stadt schreiben darüber, sonst hätte ich nichts erfahren, ich habe die Artikel wieder und wieder gelesen und kann es doch nicht fassen. Sie holen Eis aus dem Gletscher, reines, weißes Eis aus Norwegen, und vermarkten es als das Exklusivste, was man in seinen Drink geben kann, einen schwimmenden Mini-Eisberg, eingetaucht in goldenen Schnaps, aber nicht für norwegische Kunden, nein, für jene, die es sich wirklich leisten können. Das Eis soll in die Wüstenstaaten transportiert und dort, in der Heimat der Ölscheichs, an die Reichsten der Reichen verkauft werden, als wäre es Gold, weißes Gold.
Schneefall setzt ein, wie ein letztes Zucken des Winters, der April zeigt mir eine lange Nase, als ich den Berg hinaufsteige. Kleine Pfützen mit gefrorenem Wasser auf dem Weg, von Eiskristallen umrahmt, ich setze einen Fuß auf die dünne Eisschicht, höre sie brechen, zerstöre sie, aber es macht keinen Spaß mehr, nicht so wie früher.
Ich muss schnaufen, der Weg ist steil und länger, als ich ihn in Erinnerung habe.
Doch endlich komme ich an, endlich sehe ich den Gletscher, meinen geliebten Blåfonna.
Alle Gletscher schmelzen, das wusste ich ja, doch es zu sehen ist trotzdem etwas anderes. Ich bleibe stehen, atme einfach nur ein und aus, das Eis ist noch immer da, aber nicht mehr an der Stelle, wo es früher einmal war. Als Kind konnte ich vom Rand des Gletschers fast bis zum Steilhang gehen, an dem die Wasserfälle in der Tiefe verschwanden, wo der Gletscher und die Fälle zusammenhingen. Jetzt aber liegt der Gletscher weiter oben auf der Talseite, und der Abstand ist groß, hundert, vielleicht zweihundert Meter zwischen dem Hang und der blauen Zunge. Der Gletscher hat sich bewegt, als wollte er flüchten, den Menschen entkommen.
Ich laufe weiter durch die Heide, muss das Eis spüren, muss darauf gehen, es anfassen.
Dann habe ich das Eis endlich unter den Füßen, jeder Schritt macht ein Geräusch, ein leises Knirschen. Ich setze meinen Weg fort, jetzt sehe ich das Abbaugebiet, die Wunden im grauweißen Gletscher, harte Schnitte, die einen Kontrast zum blauen Inneren bilden, dort, wo das Eis herausgeschnitten wurde. Daneben stehen vier große weiße Säcke voll, bereit zum Abtransport. Sie benutzen Motorsägen, habe ich gelesen, schonende Motorsägen, die nicht geölt sind, damit die Eisstücke nicht beschmutzt werden.
Eigentlich dürfte mich nichts mehr überraschen von all dem, was die Menschen tun. Aber das hier versetzt mir trotzdem einen Stich, denn das muss Magnus in der Vorstandssitzung lächelnd genehmigt, ja vielleicht sogar befürwortet haben.
Ich nähere mich, muss klettern, um ganz nah heranzukommen, die Schnitte wurden dort gesetzt, wo der Gletscher am steilsten abfällt. Ich ziehe einen Handschuh aus, lege meine Hand darauf, das Eis lebt unter meinen Fingern, mein Gletscher, ein großes, ruhiges, schlummerndes Tier, aber auch ein verletztes Tier, und es kann nicht brüllen, in jeder Minute, jeder Sekunde, wird es angezapft, es liegt längst im Sterben.
Ich bin zu alt, um zu weinen, zu alt für diese Tränen, und trotzdem habe ich feuchte Wangen.
Unser Eis, Magnus, unser Eis.
Hast du es vergessen oder hast du vielleicht nicht einmal bemerkt, dass wir bei unserer ersten Begegnung schmelzendes Eis vom Blåfonna in den Händen hielten?
Ich war sieben, du acht, weißt du es noch? Es war mein Geburtstag, und ich bekam Wasser geschenkt, gefrorenes Wasser.
Das ganze Leben ist Wasser, das ganze Leben war Wasser, wohin ich auch sah, war Wasser, es fiel als Regen vom Himmel oder als Schnee, es füllte die kleinen Bergseen, legte sich als Eis auf den Gletscher, strömte in tausend kleinen Bächen den steilen Berghang hinab und schwoll an zum Fluss Breio; es lag spiegelglatt vor dem Ort am Fjord, dem Fjord, der zum Meer wurde, wenn man ihm nach Westen folgte. Meine ganze Welt war Wasser. Die Hügel, Berge, Steine, Wiesen waren nur winzige Inseln in dem, was die eigentliche Welt darstellte, und ich nannte meine Welt Erde, aber ich dachte, eigentlich müsste sie Wasser heißen.
Der Sommer damals war so warm gewesen, als würden wir an einem anderen Ort leben, die Wärme passte nicht hierher, und die englischen Touristen, die in unserem Hotel wohnten, schwitzten, sie saßen draußen in dem großen Garten unter den Obstbäumen und fächerten sich mit alten Zeitungen Luft zu und sagten, sie hätten sich nie träumen lassen, dass es hier oben im Norden so heiß werden könnte.
Als ich aufwachte, war das Bett leer, meine Eltern waren wohl schon aufgestanden, ich schlief meistens zwischen ihnen, nachts schlich ich mich in ihr Zimmer und legte mich in die Mitte des Doppelbetts. Sie fragten, ob ich schlecht träume, aber das war nicht der Grund.
»Ich will nur nicht allein sein«, sagte ich. »Ich will mit jemandem zusammen sein.«
Das mussten sie doch verstehen, sie schliefen ja jede Nacht mit jemandem zusammen, aber ich konnte noch so oft kommen, sie verstanden es nicht, denn jeden Abend, wenn ich mich hinlegte, erinnerten sie mich daran, dass ich in meinem eigenen Bett schlafen müsse, die ganze Nacht, nicht nur die halbe, und ich versprach es ihnen, weil ich verstanden hatte, dass sie es von mir erwarteten, aber dann wachte ich doch wieder auf, jede Nacht wachte ich auf und spürte, wie leer mein Bett war, wie leer das Zimmer, und dann schlich ich mich hinein, oder nein, ich schlich nicht, das können kleine Kinder nicht gut, und ich konnte es besonders schlecht, ich ging einfach nur, ohne daran zu denken, dass ich Geräusche machte, und ohne daran zu denken, dass ich sie weckte, ging über die kalten Dielen in ihr Zimmer, wo ich ihr Bett immer vom Fußende aus eroberte, denn so konnte ich mich zwischen sie zwängen, ohne über einen der großen Körper klettern zu müssen. Ich verlangte nie nach einer Decke, denn ihre Körper zu beiden Seiten waren mir warm genug.
Aber ausgerechnet an diesem Morgen lag ich allein da, sie waren schon aufgestanden, doch weil mein Geburtstag war, konnte ich es nicht auch tun. Ich wusste, dass ich still liegenbleiben und warten musste, bis sie kamen, das hatte ich mir vom letzten Mal gemerkt. Und das Kribbeln, noch heute erinnere ich mich an das Kribbeln in Armen und Beinen, wie unerträglich das Warten war, kaum auszuhalten, fast so, als wäre es vielleicht sogar besser, überhaupt keinen Geburtstag zu haben.
»Kommt ihr bald?«, fragte ich vorsichtig.
Doch niemand antwortete.
»Hallo?!«
Plötzlich bekam ich Angst, sie könnten gar nicht mehr kommen, sie hätten den Tag verwechselt.
»MAMAUNDPAPA?!«
Oder den ganzen Geburtstag vergessen.
»HALLO? MAMAUNDPAPA!!!«
Doch dann tauchten sie auf, mit Kuchen und Gesang, standen rechts und links vom Bett und sangen mit ihrer hellen und dunklen Stimme im Chor, und plötzlich wurde mir alles zu viel, ich musste mir die Decke über den Kopf ziehen und noch länger im Bett liegen bleiben, obwohl ich doch eigentlich hinaus wollte.
Als das Lied zu Ende war, bekam ich Geschenke, von meiner Mutter einen glänzenden Ball und eine Puppe mit einem Mund, der so schrecklich breit grinste.
»Die ist unheimlich«, sagte ich.
»Ach was«, erwiderte mein Vater.
»Doch!«, sagte ich.
»Ich fand sie niedlich, als ich sie im Laden gesehen habe, und es war die größte Puppe, die es gab«, erklärte meine Mutter.
»Sie hätten ihr doch aber nicht so ein komisches Lächeln machen müssen.«
»Du musst dich bedanken«, sagte mein Vater. »Sag danke zu deiner Mutter.«
»Danke. Für die Puppe. Die unheimlich ist.«
Ich sagte immer, was ich meinte, ich sagte, was ich dachte, und vielleicht ärgerte es sie, aber nie genug, als dass ich deshalb mein Verhalten geändert hätte, und vielleicht war es auch gar nicht so leicht zu ändern.
Ich erinnere mich an die Puppe und die restlichen Geschenke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an jenem Tag all diese Dinge bekam: zwei Bücher über Pflanzen von meinem Vater, ein Herbarium, ebenfalls von ihm, einen Globus mit Licht von beiden zusammen. Ich bedankte mich für alles. So viele Geschenke, ich wusste, dass niemand, den ich kannte, so viele bekam, aber es hatte auch niemand, den ich kannte, eine Mutter, die ein ganzes Hotel mit fast hundert Zimmern besaß, es waren vierundachtzig, aber wir sagten immer fast hundert, und noch dazu hatten wir unseren eigenen, privaten Flügel, den wir nur »den Flügel« nannten, mit drei Wohnzimmern und vier Schlafzimmern und einer Küche und sogar einem Dienstmädchenzimmer.
Sie hatte das alles von ihrem Vater geerbt, der starb, bevor ich geboren war, überall hingen Bilder von ihm, dem alten Hauger, alle nannten ihn so, selbst ich. Seinen Namen hatte meine Mutter auch geerbt, Hauger, ein langweiliger Name, ich verstand nicht, was es damit auf sich hatte, und trotzdem behielten sie ihn, sie nahmen nie den Nachnamen meines Vaters an, seinen Oslonamen, denn einen Namen wie Hauger gab man nicht einfach auf, sagte meine Mutter, dann hätten sie auch den Namen unseres Hotels ändern müssen, Hauger Hotel, und das konnte man nicht machen, denn in unseren Wänden steckte Geschichte, sie reichte zurück bis in das Baujahr, das in Holz geschnitzt über dem Eingang stand: 1882.
Ich bekam Kuchen, am Morgen und über den restlichen Tag verteilt, so viel des Süßen, dass sich mein Magen nach oben presste, auch an dieses Gefühl erinnere ich mich noch, dass ich sieben Jahre alt war und der ganze Kuchen von unten gegen meine Brust drückte, aber ich aß trotzdem weiter, denn die Familie kam vorbei, und alle saßen an einem Tisch im Garten, die ganze Verwandtschaft meiner Mutter, Großmutter, die Tanten, die beiden angeheirateten Onkel, Cousine Birgit und meine drei Cousins.
Die Gäste redeten und lärmten, aber ich lärmte am meisten, weil ich nicht stillsitzen konnte, damals nicht und auch nicht später, und ich hatte eine laute Stimme, von der mein Vater sagte, man könnte sie bis zum Galdhøpiggen hören, er lächelte immer, wenn er das sagte, bis zum Galdhøpiggen, dem höchsten Berg Norwegens, und er freue sich, dass ich so viel und laut reden würde, sagte er, es mache ihn stolz, aber meine Mutter war anderer Meinung, sie sagte, meine Stimme gehe durch Mark und Bein.
Ich machte so viel Lärm, dass ich den Lastwagen nicht hörte. Erst als meine Mutter mich bat, auf den Platz vor dem Hotel zu kommen, verstand ich, dass etwas passieren würde, sie nahm mich bei der Hand und führte mich um die Ecke, während sie die Gäste herbeiwinkte und aufforderte mitzukommen. Sie lachte in ihre Richtung und in meine, und dieses Lachen wirkte ungewohnt, denn sie lachte so, wie ich es sonst tat, wild und etwas zu laut, und ich lachte auch, ohne zu wissen, warum, nur weil ich das Gefühl hatte, es würde erwartet.
Ich sah mich nach meinem Vater um und entdeckte ihn allein hinter der Gruppe von Gästen, eigentlich hätte ich lieber seine Hand genommen, aber meine Mutter zog zu fest.
Dann bogen wir um die Ecke, und ich zuckte zusammen, verstand nicht, was ich sah, der ganze Platz war weiß, er reflektierte das Licht und funkelte so, dass ich die Augen zusammenkneifen musste.
»Eis«, sagte meine Mutter. »Schnee, Winter, sieh nur, Signe, es ist Winter!«
»Schnee?«, fragte ich.
Sie stand neben mir, und ich spürte, dass irgendetwas daran wichtig für meine Mutter war, am Schnee, der eigentlich Eis war, aber ich verstand nicht, was, und jetzt war auch mein Vater neben ihr aufgetaucht, und er lächelte nicht.
»Was ist das denn hier?«, fragte er meine Mutter.
»Weißt du noch«, sagte meine Mutter zu mir, »dass du immer so gerne im Winter Geburtstag haben wolltest?«
»Nein«, antwortete ich.
»Dass du geweint hast, als Birgit Geburtstag hatte und es schneite?«, fuhr meine Mutter fort. »Und du hast dir einen Schneemann gewünscht, erinnerst du dich?«
»Hast du das etwa den ganzen Berg heruntergekarrt?«, fragte mein Vater meine Mutter, und seine Stimme klang barsch.
»Sønstebø hat das für mich erledigt, er wollte sowieso etwas für die Fischauktionshalle holen«, antwortete sie.
Ich drehte mich um und entdeckte Sønstebø, den Bauern aus Eidesdalen, er stand neben dem Lastwagen, sah mich lächelnd an, er wartete auf etwas, von mir, wie ich jetzt verstand, und hinter ihm stand sein Sohn Magnus.
Da warst du, Magnus. Ich wusste schon vorher, wer du warst, weil dein Vater manchmal mit dem Lastwagen Eis fürs Hotel brachte, und es kam vor, dass du dabei warst, aber trotzdem denke ich an diesen einen Augenblick zurück als das erste Mal, dass ich dich sah. Du hast barfuß dagestanden, die Füße braun von der Sonne und vom Dreck, und wie alle anderen hast auch du auf etwas gewartet, du hast auf mich gewartet. Du erinnertest mich an ein Eichhörnchen, runde braune Augen, die alles mitbekamen. Du warst erst acht Jahre alt, aber du hast gemerkt, dass etwas auf dem Spiel stand, glaube ich, etwas, das nicht ausgesprochen wurde – dass jemand dich jetzt oder eines Tages brauchen würde. So warst du, so war er.
»Also musste Sønstebø eine Extrafahrt machen?«, fragte mein Vater leiser. »Den ganzen Berg hinunter?«
Ich hoffte, er würde den Arm um meine Mutter legen, wie er es mitunter tat, ihn um sie legen und sie an sich ziehen, doch er rührte sich nicht.
»Signe hat Geburtstag, sie hat es sich gewünscht«, entgegnete meine Mutter.
»Und was kriegt Sønstebø für den Auftrag?«
»Er fand es witzig. Ihm hat es gefallen, er hat die Idee geliebt.«
»Alle lieben deine Ideen.«
Da wandte sich meine Mutter an mich. »Du kannst einen Schneemann bauen, Signe. Hättest du nicht Lust dazu? Wir können alle gemeinsam einen Schneemann bauen!«
Ich wollte keinen Schneemann bauen, und trotzdem sagte ich ja.
Ich rutschte in meinen Schühchen, wäre fast gestürzt, konnte nur schlecht das Gleichgewicht halten auf all dem Weiß, das sie Schnee nannte, aber meine Mutter packte mich und zog mich auf die Beine.
Die Feuchtigkeit und Kälte drang durch meine Schuhsohlen, harte Eiskörner fielen auf meine Füße und schmolzen auf den dünnen Kniestrümpfen.
Ich beugte mich herab, griff mit beiden Händen den Schnee und versuchte einen Ball zu rollen, aber er war wie Puderzucker und löste sich einfach auf.
Als ich den Kopf hob, sahen mich alle an, die ganze Gesellschaft beobachtete mich. Magnus stand vollkommen reglos da, nur seine Augen bewegten sich und wanderten von mir zum Schnee und wieder zurück, er hätte niemals Schnee zum Geburtstag bekommen, das war wohl nur Hoteldirektorinnentöchtern vergönnt, und plötzlich wünschte ich mir, er würde das alles nicht sehen.
Doch meine Mutter lächelte so breit wie die Puppe, die größte im ganzen Laden, und ich versuchte noch einmal, einen Ball zu formen, ich musste es doch schaffen, es musste ein Schneeball daraus werden, denn ich erinnerte mich nicht, dass ich mir einen Wintergeburtstag gewünscht hatte, ich konnte mich nicht erinnern, je mit meiner Mutter darüber geredet zu haben oder dass ich an Birgits Geburtstag geweint hatte. Aber das hatte ich wohl getan, und jetzt war mein Vater böse auf meine Mutter, und meine Mutter schenkte mir nur Sachen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie haben wollte, vielleicht hatte ich ja auch gesagt, ich würde mir eine Puppe wünschen, und es vergessen. Es war meine Schuld, das alles, dass ich hier stand und so durch und durch kalte Füße hatte und mir das Eiswasser von den Fingern tropfte, dass alle hier um mich standen und komisch waren, dass der trockene Hofplatz allmählich schlammig wurde und mein Vater meine Mutter mit einem Blick ansah, den ich nicht verstand, und seine Hände so tief in den Hosentaschen vergrub, dass seine Schultern ganz schmal wurden, und dass Magnus hier war. Ich wünschte mir aus meinem ganzen, pochenden, siebenjährigen Herzen, er würde das alles nicht sehen, würde mich nicht so sehen.
Deshalb log ich, zum ersten Mal in meinem Leben log ich, manche Kinder können lügen und tun es ohne zu zögern, können problemlos sagen, dass sie die Kekse nicht aus der Dose genommen, das Hausaufgabenheft nicht verloren haben, aber ich war kein solches Kind, ebenso wenig, wie ich ein Kind war, das sich gern verstellte, Phantasiewelten oder Kunstwelten waren nichts für mich, und dasselbe galt für die Lüge. In meinem bisherigen Leben war ich nie in Situationen geraten, in denen ich hätte lügen müssen, und außerdem war ich nie auf die Idee gekommen, dass es tatsächlich funktionieren könnte, dass eine Lüge Probleme lösen würde, weil es bisher unkomplizierter gewesen war, ganz einfach zu sagen, was ich meinte.
Doch jetzt tat ich es, die Lüge drängte sich auf, denn es war ja meine Schuld, das Ganze hier, dachte ich mit meinen kalten Füßen und nassen Strümpfen und dem Kuchen, der von unten gegen meine Brust drückte, sich nach oben bewegte, zum Hals und Mund, und ich musste etwas tun, damit der Blick meines Vaters aufhörte, deshalb log ich, ich musste ihn dazu bringen, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen und sie Mama zu reichen.
Ich überlegte mir die Lüge, in einem Zug, formte sie in meinem Kopf, bevor ich sie vorbrachte, mit einer leisen Stimme, von der ich hoffte, sie klänge echt.
»Ja. Ich erinnere mich daran, Mama. Ich habe mir einen Geburtstag im Winter gewünscht. Ich erinnere mich.«
Und um die Lüge perfekt zu machen, füllte ich meine Hände mit matschigem Puderzuckerschnee und streckte sie meinen Eltern entgegen.
»Danke. Vielen Dank für das Eis.«
Jetzt, dachte ich, jetzt muss doch wohl alles wieder gut werden. Aber nichts geschah, ein Gast räusperte sich leise, eine meiner Cousinen zerrte meiner Tante am Rockzipfel und blickte zu ihr auf, aber alle Erwachsenen sahen nur mich an und warteten, als müsse noch mehr passieren.
In dem Moment kam er, Magnus, mit flinken Beinen vom Lastwagen zu mir.
»Ich werde dir helfen«, sagte er.
Er bückte sich, sein Jungennacken war ausrasiert und braun, und er nahm das Eis zwischen die Hände und formte einen Ball, der viel schöner wurde als meiner.
Seine nackten Füße auf dem Eis, es muss eiskalt gewesen sein, aber das kümmerte ihn anscheinend nicht, denn wir bauten zusammen einen Schneemann aus dem matschigen, schmelzenden Schnee, und ich vergaß die ganzen Menschen um uns herum, die immer noch dastanden und zusahen.
»Wir brauchen eine Nase«, sagte er.
»Du meinst eine Karotte«, sagte ich.
»Ja, eine Nase.«
»Aber eigentlich ist es eine Karotte«, beharrte ich.
Und er lachte.
David
Timbaut, Bordeaux, Frankreich, 2041
Die Hitze flimmerte vor uns über der Straße. Sie wogte auf den Hügelkämmen wie Wasser, doch sobald wir näher kamen, verschwand sie.
Noch immer sahen wir das Lager nicht.
Der Himmel über uns war blau. Nicht eine einzige Wolke. Blau, immer nur blau. Allmählich fing ich an, diese Farbe zu hassen.
Lou lehnte an meinem Arm und wurde leicht hin- und hergeschaukelt, wenn der Lastwagen über Schlaglöcher rumpelte. Hier hatte schon lange niemand mehr die Straßen ausgebessert. Die Häuser am Straßenrand waren verlassen, der Boden sonnenverbrannt.
Ich drehte mich zu Lou um und roch an ihrem Kopf. Ihr zartes Kinderhaar stank nach Rauch. Der strenge Brandgeruch hatte sich auch in unseren Kleidern festgesetzt, obwohl es schon viele Tage her war, seit wir Argelès verlassen hatten. Seit wir eine halbe Familie geworden waren.
Zweiundzwanzig Tage, nein, vierundzwanzig, es waren schon vierundzwanzig Tage vergangen. Irgendwann hatte ich aufgehört zu zählen. Vielleicht wollte ich einfach nicht mehr zählen. Vierundzwanzig Tage, seit wir aus Argelès weggerannt waren. Ich mit Lou in den Armen. Sie weinte. Ich rannte, bis wir den Brand nicht mehr hörten. Bis der Rauch nur noch ein ferner Nebel war. Erst da hielten wir an, drehten uns zur Stadt um und …
Halt, David, halt. Wir werden sie gleich treffen. Sie sind hier. Anna und August werden im Lager sein. Denn hier wollte Anna hin, sie hatte schon lange von diesem Ort gesprochen. Er sollte akzeptabel sein. Hier gab es Essen und Strom aus Solarzellen. Und nicht zuletzt gab es Wasser. Sauberes, kaltes Wasser aus dem Hahn.
Und von diesem Lager aus sollte es möglich sein, weiter nach Norden zu gelangen.
Der Fahrer bremste ab, fuhr an den Straßenrand und hielt an. Lou wurde wach.
»Da!« Er deutete auf etwas.
Vor uns lag ein Zaun mit einer tarnfarbenen Plane darüber.
Anna. August.
Der Fahrer ließ uns hinaus, murmelte »Viel Glück« und verschwand in einer Staubwolke.
Die Luft schlug uns entgegen wie eine heiße Wand. Lou blinzelte in die Sonne und griff nach meiner Hand.
Die Feuerkugel am Himmel saugte jeden Wassertropfen aus mir heraus. Der Asphalt glühte, war so heiß, dass er sicher bald schmelzen würde.
Mein Handy war kaputtgegangen, und meine Armbanduhr hatte ich unterwegs eingetauscht. Ich wusste nicht, wie viel Uhr es war. Aber der Zaun vor uns warf noch immer einen Schatten, es konnte also nicht viel später als drei sein.
Ich ging schnell. Jetzt würden wir sie wiederfinden. Sicher waren sie vor uns angekommen.
Wir kamen zum Eingang, wo zwei Wachleute in Militäruniform an einem Tisch saßen.
Sie sahen uns an, ohne uns zu sehen.
»Ausweispapiere?«, fragte der eine.
»Ich suche jemanden«, sagte ich.
»Erst die Papiere«, sagte der Wachmann.
»Aber …«
»Oder wollen Sie nicht rein?«
Ich legte ihm unsere Pässe vor, behielt Annas und Augusts Pass aber im Rucksack. Der Wachmann brauchte nicht zu sehen, dass wir sie hatten. Dann würde er sicher nur anfangen, Fragen zu stellen.
Er blätterte hastig durch die Seiten in meinem Pass und hielt bei meinem Foto inne. Ich selbst zuckte jedes Mal zusammen, wenn ich es sah. Der Typ auf dem Bild, war ich das? So runde Wangen, beinahe dick. Hatte die Kamera mein Gesicht verzerrt?
Nein, so hatte ich damals ausgesehen, rundlich, nicht dick, aber gut genährt.
Oder vielleicht im Grunde normal. Vielleicht hatten wir früher alle so ausgesehen.
Er nahm Lous Pass in die Hand, der neueren Datums war, aber Lou wuchs so schnell. Das Kind auf dem Foto hätte jedes Kind sein können. Drei Jahre alt, als die Aufnahme gemacht worden war. Lächelnd. Nicht ernst, so wie jetzt.
Heute früh hatte ich ihr das Haar geflochten, das konnte ich gut. Ich bürstete es und teilte es in zwei Hälften, mit einem strengen Scheitel in der Mitte. Dann flocht ich zwei stramme Zöpfe, die auf den Rücken baumelten. Vielleicht hatten wir es ihnen zu verdanken, dass uns endlich ein Lastwagen mitgenommen hatte. Auch jetzt hoffte ich, sie würden davon ablenken, wie schmutzig Lou war, und wie dünn. Und wie ernst, denn sie lächelte nur noch selten, meine Tochter. Früher war sie ein Kind gewesen, das immer hüpfte und rannte, durch die Gegend sprang. Jetzt hingen ihre Zöpfe gerade den Rücken hinunter, ganz still.
Der Wachmann sah mich weiter an. Offenbar verglich er mich mit dem Bild im Pass.
»Es ist fünf Jahre alt«, sagte ich. »Damals war ich erst zwanzig.«
»Haben Sie noch etwas anderes? Andere Dokumente, die belegen, dass Sie es sind?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Konnte nur den mitnehmen.«
Noch einmal musterte er das Bild, als würde es ihm eine Antwort geben. Dann nahm er einen Tacker und zwei hellgrüne Zettel und heftete sie routiniert in die Pässe.
»Füllen Sie die aus.«
Er streckte mir die Pässe entgegen.
»Wo denn?«
»Hier. Die Formulare.«
»Nein, ich meinte … wo? Haben Sie einen Tisch?«
»Nein.«
Ich nahm die Pässe. Bei meinem hatte er die Seite mit dem Formular schon aufgeschlagen.
»Aber hätten Sie vielleicht einen Stift?«
Ich versuchte zu lächeln, aber der Wachmann schüttelte nur resigniert den Kopf, ohne mich anzusehen.
»Ich habe meinen verloren«, sagte ich.
Das stimmte nicht ganz. Ich hatte ihn nicht verloren, sondern aufgebraucht. An unserem zweiten Abend unterwegs hatte Lou so sehr geweint, sie hatte leise geschluchzt und ihr Gesicht zwischen den Händen verborgen. Und ich hatte sie malen lassen. Sie hatte dünne blaue Tintenstriche auf die Rückseite eines alten Umschlags gezeichnet, den wir am Wegrand gefunden hatten. Sie zeichnete Mädchen in Kleidern und malte sie aus. Dabei drückte sie so fest auf, dass sie Löcher ins Papier riss.
Der Wachmann wühlte auf dem Boden in einer Kiste und zog einen abgenutzten blauen Kugelschreiber mit gesprungenem Plastik hervor. »Den möchte ich aber wiederhaben.«
Ich musste die Formulare im Stehen ausfüllen, ich hatte nichts, worauf ich die Pässe ablegen konnte. Meine Handschrift wurde unleserlich und schief.
Ich versuchte mich zu beeilen. Meine Hand zitterte. Beruf. Letzter Arbeitsplatz. Letzter fester Wohnsitz. Wo wir herkamen. Wo wir hinwollten. Wo wollten wir hin?
»In die Wasserländer, David«, hatte Anna immer zu mir gesagt. »Da müssen wir hin.«
Je trockener unser eigenes Land wurde, desto häufiger redete sie von den Ländern im Norden, wo es nicht nur ein seltenes Mal im Laufe der kalten Monate regnete, sondern auch im Frühjahr und Sommer. Wo es keine langanhaltende Dürre gab, sondern das Gegenteil, weil der Regen mit schweren Stürmen einherging und zur Plage wurde. Wo Flüsse über die Ufer traten und Dämme brachen, jäh und brutal.
»Worüber jammern die bloß?«, fragte Anna. »Sie, die alles Wasser der Welt haben!«
Wir hatten nur das salzige Meer. Und die Dürre. Sie war unsere Flut, sie war unaufhaltbar. Erst hieß sie Zweijahresdürre, dann Dreijahresdürre, dann Vierjahresdürre. Dies war das fünfte Jahr. Der Sommer schien endlos.
Schon letzten Herbst hatten die Leute angefangen, Argelès zu verlassen, aber wir waren standhaft geblieben. Ich musste meiner Arbeit nachgehen, konnte nicht einfach weglaufen von der maroden, alten Entsalzungsanlage, die das Meerwasser in Süßwasser verwandelte.
Doch immer wieder fiel der Strom aus, in den Läden fehlten die Nahrungsmittel, und die Stadt wurde immer leerer, stiller. Und wärmer. Denn je trockener die Erde, desto heißer die Luft. Früher hatte die Sonne ihre Kraft darauf gerichtet, das Wasser zu verdampfen. Als es keine Feuchtigkeit mehr in der Erde gab, richtete sie ihre Kraft auf uns.
Jeden Tag redete Anna davon, dass wir weggehen sollten. Erst wollte sie auf direktem Wege nach Norden, als es noch möglich war, bevor alle Länder ihre Grenzen schlossen. Dann sprachen wir über die verschiedenen Lager. Pamiers, Gimont, Castres. Und zum Schluss über dieses hier, in der Nähe von Timbaut.
Und während Anna redete, stiegen die Temperaturen. Flüchtlinge, die weiter aus dem Süden stammten, kamen durch unsere Stadt, machten ein paar Tage Halt und zogen weiter. Wir aber blieben.
Ich zögerte mit dem Stift in der Hand. Wo wollten wir hin?
Das konnte ich nicht allein beantworten. Erst musste ich Anna und August finden.
Der Mann hinter uns in der Schlange stieß uns an, schien es aber gar nicht zu merken. Er war klein und verschrumpelt, als würde er seine Haut nicht mehr ausfüllen. Um die eine Hand trug er einen schmutzigen Verband.
Rasch heftete der Wachmann auch in seinen Pass das grüne Formular. Der verschrumpelte Mann nahm ihn stumm entgegen, hatte schon den Stift gezückt und zog sich zurück, um zu schreiben.
Dann war ich wieder an der Reihe. Ich gab dem Wachmann die Pässe und Formulare mit den zehn Punkten, die ihm alles sagen sollten, was er über Lou und mich wissen musste.
Er deutete auf den letzten Punkt.
»Und hier?«
»Wir haben uns noch nicht entschieden. Ich muss das erst mit meiner Frau besprechen.«
»Und wo ist sie?«
»Wir wollten uns hier treffen.«
»Wollten?«
»Werden. Wir hatten verabredet, uns hier zu treffen.«
»Wir sind angehalten, dafür zu sorgen, dass alle Felder ausgefüllt werden.«
»Ich muss erst mit meiner Frau sprechen. Ich bin auf der Suche nach ihr. Das habe ich doch gesagt.«
»Dann schreibe ich England.«
England, zwischen Süden und Norden, immer noch erträglich.
»Aber es ist nicht sicher, dass wir nach England …«
Anna mochte England nicht. Sie mochte das Essen nicht. Oder die Sprache.
»Irgendetwas muss dort aber stehen«, sagte der Wachmann.
»Wir verpflichten uns damit also zu nichts?«
Er lachte auf.
»Sollten Sie das Glück haben, überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, müssen Sie das Land nehmen, das man Ihnen anbietet.«
Er beugte sich über das Formular und schrieb rasch: Großbritannien.
Dann gab er mir den Pass wieder.
»Das war alles. Nachts dürfen Sie das Gelände nicht verlassen, tagsüber können Sie sich frei im Lager und auch außerhalb bewegen.«
»Das ist gut«, sagte ich. Wieder versuchte ich zu lächeln und wünschte, er würde zurücklächeln. Ich hätte ein Lächeln gut gebrauchen können.
»In Halle 4 wird man Ihnen einen Platz zuweisen.«
»Aber wo kann ich mich nach meiner Frau erkundigen? Und meinem Sohn? Er ist noch ein Baby. August heißt er.«
Der Wachmann hob den Kopf. Endlich sah er mich an.
»Beim Roten Kreuz«, erklärte er. »Wenn Sie hineingehen, können Sie es nicht verfehlen.«
Am liebsten hätte ich ihn umarmt, murmelte aber stattdessen nur ein »Danke«.
»Der Nächste, bitte«, sagte er.
Wir eilten durch das Tor, ich schleifte Lou hinter mir her. Als wir im Lager waren, hörte ich ein lautes Geräusch. Grillen. Sie saßen in einem Baum über uns und rieben ihre Flügel aneinander. Es gab kein Wasser, und trotzdem waren sie mit Leib und Seele dabei. Vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an ihnen nehmen. Ich versuchte, ruhig zu atmen.
Das Lager bestand aus mehreren alten Fabrikhallen, die auf einer größeren Fläche verteilt standen. Große Bäume spendeten Schatten. Sie hatten noch Blätter, ihre Wurzeln mussten tief in die Erde reichen. Ein Schild an der Wand verriet, dass dies einmal eine Markisenfabrik gewesen war. »Sonnenschutz für alle Bedürfnisse«, stand dort. Es war sicher eine gute Firma gewesen.
Wir gingen tiefer ins Lager hinein. Zwischen den Gebäuden standen zehn Militärzelte und ebenso viele Baracken. Sie waren in geraden Reihen aufgestellt worden, und alle hatten Solarzellen auf dem Dach. Nirgends war Müll zu sehen. Hier und da saßen Menschen in der Sonne. Alle waren sauber und ordentlich gekleidet.
Anna hatte recht gehabt, dies war ein guter Ort.
»Da«, sagte ich und zeigte auf eine Flagge, die ein Stück entfernt auf dem Dach einer der Baracken wehte.
»Von welchem Land ist die?«, fragte Lou.
»Von keinem Land. Sie gehört zum Roten Kreuz«, sagte ich. »Und die wissen, wo Mama und August sind.«
»Wirklich?«, fragte Lou.
»Ja«, antwortete ich.
Lou hielt meine Hand mit ihrer zähen, ein wenig klebrigen Kinderhand. Anna hatte sie immer gedrängt, sich die Hände zu waschen, vor jedem Essen dieselbe Ermahnung. Denk dran, dir die Hände zu waschen, denk an die Bakterien. Sie hätte Lou jetzt einmal sehen sollen.
Wir bogen um die Ecke zur Baracke, und Lou blieb abrupt stehen.
»Eine Schlange«, sagte sie leise.
Verdammt.
»Das können wir aber doch gut, Schlange stehen«, erwiderte ich und versuchte zuversichtlich zu klingen.
In den letzten Jahren war alles rationiert worden. Wir standen für einen Liter Milch an. Für ein Stück Fleisch. Für eine Tüte Äpfel, für alle anderen Obstsorten. Die Obst- und Gemüseschlangen waren am längsten. Es gab so wenige Bienen, so wenige Insekten. Sie waren allmählich verschwunden, doch als die Dürre kam, ging es noch schneller. Keine Insekten, kein Obst. Ich vermisste Tomaten. Melonen. Birnen und Pflaumen. In eine saftige Pflaume zu beißen. Kalt, aus dem Kühlschrank …
Lou konnte sich an ein Leben ohne Schlangen gar nicht erinnern. Und sie war auf die Idee gekommen, dass man in einer Schlange auch sitzen konnte, anstatt immer nur Schlange zu stehen.
Als sie sich das erste Mal hingesetzt hatte, war es aus purer Erschöpfung geschehen. Sie hatte gequengelt, beinahe geweint. Doch als ich mich neben sie gesetzt und behauptet hatte, wir würden ein Picknick machen, musste sie lachen.
Jetzt hatten wir es uns zur Gewohnheit gemacht, Schlange zu sitzen. Schlangen waren ein Ort, um etwas zu spielen: Einen Ausflug aufs Land. Schule. Ein Abendessen. Vor allem Letzteres. Lou liebte Spiele mit Essen.
Ich gab ihr einen Keks, den letzten, den ich im Rucksack hatte. Sie kaute darauf herum und lächelte.
»Ich glaube, da ist eine gelbe Creme drin«, sagte sie und zeigte mir den angebissenen trockenen Vollkornkeks.
Wir spielten uns durch die Vorspeise, das Hauptgericht, das Dessert und die Käseplatte. Nur selten gelang es mir, mich ganz auf das Spiel zu konzentrieren.
Die meiste Zeit sah ich mich nach Anna um. Ich wartete. Sie konnte jeden Moment auftauchen. Mir mit August in den Armen entgegenkommen. Er würde mit offenem Mund lächeln und seine vier Zähne zeigen. Und sie würde ihn mir reichen, damit ich ihn halten konnte, während sie mich umarmte, und Lou würde uns auch umarmen, von der anderen Seite. Und so würden wir alle vier zusammenstehen.
Schließlich wurde die Tür zur Baracke geöffnet, und wir waren an der Reihe.
Der Boden war sauber, das war das Erste, was mir auffiel. Ein harter Holzboden ohne ein einziges Staubkorn. Und Strom, mehrere ausgerollte Kabel verliefen über den Boden. Außerdem war es hier drinnen kühler, an der Wand brummte eine Klimaanlage.
Eine Frau, halb von einem Bildschirm verdeckt, der an einen externen Computer angeschlossen war, bat uns lächelnd, Platz zu nehmen.
»Bitteschön, Sie beide, setzen Sie sich doch.«
Sie deutete auf zwei Stühle vor ihrem Schreibtisch.
Ich erklärte kurz und bündig unser Anliegen, dass unsere Familie getrennt worden war, als wir aus dem Süden herkamen, aber dass wir uns darauf geeinigt hatten, uns in diesem Lager zu treffen.
»Es war der Vorschlag meiner Frau«, erklärte ich. »Sie wollte, dass wir hierherkommen.«
Die Dame fing an, etwas in den Computer einzugeben. Sie erkundigte sich nach Annas und Augusts Geburtsdaten und fragte, wie sie aussahen.
»Aussehen?«
»Haben die beiden spezielle Merkmale?«
»Nein … Anna hat braune Haare. Sie ist ziemlich klein.« Plötzlich klang es so, als würde ich das als Makel ansehen. »Ich meine, genau richtig. Einssechzig, glaube ich. Und hübsch«, fügte ich schnell hinzu.
Die Dame lächelte.
»Sie hat braune Haare, die im Sommer heller werden. Und braune Augen«, sagte ich.
»Und das Kind?«
»August ist … ein ganz normales Baby. Er hat vier Zähne und ist noch ziemlich kahl. Vielleicht sind es inzwischen auch mehr Zähne. In den letzten Tagen hatte er ziemlich viel gequengelt. Ich glaube, es hat ihn im Mund gejuckt.«
Was sollte ich noch sagen? Dass er einen Bauch hatte, in dem ich gern mein Gesicht vergrub? Dass er hoch und glucksend lachte? Dass er wie ein Nebelhorn heulte, wenn er Hunger hatte?
»Wann haben Sie die beiden zuletzt gesehen?«
»Als wir aufgebrochen sind«, antwortete ich. »An dem Tag, als wir in Argelès aufgebrochen sind, am 15. Juli.«
»Zu welcher Tageszeit?«
»Gegen Mittag.«
Lou hatte aufgehört, mich anzusehen, stattdessen zog sie ihre Beine unters Kinn.
»Was ist passiert?«, fragte die Dame.
»Was passiert ist?«, wiederholte ich.
»Ja?«
Plötzlich gefiel es mir nicht, dass sie so nachbohrte.
»Das, was so vielen passiert ist. Wir mussten flüchten und gehörten zu den Letzten, die die Stadt verlassen haben. Und dabei haben wir uns verloren.«
»War das alles?«
»Ja.«
»Und seither haben Sie nichts von ihr gehört?«
»Wie sollte ich? Das Netz ist doch zusammengebrochen. Mein Telefon funktioniert nicht. Aber ich habe es versucht. Sonst würde ich doch wohl nicht hier sitzen!«
Ich holte tief Luft. Musste mich beruhigen, konnte hier nicht herumschreien. Musste positiv sein. Zeigen, dass ich ein guter Kerl war.
Außerdem mochte ich die Frau. Sie war vielleicht Mitte fünfzig und hatte ein schmales Gesicht. Sie sah müde aus, als würde sie den ganzen Tag hart für andere arbeiten, diese Art Müdigkeit.
»Wir hatten vereinbart«, sagte ich so ruhig und deutlich, wie ich konnte, »wir hatten vereinbart, hierherzufahren. Das war unser Plan.«
Sie wandte sich wieder dem Computer zu und schrieb noch etwas dazu.
»Leider finde ich sie nicht in meinen Registern«, sagte sie schließlich langsam. »Sie sind nicht hier. Und sie waren auch früher nicht hier.«
Ich schielte zu Lou hinüber. Ob sie etwas mitbekam? Vielleicht nicht. Sie hatte die Stirn auf ihre Knie gelegt, unmöglich, ihr Gesicht zu sehen.
»Können Sie das nicht noch einmal nachprüfen?«, fragte ich die Dame.
»Das ist nicht nötig«, sagte sie neutral.
»Doch, es ist nötig.«
»Hören Sie, David …«
»Wie heißen Sie?«
»Jeanette.«
»Okay, Jeanette. Sie haben doch sicher selbst eine Familie. Stellen Sie sich mal vor, es ginge hier um Ihre Leute.«
»Meine Leute?«
»Ihre Familie. Ihre Nächsten.«
»Ich habe auch jemanden verloren«, sagte sie.
Sie hatte auch jemanden verloren. Jemanden, nach dem sie suchte und den sie vielleicht nie wiedersehen würde. Allen ging es so.
»Verzeihung«, sagte ich. »Ich meinte ja eigentlich nur, dass Sie Zugang zu den Registern haben.« Ich deutete auf den Computer. »Ist es nicht das, was ihr macht? Leute finden?«
Leute finden. Wie kindisch das klang. Für sie war ich ein Kind, ganz sicher, ein Kind mit einem Kind. Ich richtete mich auf. Zerzauste Lou das Haar und versuchte, väterlich auszusehen.
»Wir müssen Anna finden. Sie ist Lous Mutter«, sagte ich. »Und ihren Bruder auch«, fügte ich schnell hinzu. Sie sollte nicht glauben, ich hätte August vergessen.
»Es tut mir leid, das zu sagen, aber Sie sind jetzt schon vierundzwanzig Tage voneinander getrennt. Es könnte alles Mögliche passiert sein.«
»Vierundzwanzig Tage ist doch gar nicht so lange«, erwiderte ich.
»Vielleicht sind sie in einem anderen Lager gelandet«, sagte sie, und jetzt hatte ihre Stimme etwas Tröstliches an sich.
»Ja«, sagte ich hastig. »Sicher ist es so.«
»Ich kann eine Suchmeldung aufgeben«, schlug Jeanette vor.
Sie lächelte wieder, war wirklich bemüht, nett zu uns zu sein. Und ich antwortete genauso nett, danke, das wäre sehr freundlich, ich wollte zeigen, dass ich mir auch Mühe geben konnte. Steif saß ich da, die Arme dicht am Körper. Versteckte meine Achselhöhlen vor ihr, die Schweißflecken auf meinem T-Shirt. Konnte noch immer nicht Lous Gesicht sehen. Sie saß genauso steif da wie ich, das Gesicht an die Knie gepresst.
Anschließend hatte sie Abdrücke von ihren Knien auf der Stirn, der Hosenstoff hinterließ ein schwaches Wegenetz auf ihrer glatten Haut.
Ich nahm sie nicht bei der Hand. Am liebsten wäre ich schreiend weggerannt. Doch ich zwang mich selbst dazu, ruhig zu sein.
Die Grillen. Sie geben nicht auf. Sie überstehen das alles.
Ich bin eine Grille.
Signe
Ich sollte mich um etwas von all dem kümmern, was ansteht; auf einem Boot gibt es immer etwas zu erledigen, zu schmieren, rollen, leimen, putzen, befestigen, auf einem Boot hat man nie frei; und ich sollte im Hotel vorbeischauen und meine Halbbrüder besuchen. Ich habe sie kaum gesehen, seit sie es übernommen haben. Ich sollte es tun. Stattdessen sitze ich hier im Salon und trinke Tee und kann mich nicht aufraffen, einen ganzen Tag und eine Nacht bin ich jetzt schon in Ringfjorden, zu Hause, und ich sitze nur da und lausche.
Das Knattern der Hubschrauber ist seit heute Morgen zu hören, sie fliegen die ganze Zeit über den Berg, vom Gletscher zu der stillgelegten Fischauktionshalle und wieder zurück. Die Halle wurde mit neuem Leben gefüllt, dort wird das Eis gespalten und abgepackt, um anschließend weiterverschickt zu werden.
Das Knattern steigt und fällt, ist bald kein Lärm mehr, sondern fast etwas Stoffliches, das sich in mir festsetzt, die Vibrationen erschüttern das Wasser im Fjord und die Schiffsplanken, und sie durchzucken mein Rückgrat.
Vielleicht klagen die Leute im Ort darüber, vielleicht schreiben sie Leserbriefe an die Lokalzeitung und beschweren sich. Denn irgendetwas müssen sie doch wohl sagen und meinen? Noch habe ich mit niemandem gesprochen, niemanden gefragt, aber jetzt stehe ich endlich auf, um in den Laden zu gehen.
Ich nicke der Kassiererin zu, sie erkennt mich wohl nicht wieder, und ich kann mich auch nicht an ihr Gesicht erinnern. Ich bin eine der wenigen, die weggegangen sind und sich für ein anderes Leben entschieden haben. Signe Hauger, die Journalistin, Autorin, Berufsdemonstrantin, die Leute hier zu Hause haben vielleicht nichts von mir gelesen, aber sie haben garantiert etwas über mich gehört und sicher auch über mich getratscht, obwohl es inzwischen viele Jahre her ist, dass ich mich angekettet habe und verhaftet wurde.
Aber sie erkennt mich wohl nicht, nein, denn sie erwidert mein Nicken nur gleichgültig. Ich sollte sie fragen, ob sie etwas weiß und was sie von der Sache mit dem Blåfonna hält und von den Hubschraubern, die meisten Leute tun gern ihre Meinung kund. Vielleicht sollte ich ein bisschen Smalltalk mit ihr machen, was für ein seltsamer Ausdruck, als wollte man diese kleine Unterhaltung so schnell wie möglich wieder beenden, und vielleicht ist das auch genau der Grund, warum ich diese Form des Gesprächs nicht gut beherrsche, ganz gleich, ob ich die Frau kenne oder nicht. Doch heute will ich ja eine konkrete Frage stellen, das ist etwas anderes; und trotzdem wage ich es nicht, direkt auf sie zuzugehen, das würde seltsam wirken, unnatürlich, ich warte lieber bis zum Bezahlen.
Ich fange an, die Sachen einzupacken, die ich brauche, Brot, Saft, Spülmittel, Konserven und Tee. Die kleine Glocke über der Tür bimmelt, zwei ältere Frauen kommen herein.
Sie fangen sofort mit Smalltalk an, der aber keineswegs schnell beendet ist, sie schwatzen, als hätte man sie dafür bezahlt, aber nicht über die Hubschrauber, nicht über das Eis, anscheinend redet hier niemand über den Blåfonna.
Es dauert einen Moment, bis ich verstehe, wer sie sind. Ihre Stimmen verraten sie, ich erkenne sie als Erste, wir sind zusammen in die Schule gegangen, und es ist erstaunlich, wie sehr sie noch so klingen wie damals, als sie Mädchen waren, die steigenden und fallenden Töne, wie sie lachen.
Ich trete einen Schritt hinter dem Regal hervor, allmählich wird es peinlich, wenn ich nicht grüße, und vielleicht wissen sie etwas über den Gletscher, vielleicht machen sie sich tatsächlich Gedanken, doch dann fällt ein Wort, ein Name in ihrem Redefluss, der mich innehalten lässt.
Magnus.
Sie sprechen über ihn, und stimmt ja, die eine ist seine Schwägerin, sie verrät die Neuigkeit. Er sei nach Frankreich gezogen, erzählt sie mit unverhohlenem Neid, und komme nur noch zu den Aufsichtsratssitzungen, habe wohl auch noch nicht vor, als Aufsichtsratsvorsitzender bei Ringfallene aufzuhören, nein, nein, er liebe ja seinen Job, genieße ansonsten aber das Rentnerleben dort unten, spiele Golf und gehe zu Weinproben, das müsse wirklich wundervoll sein, sie benutzt tatsächlich dieses Wort, wundervoll, und ich bleibe doch hinter dem Regal stehen.
Wundervoll. Doch, das kann ich mir vorstellen, ich habe ihn vor ein paar Jahren einmal in Bergen gesehen, auf der anderen Straßenseite, er musste sicher zu einem Termin, trug Anzug, Aktentasche und Allwetterjacke, die Uniform des älteren norwegischen Geschäftsmannes, er sah mich nicht, aber ich konnte ihn kurz studieren. Das wundervolle Leben hatte sichtbar Spuren hinterlassen, vor allem am Bauch; er war so geworden wie viele andere in seiner Generation. Ein gepolsterter Körper in einem gepolsterten Dasein, in unserer wundervollen neuen Welt.
Ich bleibe stehen, bis sie allmählich zum Ende ihres Gesprächs kommen, und warte darauf, dass sie noch mehr über ihn sagen, aber jetzt reden sie anscheinend über ihre Enkel, versuchen sich gegenseitig mit Geschichten zu übertreffen, wie großartig sie seien und was für eine enge Beziehung sie zueinander hätten, wie oft sie sich sähen, wie abhängig die Eltern doch von ihnen seien, den Großmüttern, um ihren Alltag zu bewältigen.
Und sie finden doch kein Ende, über Enkel kann man wohl ewig sprechen. Ich schleiche mich von meinem Einkaufskorb weg und zur Tür, öffne sie vorsichtig, damit die Glocke nicht so laut bimmelt.
Ich weiß, dass ich dich liebe, sagte ich immer.
Ich liebe dich, antwortete Magnus dann.
»Kann man das Wort lieben eigentlich steigern?«, fragte ich einmal.
Wir lagen eng umschlungen im Bett, während unser Puls langsam ruhiger wurde. Ich glaube, wir waren bei ihm, wir waren meistens dort.
»Wie meinst du das?«, fragte er.
»Kann man es steigern, oder ist das Wort an sich so stark, dass es immer maximale Gültigkeit hat, dass es immer einhundertprozentig ist?«
»Jedenfalls bist du die Einzige, die aus dem emotionalsten Wort unserer Sprache eine Theorie machen kann«, erwiderte er lächelnd und streichelte meinen Arm.
»Aber angenommen, man könnte es steigern«, sagte ich, »wäre es zu wissen dann nicht eine Verstärkung? Ist mein Satz nicht eigentlich stärker als deiner, wenn ich sage, dass ich es weiß?«
»Du meinst, dass du mich mehr liebst als ich dich?«
»Ja. Vielleicht schon«, sagte ich und schmiegte mich enger an ihn.
»Das glaube ich nicht.«
»Es ist die Sicherheit, die ich zu dem Wort hinzufüge, indem ich es in diesen sprachlichen Kontext einfüge, die es stärker macht.«
»Willst du wirklich, dass ich das ernst nehme?«
»Ich will, dass du alles, was ich sage, ernst nimmst.«
»Gut. Dann würde ich gern darauf hinweisen, dass du mit dieser Formulierung einen Zweifel zulässt. Die Wörter ich weiß lassen die Möglichkeit zu, dass einmal ein Moment, eine Zeit kommen könnte, in der du es nicht mehr weißt.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Und du benennst damit ja implizit auch den Gegensatz … dass ein ich weiß nicht