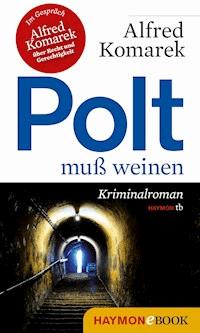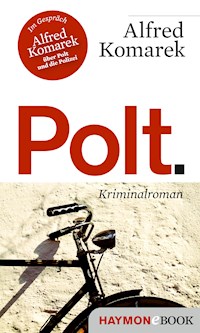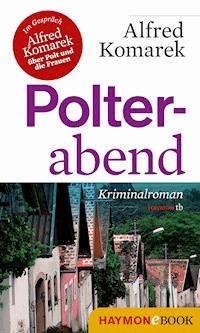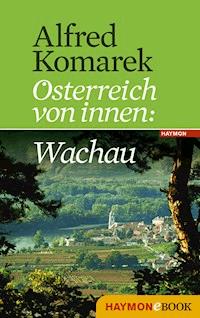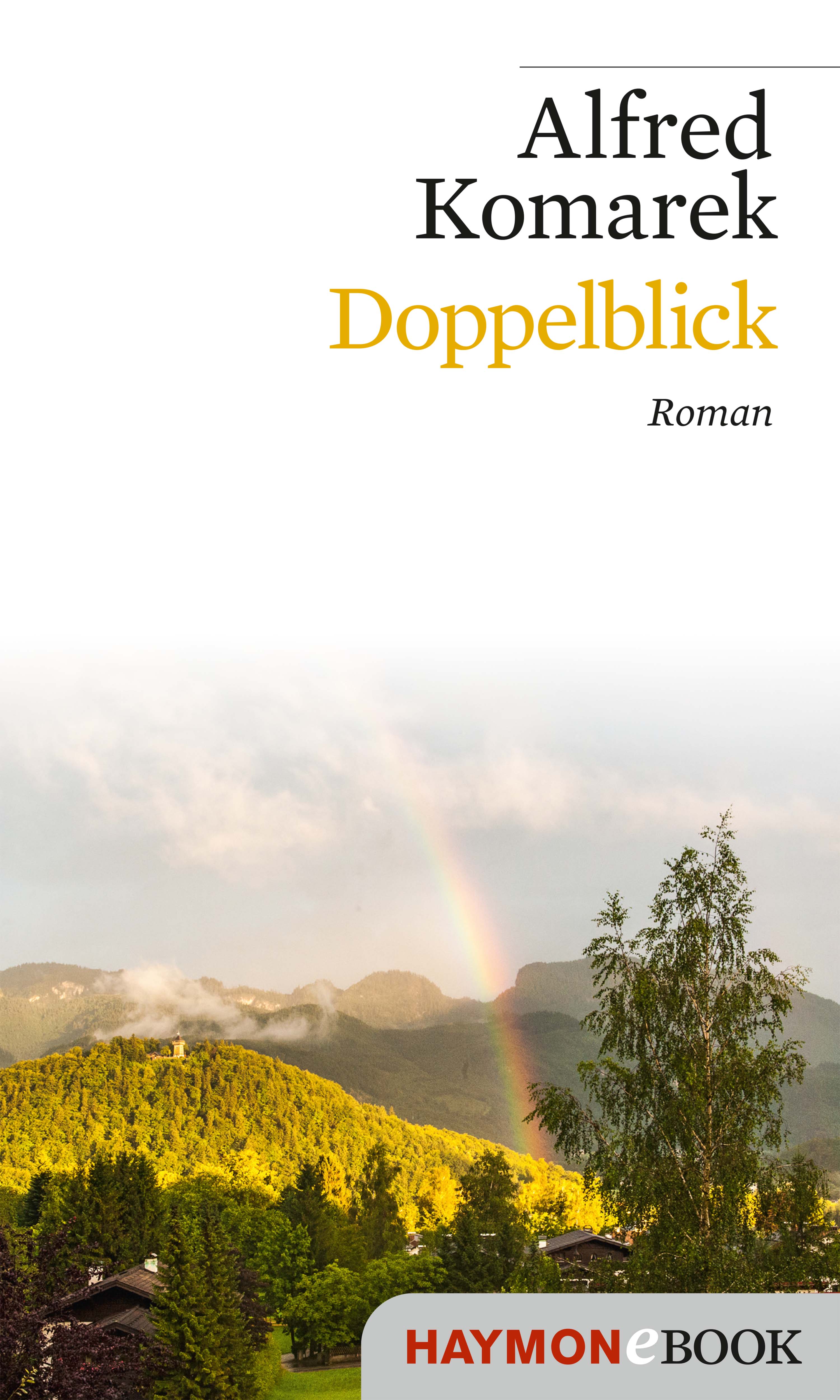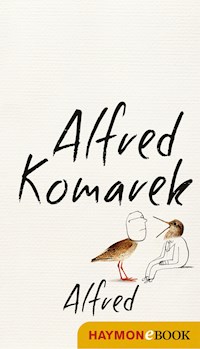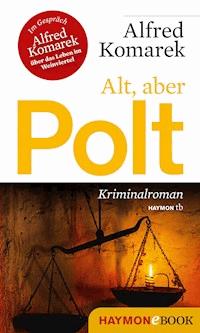
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polt-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der neue Polt von Alfred Komarek erstmals im Taschenbuch: Simon Polt, ehemaliger Gendarm im Wiesbachtal, neuerdings Gemischtwarenhändler, schlendert von seinem Presshaus die sacht abfallende Kellergasse hinunter. Da wird er unversehens Zeuge eines seltsamen Schauspiels, das ihn fasziniert und bedrückt zugleich. Am nächsten Tag erfährt er vom schrecklichen Ausgang dieses Spiels – und will Klarheit, jetzt erst recht. Polt bleibt eben Polt, ist so sehr Polt wie noch nie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Komarek
Alt, aber Polt
Kriminalroman
Mannsbilder
Simon Polt hing seinen Gedanken nach, und weil er vertraut mit ihnen war, ließ er sie achtlos laufen, eins werden mit den schütteren Schatten ringsum. Obwohl es draußen noch einigermaßen hell war an diesem späten Nachmittag im Oktober, hatte Polt die Tür seines Presshauses zugemacht, weil er Ruhe haben wollte. Nur eine kleine Fensteröffnung ließ Licht herein, und oben waren dort, wo die Dachziegel lose aneinanderlagen, helle, dünne Streifen im Dunkel zu sehen.
Der gewesene Gendarm saß da, schaute auf seine Hände und war sich selbst genug. Genug? Ja doch, hier schon, in einem Gebäude, das ihm gehörte, umgeben von Dingen, die er mochte. Aber zwischen den Menschen und in den Dörfern war vieles verloren gegangen, das auch für sein Leben wichtig und erfreulich war. Na und? Polt spürte etwas wie zärtliche Wut in sich. Der Kirchenwirt hatte zugesperrt. Ja, dann galt es eben, ihn mit Hilfe tatkräftiger Freunde trotzdem offen zu halten, wenigstens an Wochenenden. Aloisia Habesam, die unbestritten gut sortierte Anbieterin von gemischten Waren und Gerüchten, war gestorben. Jetzt handelte Simon Polt an ihrer Stelle, und zwar erfolgreich, zum eigenen Erstaunen. Es gab kaum noch Weinbauern in den Kellergassen. Was blieb ihm demnach anderes übrig, als unter kundiger Anleitung selbst Weinbauer zu werden, und zwar einer, der die hölzerne Weinpresse in Ehren hielt und das Fass im Keller?
Polt hob den Kopf. Die Presshaustür bewegte sich und gemessenen Schrittes traten Friedrich Kurzbacher, Sepp Räuschl und Christian Wolfinger ein. Unziemliche Eile war ohnehin nicht am Platz und hätte die drei Männer wohl auch ein wenig überfordert. Sepp Räuschl hatte vor ein paar Wochen seinen fünfundachtzigsten Geburtstag gefeiert, dachte allerdings nicht daran, in brüchiger Würde zu vergreisen. Zwar war er schon seit einiger Zeit mit einem Gehstock unterwegs, verwendete ihn aber hauptsächlich als Ausdrucksmittel seines cholerischen Temperaments. Wenn er im Wirtshaus wacker getrunken hatte, drosch er gerne mit dem Stock auf den Tisch ein, krächzte: „Die Jungen halten nichts aus!“, und bestellte einen Schnaps, um die Sache abzurunden.
Friedrich Kurzbacher hingegen, kaum ein Jahr jünger, hatte in den vergangenen Monaten mit erstaunlicher Tatkraft und mürrischem Eifer Simon Polt die Grundlagen des Weinbaus beigebracht. Jetzt war das kleine Fass im Keller gefüllt und die Gärung abgeschlossen. Feierlich hatten Lehrer und Schüler den jungen, noch trüben Wein verkostet. Nach einer guten Weile vielsagenden Schweigens war dann Kurzbachers Urteil zu hören gewesen: „Viel bringst nicht zusammen, Simon. Aber trinken kann man ihn.“ Polt hatte diesen derben Ritterschlag mit großer Erleichterung empfangen. Immerhin sah er seinen Siebziger vor sich, und es war an der Zeit, endlich das zu tun, was er schon immer tun wollte.
Christian Wolfinger, eben erst fünfundsechzig geworden, also unverschämt jung, war indes schon immer mit Leib und Seele Jäger gewesen. Seine mit bemerkenswerter Beiläufigkeit ausgeübten Brotberufe hatten aber am Ende sogar eine bescheidene Pension gebracht. Jetzt konnte er endlich ohne lästige Zeitvergeudung das scheue Wild hegen, pflegen und lustvoll erlegen. Ein einziges Indiz deutete darauf hin, dass es auch Wolfinger ein wenig gemächlicher anging: Früher hatte er, auf dem Fahrrad zwischen Dorf und Kellergasse unterwegs, seine drei Hunde an den Leinen hinter sich hergezogen. In letzter Zeit liefen sie immer öfter voran und der Jäger hielt auch einmal inne und ließ sich ein Stück des Weges ziehen.
Die Männer nickten einander zu, redeten aber nicht, weil es vorerst nichts zu sagen gab. In den letzten Jahren hatte sich ein stummes Ritual eingetieft: Jeden ersten Sonntag im Monat trafen die vier Freunde in Polts Presshaus zusammen. Friedrich Kurzbacher holte aus seiner hellbraunen Kunstleder-Einkaufstasche Brot, scharfe Ölsardinen, Räucherspeck und fetten, stark riechenden Käse. Sepp Räuschl deckte den Tisch mit Gläsern, hölzernen Schneidbrettern und Messern, Christian Wolfinger tat vorerst nichts. Als dann die beiden anderen fertig waren, stellte er seinen Rucksack auf die Sitzbank, stieß einen bedeutungsvollen Pfiff aus, lächelte geheimnisvoll und holte endlich zur geringen Überraschung seiner Freunde eine Flasche Trebernschnaps hervor.
„Da schau her“, brach dann der Kurzbacher das Schweigen. Polt zündete eine Kerze an und griff zum Weinheber. Er freute sich schon lange auf diesen Augenblick. Bisher hatte er immer irgendeine Flasche aus dem Keller geholt. Diesmal war es sein eigener Wein, der erste, den er gekeltert hatte.
Er trat ins Freie. Sein Presshaus stand am oberen Ende der langen, sacht ansteigenden Kellergasse von Burgheim. Aus einiger Entfernung war Musik zu hören. Polt achtete nicht darauf, nahm von welkem Laub bedeckte Stufen vorsichtig unter die Füße, öffnete die Kellertür und holte tief Atem. Der Geruch hier war ihm natürlich vertraut: So rochen alte Kirchen und alte Wirtshäuser, wenn sie eins wurden unter der Erde. Seit ein paar Wochen war in seinem Keller aber auch junger, ungebärdiger Wein im Spiel, brachte Leben ins stille, kühle Dunkel. Das hatte es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben.
Unten angekommen, stellte Polt die Kerze auf den Lössboden, nahm den Spund vom Fass, füllte den geräumigen Weinheber, verschloss die Öffnung des Glasrohres mit dem Zeigefinger und ging nach oben. Dort ließ er ruhig und gekonnt den Grünen Veltliner in die Gläser rinnen, setzte sich, nahm den Weinheber in die linke Hand und lehnte ihn an den Oberkörper. Er hob sein Glas. „Prost, alle miteinander!“ Die vier senkten die Nasen, kosteten und tranken. Sepp Räuschl, der Durstigste in der Runde, hatte sein kleines Glas bald geleert. Polt füllte es wieder. „Und? Was sagst?“
„Nichts sag ich.“ Sepp Räuschl trank und neigte den Kopf.
„Warum?“
„Weil ich ihn sonst loben müsste, deinen Wein. Bist du am Nachmittag in der Kellergasse gewesen, Simon?“
„Nein. Heute war ich ja im Kirchenwirt an der Reihe. Um fünf hab ich dann zugesperrt und bin gleich hierher gegangen. Zu laut für mich, das alles.“
„Was jetzt? Dann jammerst du wieder, dass es viel zu still geworden ist in der Kellergasse.“
„Stimmt schon. Aber die blöde Musik aus den Lautsprechern passt nicht hierher und die Marktfahrer könnten ihr Zeug ruhig anderswo verkaufen. Bauernmarkt? Sehr originell. Hast irgendeinen Bauern aus dem Dorf gesehen, Sepp?“
„Lass mich nachdenken. Der alte Karl Haupt hat ein paar Säcke Erdäpfel vor sein Presshaus gestellt. Das letzte Mal, hat er mir erzählt. Er tut sich das nicht mehr an. Ich hab nicht aufgesperrt, weil’s ja keinen Flaschenwein bei mir gibt. Und auf die siebengscheiten Bemerkungen von ein paar dahergelaufenen Weinkennern kann ich verzichten. Der Höllenbauer hat Gäste im Presshaus und im Keller gehabt. Der weiß schon, wie’s geht, und versteht was vom Wein. Aber die großen Fässer in seinem Keller … alle leer, Simon, alle leer, nichts wie Stahlzisternen und technisches Zeug in der Halle hinten im Hof. Ja, und der Hannes Eichinger, unser Größter und Bester und Gscheitester, der war sich zu gut für die Kellergasse. Nur seine Tochter, die Laura, hat Einladungen verteilt: in die Weinlauntsch oder wie das heißt. Aber sonst war schon viel los. Autobusse sind gekommen und dann sind die Leute scharenweise durch die Kellergasse gezogen.“
„Aber schon auch welche aus Burgheim?“
„So ziemlich alle, glaub ich. Die kommen halt, weil endlich wieder einmal was los ist in unserer ruhigen Gegend. Sogar die strammen Greise vom Kameradschaftsbund sind ausgerückt, streng auf Kommando, in Reih und Glied. Vor dem Presshaus vom Bayer Bertl, ihrem Vereinslokal, hat’s dann ‚rührt euch!‘ geheißen. Der Befehl zum Kampftrinken, verstehst, Simon?“
„Und sonst?“
„Na, die Dorfmusik ist aufgetreten und war bald einmal weg und beleidigt, weil keiner daran gedacht hat, die Lautsprechermusik auszuschalten. Der Bürgermeister hat geredet, der Pfarrer ist gekommen, hat aber nichts sagen wollen, und im Weinstadl hat’s was für die Jungen gegeben. Dann war da noch ein Feuerwerk, sehr schön und sehr teuer, denk ich mir. Und noch allerhand hat sich abgespielt, frag mich nicht, was genau. Was ist da im Heimatblatt gestanden, Christian?“
„‚Herbstzauber. Ein unvergesslicher Event in der Burgheimer Kellergasse‘. Alles ist heutzutage ein Event. Der Feuerwehrheurige, die Sparvereinssitzung und das Kaffeekränzchen vom Kleintierzüchterverband. Mir egal. Aber es muss halt englisch sein, sonst ist es nichts. Die Kellergasse ist ja auch nicht mehr, was sie war, sondern eine Lokeischn. Kommst du da mit, Simon? Du hast ja eine gscheite Frau und zwei Kinder, die was lernen.“
„Hab ich derzeit nicht, Christian. Zwei Wochen Schulreise nach London, und die Karin ist mitgefahren, weil sie ihr Englisch auffrischen will.“
„Für wen und für was?“
„Frag mich was Leichteres.“
Friedrich Kurzbacher stellte hörbar sein Glas auf den Tisch. „Eine andere Zeit. Früher war jedes Dorf im Wiesbachtal seine eigene Welt. Jetzt ist die Welt wie ein Dorf, und die Amerikaner, die Eskimos und die Chineser sind unsere Nachbarn. Und alle reden’s Englisch.“
Räuschl grinste. „Die Krimmel Hilda und der Georg, ihr Mann, haben heute Nachmittag aber auf Deutsch gestritten, dass die Fetzen nur so geflogen sind. An ihrem Stand hat’s Zwiebelschmalzbrote und Punsch gegeben. Alle, die nicht mehr auf die Sauferei im Advent warten wollten, waren also schon jetzt besinnlich, aber ordentlich. Einer hat dann der Hilda auf den Hintern gegriffen, obwohl sich das nicht gehört und es sich auch nicht wirklich auszahlt bei ihr. Der Georg hat ihm brennheißen Punsch ins Gesicht geschüttet, die Hilda wollt sich das Geschäft nicht verderben lassen und hat ihren Mann einen blöden Hund geschimpft, der sowieso nichts mehr zusammenbringt. Das hat der Georg nicht auf sich sitzen lassen und ihr ein paar Watschen verpasst, worauf ihn die anderen Männer verprügelt haben, bis er still dagelegen ist. Als er wieder bei sich war, haben sie ihm einen Punsch eingeflößt, zur Belebung. Ich möcht nicht wissen, wie das noch weitergeht, heute.“
„Und ich bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe.“ Simon Polt schaute auf den leeren Weinheber, stand auf und begab sich in den Keller.
Traumzeit
Wie an jedem dieser Abende gab es irgendwann nichts Neues mehr zu bereden und nichts Altes mehr aufzuwärmen. Ein behäbiges, aber doch drängendes Schweigen machte sich breit. Zeit demnach, das anfängliche Ritual in umgekehrter Reihenfolge abzuwickeln. Christian Wolfinger hob grinsend die Flasche mit dem Trebernschnaps, schenkte ein und steckte sie dann in den Rucksack. Nachdem alle getrunken hatten, räumte Sepp Räuschl die Jausenbretter, Messer und Gläser in einen blauen Plastikbottich, Friedrich Kurzbacher packte die übriggebliebenen Nahrungsmittel in seine Einkaufstasche und Simon Polt stand auf, um den Weinheber an einen Nagel neben der Tür zu hängen. Dann bat er seine Gäste hinaus und die Nacht herein. Das gefiel ihm gut so: In seinem Presshaus gab es kein elektrisches Licht und die Kerzen schafften die Dunkelheit nicht ab, sondern schufen in ihr eine kleine Höhle, groß wie die Welt. Polt ließ die Zeit verrinnen. Er hatte mehr als genug davon.
Endlich entsann er sich seiner häuslichen Pflichten und nahm mit gebotener Vorsicht einen museumsreifen Spirituskocher in Betrieb. Dieses Gerät gehörte zu jenen unzähligen Merkwürdigkeiten, die Ignaz Reiter in seinem Presshaus angehäuft hatte. Jetzt war Simon Polt hier zuhause und lebte auf seine Weise ein erloschenes Leben weiter. Er stellte einen mit Wasser gefüllten Topf auf die Flamme und wartete geduldig, bis Dunst aufstieg.
Bald darauf walteten wieder Sauberkeit und Ordnung zwischen seinen vier Wänden. Polt nickte zufrieden, löschte die Kerzenflammen aus und wandte sich zum Gehen. In der geöffneten Tür zögerte er. Irgendetwas hielt ihn zurück, zog ihn gebieterisch ins dunkle Presshaus. Auch gut. Er griff zum Weinheber, dem „Dupfa“. Im Keller angekommen, ging er nicht gleich zum Fass, sondern verharrte dort, wo er dereinst „Eigen: Simon Polt“ in die Lösswand geritzt hatte. Gut zwanzig Jahre war das her. Oder noch länger? Damals war er Gendarm gewesen. Heute war er Weinbauer. Mit dem Daumennagel grub er einen dicken Strich unter die Inschrift.
Er ging nach oben, setzte sich an den Tisch, füllte sein Glas, kostete nunmehr ganz ruhig und ungestört, trank und schloss die Augen, weil er sich dabei zuschauen wollte, wie er still Zwiesprache hielt mit seinem Presshaus und seinem Wein. Oh ja, dieses Bild konnte ihm gefallen. Er öffnete die Augen und schaute sich um. Alles hier war für ihn im schönsten Sinne wunderlich. Unzählige Bilder gab es: herausgetrennte Seiten aus alten Kinderbüchern, Kalenderheilige, vergilbte Ansichtskarten. Der gute alte Kaiser blickte backenbärtig auf Polt hernieder, schnörkelige Urkunden ehrten die Verdienste längst Verstorbener, im Halbdunkel war bäuerliches Arbeitsgerät zu erahnen. Polt hatte sich redlich bemüht, Ignaz Reiters Erbe zu bewahren. Mit einer besonderen Arglist des alten Spitzbuben hatte er allerdings aufgeräumt: Wer dereinst das Presshaus betrat, sah sich einem gusseisernen Grabkreuz gegenüber, umringt von sehr gottesfürchtigen und hohlwangigen Asketen. Hinter der Weinpresse verbargen sich allerdings Bilder von aufreizend leicht geschürzten Damen. Jetzt schauten die Schönen, neckisch die Röcke raffend, ins Licht und das Grabkreuz mit seinem Gefolge verharrte in angemessener Demut im Dunkel.
Nach einer gar nicht so kleinen Ewigkeit entschloss sich Polt dann doch zum Aufbruch und trat ins Freie. Die Tür des Presshauses öffnete sich zu einer Wiesenfläche, die an eine kleine Steilwand aus Löss grenzte. Darüber zeichneten sich Rebstöcke schwarz gegen den helleren Himmel ab. Polt atmete tief die kühle Nachtluft ein und spürte feinen Rauch in der Nase, Rauch von Buchenholzscheitern, mit denen die Bäuerinnen im Dorf ihre Küchenherde fütterten. Talwärts führte ein an den Rändern dicht bewachsener Hohlweg an den Rückseiten der Presshäuser vorbei zur Kellergasse. Dort angekommen, blieb Polt erst einmal stehen. Vereinzelt waren Stimmen zu hören, aber die Musik aus den Lautsprechern war verstummt. Einige von den kleinen Fensteröffnungen der Presshäuser waren noch hell, da und dort fiel Licht aus geöffneten Türen. Die Fackeln, mit denen man glaubte, die Kellergasse dekorieren zu müssen, waren fast alle erloschen. Unten im Tal sah Polt die langgezogenen Lichterketten der Dörfer, daneben kleinere Gruppen neu gebauter Häuser. Ein wenig abseits der Kellergasse, ungefähr dort, wo der Friedhof lag, bewegten sich helle Punkte in der Dunkelheit, dazwischen bemerkte Polt ein merkwürdig farbiges Aufflackern. Wahrscheinlich irgend so ein elektronisches Spielzeug. Seine Frau erzählte ihm ja hin und wieder, was es da so alles gab, auch schon im Kindergarten. Wozu selbst spielen, wenn man ein Gerät hatte, das einem was vorspielte?
Langsam setzte Polt seinen Weg fort. Derzeit gab es ja niemanden, der auf ihn wartete. Frau und Kinder würden erst in knapp zwei Wochen heimkehren. Und sein ebenso dicker wie selbstbewusster Kater, Czernohorsky mit Namen, war schon vor einigen Jahren für immer gegangen. Seiner ausgeprägten Wesensart folgend, hatte er das an sich betrübliche Lebensende durchaus stilvoll und lustbetont inszeniert. Als eine seiner vierbeinigen Favoritinnen merklich Sehnsucht verspürte, näherte sich Czernohorsky, wartete gelassen das hitzige Treiben jüngerer Nebenbuhler ab, um endlich mit gereifter Leidenschaft ans Werk zu gehen. Anschließend kam er ermattet nach Hause, schlief ein und wachte nicht mehr auf.
Der Klang einer dünnen, melancholisch verirrten Frauenstimme holte Polt aus seinen Gedanken. Er ging neugierig auf ein Presshaus zu, von dem er wusste, dass es einer Wienerin gehörte, die ins Wiesbachtal gezogen war: eine Schauspielerin, angeblich berühmt gewesen und nunmehr bemüht, das flache Land mit ihrer Kunst zu erhöhen. Mira Martell nannte sie sich. Polt schaute durch den Türspalt, sah leere Sesselreihen und einen Lehnstuhl, in dem die ältere Frau saß.
„Und warf den heil’gen Becher hinunter in die Flut“, hörte er sie singen. Dann kippte ihre Stimme, brach ab, der Kopf sank an die Brust. Polt erschrak ein wenig, klopfte und trat ein. „Ist was? Kann ich helfen?“
Frau Martell hob den Kopf und lächelte dem Besucher zu. „Die Augen täten ihm sinken. Trank nie einen Tropfen mehr.“ Sie schaute auf das leere Glas in ihrer Hand. „Wenn Sie in der Schule aufgepasst haben, Herr Polt, kennen Sie diese Zeilen: ‚Es war ein König in Thule …‘“
„Ja, ich kann mich so ungefähr erinnern. Vor allem, weil ich mich als Bub immer gefragt habe, was eine ‚Buhle‘ ist.“
„Das wissen Sie inzwischen hoffentlich. Ich wollte heute mit einer Soiree diesem seltsamen Fest eine künstlerische Note geben. Wenn es ums Trinken geht in den Texten, werden die Leute schon kommen, hab ich gedacht. Ein Irrtum, mein Lieber. Na gut, die Laura hat mir ein paar Minuten zugehört. Aber auch nur aus Mitgefühl, vermute ich.“
„Die Laura vom Eichinger?“
„Ja, die. Irgendwie eine verwandte Seele.“
„Da schau her. Sehr enttäuscht, wegen heute Abend?“
„Ach wo. Aber leicht angesäuselt, das Leben durchs Veltlinerglas betrachtend.“
„Ja dann …“
„Ja dann!“
Polt hatte eine sterbende Buhle und einen goldenen Becher vor seinem inneren Auge, als ihm ein Geruch in die Nase stieg, der nicht so recht ins Bild passte: verbranntes Papier. Er schaute sich um und sah in einem schmalen Durchgang zwischen Mira Martells Presshaus und dem Gebäude daneben ein Häufchen Asche, dazwischen einen noch glosenden Stapel. Er zog ein halb verkohltes Blatt heraus: Hannes Eichingers Einladung in die Weinlounge. Laura hatte offenbar bald die Lust am Zettelverteilen verloren. Und da war noch was: eine kleine, bunte, aus Wollfäden gewickelte Puppe lag in der Asche. Ohne viel nachzudenken, steckte Polt sie ein. Und Laura? Die zog jetzt wohl mit Freundinnen und Freunden durch die Gegend. Polt gönnte ihr den Spaß, so wie er seinen Heimweg durch eine Kellergasse genoss, in der ausnahmsweise ein wenig Leben war.
Als er sich dem Presshaus von Bertl Bayer näherte, begegnete ihm dieses Leben ein weiteres Mal als Gesangsdarbietung. Ein martialisch-elegischer Altherrenchor intonierte mit hörbar schweren Zungen „Ich hatt’ einen Kameraden“. Doch schon während der ersten Strophe mischten sich Störgeräusche ins Klangbild. Das Lied erstarb, Polt war akustischer Zeuge einer kurzen, aber heftigen Kampfhandlung. Als er vor der Tür stand, wurde sie aufgestoßen. Junge Leute, nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, drängten nach draußen, schoben ihn rücksichtslos zur Seite. Laura war unter ihnen. Die Tür wurde zugeschlagen, innen drehte sich ein Schlüssel im Schloss. Polt klopfte, so laut er konnte, nannte seinen Namen, die Tür blieb zu. Als er den offenbar ungebetenen Besuchern nachschaute, sah er, ein paar Schritte zurückgeblieben, einen, den er zu kennen glaubte. Er rief ihm nach. Der junge Mann stutzte, ging dann aber schneller und verschwand in der Gruppe. Jetzt erst bemerkte Polt starken, um nicht zu sagen aufdringlichen Blütenduft. Er drehte sich zur Seite und sah Mira Martell, diesmal in einen Kaschmirschal von monströser Eleganz gehüllt. „Sie hier?“
„Wo sonst? Immer noch auf der Suche nach Publikum … Diesmal als ‚femme entretenue‘.“
„Als was?“
„Als Halbseidene, vulgär gesagt. Sie sehen in mir und riechen an mir die ‚Kameliendame‘, die beste unter meinen sehr vielen, sehr guten Rollen. Sarah Bernhardt war ich vielleicht keine. Aber verdammt nahe dran.“
Polt musterte sie argwöhnisch. „Sie haben viel zu wenig an bei der Kälte. Und morgen sind Sie dann krank.“
„Morgen? Ich zitiere: ‚Was liegt daran, ob ein Mädchen wie ich mehr oder weniger in der Welt ist?‘“
„Unsinn! Und jetzt kommen S’ mit. Wenn Sie möchten, gibt’s einen heißen Tee bei mir.“
Schweigend gingen die beiden nebeneinander her. Nach ein paar Minuten zupfte die Schauspielerin Polt am Rockärmel. „Da, schauen Sie: ein Geisterballett! Elben, Elfen, wie ich vermute, von ein paar Faunen bedrängt.“
Tatsächlich sah nun auch Polt bewegte Schatten auf einer weiß gekalkten Mauer. Aber es war doch windstill …? Kurz darauf erlosch hinter den Presshäusern eine Straßenlaterne und das Spiel versank im Dunkel. Polt hielt rasch Nachschau, konnte aber nichts entdecken. Langsam gingen sie weiter. Dort, wo die letzten Presshäuser standen und hinter einer dunklen Ackerfläche die Lichter von Burgheim schon nahe waren, blieb Mira Martell stehen und lehnte sich an Polt. „Sie entschuldigen schon, mon cher.“
„Ist Ihnen nicht gut?“
„Ganz im Gegenteil. Aber ich hätte gerne mehr Freunde in meinem selbst gewählten Exil. Na ja. Man kann nicht alles haben. Oder vielleicht doch?“
Weiter oben in der Kellergasse zerriss plötzlich laute, verzerrte Musik die Stille. Wenig später sah Polt ein Polizeiauto mit Blaulicht, doch in mäßigem Tempo vom Dorf her in die Kellergasse einbiegen. „Schöner Herbstzauber, das alles“, murmelte Polt.
Mira Martell lächelte fein. „Sie waren doch einmal Gendarm, mon cher Polt. Wollen Sie nicht wissen, was los ist?“
„Muss mich nicht mehr interessieren. Außerdem kann ich’s mir fast denken.“
Dann wurde es still und die Nacht blieb ungestört. Frau Martell hatte sich untergehakt. An der Brücke, die über den schmalen Wiesbach führte, blieb sie stehen. „Darf ich Sie küssen?“
„Nein.“
„Dann will ich auch keinen Tee.“
Spätnachts stand Polt dann vor dem Haus, das ihm Aloisia Habesam vererbt hatte. Er wohnte seit Jahren mit seiner Familie darin, fühlte sich aber immer noch als Gast. Derzeit, so ganz ohne Mitbewohner, war viel zu viel Platz um ihn, auch zu viel Stille, obwohl er es doch gerne ruhig hatte. Seltsam: Hier war ihm auch nicht nach Wein. Der gehörte ins Presshaus, das jetzt verlassen in der Kellergasse stand. Im Schlafzimmer strich Polt mit der Hand über Karins Bett, wandte sich unschlüssig ab und begab sich in die Gemischtwarenhandlung. Hier war er wenigstens von vielen Bildern und Gerüchen umgeben, wusste sich irgendwie geborgen.
Er nahm hinter dem Verkaufspult Platz, holte eine Schokobanane aus dem Glas, steckte sie in den Mund und spürte, wie er ruhiger wurde. Er war fast eingeschlafen, als er glaubte, ein Geräusch zu hören. „Ja, Frau Aloisia?“ Er schaute sich um. Da war nichts, da war niemand. Nur das Bild einer alten Frau mit jungen Augen war in ihm, so lebendig wie stets. „Na, Frau Aloisia“, murmelte Polt, „was halten Sie vom Herbstzauber in der Kellergasse?“
Wie zu erwarten, bekam er eine Antwort: „Bsoffene Gschicht, Simon. Und du bist auch nicht mehr nüchtern. Ins Bett mit dir!“
Zwischenzeit
Pünktlich um acht öffnete Simon Polt unter den wachsamen Augen der verblichenen Aloisia Habesam seine Gemischtwarenhandlung. Für ihre machtvolle Präsenz im Diesseits sorgte ein feierlich gerahmtes Gemälde. Polt hatte sich nichts dabei gedacht, als ihn sein Sohn eines Tages um ein Foto von der ehemaligen Dienstgeberin gebeten hatte. Peter, in den Weiten und Tiefen des Internet nicht minder zuhause als im Wiesbachtal, hatte herausgefunden, dass Ölbilder, nach irgendwelchen Vorlagen gemalt, erstaunlich preiswert zu bekommen waren. Damit hatte er ein schönes Geschenk zum 60. Geburtstag seines Vaters gefunden. Seit damals schaute die Kauffrau hoch über Polt hinweg gebieterisch jedem Kunden entgegen und ließ keinen Zweifel daran, wer hier das Sagen hatte, auch wenn es schweigend geschah.
Dennoch hatte Polt einiges verändert, nichts Grundlegendes natürlich: Frau Habesams Lagerhaltung hatte einer in genialischem Überschwang schwelgenden Krämerseele entsprochen. Polts Lagerhaltung begnügte sich mit einem immerhin irgendwie überschaubaren Chaos. Frau Habesams Geschäftsprinzip war hartnäckige Habgier gewesen, Polt begnügte sich mit bescheidenem Gewinnstreben. Außerdem gab es nunmehr ein eigenes Regal mit Produkten aus dem Wiesbachtal und der näheren Umgebung. Natürlich gehörte auch Karins Quittenkäse dazu: sehr fest, mit einer fast schon erschreckenden Zitronennote. Wenn Polt, wie üblich, wochenlang nichts davon verkauft hatte, verzehrte er ihn heimlich und berichtete seiner Frau dann vom reißenden Absatz ihrer Köstlichkeit, nicht ohne anzumerken, dass sie sich mit der Nachlieferung ruhig Zeit lassen könne, er wolle sie ja nicht überfordern.
„Und jetzt nimmst den Besen und kehrst auf. Ein reines Herz und ein sauberer Fußboden gehören zusammen, sag ich immer!“ Polt hatte die morgendliche Befehlsausgabe im Hause Habesam noch gut im Ohr. Er murmelte: „Ja, Frau Aloisia“, und ging ans Werk. Nach getaner Arbeit warf er einen prüfenden Blick auf das Bildnis der Kauffrau selig und hätte schwören können, dass ihre Miene Anzeichen widerwilligen Wohlwollens zeigte. Dann sah er Friedrich Kurzbacher durch die Tür kommen, diesmal ohne Einkaufstasche. Der alte Weinbauer schaute sich um. „Wie geht das Gschäft, Simon?“
„Heute bin ich noch schwer im Minus. Die einzige Kundschaft bis jetzt war ich: eine Käswurstsemmel.“
„Mit Gurkerl?“
„Mit Gurkerl. Und was willst einkaufen, Friedrich?“
„Wir haben morgen Hochzeitstag, den 50., die Frieda und ich.“
„Also dass du an so was denkst …“
„Ich nicht. Die Frieda denkt dran. ‚Ich sag’s dir lieber‘, hat sie gesagt, ‚weil du ja sonst darauf vergisst. Dann müsst ich beleidigt sein, und die Umständ kann ich mir ersparen.‘“
„Eine gescheite Frau, die du da hast. Und was soll es sein?“
„Ich hab mir gedacht, du weißt was.“
„Seit wann weiß ich was? Das erfordert eine gemeinsame Geistesanstrengung.“
„Trinken wir was?“
„Trinken wir was. Aber Kaffee, um die Tageszeit. Komm mit nach hinten, Friedrich.“
Nach eingehender Beratung war Polt in die Tiefe seiner Lagerräume getaucht und kam mit einem sittsam langen Nachthemd aus wärmendem Flanell zurück. „Eigentlich schade, dass nur du sie darin siehst.“
„Du musst nicht alles haben, Simon. Warst noch lang im Presshaus, gestern?“
„Ja, schon … eine Stunde vielleicht. Und auf dem Heimweg ist mir dann diese Schauspielerin untergekommen, Miratel oder so ähnlich.“
„Kenn ich nicht, muss neu sein bei uns.“
„Seit drei Jahren ungefähr ist sie in der Gegend.“
„Sag ich’s doch. Wir waren noch beim Höllenbauer im Presshaus und nachher haben wir uns beim Punschstandl umgeschaut, du weißt ja. Die Krimmel Hilda hat ein paar Zähne weniger im Mund gehabt und ihr Mann ein Messer im Bauch, aber nur ein kleines. Als die Polizei mit dem Arzt gekommen ist, haben sich die zwei schon wieder vertragen.“ Friedrich Kurzbacher stand mit einiger Mühe auf. „Alt sollt man nicht werden.“
„Wem sagst du das?“ Polt schaute zur Ladentür hin. „Und der da passt irgendwie zum Thema.“
„Wer da?“
„Der Erwin Städtner. Unser Totengräber.“
Jetzt hatte es Kurzbacher eilig. „Ich geh dann.“
„Ganz ruhig, Friedrich. Der Erwin ist ja auch noch Schulwart, Obmann des Radwandervereins und Heurigenwirt in seinem Presshaus.“
„Aber den Geruch wird er nicht los, Simon.“ Kurzbacher versetzte im Vorbeigehen dem vielseitig jenseitigen Mann einen friedlichen Rempler und suchte das Weite. Erwin Städtner grinste und stellte eine große Schachtel auf das Verkaufspult. „Neue Lieferung von der Elisabeth: Marmelade aus eigenen Äpfeln und Weingartenpfirsichen. Mit Zimt, mein Lieber! Wie ich dich kenn, magst kosten.“
„Na klar! Das gehört zu den Pflichten eines gewissenhaften Gemischtwarenhändlers.“