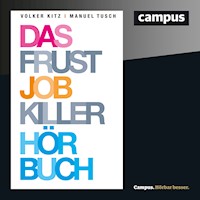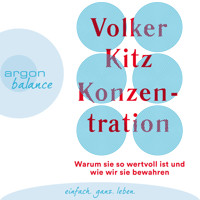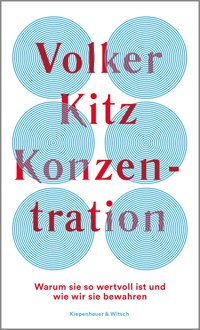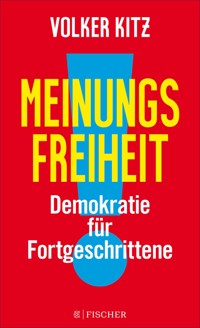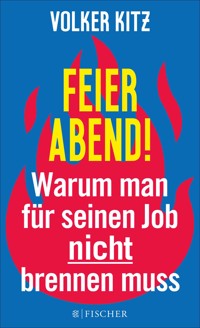19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet es, wenn die Eltern alt werden? Bestsellerautor Volker Kitz erzählt in seinem literarischen Essay die Geschichte seines Vaters und erkundet an ihr exemplarisch, wie sich familiäre Verantwortung verschiebt, wenn Eltern alt werden. Sein Buch berührt die Gefühle und Fragen einer ganzen Generation. »Bleibt bei mir«, bittet der Vater seine zwei Söhne, als die Erinnerung ihn verlässt. Bis dahin war Erinnerung für Volker Kitz kein Thema. Sie funktionierte, der Vater funktionierte, die Familie funktionierte. Doch eines Tages verunglückt die Mutter, und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Erst unmerklich, dann immer deutlicher, verliert der älter werdende Vater die Orientierung in seiner Welt. Volker Kitz begleitet ihn, von den übersehenen Anfängen bis zu dem Tag, an dem der Vater vergisst, wie man schluckt. Durch Hoffnung und Hilflosigkeit, bis zum Abschied, als der Vater – trotz allem plötzlich – stirbt. In diesem persönlichen literarischen Essay erkundet Volker Kitz eine Zeit der Ungeahntheiten, in der sich Verantwortung verschiebt, und dringt mit zärtlicher Wucht zu Empfindungen und Fragen vor, die eine ganze Generation betreffen. »Was für ein Buch, das so viele Menschen betrifft! Aufwühlend und tröstlich zugleich, eine packende Erzählung nicht nur über den Tod, sondern auch über das Leben.« Kristof Magnusson »Eine Schule der Empathie und des Verstehens – ein unendlich schönes Buch.« Maria-Christina Piwowarski »Es ist lange her, dass mich ein Buch so berührt hat. Manchmal musste ich mitten im Satz innehalten, weil so viele eigene Bilder und Erinnerungen in mir hochkamen, dann wieder konnte ich es nicht weglegen.« Sarah Stricker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Volker Kitz
Alte Eltern
Über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Volker Kitz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Volker Kitz
Volker Kitz, Jahrgang 1975, Jurastudium in Köln und an der New York University, hat sich seit vielen Jahren einen Namen als Autor erfolgreicher Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen gemacht. Er veröffentlicht Beiträge in internationalen Fachzeitschriften ebenso wie Essays in Die Zeit, Welt am Sonntag, SPIEGEL oder im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seine Bücher erscheinen weltweit in zehn Sprachen und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, zuletzt etwa »Konzentration. Warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Bleibt bei mir«, bittet der Vater seine zwei Söhne, als die Erinnerung ihn verlässt. Bis dahin war Erinnerung für Volker Kitz kein Thema. Sie funktionierte, der Vater funktionierte, die Familie funktionierte. Doch eines Tages verunglückt die Mutter, und das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Erst unmerklich, dann immer deutlicher, verliert der älter werdende Vater die Orientierung in seiner Welt. Volker Kitz begleitet ihn, von den übersehenen Anfängen bis zu dem Tag, an dem der Vater vergisst, wie man schluckt. Durch Hoffnung und Hilflosigkeit bis zum Abschied, als der Vater – trotz allem plötzlich – stirbt. Gegen die eigene Furcht beschäftigt sich der Sohn zunächst mit Erinnerung: Wenn er weiß, warum etwas geschieht, denkt er, kann er das Geschehen beeinflussen. Doch bald merkt er, dass die wahren Themen darunter liegen.
Mit zärtlicher Wucht dringt er zu Empfindungen und Fragen vor, die eine ganze Generation betreffen und die keine Debatte über Pflegenotstand beantwortet: Welche Zeichen muss ich erkennen? Welche Entscheidungen treffen, auch gegen den Willen der Eltern? Wie behalte ich Zugang zu ihnen, teile Schmerz, Freude, pendle in ihre Welt – ohne meine verdorren zu lassen? Wie helfe ich, Lebensaufgaben aufzuarbeiten, in der Zeit, die uns bleibt? Wie bereite ich mich auf die existenziellen Augenblicke vor, begegne der eigenen Unzulänglichkeit?
In diesem persönlichen literarischen Essay erzählt Volker Kitz die Geschichte seines Vaters und erkundet an ihr exemplarisch, was familiäre Verantwortung bedeutet.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Das Zitat von Paul Auster (erstes Motto) wurde entnommen aus: Paul Auster: Winterjournal. In der Übersetzung von Werner Schmitz © 2013, Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung und -motiv: © Marion Blomeyer / Lowlypaper
ISBN978-3-462-31137-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motti
Ich werde bald einen Kuchen backen
Das Licht ferner Sterne
Sammeln, bewahren
Unsicher
Wirklichkeit teilen
An manchen Tagen im Reinen sein
Notfallsammelpunkt
Kostbare Fragmente
Tatortversiegelung
Ich werde den Kuchen mit der 8 und der 0 nicht backen
Die Welt in wiederherstellbarer Reichweite
Ein Versuch, Scham zu überwinden
Freunde spielen
Literatur
Für Tobias
Du denkst, das wird dir niemals passieren, das kann dir niemals passieren, du seist der einzige Mensch auf der Welt, dem nichts von alldem jemals passieren wird, und dann geht es los, und eins nach dem anderen passiert dir all das genauso, wie es jedem anderen passiert.
Paul Auster, Winterjournal
For tomorrow and its needs I do not pray;
Keep me, my God, from stain of sin,
Just for to-day.
S.M. X., To-Day
Ich werde bald einen Kuchen backen, mit der Blechherzform, die unsere Mutter für jeden unserer Geburtstage benutzte. Mein Vater wird nicht verstehen, was die 8 und die 0 auf dem Kuchen mit ihm zu tun haben. Vielleicht lade ich trotzdem Gäste ein. Er wird zwei Stücke oder drei verschlingen, die Augen schließen und »Mmh!« rufen. Wir werden frische Wäsche brauchen. An einem guten Tag wird er mit uns über den Kurfürstendamm bis zur Gedächtniskirche marschieren (»Findest du das nicht zynisch, mit deinem Vater zur Gedächtniskirche?«, fragt ein Freund). Ist sein AZ aber schlecht, liegt er im Bett, unbewegbar, als wäre es ein Experiment mit dem gelenklosen Körper, unerreichbar, die Stimme in den Kopf gerutscht, nur ein Wimmern, wenn ich ihn anfasse, die Unruhe in seinem Innern schlägt gegen die Hülle wie Magma.
AZ nennen sie im Pflegeprotokoll den Allgemeinzustand.
Ich hatte es mir anders vorgestellt.
Selbst als wir wussten, worum es ging, als die Leugnungsphase an Verteidigungskraft verlor, dachte ich nicht, dass ich meinen Vater bald in so extremen Situationen erleben würde, dass meine Kraft (von der es bisher nie zu wenig gab) kaum reichen sollte, mich zu beruhigen, mir Mut zuzusprechen, geschweige denn ihm. Zu erkennen, wann es an mir ist, zu handeln, und zu entscheiden, was zu tun ist.
Das hier schreibe ich nicht, um den Entwicklungen einen Sinn abzupressen, auch Geschehnisse, in die wir in Echtzeit keinen Sinn bringen, bleiben Geschehnisse; uns bleibt, zurechtzukommen. Ohne Goldrahmen um die Bilder zu legen, ohne Verklären und Romantisieren, doch ohne auch: uns als Opfer ungerechter Welt auszustellen / das Hadern.
Ohne Heldenstolz, ohne Rettergehabe, doch ohne auch: das Schuldgefühl, unterlassen zu haben, nicht hinzureichen. Wiewohl bald der eine, bald der andere Pol mit Kraft an uns zieht.
Schreiben ist Suche nach Zurechtkommen, das heißt für mich: meinem Vater anständig gegenübertreten. Dem Vertrauten nicht nachtrauern, wenn es gegangen ist. Dem Vertrauten an ihm, an mir, an den Dingen, an einer Welt, die sich so ändert, dass wir die alten Rezepte nicht anwenden können, weil Zutaten fehlen. Die Lücken füllen mit etwas, das trägt, für diesen Moment. Dann für den nächsten. Dann sehen wir weiter.
Das Licht ferner Sterne
Auf seinem Weg zu uns verändert das Licht der Sterne seine Farbe. Je ferner der Stern, desto stärker verschiebt sich sein Leuchten ins Rot. Diese Entdeckung Edwin Hubbles hat unsere Vorstellung vom Universum erschüttert: Wir müssen davon ausgehen, dass die Sterne vor uns fliehen. Je weiter weg sie schon sind, desto schneller treiben sie nach außen. Die Geschwindigkeit streckt ihre Lichtwellen, wie sich das Heulen der Polizeisirene verändert, wenn der Einsatzwagen an uns vorbeipeitscht. Lassen wir die Vergangenheit des Universums rückwärtslaufen, galoppieren die Galaxien aufeinander zu, je ferner, desto schneller, bis sie in einem Punkt zusammenfallen. Weil das Licht Reisezeit braucht, schauen wir in unsere Vergangenheit, wenn wir in den Himmel schauen. Jedes Morgen gibt ein Stück unseres Gestern preis, weitet in winzigen Schritten unseren Rückspiegelhorizont. Mit immer feineren Instrumenten versuchen wir zu erkennen, was war.
Dieser eine Moment aber, vor vermutlich 13,8 Milliarden Jahren, bildet die Grenze dessen, was wir sehen werden. Weiter kommen wir nicht, so sehnsüchtig wir auch wollen. Niemand hat eine Idee, wie wir hinter das Blendlicht des Urknalls schauen könnten.
Das Gefühl, das diese Erkenntnis in uns auslöst, muss das Gefühl sein, das meinen Vater jetzt immer öfter befällt.
Schreiben Sie nie, las ich einmal in einem Buch des Journalismusprofessors Jack Hart, jemand »begann etwas zu tun«. Schreiben Sie »er lachte« statt »er begann zu lachen«. Sonst verwischen Sie die Handlung.
Mein Vater aber verlor nicht seine Erinnerung, wie man einen Schlüssel verliert. Er begann eines Tages damit, sie zu verlieren.
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Berlin. Auch mein Vater befindet sich in einem Zimmer. Es ist wenige Straßen von meiner Wohnung entfernt, in der zweiten Etage eines Eckhauses. Wer vorbeigeht, mit dem Haus und seinen Bewohnern nichts zu tun hat, sieht den goldenen Baldachin und die fünf Sterne und denkt an ein feines Hotel. Nur wer genauer hinschaut oder hineingeht, bemerkt die warmleuchtende Schrift: »Pflegeresidenz«. Mein Bruder und ich nennen es »die Residenz«. Wir wissen, dass wir den Euphemismus brauchen, um die Wahrheit zu ertragen. In die »Residenz« ist unser Vater vor vier Monaten gezogen, im November, aus seinem Haus, in dem er über vier Jahrzehnte gewohnt hat, sieben Stunden Autofahrt entfernt. Es war ein gemeinsamer Entschluss, ein gemeinsamer Aufbruch.
Bei jeder Bewegung, die ich in meinem Zimmer vollziehe, muss ich daran denken, welche Körperhaltung mein Vater in seinem gerade eingenommen haben mag, was er macht, ob seine Augen zufrieden schauen oder ob sie getrieben Halt suchen im Raum und nicht finden. Beide Zustände wechseln sich ab. Seit er so nah bei mir wohnt, kann ich unsere Leben nicht voneinander trennen. Sie durchflimmern meinen Kopf in Parallelmontage, als Film, der zwischen uns, zwei ruhelosen Menschen, hin und her schneidet. War ich nachts unterwegs, fahre ich auf dem Heimweg mit dem Fahrrad unter seinem Fenster vorbei und schaue hinauf, oft sehe ich das Deckenlicht eingeschaltet, den Kleiderschrank offen. Dann male ich mir aus, welche Dramen sich abspielen; gut, dass in der Nacht nicht Besuchszeit ist.
Noch erkennt mich mein Vater. Aber ich merke, er entfernt sich von mir, wie man in einer Liebesbeziehung manchmal spürt, dass der Partner sich in seine Welt zurückzieht, sich trennen wird. Einen weggelaufenen Partner kann ich in der Zukunft treffen, um zu sprechen, um zu verstehen, was geschehen ist. Meinen Vater nicht. Ich kann nur versuchen, es im Alleingang zu begreifen.
Ich tue, was ich gelernt habe: Literatur befragen, mich sachkundig machen.
Wenn ich weiß, warum etwas geschieht, denke ich, kann ich das Geschehen beeinflussen.
Zunächst schien es mir sinnvoll, mich mit Erinnerung zu beschäftigen. Geht es bei der Demenz nicht um sie? Ich will verstehen, wie Erinnerung funktioniert und warum sie bei meinem Vater nicht funktioniert. Ich frage mich, was wir früher hätten wissen müssen, erkennen können. Ich brauche eine Ahnung davon, was in meinem Vater vorgeht und wie ich ihm am besten gegenübertrete, wenigstens eine Ahnung.
Wenn ich weiß, wie es anfing, denke ich, kann ich es anhalten.
Ich wäre ruhiger, wenn ich wüsste, wie es angefangen hat.
In meiner eigenen Erinnerung blitzen Antwortfetzen auf; fremde Schilderungen lösen Wiedererkennungsmomente aus. Jonathan Franzen spricht als Mitwisser zu mir, wenn er in seinem Essay »Das Gehirn meines Vaters« beschreibt, wie die Familie auffallend oft den Pannendienst rief, weil Papas Auto nicht ansprang. Auch uns erklärte der Mechaniker in immer kürzeren Abständen, welches Licht diesmal in die Einsamkeit der Garage gestrahlt hatte, bis die Batterie erschöpft war. Das ließ sich präzise rekonstruieren, die Bordelektronik zeichnete das Geschehen auf, an das meinem Vater die Erinnerung schon fehlte. Ich weiß auch noch, dass drinnen, in seinem Haus, die Wandleuchten neben dem Badezimmerspiegel die ersten waren, in die wir Energiesparlampen schraubten, weil mein Vater sie immer öfter nur noch einschaltete, nicht mehr aus.
Noch früher sehe ich mich auf einem Markt in Tel Aviv, zwischen Freunden und bunten Auslagen, der Name auf dem Display schreckte mich auf. Es war der Hausarzt meines Vaters, der mich im Urlaub anrief. Kein akuter Notfall, sagte er, ein Notfall aber doch; dass er mir ins Gewissen rede, könne er nicht länger aufschieben: Wir müssten uns etwas überlegen. Der Vater bewältige sein Leben nur noch, weil er es auf Zettel schreibe, an die er sich klammere, buchstäblich, mit den Fingern, getrieben von der beständig-schaurigen Angst, etwas zu vergessen, einen Fehler zu machen.
Was erlaubt sich der Doktor, dachte ich, er sollte besser die Blutwerte im Blick behalten, die nämlich hatten sich verschlechtert.
Noch entrüsteter war mein Vater selbst. Mal was vergessen – wer kenne das nicht, im Alter? Die Karte mit der Nummer des Neurologen, den der Hausarzt als »verständnisvoll« empfohlen hatte, legte er in eine Holzkiste. Schon damals war sein Haus, unser Familienhaus, in dem er inzwischen allein lebte, voller Kisten, und sie schienen sich mit inzestuöser Fruchtbarkeit zu vermehren. In den Kisten deponierte er Dinge, die er für wichtig hielt, mit denen er aber nichts Konkretes anzufangen wusste.
Nach und nach wurde das fast alles.
Ausrangierte Rasierköpfe, sorgfältig in Klarsichttüten verpackt und mit Datum versehen, lagerten ebenso darin wie die fettverschmierten Kassenzettel der Dorfmetzgerei, die die Preisentwicklung für Aufschnitt über die letzten Jahre belegten. Dazwischen Objekte, die offiziell als wichtig anzusehen waren: ein Ausweis, ein Geldschein, eine Rechnung und die Mahnungen, die auf ihre Nummer Bezug nahmen. Mein Bruder und ich durchforsteten bei jedem Besuch das Haus nach Kisten und die Kisten nach ihrem Inhalt: um die amtlichen Wichtigkeiten von den subjektiven Wertgegenständen unseres Vaters zu trennen, um sie sicherzustellen und den Gang des Alltags, so gut eben möglich, aufrecht zu halten.
Ständig entdeckten wir neue Verstecke.
Die Kisten – sind sie die Szenerie des Anfangs? Ich erinnere mich an die Wut, die mich befiel, wenn ich zu jener Zeit durch Baumärkte ging und die Kisten auf ihren Präsentierflächen sah: klein, mittel, groß und eine Zwischengröße für Unentschlossene. Besonders die Zwischengröße fuchste mich, weil sie meiner Meinung nach die Leute köderte, die gar keine Kiste brauchten.
»Die Kisten«, schrie ich einmal in der Küche des Vaters, »haben das Unheil über uns gebracht.«
Mein Vater staunte über meine Verzweiflung und meine Theorie. Er lachte.
Oder begann es mit dem Tag, der sich eindeutig im Kalender einkreisen lässt, sich als Wendepunkt aufdrängt? In jenem Moment, der unsere Familie umkippte und ihr zumutete, in reduzierter Besetzung wieder aufzustehen? Ein paar Jahre, bevor die Kisten in unser Haus zogen, an einem gute Laune machenden Sonnenmittwoch im Dezember 2004, verunglückte unsere Mutter. Sie war mit dem Auto losgefahren und kam nicht zurück. Front gegen Front war sie mit einem Lastkraftwagen zusammengestoßen, ihr Ford Fiesta unter seine Räder gequetscht. Ohne Ankündigung und ohne Adieu hatte sie uns von einer Sekunde auf die nächste verlassen. »Im Kühlschrank steht noch ihr Salat«, sagte mein Vater, »was soll ich damit jetzt machen?« In seiner Stimme die Monotonie, die eine Frage zur Klage macht.
Anders, als wir befürchtet hatten, fand unser Vater zunächst in den Alltag zurück. Es war wohl ein Aufbäumen gegen das Aufgeben, ein Präventivschlag gegen das Sichgehenlassen, wenn man nach dreißig Jahren Ehe mit einem Mal allein ist. Er war einundsechzig, es half, dass er noch in der Kanzlei arbeitete, mein jüngerer Bruder noch bei ihm wohnte. Als der ausgezogen war und unser Vater in den Ruhestand trat, nahm er seine Kräfte zusammen und bäumte sich ein zweites Mal auf. Er war siebenundsechzig, buchte Reisen, Kurse, Exkursionen. Er lernte sogar »das Internet«, schrieb mir zum ersten und einzigen Mal eine E-Mail. Doch die Dinge fielen ihm zunehmend schwer, körperliche Krankheiten des Alters kamen hinzu.
Von da an gab er sich mit immer weniger zufrieden. Stattdessen sagte er nun öfter, er sei alt.
»Du bist nicht alt«, entgegneten wir, noch blind, zählten Bekannte aus dem Dorf auf, die zehn Jahre älter waren und ein geselliges, geschäftiges Leben führten. »Nimm dir an denen ein Beispiel.«
Bis die Indizien dafür erdrückend wurden, dass mein Vater seine Erinnerung verliert, war Erinnerung für mich kein Thema. Sie existierte, funktionierte. Allenfalls schickte sie mir ein kurzes, zunickendes Lebenszeichen, weil sie besonders gut funktionierte. Mein Lateinlehrer am Gymnasium gestand meinen Eltern, er beneide mich um mein Gedächtnis. Sein eigenes, fehleranfälligeres habe ihn um eine akademische Laufbahn betrogen. Beim täglichen Vokabelabfragen sparte er mich fortan aus, mit der Folge, dass ich für den Unterricht nichts mehr lernte; vor den Klassenarbeiten musste ich alles nachholen. Später studierte ich Jura, wie mein Vater. Der Prüfungsstoff im Staatsexamen ist unüberschaubar; wie man beim Bäcker einen Kaufvertrag über ein Brot schließt, gehört dazu ebenso wie die Regeln, nach denen das Bundesverfassungsgericht über eine Anklage gegen den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes entscheidet.
Die Psychologie spricht vom »semantischen Gedächtnis«, das solche Dinge behält. Es speichert Informationen zum Abruf, abstrakt, ohne Kontext.
Das semantische Gedächtnis meines Vaters beeindruckt mich bis heute. Er wusste immer viel, und vieles davon ist noch da. Regelmäßig spiele ich mit ihm Wer wird Millionär? Es ist eine Sendung, die er mag. Ich habe einen Fragenfundus angeschafft, lese Karte um Karte vor, und wir lösen gemeinsam. »Wie heißt der Knabe, dem Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf schießt?« Während ich überlege, ob ihn meine Stimme erreicht, weil er teilnahmslos in den Sessel gesunken scheint, sagt mein Vater in den Luftraum vor sich: »Walter.« Säße er in der Sendung, hätte er damit die Million gewonnen.
Sitzt er aber nicht.
Das semantische Gedächtnis hält meinem Vater, wie es scheint, am längsten die Treue, dabei könnte er auf seine Dienste am ehesten verzichten. Wichtiger, um durch den Tag, durch die Nacht zu kommen, ist das »prozedurale Gedächtnis«. Es speichert Bewegungen, Handlungsabläufe: Fahrrad fahren, tanzen, laufen. Es lässt meinen Vater immer öfter im Stich; zumindest kann er, was davon noch da ist, nicht mehr gut nutzen. Er steht vor seiner Zimmertür und weiß nicht, wie man die Klinke bedient. Er betrachtet das Bild, das seine Enkelin, meine Nichte, gemalt hat, es zeigt ihn und sie, zeigt uns alle, wir haben es an seine Tür gehängt, damit er sie findet. Laut liest er den Namen auf dem Schild vor, sagt: »Das bin ich.« Doch wie man die Tür öffnet, weiß er nicht. Es erstaunt und verunsichert ihn, wenn er erfährt, dass alles hinter dieser Tür sein Reich ist, sein Reich allein: sein Bett, sein Fernseher, sein Teppich, seine Stehlampe, seine Bilder, sein Badezimmer.
»Wo schläfst du?«, fragt er mich. »Und wo kann ich schlafen?«
Dass sein Sinn für die einfachen Alltagsverrichtungen weg ist, nicht mehr da, hat mich am meisten überrascht und mit einer Wucht, die ich nicht vorgeahnt hatte, von hinten getroffen. Ich hatte gedacht, Demenz heißt, ein paar Dinge zu vergessen, Namen, Gesichter, was es zu essen gab, Anekdoten aus dem Leben; traurig, aber auch liebenswert, der Alltag lässt sich schon meistern (wollen wir nicht alle in der Gegenwart leben und nicht in der Vergangenheit?). Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass mein Vater einmal lebenswichtige Handlungsschritte nicht mehr würde ausführen können; einen Löffel zum Mund bringen, sich auf sein Bett legen, den Kopf drehen und jemanden anschauen: All das macht ihm Probleme, und es liegt nicht daran, dass die Mechanik seines Körpers versagt. Die Muskeln tun ihren Dienst und die Knochen und die Gelenke; es liegt daran, dass der Kopf das Konzept nicht findet.
Mein Vater und ich sehen uns alle ein, zwei Tage. Doch gestern haben sie mich weggeschickt. Ein Virusausbruch auf seiner Etage muss erst geklärt werden. In der Spätphase der Pandemie erscheint mancher Schreck gemildert; mich traf er voll. Am Vorabend hatte ich meinen Vater in schlechter Verfassung zurücklassen müssen, apathisch saß er im Stuhl, konnte nicht mehr den Kuchen essen, den er liebt. Nun das Kontaktverbot. Es war eingetreten, wovor ich mich gefürchtet hatte. Ich taumelte vom Empfang zurück auf die Straße; draußen, im Frost, vergrub ich mein Gesicht im Fahrradhelm, schluchzte hinein. »Es tut mir so leid«, sagte die Apothekerin, die Medikamente brachte, alles mitbekommen hatte.
Zurück in meiner Wohnung, fühle ich mich elend, schäbig, als hätte ich meinen Vater in hilfloser Lage im Stich gelassen. So muss er es empfinden, und dafür schäme ich mich vor ihm. »Wenn du hier bist, habe ich weniger Probleme«, hat er mir einmal gesagt. Ich stürme wieder nach draußen, gehe laufen im Park, nehme das Springseil mit, kehre zurück und sitze lange auf dem Bänkchen hinter der Wohnungstür, bis ich die Jacke, die Schuhe ausziehe. Ich betrachte den Zettel, den ich vor einiger Zeit bei meinem Vater gefunden habe, nachdem ich einmal einen Tag nicht kommen konnte. Mehrfach hat er angesetzt, lange muss er gebraucht haben, bis ihm zwei Sätze gelangen:
Volker Kitz wird aus Irrtum festgehalten. Bitte ändern.
Ich bin nicht allein. Die Sorge um die Eltern erfasst meine Generation. Wir sind die Generation X, zurzeit die größte in Deutschland, wir sind fast siebzehn Millionen. Unsere Eltern werden alt. »Kommen sie noch zurecht?«, fragen wir uns gegenseitig. Erzähle ich von meinem Vater, schauen andere getroffen, grübelnd. Freunde, Bekannte kehren vom Elternbesuch zurück mit einer aufwühlenden Ahnung: dass es »zu Hause« nicht mehr wie früher ist. Dass die Dinge funktionieren, aber nicht mehr lange. Dass sich etwas ändern muss. Bei einigen Müttern, Vätern wachsen Zeichen einer Demenz, wie Knospen, über die man hinwegsehen möchte, von denen man nicht weiß, was sie zeigen, wenn sie aufbrechen. 1,8 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland, über 1.200 kommen jeden Tag dazu. Bei anderen sind es andere Krankheiten, die Fähigkeiten schwinden lassen, das Denken, das Laufen, das Lieben. Oder es ist »nur das Alter«. Das klingt beruhigend normal, doch bedeutet auch das den Eintritt in eine Zeit der Ungeahntheiten, in der sich Verantwortung verschiebt.
Nach dem Anfang, scheint mir, suchen viele.
Wir, die Kinder, machen scharenweise ähnliche Erfahrungen, während unsere Eltern alt werden: Zeichen erkennen, deuten, sich eingestehen. Konsequenzen aushandeln. Liebe und Streit; Verwandlungen verarbeiten. Bangen. Abschied nehmen. Sie betreffen nicht nur die Eltern, sondern auch uns, im Kern unserer Lebensgestaltung. Die schwindende Selbstbestimmung der Eltern greift auch unsere Selbstbestimmung an, ein Gut, das unserer Generation so unentbehrlich scheint.
Ich mache die Erfahrung nur zur Hälfte. Alt wird nur mein Vater. »Ich werde über hundert«, hat meine Mutter gesagt. Sie hat sich geirrt. Oft frage ich mich, wer es besser hat oder hatte, die Mutter oder der Vater. Die Frage ist Theorie. Sie hält mich von den Dringlichkeiten der Wirklichkeit ab, um die ich mich zu kümmern habe.
»Kümmern« ist jetzt ein Wort unserer Generation.
In meinem Arbeitszimmer laufe ich im Kreis und stelle mir vor, wie es mein Vater in seinem Zimmer genauso macht. Ich betrachte das Foto meiner Mutter. Ich schicke ihr Stoßgebete. Ich bitte sie, nicht ernst zu nehmen, dass sie ihm Treue nur bis zum Tod versprochen hat, bitte sie, auch über ihren Tod hinaus bei ihm zu sein, seine Hilflosigkeit zu lindern, wenigstens bis ich wiederkomme.
Bitte ändern.
Ich werde mich an diesen Tag im nächsten Jahr noch erinnern. Er wird in mein »episodisches Gedächtnis« eingehen. Es speichert Szenen unseres Lebens.
Mein Vater wird nächste Woche mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass ich mich gesorgt habe. Er wird sich nicht daran erinnern, wie er den Tag verbracht hat, ob er sich unbeschwert fühlte oder verzweifelt war, ob ich bei ihm war oder er mich vermisst hat. Auf meine Frage »Hast du zu Mittag gegessen?« wird er erst nicht reagieren, dann wird er sie vorsichtshalber verneinen. Er weiß die Antwort nicht, hat aber immer Appetit.
Seine Demenz durchkreuzt die Arbeit des Hippocampus, des Gehirnstücks, das seiner Form wegen Seepferdchen heißt. Das Seepferdchen arbeitet als Verzeichnisdienst, es legt Erinnerungen im semantischen und episodischen Gedächtnis an. Deshalb hat mein Vater Zugriff auf weit zurückliegende Inhalte, bildet aber keine Erinnerung mehr an das, was heute geschieht, was er gerade eben getan, was ihm vor wenigen Minuten jemand erklärt hat.
Im Leben meines Vaters, so stelle ich mir vor, gibt es alle paar Minuten einen Urknall. Immer wieder. Er kann nicht weiter zurückschauen als diese paar Minuten, und der Raum dahinter ist leer.
Ich wäre ruhiger, wenn ich wüsste, wie es angefangen hat.
Jede Krankheit bricht irgendwann aus. »Ausbruch« lässt an Krieg oder Vulkane denken, an ein für Chronisten geeignetes Format. Doch der Ausbruch der Demenz gilt als »heimtückisch«. Heimtücke ist ein Merkmal aus dem Mordparagrafen. Es bedeutet, dass das Opfer dem Täter wehrlos gegenübersteht, weil es arglos ist, weil es den Angriff zu spät bemerkt.
Die Krankheit, die Erinnerung zerstört, tarnt sich im Erinnerungsschleier. In Arno Geigers Schilderung Der alte König in seinem Exil habe ich mir Stellen angestrichen, an denen die Familie sich damit tröstet, der Vater habe immer seine Eigentümlichkeiten gehabt, im Alter verstärkten sie sich eben. So haben auch wir geredet. Die sozialen Kontakte gingen zurück? Der Vater hatte nie viele. Sein Interesse an der Welt nahm ab? Fußball schaut er doch noch! Dafür unternahm er sogar erstaunlich ergiebige Erkundungsreisen durch Programmzeitschriften, durch hundertvierzehn Fernsehkanäle. Er will seine Jacke jetzt gar nicht mehr ausziehen, weil das »einfacher« ist? Er war schon immer gegen »unnötigen Aufwand«. Wie Arno Geiger befällt mich heute »ein stiller Zorn über diese Vergeudung von Kräften«, darüber, wie wir augenverdrehend »wie immer« dachten, ohne zu merken, dass es längst nicht mehr genauso wie immer war.
Hat mein Vater den Ausbruch als heimtückisch empfunden wie wir? Oder spürte er, wie das Wasser stieg, redete bloß mit niemandem darüber, machte seine Ängste und Qualen mit sich aus? Nur manchmal, ich verorte es in der späten Anfangsphase, wenn er zum Beispiel den Inhalt eines Telefonats wiedergeben wollte, bekannte er bestürzt: »Ich bringe es nicht zusammen.« Dann sah er mir ins Gesicht und sagte: »Ist das nicht traurig?« Wahrscheinlich war das sein Versuch, über das Geschehende mit mir in Kontakt zu treten, und wahrscheinlich meinte ich es gut und machte es schlecht, wenn ich ihn mit der Lüge zu beruhigen versuchte, das gehe uns allen so.
Wenn ich ehrlich bin, sorge ich mich bei der Frage nach dem Anfang nicht nur um meinen Vater. Ich habe auch Angst um mich selbst. Fällt mir ein Name nicht ein, was zunehmend vorkommt, fragt mich die Stimme: Hat es angefangen? Ich überlege, was ich tun kann, um es abzuwenden. Ich komme mir vor wie jemand, der in der U-Bahn hastig eine Münze in den Fahrkartenautomaten wirft, obwohl ihn der Kontrolleur längst gesehen hat.
Auch mit dieser Angst bin ich nicht allein. Die Schriftstellerin und Neurowissenschaftlerin Lisa Genova ist mit Still Alice bekannt geworden, einem Roman über eine Harvardprofessorin, die gegen ihre Alzheimerkrankheit kämpft. Genova berichtet, wie sie nach öffentlichen Auftritten von Menschen eingekesselt wird, die sich sorgen. Um Angehörige. Meist aber um sich selbst.
In Deutschland gibt es eine Studie mit dem hässlichen Namen Angst vor Krankheiten. Sie ermittelt die Rangfolge der »am meisten gefürchteten«. Auf Platz zwei, gleich nach Krebs, kommt die Demenz. 49 Prozent der Männer und 58 Prozent der Frauen ängstigten sich im November 2021 davor, ihre Erinnerung zu verlieren. Selbst unter den 14- bis 29-Jährigen war es jeder Zweite.
Die Angst vor Demenz ist keine Angst, zu vergessen, was es zum Mittagessen gab. Es ist die Angst, sich selbst zu vergessen. Prognosen rechnen aus, dass sich mit steigender Lebenserwartung die Zahl der Demenzdiagnosen alle zwanzig Jahre verdoppelt, dass sie im Jahr 2050 weltweit bei 153 Millionen liegen wird. Dann bin ich nicht einmal so alt wie mein Vater heute. Werde ich dazugehören?
Ich wäre ruhiger, wenn ich wüsste, wie es angefangen hat.
Meine Suche nach dem Anfang ist der Versuch, Kontrolle zu gewinnen. Zurückzugewinnen, rede ich mir ein, als hätte ich sie gehabt. Ich flüchte mich in die Lektüre über Erinnerung; gerade die Erinnerung, lese ich, soll uns Überleben sichern, Orientierung geben. Deshalb erinnern sich wohl alle Lebewesen in irgendeiner Form. Der Nobelpreisträger Eric Kandel machte schon in den 1960er-Jahren sichtbar, wie die Meeresschnecke Aplysia californica ihre synaptische Architektur verändert, wenn man sie wiederholt an den Kiemen berührt. So kann sie ihre Reaktion anpassen und sich schützen.
Wir Menschen aber nutzen Erinnerung vermutlich auf einzigartige Weise. Davon geht der Soziologe Harald Welzer aus. Er betrachtet die Fähigkeit als »humanspezifisch«, mithilfe der Erinnerung »die eigene Existenz in einem Raum-Zeit-Kontinuum zu situieren«. Um uns zu orientieren, greifen wir nicht nur auf eigene Erinnerungen zurück. Lücken in unserem Gedächtnis füllen wir mit Informationen, die wir woanders beschaffen. Wie mit Greifarmen fassen wir, was wir bekommen können, hier einen Brocken, dort einen, führen verschiedene Aufzeichnungsformate in ein Mosaik zusammen, auf dem wir zu erkennen versuchen, wer wir sind, wo wir sind, wann wir sind. Wir nutzen Erinnerung zur Standortbestimmung, um in Raum und Zeit nicht verloren zu gehen. Nicht unterzugehen.
Ich versuche, meine Bruchstücke zusammenzutragen. Ich kann mich nicht erinnern, das Wort »Demenz« früher, als ich Kind war, gehört zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, »Kommen sie noch zurecht?« in den Gesprächen der Erwachsenen über ihre Eltern gehört zu haben. Denke ich zurück, sehe ich die älteren Menschen in unseren Dörfern, Urgroßmütter, Großväter, Tanten, auf Eckbänken, die Familien um sie geschart. Sie trugen selten zum Gespräch bei, und wenn, war es unverständlich. Das entsprach der Erwartung, fiel nicht auf; Oma ist verkalkt, warf jemand ein und lachte.
Im Nachbarort besuchten wir regelmäßig eine Großtante meiner Mutter, die alle »Tante Bettchen« nannten. Als Kind dachte ich, der Name sei entstanden, weil sie nur im Bett lag. Später erklärte mir meine Mutter, »Bettchen« komme von Elisabeth. Mein Bruder und ich saßen mit unserer Mutter in Elisabeths Zimmer, ab und zu öffnete sich die Tür, eine der anderen »Tanten« aus dem Haus steckte den Kopf herein und uns Schokolade zu. Ich meine mich zu erinnern, dass die Dame im Bett angeregt mit unserer Mutter sprach, fein formulierte. Sie war nicht »verkalkt«. Sie war anders krank oder »nur alt« und brauchte Hilfe. Ihr Anblick ist eines der starken Bilder, die in meine Kindheitserinnerung ein Idyll projizieren: Dass in jedem Dorfhaus wenigstens ein Familienmitglied umstandslos dazugehörte, das nicht allein zurechtkam. In jedem dieser Mehrgenerationenhaushalte war es meist eine Frau, die stillschweigend dafür sorgte, dass es »umstandslos« blieb.
Heute ist das nicht mehr so, auch nicht in meinem Heimatdorf. Die Eltern meiner Freunde bewohnen ihre Häuser allein. Zimmer stehen leer. Kinder sind, wie ich, ausgezogen. Wohnen sie noch in der Gegend, kommen sie mit Enkeln zum Kaffee, mehr nicht. Das dörfliche Mehrgenerationenhaus mit Eckbank ist ein Entwurf aus vergangenen Tagen.
Und wir, die Kinder, stehen jetzt in der ersten Reihe. Es gibt keine Puffergeneration mehr, die uns erlaubt, das Altwerden aus passiver Ferne zu beobachten, wie wir es bei unseren Großeltern konnten.
Wir sind in eine Zeit geraten, in der es schwierig geworden ist, Kontrolle zu spüren. Die Kontrolle, die unserer Generation so wichtig ist. Ungewissheit durchdringt unsere Leben wie das Wurzelnetz eines Waldes. Alles wackelt.