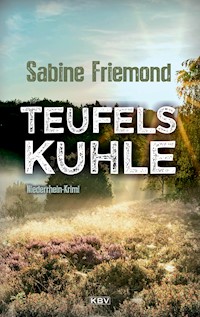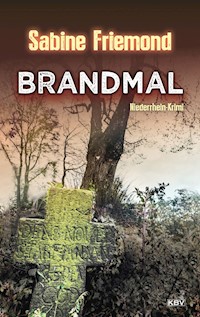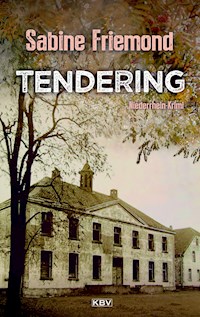12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Christin Erlenbeck
- Sprache: Deutsch
Zurück in die 80er Am Sonntagmorgen liegt ein Toter auf einem Grab des evangelischen Friedhofs in Voerde. Jörg Keller wurde durch zahlreiche Messerstiche getötet. Er war gebürtiger Voerder und betrieb in Berlin eine Werbeagentur, doch hinter der unscheinbaren Fassade lauern Abgründe: eine kriselnde Ehe, finanzielle Probleme, Kontakte in zwielichtige Kreise ... Kurz darauf wird ein weiterer Toter gefunden, einer der engsten Jugendfreunde Kellers. Ebenso wie dieser war auch er am Vorabend Gast einer Revival-Party in der Stockumer Schule, einem Jugendtreff vergangener Zeiten. Während Hauptkommissarin Skalecki den Spuren in die Achtziger folgt, stößt die neugierige Christin Erlenbeck auf eine alte Schuld, die offenbar nie gesühnt wurde. Dass Kellers Leiche ausgerechnet an der letzten Ruhestätte eines behinderten Jungen gefunden wurde, der einst den Nazis zum Opfer fiel, kann für die Pfarrerin kein Zufall sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine Friemond
Alte Schule
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Hochbahn
Teufelskuhle
Tendering
Brandmal
Hitzewelle
Schwesterlein
Sabine Friemond, geb. 1968 in Duisburg, wuchs in der Gemeinde Spellen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Ihre Liebe zu Büchern ist bereits daran ersichtlich, dass sie am Niederrhein eine Buchhandlung in Voerde betreibt. Ihre Heldin Pastorin Christin Erlenbeck ermittelt bereits in ihrem siebten Fall.
Sabine Friemond
Alte Schule
Kriminalroman
Originalausgabe
© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH
Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
[email protected] · www.kbv-verlag.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere
Herstellung: [email protected] · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-746-9 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-757-5 (eBook)
INHALT
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
Danksagung
In Erinnerung an die Menschen, die einmal Teil unseres Lebens waren
Rolf Dickmann war eine real existierende Person.
Trotz seiner Einschränkung überlebte er die Zeit des Dritten Reiches und wurde einundsiebzig Jahre alt. Er ist auf dem Friedhof der evangelischen Gemeinde Voerde-Grünstraße beerdigt. Ich danke Ralf Dickmann, dass ich das Schicksal seines Onkels zu einem teils fiktiven Bestandteil meines Krimis machen durfte.
Prolog
September 2024
Es war lange her, dass er so betrunken gewesen war. Ihm war übel, die Musik dröhnte noch in seinen Ohren, rauschte mal lauter, mal leiser wie ein Karussell durch seinen Schädel.
Kurz blieb er stehen und überlegte, sich einen Finger in den Hals zu stecken, um wenigstens einen Teil des Alkohols wieder loszuwerden. Aber dann, dachte er, würde er vollends zusammenbrechen und vielleicht nicht mehr hochkommen. Außerdem ekelte ihn der Gedanke ans Erbrechen. Vielleicht würde die kühle Luft helfen.
Wohin wollte er eigentlich? Ach ja – nach Hause.
Zu dem Haus, in dem er groß geworden war, in dem noch seine Mutter lebte. Ob sie auf ihn wartete? So wie früher, wenn er mehr Abende in der Stockumer Schule verbracht hatte als daheim? Ihr vorwurfsvoller Blick fiel ihm ein, der mahnend erhobene Zeigefinger an den Lippen – bloß nicht den Papa wecken. Der Ärger mit ihm, Wilfried, kam dann ohnehin am nächsten Morgen. Rückblickend bestand seine Jugend aus nichts als Auseinandersetzungen mit ihm. Und mit dem damals schon spießigen Bruder sowieso.
Irgendwie musste er zur Frankfurter Straße gelangen. Bald musste es doch nach rechts gehen? Er stolperte, die Knie gaben nach, doch er fing sich wieder. Rechts – ja, da war die Grünstraße. Sie zog sich endlos. Schon mit dem Auto konnte einem in ihren Kurven übel werden. Früher, als er gerade seinen Führerschein hatte, hatte er sich einen Spaß daraus gemacht, diese paar Kurven so schnell wie möglich zu fahren, aber jetzt – alleine bei dem Gedanken daran – stieg ihm sein Mageninhalt die Speiseröhre hoch. Er atmete flach und ruhig, um seinen Magen zu beruhigen. Nicht jetzt, nicht hier. Bitte erst zu Hause, im Badezimmer.
Er versuchte, sich zusammenzureißen und etwas schneller zu gehen. Für einen Moment schloss er die Augen, aber das ging gar nicht. Als er sie wieder öffnete, taumelte er erneut. Wo war er jetzt? Alles drehte sich um ihn, in ihm, und als das Bild wieder klarer wurde, sah er rechts einen Platz. Ein großes, weißes Haus. Die Kirche, dachte er triumphierend. Wenn er jetzt hinter der Kirche den Weg hinuntergehen würde, käme er auf die Frankfurter, und dann würde er auf jeden Fall nach Hause finden.
Ein schiefes Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, und mit schnelleren und, wie er meinte, sichereren Schritten ging er über den kleinen Parkplatz.
Bis auf das Gezwitscher der Vögel, die mit dem Aufgehen der Sonne immer lauter wurden, war die Welt um ihn herum still. Er steuerte die langen flachen Stufen, die hinunter zur Frankfurter Straße führten, an, stand aber plötzlich auf dem Friedhof, der hinter der kleinen Kirche lag. Versuchte, sich wieder zu konzentrieren. Er hob seinen Kopf – und schaute mit verschwommenem Blick direkt in die Augen einer anderen Person.
Wie peinlich, dachte er, hoffentlich nicht die Pfarrerin.
Die Person sprach ihn an, aber er verstand kein Wort. Er nahm nur ein verzerrtes Lächeln wahr. Oder fletschte sie die Zähne? Wieder redete sie auf ihn ein. Weißt du noch … weißt du eigentlich … das Leben verändert …
Doch das Dröhnen in seinem Kopf war zu laut, er schaffte es nur, seine Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen zu verziehen.
1. Kapitel
Christin schlug die Augen auf.
Irgendetwas hatte sie geweckt. Sie lauschte in das diffuse, warme Licht des beginnenden Tages hinein. War eines der Kinder schon aufgestanden? Oder Freddie? Träge schob sie ihren Arm auf seine Hälfte des Bettes. Ihre Finger ertasteten den schweißwarmen Rücken ihres Mannes, der ruhig und gleichmäßig atmend neben ihr lag. Fast war sie versucht, ihre Hand weiter über seine Hüften wandern zu lassen, aber nein, sie gönnte ihm seinen tiefen Schlaf.
Sie lauschte wieder. Auch auf dem Flur hörte sie keine Schritte, das Pfarrhaus und seine Bewohner – außer sie selbst – schienen noch zu schlafen.
Christin blinzelte. Durch die Vorhänge konnte sie das erste Morgenlicht sehen. Sie überlegte, schon aufzustehen, aber ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass es erst fünf Uhr morgens war. Nein, das war zu früh. Sie beschloss, noch etwas zu schlafen, ihre innere Uhr würde sie in etwa einer Stunde wecken.
Trotz aller Bemühungen fand sie nicht wieder in den Schlaf zurück. Sie versuchte, still zu liegen und gleichmäßig zu atmen, aber ihre Gedanken kreisten um die Frage, was sie geweckt hatte. Was natürlich völliger Quatsch war. Es könnte alles gewesen sein, eine Autotür, die zugeschlagen worden war, der Schrei einer Katze – irgendein ganz normales Geräusch, das ihr aber heute Morgen den Schlaf raubte.
Christin seufzte. Also gut, dann konnte sie auch aufstehen. Es war Sonntagmorgen, um zehn Uhr würde sie den Gottesdienst halten. Jetzt hellwach, richtete sie sich auf und schlug die Bettdecke zurück. Ein Frösteln lief ihr über die Haut. Der Sommer war unmerklich in den Herbst übergegangen, die warme Sommerluft den kühleren Temperaturen gewichen. Sie zog sich eine warme Freizeithose an, dazu einen gefütterten Sweater und dicke Socken, dann schlich sie aus dem Schlafzimmer. Vorsichtig öffnete sie einen kleinen Spalt breit die Türen zu Mathildas und Oskars Jugendzimmern und guckte hinein. Beide schliefen tief und fest, sie waren nicht die Ursache des Geräusches gewesen. Auch Flora lag zwar völlig verdreht, aber ansonsten ganz ruhig in ihrem Bett.
Christin ging die Treppe hinunter und aus dem Haus heraus. Mit nur wenigen Schritten hatte sie den Hof überquert und gelangte in »ihre« Kirche. Sie ging auf die Knie, dann legte sie sich bäuchlings auf die kalten Steinfliesen vor dem Altar. Sie blendete alle Gedanken, die sie mit ihrem profanen Alltag verbanden, aus und versenkte sich in das stumme Zwiegespräch, das sie mit ihrem Gott führte.
Mein Gott. Lass auch diesen Tag wieder erfüllt sein. Gib mir auch heute die Kraft, meinen Aufgaben gerecht zu werden. Bitte gib uns Frieden.
Später am Tag würde sie sich wundern, dass sie nichts gespürt hatte. Müsste man, konkret sie, als Pfarrerin, als Gläubige, es nicht spüren, wenn nur wenige Meter von einem entfernt ein Mensch stirbt? Und das auch noch auf so brutale Weise?
Nach ihrem Morgengebet war sie zurück ins Haus gegangen, hatte sich und Freddie einen Kaffee gekocht, den sie ihm ans Bett gebracht hatte, war dann selbst noch einmal unter die Bettdecke geschlüpft und hatte so, gemütlich und in aller Ruhe, mit ihrem Ehemann den Tag begonnen. Später war noch Flora in ihr Bett gehüpft und hatte sich mit ihrem Vater eine wilde Kissenschlacht geliefert. Zufrieden, nein sogar glücklich war sie dann in die Küche gegangen und hatte das Frühstück vorbereitet. Dabei der Spaziergängerin, die oft mit ihrem Hund am Pfarrhaus vorbeiging, um den Stufenweg zur Frankfurter Straße hinunter zu nehmen, durch das Fenster zugewunken.
Nur Sekunden später wurden die Normalität und Ruhe des Sonntagmorgens zum Stillstand gebracht wie ein laut plärrendes Radio, dem man den Stecker zog. Ein gellender Schrei ließ die Pfarrerin erstarren. Sie beugte sich vor, schaute durch das Fenster, um herauszufinden, woher der Schrei kam. In diesem Moment sah sie die ansonsten immer so ruhig und gelassen wirkende Hundebesitzerin mit weit aufgerissenen Augen und wild fuchtelnden Armen zum Pfarrhaus rennen.
2. Kapitel
Es war so einfach gewesen!
Nichts, aber auch gar nichts, hatte auf diese völlig überraschende Begegnung hingewiesen. Eigentlich bin ich ein sehr sensibler Mensch, und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass ich kommende, wichtige Veränderungen schon spüre, bevor sie überhaupt ihre Auswirkungen zeigen.
Ich hatte schon länger nicht mehr an ihn gedacht.
An ihn und seine Freunde.
Und plötzlich stand er vor mir.
Zuerst hatte ich ihn gar nicht erkannt. Er sah ein bisschen wie ein heruntergekommener, knautschig gealterter Schauspieler aus, der seine erfolgreichsten Tage schon länger hinter sich hatte. Und gestunken hat er. Er war blau wie eine Haubitze, daran gab es keinen Zweifel.
Dann dieses Grinsen. Noch genauso schief wie früher, aber nicht mehr so einnehmend. Trotzdem kam alles wieder hoch, alles, was ich mit ihm verband – und ein anderes Ich übernahm mein Handeln.
Der Stoß war erst der wunderbare Anfang gewesen.
Plötzlich hatte ich das Messer in der Hand. Ich weiß immer noch nicht, warum, ich bin kein gewaltbereiter Mensch, eher im Gegenteil, ich verabscheue Gewalt. Auf jeden Fall war es auf einmal da, und wenn der feste Stoß, der ihn hatte zurücktaumeln und hinfallen lassen, mir schon eine unglaubliche Befriedigung verschafft hatte, waren die Stiche, die ich ihm mit dem Messer versetzte, wie eine Erlösung.
Ich prägte mir das Bild, das sich mir bot, genau ein.
Davon würde ich sehr lange zehren.
3. Kapitel
Christin hastete zur Haustür, öffnete sie und rannte der schreienden Frau entgegen.
»Mein Gott!«, rief Christin. »Was ist los?«
Sie warf einen suchenden Blick hinter die Frau, vermutete, dass dem Hund vielleicht etwas passiert war, aber nein, dieser stemmte sich nur in die Leine, als ob er so viel Abstand wie möglich zu seiner aufgeregten Halterin herstellen wollte – oder etwas sehr Interessantes witterte.
»Rufen Sie einen Krankenwagen«, brachte die Frau hervor, »da liegt jemand!« Wieder stieß sie einen Schrei aus, der zu einem Schluchzen wurde.
Ihr ist klar geworden, dass weitere Hysterie und Hektik keinen Sinn mehr haben, dachte Christin, und eine böse Vorahnung beschlich sie, während sie ins Haus zurückrannte. Sie dachte an das Geräusch, das sie vor ungefähr drei Stunden geweckt hatte.
»Freddie!«, schrie sie dann, jetzt auch voller Panik. »Bitte komm sofort her!«
Ihr Mann erschien fast umgehend an der Treppe. Er schnappte nach Luft, als er den Gesichtsausdruck seiner Frau sah. Er rannte die Treppe hinunter, Christin reichte ihm schon eine Jacke. Gemeinsam stürmten sie aus der Haustür und liefen in die Richtung, die die Frau mit dem Hund ihnen zeigte. Zum Friedhof.
Zuerst sahen sie nichts. Die Sonne war schon aufgegangen, warf jedoch noch lange Schatten. Überall funkelten die Tautropfen auf den Spinnennetzen, die scheinbar tausendfach den kleinen Friedhof der evangelischen Gemeinde Voerde überzogen hatten. Dann sahen sie es gleichzeitig. Hinter einem dichten Strauch, der zwei Grabstätten voneinander trennte, ragten Beine hervor.
»Du bleibst erst einmal hier«, sagte Freddie zu seiner Frau, aber schon im gleichen Moment wusste er, wie sinnlos diese Aufforderung war.
Mit wenigen Schritten hatten sie die liegende Person erreicht, und als sie vor dem Mann standen, der hingestreckt auf einem der Gräber lag, war ihnen klar, dass jede Hilfe zu spät kam.
Noch nicht einmal eine halbe Stunde später beobachtete Christin fassungslos, wie die Polizeioberkommissarinnen Elif Çelik und Katja Weber die Zugänge zum Kirchhof routiniert mit Absperrband blockierten. Dabei verscheuchten sie energisch und so freundlich wie möglich neugierige Passanten, die schon ihre Hälse reckten.
Sie selbst hatte Mathilda, Oskar und Flora zurück ins Haus geschickt und ihnen eingeschärft, auf keinen Fall herauszukommen. Natürlich hatte Oskar gemault, aber Freddie hatte ihm eine klare Ansage gemacht, die seinen Ziehsohn sofort verstummen ließ.
»Oskar, auf dem Friedhof liegt ein toter Mann, und du weißt genau, dass der Friedhof, der Parkplatz und die Zugänge dazu jetzt wie ein …« Er hatte gezögert – er wusste ja selbst noch nicht genau, was dies nun für ein Ort war –, aber er ging erst einmal davon aus, dass der Mann auch auf diesem Grab zu Tode gekommen war. »… Tatort behandelt werden«, fuhr er fort, »bis wir wissen, was passiert ist. Ich weiß, dass du mit dem Anblick eines Toten umgehen kannst, aber die Spurensicherung muss erst ihre Arbeit machen.«
Oskars Augen hatten sich geweitet, aber er hatte genickt.
Freddie hatte genau gewusst, dass er mit dem Wort »Spurensicherung« dem Jungen schon verraten hatte, dass es sich eventuell um einen Mord handelte, aber er hatte gehofft, dem aufgedrehten Teenager so den Ernst der Lage klargemacht zu haben.
Dann hatte sich Freddie auch an Mathilda gewandt. »Ich verbiete euch auch ausdrücklich, irgendetwas dazu zu schreiben. Weder in Facebook, bei Insta, TikTok oder so noch euren Freundinnen und Freunden über WhatsApp. Ihr wisst beide, wie wichtig es ist, dass unser Team erst einmal ungestört seine Arbeit machen kann.«
Die Kinder erlebten Freddie selten so resolut. Er war meistens geduldiger als ihre Mutter Christin, und es gab – die Erziehungsmaßnahmen betreffend – natürlich auch immer eine kleine Distanz, da Mathilda und Oskar nicht seine leiblichen Kinder waren. Aber wenn Freddie etwas durchsetzen wollte, tat er dies fast noch strikter als seine Frau.
Mathilda und Oskar hatten genickt, »geht klar« gemurmelt und sich an den Küchentisch gesetzt, ihre kleine Schwester Flora in die Mitte nehmend.
Christin setzte sich neben die Hundebesitzerin auf eine Bank, die vor dem Pfarrhaus stand, und drückte immer wieder tröstend die Hand der Frau. Der Hund hatte sich letztendlich zu ihren Füßen niedergelassen.
Fassungslosigkeit beschrieb Pfarrerin Christin Erlenbecks Zustand am besten. Freddie hatte ihr bisher nichts weiter berichtet.
Vorsichtig war er um das Grab herumgegangen. Ein Arm des Toten lag über seinem Kopf, wie hochgereckt, als ob er sich noch im Tod gemeldet hätte, um etwas Wichtiges zu sagen. Freddie hatte seine Finger auf das entblößte Handgelenk gelegt. Aber dieses Suchen nach einem Puls, der noch Leben in dem reglosen Körper verraten hätte, war mehr seinem Pflichtbewusstsein geschuldet als der Hoffnung, tatsächlich noch ein Lebenszeichen zu spüren.
Dann hatte er sich aufgerichtet. »Hol bitte mein Handy, ich rufe schon mal die Kollegen an, ruf du einen Rettungswagen«, hatte er emotionslos zu Christin gesagt.
Wortlos hatte sie sich umgedreht und war zurück ins Pfarrhaus gehastet.
4. Kapitel
Ralf Dickmann saß mit einer Tasse heißem Tee auf dem Sofa und starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Neben ihm lag ein Packen Dokumente, und zufrieden registrierte er, wie klein dieser Stapel nur noch war. Kein Wunder. Er hatte viel Zeit gehabt, die Dokumente wegzusortieren.
Wie harmlos diese Papiere ausgesehen hatten. Wie schwer es ihm gefallen war, sich nichts anmerken zu lassen, obwohl alles wieder aufgewühlt worden war – und er endlich die Wahrheit erfahren hatte.
Dickmann war schon sehr früh wach gewesen, das leise Wummern von Bässen hatte ihn geweckt, dann war es plötzlich still geworden. Danach war das gedämpfte Knallen von Autotüren gefolgt, das Starten von Motoren, dann das leise Brummen der Autos, die sich entfernt hatten.
»Revival Party« in der Stockumer Schule. Die Party war dann wohl vorbei gewesen, alle waren in ihr altes Leben zurückgekehrt.
Er hatte nicht mehr einschlafen können, war wach geblieben und hatte sich vorgestellt, wer alles zu dieser Party gekommen war. Er hatte gespürt, wie sich sein Magen zusammengezogen hatte, ein schmerzhafter Druck, der ihn immer wieder überkam, seitdem er durch Zufall auf die Tagebucheinträge gestoßen war. Er hatte gewusst, dass er sowieso nicht mehr einschlafen würde, war aufgestanden und hatte lautlos die Haustür hinter sich zugezogen.
Jetzt genoss er die Stille, die sich langsam in seinem Kopf ausgebreitet hatte. Seine Frau Britta war über das Wochenende bei ihrer Schwester, sie würde erst gegen Mittag zurückkommen. Er war ganz alleine und hatte so genügend Zeit, sich wieder zu sammeln.
Der Druck in seiner Magengegend war verschwunden, und plötzlich merkte er, wie er lächelte.
Er hatte heute Morgen schon sehr viel geschafft.
5. Kapitel
Als Kriminalhauptkommissarin Skalecki an der evangelischen Kirche in der Grünstraße ankam, kamen ihr die Notärztin und zwei Rettungssanitäter entgegen. Da Freddie ihr am Telefon schon mitgeteilt hatte, dass der Mann, der auf dem Friedhof lag, tot war, wunderte sie sich nicht über die entspannte Gangart des medizinischen Notfallteams.
Die Ärztin, die Skalecki kannte, begrüßte sie und blieb stehen. »Wie Herr Neumann schon am Telefon vermutete, der Mann ist tot.«
»Können Sie in etwa sagen, wie lange schon?«, wollte Skalecki wissen.
Die Ärztin schüttelte den Kopf. »Da ich mir gedacht habe, dass dies ein Fall für euch ist, habe ich so wenig wie möglich angerührt. Aber so starr und kalt der Mann ist, gehe ich von einigen Stunden aus. Aber«, sie hob wie zur Entschuldigung beide Hände hoch, »natürlich ohne Gewähr.«
Die Kommissarin lächelte. »Ja, klar. Danke.« Dann wandte sie sich an die beiden Rettungssanitäter. »Habt ihr ein Portemonnaie oder eine Brieftasche gefunden?«
Beide schüttelten ihre Köpfe.
»Nein«, sagte dann einer, »aber wir wollten auch nichts verändern. Vielleicht sind in der Gesäßtasche Ausweispapiere, aber da wären wir nicht herangekommen, ohne den Toten zu bewegen.« Bedauernd zuckte er mit den Schultern.
Nachdem Skalecki den dreien noch einen schönen Restsonntag gewünscht hatte, ging sie weiter über den Hof zu ihren beiden Kollegen, die etwas abseits des Toten standen. Sie nickte ihnen zu, dann stellte sie sich direkt vor das Grab, auf dem die Leiche lag. Ihre für eine Frau – ja selbst für einen Mann – sehr große Gestalt überragte wie ein Monolith die niedrigen Gehölze und Grabsteine um sie herum. Ihr schwarzer Mantel, den sie sich wegen der spätsommerlichen Kälte übergestreift hatte, unterstrich dieses Bild noch.
Konzentriert betrachtete Skalecki den Toten zu ihren Füßen. Dann musterte sie mit gerunzelter Stirn die Masse an Fußspuren. Die Kriminaltechniker würden sich freuen, dachte sie. Zu Freddies und Christins Abdrücken waren die der Ärztin, der Sanitäter und Schlüters dazugekommen. Und jetzt noch ihre. Nicht zu vergessen die Abdrücke der Passanten, die am gestrigen Tag über den Friedhof gegangen waren.
Die Kommissarin wandte sich wieder dem Toten zu. Ein Mann, konstatierte Skalecki als Erstes für sich. Sie schätzte, dass er etwa in ihrem Alter war, also Mitte, Ende fünfzig. Er lag auf dem Rücken, lang hingestreckt, der rechte Arm ragte über den Kopf hinaus, der Zeigefinger sogar noch höher, als ob er sich wie ein eifriger Schüler gemeldet hatte, um eine Frage zu beantworten. Sein Kopf lag auf dem flachen Grabstein, und die Kommissarin vermutete, dass die dunkle, fast eingetrocknete Masse um seinen Kopf herum Blut war.
Das kleine Grab war von Kantsteinen eingefasst, vielleicht war er rückwärtsgegangen, vor irgendetwas oder irgendwem zurückgewichen, gestolpert und nach hinten gefallen, direkt mit dem Hinterkopf auf den Grabstein. Bis dahin möglicherweise ganz banal, dachte Skalecki weiter. Wären da nicht die gut erkennbaren Wunden in seinem Oberkörper. Stichverletzungen.
Der Tote hatte ein Hemd an, das bestimmt einmal strahlend weiß gewesen war, jetzt aber wie ein modernes Kunstwerk floraler Fantasien aussah. Auch nicht mehr rot, sondern fast so braun wie die Erde um den Leichnam herum. Das Sakko, das er trug, war aufgeschlagen, die Fronten klafften auseinander. Die Jeans und die Turnschuhe sahen dagegen völlig unversehrt aus. Um die Taschen seines Sakkos nach Ausweispapieren zu durchsuchen, wäre Skalecki gerne näher an den Toten herangetreten, ließ es aber bleiben, da sie keine Ausbuchtungen sehen konnte, die auf ein Portemonnaie oder eine Brieftasche hindeuteten, und sie die Kriminaltechniker nicht noch mehr verärgern wollte.
»Kennt ihn irgendjemand von euch?«, fragte sie, ohne den Blick zu heben.
Polizeihauptkommissar Michael Schlüter stand noch weiter von dem Toten entfernt als Skalecki. Er reckte seinen Kopf. »Nein«, sagte er dann. »Vielleicht wenn ich ihn von Nahem sehe, aber von hier aus kommt er mir nicht bekannt vor.«
Auch Freddie, der neben Schlüter stand, schüttelte den Kopf. »Ich kenne ihn auch nicht.«
»Wann hatte Christin das Geräusch gehört?«, wollte Skalecki wissen.
Auf dem Weg von ihrem Auto zu dem Fundort der Leiche hatte Freddie seiner Vorgesetzten schon in knappen Sätzen berichtet, was er bisher wusste.
»So gegen fünf«, antwortete er.
»Mein Gott«, stöhnte Skalecki auf, »was macht jemand an einem Sonntagmorgen um fünf Uhr an diesem …«, beinahe hätte sie »gottverlassenen Ort« gesagt, konnte sich aber mit Blick auf die kleine Kirche noch zurückhalten, »… auf diesem Friedhof?«
Freddie zuckte mit den Achseln. »Er ist dort jemandem begegnet. Ich denke, um diese Uhrzeit und an diesem Ort kann es kein zufälliges Treffen gewesen sein. Die haben sich verabredet.«
Skalecki wandte sich zum Gehen. »Ja, ich denke auch. Es kam zum Streit, der andere hatte ein Messer dabei. Interessant ist nur noch, ob er«, sie deutete auf den Toten, »schon gefallen war oder ob er durch den Angriff fiel.«
Zurück am Pfarrhaus, lud Christin Skalecki und Schlüter mit den Worten: »Ich habe Kaffee gekocht«, ins Pfarrhaus ein. Sie wusste mittlerweile, dass die Polizisten vorerst nicht viel tun konnten, erst musste das Team der Kriminaltechnik seine Arbeit erledigen.
»Kennst du den?« Skalecki deutete mit einem Kopfnicken zum Friedhof.
»Ich glaube nicht«, entgegnete Christin, »ich habe ja kaum hingeschaut. Aber ich denke, ich kenne ihn nicht.«
»Wer treibt sich denn sonst so auf dem Friedhof herum?«
Die Pfarrerin überlegte. »Wenn du wissen möchtest, ob hier gedealt wird oder ich den Eindruck habe, dass sich Kriminelle rumtreiben, muss ich dich – Gott sei Dank – enttäuschen. Hier besuchen entweder Angehörige die Verstorbenen oder, wie heute Morgen die Spaziergängerin, gehen Passanten über den Hof, um die Treppe zur Frankfurter Straße als Abkürzung zu nutzen. Viele mit Hund, einige kenne ich mittlerweile vom Sehen oder weil sie in meiner Gemeinde sind.«
»Hast du in der letzten Zeit irgendetwas bemerkt, was dir ungewöhnlich vorkam?«, fragte Skalecki als Nächstes.
Nervös lachte Christin auf. »Dies hört sich jetzt exakt wie in einem Fernsehkrimi an!« Dann schloss sie kurz die Augen. Freddie schob seine Hand auf ihre, umschloss sie und drückte sie sanft.
»Entschuldige bitte«, Christin wandte sich wieder Skalecki zu, »aber nein. Vielleicht fällt mir später irgendetwas ein, aber ich hätte sofort mit Freddie darüber geredet, wenn ich etwas bemerkt hätte. Schon allein wegen Flora.«
Skalecki nickte. Dann legte sie eine ihrer riesigen Hände auf Christins Schulter. »Ich weiß, wie unwirklich dir dies hier alles vorkommt. Aber wenn es dich tröstet, mir geht es genauso.«
Der kleine Moment des Innehaltens wurde von einem Klopfen an der Haustür gestört. Freddie stand auf, ging in den Flur und öffnete die Tür.
»Oh, hallo!«, hörten Christin, Skalecki und Schlüter eine fast schon fröhliche weibliche Stimme. »So sieht man sich wieder. Mörderische Gegend hier, aber dass du so schnell hier bist …! Freut mich, dich wiederzusehen.«
Fragend sah Christin Skalecki an, die sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Sie bekamen mit, wie Freddie versuchte, etwas zu entgegnen, aber die fast schon aufgedreht klingende Frau an der Haustür redete einfach weiter.
»Na, wir sind hier jedenfalls jetzt fertig, die Leiche kann abtransportiert werden. Ich gebe dir am besten mal meine Nummer, also falls du noch Fragen hast.«
Freddie, der nicht bemerkt hatte, dass seine Frau hinter ihn getreten war, sah, wie die Kriminaltechnikerin, der er vor einiger Zeit schon einmal in Mehrum begegnet war, stockte und das Lächeln auf ihrem Gesicht erlosch. Als Christin den Arm um die Taille ihres Mannes legte, senkten sich ihre Mundwinkel vollends.
»Ich wohne hier mit meiner Familie«, kam Freddie endlich zu Wort, »und wenn es noch Fragen gibt, wird sich sicher Kriminalhauptkommissarin Skalecki mit Ihnen in Verbindung setzen.«
»Schade«, sagte die Kriminaltechnikerin und lächelte wieder. Sie wandte sich zum Gehen. »Aber ich habe es wenigstens versucht.«
Skalecki war ebenfalls aufgestanden und an die Haustür gekommen. »Dann kann ich den Toten jetzt anfassen?«, fragte sie.
Die Kriminaltechnikerin nickte. »Ja, wir sind fertig. Die Leiche kann abtransportiert werden.«
Die Kommissarin ging mit großen Schritten zum Friedhof. Freddie und Schlüter folgten ihr. Alle drei zogen sich im Gehen die Einweghandschuhe an, die sie sich schon aus dem Dienstwagen genommen hatten. Bei dem Toten angekommen, ging Skalecki in die Hocke. Freddie positionierte sich auf der anderen Seite. Er ahnte, was seine Kollegin vorhatte. Mit beiden Armen griff er über die Leiche, umfasste mit den Händen deren Hüfte und zog den Toten so zu sich, dass Skalecki an die rechte Gesäßtasche des toten Mannes kam.
»Bingo«, murmelte sie.
Skalecki bemühte sich, nur mit den Spitzen des Daumens und Zeigefingers ein kleines ledernes Portemonnaie herauszuziehen. Leicht ächzend stand sie wieder auf.
»Man wird nicht jünger«, feixte Schlüter, der ihr Stöhnen gehört hatte.
Skalecki warf ihm einen vernichtenden Blick zu, musste dann aber selbst grinsen. Dann betrachtete sie das Portemonnaie in ihrer Hand. Sie überlegte, ob sie eventuelle Fingerabdrücke vernichten könnte, kam dann aber zu dem Schluss, dass dies eher unwahrscheinlich war. Was auch immer sich hier abgespielt hatte – es sah nicht so aus, als ob es jemand auf das Portemonnaie abgesehen hatte. Trotzdem öffnete sie nur mit den Spitzen ihrer Finger die Brieftasche.
»Jörg Keller«, sagte sie. »Geboren 1964 in Dinslaken. Wohnhaft in Berlin.« Sie wandte sich an Schlüter. »Sagt dir der Name etwas?«
Ihr Kollege war Voerder durch und durch. Es hätte sie nicht gewundert, wenn er jetzt eifrig genickt und ihr die Lebensgeschichte des Toten und seiner ganzen Familie erzählt hätte.
Aber Schlüter zuckte nur mit den Achseln. »Kenne ich nicht«, sagte er mit einem entschuldigenden Gesichtsausdruck.
»Ich fahre schon zur Wache«, entschied Skalecki dann. »Hier ist für mich nichts mehr zu tun. Vielleicht hat er hier noch Angehörige, die müssen wir dann benachrichtigen.« Sie wandte sich an Freddie. »Bleibst du hier, bis der Bestatter ihn eingeladen hat?«
6. Kapitel
Annemarie Keller war überrascht, wie lange sie geschlafen hatte. Sie hatte erwartet, jetzt, da Jörg das Wochenende bei ihnen verbrachte, unruhiger zu sein und wieder in die alte Gewohnheit zu verfallen, so lange wach zu bleiben, bis sie den Schlüssel im Schloss der Haustür hörte. Aber anscheinend war sie endgültig über die Phase, sich Sorgen um den Sohn zu machen, hinaus.
Noch am vergangenen Abend hatte sich Jörg über sie lustig gemacht.
»Wirst du so lange wach bleiben, bis ich nach Hause komme?«, hatte er sie grinsend gefragt.
Annemarie hatte hörbar durch die Nase geschnaubt. »Nein, mein Sohn. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin mittlerweile zu alt dafür. Im Gegenteil, bald musst du dich darum kümmern, dass ich immer abends heil ins Bett komme.«
Wie erwartet hatte Jörg seine Lippen zu einem dünnen Strich zusammengepresst. Und Wilfrieds Gabel war auf dem Weg zum Mund in der Luft stehen geblieben.
»Keine Sorge«, hatte Annemarie ihren Sohn sofort beschwichtigt, »sobald wir eine passende Wohnung gefunden haben, ziehen wir um.«
Wilfried hatte weiter auf seinen Teller gestarrt. Er hatte sich fest vorgenommen, seiner Frau nicht den Abend zu verderben, indem er sich mit Jörg stritt.
Kurz trübte sich ihre Stimmung, als sie wieder an Wilfrieds Gesichtsausdruck, mit dem er am gestrigen Abend die restliche Zeit beim Abendessen gesessen hatte, dachte. Das Beisammensein mit Jörg war mittlerweile zu einem Minenfeld geworden. Jede Aussage konnte zu einer Explosion zwischen den beiden Männern führen.
Es war schon neun Uhr, und soweit sie wusste, hatte Wilfried sich mit einem alten Kollegen zum Golfen verabredet, er war wahrscheinlich schon weg. Angeblich wäre es am schönsten, in der Frühe zu spielen, behauptete er. Aber merkwürdigerweise spielte er immer nur so früh, wenn Jörg ein Wochenende bei ihnen verbrachte.
Annemarie seufzte. Gut. So konnte sie mit ihrem Sohn ein paar entspannte Stunden alleine verbringen, bevor er sich am Nachmittag zurück auf den Weg nach Berlin machte.
Polizeihauptkommissar Michael Schlüter brauchte nur wenige Klicks in seinem Rechner, um herauszufinden, ob Jörg Keller Angehörige hatte und wer sie waren.
»Jörg Keller war verheiratet und hatte zwei Kinder«, informierte er Skalecki und Freddie.
Da der Bestatter, der den Toten in die Duisburger Rechtsmedizin brachte, schnell vor Ort gewesen war, war Freddie auch schon auf der Wache angekommen.
»Er und seine Frau Sylvie haben die gleiche Adresse«, sagte Schlüter. »Ich gehe dann mal davon aus, dass sie noch zusammen sind, na ja, waren. Die Kinder, Leonie, sechsundzwanzig, und Ben, dreiundzwanzig Jahre alt, sind noch bei ihren Eltern gemeldet. Soll ich die Kollegen in Berlin bitten, seine Frau zu informieren?«
Er schaute zu Skalecki hoch, die hinter ihm stand. »Ja«, antwortete sie, »mach das.«
»Wenn er in Dinslaken geboren wurde«, mischte sich Freddie ein, »gibt es hier eventuell noch Angehörige oder Freunde. Warum sollte er sonst hier gewesen sein?«
Skalecki nickte, während Schlüter sich schon wieder dem Bildschirm zuwandte.
»Annemarie und Wilfried Keller«, las er vor. »Wohnhaft Frankfurter Straße. Wenn ich mir die Hausnummer angucke, ist das ganz in der Nähe des Pfarrhauses.«
»Also war er heute früh wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause«, überlegte Freddie laut.
»Ich denke«, sagte Skalecki, »wir werden jetzt zu ihnen gehen, sie über den Tod ihres Sohnes informieren und erste Fragen stellen. Ich gehe davon aus, dass es eine Mordermittlung geben wird. Wer kommt mit?«
Diese Frage war fast rhetorisch gemeint – es war klar, dass Freddie mitging, da Schlüter es wahrscheinlich schon nicht mehr erwarten konnte, sein Flipchart aus der Abstellkammer zu rollen und in Position zu bringen.
»Schicke Hütte«, nickte Skalecki anerkennend, als Freddie den Wagen direkt an der Frankfurter Straße vor dem Haus von Annemarie und Wilfried Keller parkte.
Das Haus der Eheleute stand in einer Reihe zwischen einigen anderen Gebäuden. »Reihe« traf es nicht wirklich, denn die Bebauung erinnerte kaum an eine Reihenhaussiedlung – eher glich sie einem kleinen Villenviertel.
Die imposanten Häuser standen weit zurück auf ihren Grundstücken. Vor den Häusern erstreckten sich große, meist sehr gepflegte Vorgärten. Obwohl die Gebäude hoch aufragten, waren sie elegant, die Proportionen stimmten. Sie wirkten altehrwürdig.
Sie sahen nach Geld aus, wie Skalecki für sich feststellte. Der einzige Makel, den die Häuser – wie sie persönlich fand – hatten, war ihre Lage direkt an der verkehrsreichen Frankfurter Straße. Wobei »verkehrsreich« für Skalecki, die die meiste Zeit ihres Lebens in Duisburg verbracht hatte, relativ war. Trotzdem war diese Straße eine Durchgangsstraße, die viele Autofahrer nutzten. Aber zu der Zeit, als die Häuser gebaut worden waren, war die Lage wahrscheinlich sehr attraktiv gewesen. Man hatte mit seiner Kutsche direkt auf eine der am besten befestigten Straßen der Gegend rollen und in die nächstgrößeren Städte wie Dinslaken, Duisburg oder Wesel fahren können.
In diesem Moment durchströmte Skalecki ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Sie und ihr Mann Rolf lebten jetzt in Mehrum, nur durch den Deich vom Rhein getrennt. Ihr Häuschen war vielleicht nicht so hochherrschaftlich wie dies, vor dem sie jetzt stand, aber dafür hatte ihre direkte Umgebung den Charakter eines Urlaubsortes. Runterkommen und Abschalten nach einem langen Arbeitstag war garantiert – und das jeden Tag.
»Ich habe mich immer gefragt, wer hier wohnt, aber unter diesen Umständen wollte ich die Leute nicht kennenlernen«, sagte sie zu Freddie.
Ihr Kollege nickte zustimmend. »Ja, diese Häuser sind wirklich eindrucksvoll. Aber tatsächlich kenne ich auch niemanden von den Bewohnern, obwohl sie ja fast schon Nachbarn sind.«
Die Polizisten stiegen aus und gingen die breite Treppe zum Elternhaus des Toten hoch. Als Skalecki auf den Knopf der Klingel drückte, ließ sie der laute, melodische Klingelton zusammenzucken. Mit bedrückten Mienen warteten sie darauf, dass jemand öffnete. Sie hatten keine Ahnung, in welcher gesundheitlichen Verfassung Jörg Kellers Eltern waren. Sie wussten nur, dass Annemarie achtundsiebzig und Wilfried dreiundachtzig Jahre alt waren.
Ihre Stimmung trübte sich weiter, als sie die fröhliche, laute Stimme einer Frau hörten, die sich der Eingangstür näherte.
»Oh, Jörg! Das muss ja eine tolle Party gewesen sein …«, die Stimme erstarb, als die ältere Frau die Haustür öffnete und in die Gesichter zweier ihr fremder Menschen schaute. »Oh!«, rief sie aus, nun leicht verärgert. »Entschuldigen Sie, aber ich möchte nicht von Ihnen gestört werden.«
Skalecki verstand als Erste.
»Wir sind nicht von den Zeugen Jehovas«, stellte sie sofort klar. »Wir sind«, sie räusperte sich, »ich bin Kriminalhauptkommissarin Skalecki, und dies ist mein Kollege Polizeihauptmeister Frederick Neumann. Wir müssen leider mit Ihnen über eine sehr tragische Angelegenheit sprechen. Ist Ihr Mann auch da?«
Während Skalecki sich und Freddie vorstellte, hatten beide ihre Dienstausweise aus ihren Taschen gezogen und Annemarie Keller hingehalten.
Skalecki und Freddie hatten solche Momente schon oft erlebt. Zuerst die völlige, aber sehr kurze Unbefangenheit, fremden Menschen vor der eigenen Haustür gegenüberzustehen. Dann die leichte Verärgerung über die Störung, wenn man realisierte, dass es nicht der Spontanbesuch eines Bekannten war. Danach folgte das Entgleisen der Gesichtszüge, wenn sie erfuhren, dass Polizisten in ziviler Kleidung vor ihnen standen. Meistens wussten die Menschen aus zahlreichen Fernsehkrimis, dass jetzt eine schlechte Nachricht kommen würde. Und dies war die Wirklichkeit und kein TV-Film.
Genau das Gleiche spielte sich jetzt in Annemarie Kellers Mimik ab.
»Jörg?«, brachte sie mit gepresster Stimme hervor. »Was ist passiert? Was ist mit ihm?«
»Können wir reinkommen?«, fragte Skalecki, ohne auf ihre Fragen einzugehen.
Annemarie Keller drehte sich wortlos um und ging ihnen in das Innere des Hauses voraus. Sie führte sie in ein großes Wohnzimmer. Hohe, mit weißen Sprossen unterteilte Fenster gaben den Blick auf einen riesigen Garten frei, dem man die liebevolle und regelmäßige Pflege ansah. Unsicher, ob sie den beiden Polizisten einen Platz anbieten sollte, drehte sich die Hausherrin wieder zu ihnen um. Wie um sich selbst Halt zu geben, umfasste die eine Hand die andere.
»Ist Ihr Mann auch hier?«, wiederholte Skalecki ihre Frage.
Annemarie Keller schüttelte den Kopf. »Nein, er wird auf dem Golfplatz sein. Was ist denn nun?« Ihre Stimme schraubte sich einen hysterischen Ton höher.
»Bitte rufen Sie Ihren Mann an, er soll sofort herkommen«, schaltete sich nun Freddie mit sanfter Stimme ein.
Schnell überlegte Skalecki, wo der nächste Golfplatz war. Sie wusste es nicht. Irgendwo in Hünxe? In Duisburg? Dann würde es zu lange dauern, bis Jörgs Vater hier war – so lange konnten sie Annemarie Keller nicht im Unklaren lassen.
Resigniert deutete Skalecki auf einen der Sessel. »Setzen wir uns.«
»Nein!«, entgegnete Annemarie Keller energisch, »ich verlange, dass Sie mir jetzt ohne Umschweife sagen, was Sie zu sagen haben.«
Ihre Augen funkelten die Polizisten an, ihre Unterlippe zitterte leicht.
»Ihr Sohn wurde heute Morgen tot auf dem Friedhof an der Kirche in der Grünstraße gefunden«, sagte Freddie mit fester, aber sehr ruhiger Stimme.
Auch jetzt spielte sich vor den Augen der Polizisten ein vertrautes Mienenspiel ab. Der Bruchteil der Sekunde, bis die Nachricht den Verstand ihres Gegenübers erreichte. Das langsame Heben der Lider, die Augen, die größer wurden. Ganz oft ein Lächeln, nur ein Zucken der Mundwinkel, ach, nein, das kann nicht, der geliebte Mensch war doch gerade noch quicklebendig, dann die Fassungslosigkeit und wieder das völlige Entgleisen der Gesichtszüge, das Aufschreien.
»Was … Was ist passiert?« Heiser kamen die Worte aus Annemaries Kehle. Sie hob die Hand, führte sie zum Hals, als ob sie prüfen wollte, ob dort noch alles in Ordnung war.
»Wir wissen es noch nicht genau«, antwortete Skalecki. »Es sieht aber so aus, als ob Ihr Sohn Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.«
Annemarie Keller stolperte zurück, sackte in den Sessel. Freddie schaute sich suchend um und sah ein Handy auf dem Wohnzimmertisch liegen.
»Bitte rufen Sie jetzt Ihren Mann an oder entsperren Sie das Handy, dann rufe ich ihn an.«
In dem Moment hörten sie durch die geöffnete Flurtür, wie ein Schlüssel in der Haustür gedreht wurde und ein älterer Mann mit festen Schritten in das Wohnzimmer kam. Völlig perplex starrte er Skalecki und Freddie an, dann fiel sein Blick auf Annemarie.
»Was ist denn hier los? Wer sind Sie?«, fragte er.
Die beiden Polizisten holten wieder ihre Dienstausweise aus den Jackentaschen und hielten sie dem Mann hin, während Skalecki ihm ihren und Freddies Namen nannte.
»Herr Keller?«, fragte Skalecki.
Der Mann nickte.
»Es tut mir sehr leid, aber auch Ihnen müssen wir mitteilen, dass Ihr Sohn heute Morgen tot auf dem Friedhof der Grünstraße gefunden wurde.«
Erstaunt riss er die Augen auf. »Wie bitte? Jörg? Sind Sie sicher? Das … Das kann doch nicht wahr sein!«
Fassungslos wandte er sich seiner Frau zu, die mittlerweile aufgestanden war. Er stockte einen Moment, dann schloss er seine Arme um sie.
»Sind Sie wirklich sicher?«, fragte er mit brüchiger Stimme.
»Wir haben in seinem Portemonnaie einen Ausweis gefunden, das Bild gleicht dem Toten, deswegen sind wir uns sicher. Die Kollegen in Berlin informieren gerade Ihre Schwiegertochter. Ich hoffe, dass sie noch heute kommen wird. Dann muss ihn natürlich noch jemand eindeutig identifizieren«, erklärte Skalecki die weitere Vorgehensweise.
»Also kann es sein«, brauste Annemarie Keller plötzlich mit einem Funken Hoffnung in den Augen auf, »dass es gar nicht Jörg ist?«
Skalecki wiegte langsam ihren Kopf hin und her. »Ich will Ihnen jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Rein theoretisch kann das sein, aber der Ausweis ist ganz neu, der Tote gleicht eindeutig dem Passfoto.«
»Dürfen wir Ihnen jetzt vielleicht schon ein paar Fragen stellen?«, wollte Freddie wissen.
Irritiert sah Wilfried Keller sie an. »Warum? Wie ist er gestorben?«
»Das können wir noch nicht genau sagen«, wiederholte Skalecki das, was sie schon seiner Frau gesagt hatte. »Aber im Moment sieht es so aus, als ob er gewaltsam zu Tode gekommen ist.« Mit ruhiger Stimme und so behutsam wie möglich schilderte sie, wie sie Jörg vorgefunden hatten. »Deswegen gehen wir im Moment davon aus, dass noch eine oder mehrere andere Personen dabei waren, als er starb. Wo war Ihr Sohn denn gestern Abend?« Sie schloss diese Frage direkt an, um die Aufmerksamkeit der erschütterten Eltern zu behalten.
»Er war an diesem Wochenende bei uns zu Besuch, weil er auf eine Party in der Stockumer Schule gehen wollte. Er lebt eigentlich mit seiner Familie in Berlin«, antwortete Wilfried Keller.
Lebt. Wie viele Menschen in dieser Situation nutzte er noch die Gegenwartsform.
»Haben Sie gehört, dass er in der vergangenen Nacht nach Hause gekommen ist?«
Keller schüttelte den Kopf. »Nein. Wir rechneten damit, dass es sehr spät werden würde, und er ist erwachsen, da bleiben wir nicht mehr auf.«
»Hatte er Ihnen von irgendwelchen Streitigkeiten oder Animositäten erzählt? Oder Schwierigkeiten, die er hatte?«
In diesem Moment schien sich Annemarie Keller wieder auf ihr Umfeld konzentrieren zu können. »Nein!«, rief sie laut aus. »Nein! Er ist ganz unbeschwert und gut gelaunt losgegangen. Jörg hat sich auf ein Wiedersehen mit seinen alten Freunden gefreut. Er ist ein friedliebender und freundlicher Mann, er hatte mit niemandem Streit.«
Dies war auch eine den beiden Polizisten vertraute Reaktion. Aber sowohl Freddie als auch Skalecki wussten, dass es fast in jedem sechzig Jahre währenden Leben nicht nur friedliebend und freundlich zugegangen war.
Und es war genau ihre Aufgabe herauszufinden, wann und warum es nicht so gewesen war.
7. Kapitel
Polizeihauptkommissar Michael Schlüter koordinierte die Zusammenarbeit mit den Berliner Kolleginnen und Kollegen. Er hatte ihnen die Umstände, unter denen sie die Leiche von Jörg Keller aufgefunden hatten, geschildert und sie darüber informiert, dass sie von einem Gewaltverbrechen ausgingen. Zwei Kolleginnen hatten dann Sylvie Keller aufgesucht und sie über den Tod ihres Mannes informiert. Als sie wieder zurück auf ihrer Polizeiwache waren, rief eine von ihnen sofort ihren Voerder Kollegen an.
»Wir kommen jetzt gerade von Sylvie Keller«, kam die Berliner Kollegin Annika Böhm gleich zur Sache. Es gehörte zu ihrer Routine, die oder den Ehepartner automatisch auch als Verdächtigen zu betrachten. »Wir haben den Eindruck, das Sylvie ehrlich überrascht und schockiert war. Also ist sie entweder eine wirklich trauernde Witwe oder sie ist eine gute Schauspielerin.«
Schlüter lachte auf. »Genau das ist ja der Fall. Ihre Arbeit als Schauspielerin ist zwar schon viele Jahre her, aber gelernt ist gelernt.«
»Wenn sie etwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat«, fuhr Annika fort, »dann hat sie einen Helfer bei euch vor Ort. Auch wenn man von Berlin nach …«, sie zögerte, Schlüter ahnte, dass sie in ihren Notizen kramte.
»Voerde«, kam er ihr zur Hilfe. Er hörte ein leises Geräusch, das er als Lachen deutete.
»Danke, sorry. Also für Berlin bis Voerde braucht man, wenn man wirklich gut durchkommt, mindestens fünf Stunden. Als wir bei ihr eintrafen, war es halb elf, und sie hatte anscheinend sehr entspannt am Frühstückstisch gesessen«, berichtete sie weiter.
»Halb elf«, murmelte Schlüter. »Leider wissen wir den genauen Todeszeitpunkt noch nicht. Eventuell – aber das ist absolut noch nicht sicher – gegen fünf Uhr in der Früh.«
Er hörte, wie Annika auf der Tastatur ihres Rechners tippte.
»Wenn sie mit der Deutschen Bahn gefahren wäre, hätte sie einen Zug vor zwei Uhr nehmen müssen«, sagte sie dann. »Ich schaue hier parallel die möglichen Zugverbindungen nach«, fügte sie erklärend hinzu.
»Mit dem Auto wäre es vielleicht machbar gewesen«, entgegnete Schlüter.
»Das Auto stand in der Einfahrt«, antwortete Annika Böhm. »Die Motorhaube war kalt, und es war noch eine leichte Morgentauschicht auf dem ganzen Wagen.«
»Respekt«, brummte Schlüter anerkennend. »Noch bevor Sie geklingelt haben, um die Todesnachricht zu überbringen, haben Sie schon mit den Ermittlungen angefangen.«
Wieder meinte Schlüter seine Berliner Kollegin leise lachen zu hören. »Danke. Aber die Familie Keller könnte ja noch einen weiteren Wagen besitzen oder sich einen geliehen haben.«
»Egal ob mit dem Zug oder mit einem Auto«, fasste Schlüter zusammen, »die Fahrt wäre für Sylvie auf jeden Fall sehr anstrengend gewesen und auch sehr riskant, wieder rechtzeitig zu Hause zu sein. Wie sind Sie mit ihr verblieben?«
»Sie hat in meiner Gegenwart einen Freund der Familie angerufen«, antwortete die Berliner Polizistin. »Er versprach, sofort zu kommen. Sie wollte dann die Kinder informieren und im Laufe des Tages mit ihnen nach Voerde fahren. Ich habe ihr Ihre Telefonnummer gegeben und versichert, dass Sie sich um sie kümmern werden. Das war doch in Ordnung?«
»Ja, natürlich«, entgegnete Schlüter. »Soll ich Sie kontaktieren, wenn wir Hilfe in Berlin benötigen?«
»Ja«, bestätigte Annika Böhm, »sehr gerne.«
Sie beendeten das Gespräch mit gegenseitigen Wünschen für einen erfolgreichen Tag. Schlüter war zufrieden. Diese Berliner Kollegin hatte sich sehr nett und hilfsbereit angehört, gar nicht wie eine gestresste Polizistin aus der größten Stadt Deutschlands.
8. Kapitel
»Haben Sie noch weitere Kinder?«, wollte Skalecki wissen.
»Ja, noch einen Sohn, Markus«, antwortete Wilfried Keller. »Er ist jünger und wohnt in Düsseldorf.«
»War er auch auf dieser Party gestern Abend?«
»Nein!«, rief Keller aus.
Skalecki hatte den Eindruck, dass diese Vorstellung in den Augen Kellers völlig abstrus war. Er wollte noch etwas sagen, aber nach einem Blick auf seine Frau schloss er seinen Mund wieder.
»Wie oft war Jörg hier in Voerde?«, fragte Freddie.
»Höchstens alle zwei bis drei Monate, eher seltener«, antwortete Keller.
»Öfter«, fuhr seine Frau dazwischen, überraschend laut und energisch.
Freddie und Skalecki wechselten einen Blick.
Keller presste die Lippen zusammen. »Wenn Sie es genau wissen wollen«, sagte er dann mit beherrschter Stimme, »können wir das wahrscheinlich mit einem Kalender rekonstruieren.«
Skalecki winkte ab. »Vielleicht später. Kam er gezielt, nur um Sie zu besuchen, oder hatte er noch engere Kontakte zu alten Freunden?«
Trotz ihrer offensichtlichen tiefen Trauer verfolgte Annemarie Keller aufmerksam das Gespräch. »Natürlich kam er, um uns zu besuchen. Es war ihm wichtig zu sehen, wie es uns ging.«
Skalecki entgingen Kellers hochgezogene Augenbrauen nicht. »Hatte er denn noch Kontakte zu alten Freunden?«, wiederholte sie ihre Frage.
»Er reiste meistens Freitagnacht oder Samstagvormittag an und verbrachte den Samstagabend dann mit Freunden«, beantwortete Keller die Frage. »Sonntags, direkt nach dem Frühstück, fuhr er wieder zurück nach Berlin.«
»Wissen Sie, wie seine Freunde heißen?«, wollte Freddie wissen.
Annemarie Keller musste nicht lange überlegen. »Martin Willems und Andreas Gerlich«, antwortete sie. Sie schluchzte wieder auf. »Mein Gott!«, rief sie verzweifelt aus. »Er war mit ihnen seit seiner Kindheit befreundet. Ich muss es ihnen sagen.«
»Hatte er sich mit den beiden gestern Abend auf der Party getroffen?«, fragte Freddie nach.
Keller zuckte mit den Schultern. »Ich denke, ja. Jörg, Andreas und Martin haben in ihrer Jugend sehr viel Zeit in dieser Stockumer Schule verbracht. Die beiden werden garantiert auch auf dieser Wiedersehens- oder, wie man heute sagt, Revival-Party gewesen sein.«
»Haben Sie die Adressen oder Telefonnummern der beiden?«, wollte Skalecki wissen.
»Ja«, antwortete Annemarie Keller mit tränenerstickter Stimme. Sie hatte sich mittlerweile wieder hingesetzt, und als sie aufstand, um nach dem Gewünschten zu sehen, strauchelte sie leicht. Sofort war ihr Mann bei ihr.
»Bleib sitzen«, sagte er und drückte sie sanft in den Sessel zurück. »Die Adressen wissen wir auswendig, und die Nummern sind in unserem Telefonbüchlein.«
Wenig später begleitete Wilfried Keller die beiden Polizisten zur Haustür.
»Sie waren heute Morgen schon golfen?«, fragte Skalecki in der geöffneten Haustür stehend.
»Nein! Wieso?«, rief Keller verwundert aus.
»Ihre Frau hatte so etwas gesagt«, entgegnete Skalecki.
Keller runzelte die Stirn, dann stieß er ein Lachen aus. »Es geht jetzt nicht etwa um mein Alibi?«
Skalecki ging auf diese Frage nicht ein. Sie schaute Keller weiter abwartend an.
»Ich gehe ab und zu sonntags in der Früh golfen, aber heute Morgen war ich walken«, beantwortete Keller endlich Skaleckis Frage.
Schweigend fuhren Skalecki und Freddie den kurzen Weg zu ihrer Polizeiwache in die Friedrichsfelder Straße. Wie abgesprochen blieben beide noch im Auto sitzen.
»Du denkst das Gleiche wie ich«, lachte Freddie.
»Oh Mann«, auch Skalecki musste laut lachen. »Ich kann mir ein Leben ohne dich an meiner Seite gar nicht mehr vorstellen!« Sie wurde wieder ernst. »Ja, wahrscheinlich. Wilfried Keller scheint, um es mal so zu sagen, ein eher schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn gehabt zu haben.«
Freddie nickte zufrieden. »Und?«
»Und: Wenn Rolf und ich walken gehen würden, würden wir uns mindestens Turnschuhe anziehen.«
Da der Gottesdienst wegen des Todesfalls abgesagt worden war, konnten die Pfarrerin und ihre Kinder ungewohnt lange am Frühstückstisch sitzen. Bis auf Flora, die sich selbst laut ein Buch vorlas, starrten alle nur bedrückt auf die angebissenen Brote, die vor ihnen auf den Tellern lagen.
Plötzlich kam Christin ein Gedanke.
»Oskar«, sagte sie, »du warst doch gestern Abend in der Stockumer Schule und hast dort gekellnert?« Obwohl sie als Mutter eigentlich genau wissen sollte, wo sich ihr minderjähriger Sohn an einem Samstagabend aufhielt, formulierte sie es als Frage.
»Ja, war ich«, antwortete Oskar.
Die nächste Frage war Christin etwas unangenehm. In Gesprächen mit anderen Müttern hörte sie sehr oft, wie diese erzählten, dass sie nicht eher einschlafen könnten, bis ihr Kind wieder zu Hause sei. Christin gehörte nicht zu diesen Müttern. Zum einen vertraute sie Mathilda und Oskar, wenn sie ihre Pläne für den Abend vorbrachten. Gemeinsam wurden Regeln festgelegt, die ihre beiden Großen sehr zuverlässig einhielten. Zum anderen war Christin ihr Schlaf sehr wichtig, und da sie eine Frühaufsteherin war, reichte ihr ein morgendlicher Kontrollblick in die Zimmer ihrer Kinder. Trotzdem hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie natürlich nicht sicher sein konnte, dass Oskar und Matti wirklich zur verabredeten Zeit in ihren Betten lagen.
»Wann bist du denn nach Hause gekommen? Ist dir da vielleicht etwas aufgefallen?«
»Das habe ich auch schon überlegt«, antwortete ihr Sohn. »Ich war gegen zwei Uhr zu Hause, wie abgemacht. Um diese Zeit waren schon einige gegangen, aber es waren noch ’ne Menge anderer Gäste da. Alle voll, die alten Säcke.« Er stieß ein kehliges Grunzen aus. »Ich sag euch, die haben echt gekippt. Nico und ich hatten echt gut zu tun. Später haben die sich dann selbst bedient. Aber als wir fuhren, ist mir nichts aufgefallen. Vor der Stock standen ein paar herum, aber in den Schafstegen und auf der Grünstraße war dann kein Mensch mehr.«
»Meinst du, der Tote war auf dieser Party gewesen?«, fragte Mathilda.
Christin zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich nicht. Aber immerhin war dort eine große Fete mit vielen Gästen.«
»Wenn ich ihn hätte sehen dürfen, hätte ich ihn vielleicht wiedererkannt«, sagte Oskar mit vorwurfsvoller Stimme.
Christin betrachtete ihren Sohn. Die kindlichen Züge waren komplett aus seinem Gesicht verschwunden. Da er seit vielen Jahren Judo machte, war er sehr muskulös, und seine Gliedmaßen hatten fast alles Schlaksige verloren. Sie konnte sich schon vorstellen, wie er als erwachsener Mann aussehen würde.
»Ich glaube, dass du alt genug für den Anblick eines toten Menschen bist«, antwortete sie ihm schließlich, »und ich glaube nicht, dass, nach allem, was wir hier schon gemeinsam durchgemacht haben, du davon traumatisiert werden würdest, aber vielleicht bin ich als Mutter noch nicht so weit, dir einen solchen Anblick zuzumuten. Na, und außerdem hätten uns die Kriminaltechniker einen Kopf kürzer gemacht, wenn wir einen Familienausflug daraus gemacht hätten.«
Bei dieser Vorstellung mussten alle grinsen.
»Hier, liebe Kinder«, Mathilda imitierte – ziemlich treffend – die Stimme ihrer Mutter, »zu eurer Rechten sehr ihr einen toten Menschen. Schaut euch diese Leiche genau an. Ja, geht ruhig noch näher ran, achtet auf das Muster der Blutflecken.«
Jetzt brachen Christin und die Kinder in lautes Gelächter aus. Flora, die zwar nicht verstand, warum ihre Mutter und ihre großen Geschwister lachten, klatschte vor Vergnügen in die Hände.
Kaum hatte sich die Haustür hinter Skalecki und Freddie geschlossen, brach Annemarie Keller komplett zusammen. Es war wie ein Faustschlag, der sie unvermittelt in den Magen getroffen hatte. Sie spürte den Verlust ihres ältesten Sohnes körperlich, ein Schmerz, der sie sich zusammenkrümmen ließ.
Ihr Mann wunderte sich nicht, dass Annemarie seine Versuche, sie in seine Arme zu ziehen, abwehrte und sich stattdessen wieder auf das Sofa niedersinken ließ.
Sie war untröstlich. Oder steckte etwas anderes hinter ihrer Abwehr? Ihre Verbindung zu Jörg war immer wesentlich stärker gewesen.
Wilfried atmete tief ein und aus. »Ich rufe Markus an«, sagte er dann. »Ist es dir recht, wenn Sylvie und die Kinder bei uns übernachten? Natürlich nur, wenn sie es wollen.«
Seine Frau reagierte nicht. Sie lag – jetzt eingerollt wie ein Igel, der sich schützen will – auf dem Sofa. Ihr lautes Weinen war in ein leises Wimmern übergegangen.
9. Kapitel
Schlüter hatte schon Kaffee gekocht, als Skalecki und Freddie zu ihm in das Besprechungszimmer kamen. Nach Absprache mit Skalecki hatte Schlüter ihre Kolleginnen Katja Weber und Elif Çelik dazugebeten. Belustigt hatte er zur Kenntnis genommen, dass die beiden nicht sehr traurig über diese ungeplante Zusatzschicht an einem Sonntag gewesen waren. Sosehr sie ihren Sohn Jakub liebten, so sehr genoss das Paar auch eine Auszeit von der Kinderbetreuung. Da sich die Großmütter des kleinen Jakub ebenfalls um jede Minute Betreuungszeit stritten, brauchten Katja und Elif auch kein schlechtes Gewissen zu haben.
Polizeioberkommissar Leo Rademacher wurde ebenfalls von Skalecki zu dieser ersten Besprechung gebeten. Der jüngere Kollege hatte schon oft das Team ergänzt und war sowieso im Dienst.
Nachdem sie alle vollständig um den Konferenztisch saßen, informierte Skalecki ihre Kolleginnen und Kollegen über die Ereignisse des Morgens.
Polizeioberkommissarin Katja Weber schaute zu Freddie und schüttelte fassungslos den Kopf. »Das kann doch nicht wahr sein! Ein Mord direkt vor eurer Haustür?«
Auch Elif war entsetzt. »Wie geht es deiner Frau? Und wie haben die Kinder reagiert?«
»Christin ist bisher sehr gefasst«, antwortete Freddie. »Aber ich denke, der Schock wird später kommen. Mit den Kindern habe ich bisher noch gar nicht gesprochen. Matti ist bestimmt sehr aufgewühlt, während Oskar das wahrscheinlich alles wieder sehr spannend finden wird.«
»Wie lange dauert Mattis FSJ noch?«, fragte Katja.
Nach ihrem Abitur hatte Matti sich dazu entschlossen, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Psychiatrie des katholischen Krankenhauses in Dinslaken zu machen, bevor sie sich darum bemühte, einen Studienplatz für Psychologie zu bekommen. Christins älteste Tochter war schon seit ihrer Kindheit sehr sensibel gewesen, die Gefühle und Befindlichkeiten anderer Menschen hatten sie immer tief berührt. Deswegen – und wegen der Erlebnisse der letzten Jahre als Stieftochter eines Polizisten – hatte sie immer vorgehabt, Psychologie zu studieren. Aber je näher der Bewerbungsschluss für eine Universität oder Hochschule im letzten Sommer gerückt war, desto unsicherer war Mathilda geworden. War sie wirklich den Sorgen und Nöten, den psychischen Erkrankungen anderer Menschen gewachsen? Oder, ein noch schlimmerer Gedanke – wollte sie dies überhaupt? Interessierten sie die Probleme anderer wirklich? In den letzten Jahren hatte sie erlebt, wie einmal ein machtbesessener und ein anderes Mal ein raffgieriger Mensch versucht hatten, ihre Mutter zu töten, wie ihr Bruder aus Rachsucht beinahe ertränkt worden wäre und Freddie um ein Haar lebenslänglich für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, in den Knast gekommen wäre. Und jedes Mal, wenn Skalecki und ihre Voerder Kollegen den Täter oder die Täterin gefasst hatten, hatte Mathilda eine tiefe Befriedigung erfüllt, hatte sie sich innerlich stärker gefühlt. Deswegen hatte sie sich dafür entschieden, zuerst einmal eine längere Zeit in diesem Berufsfeld zu verbringen, in einem Arbeitsalltag, der sie nach einem klassischen Psychologiestudium erwarten würde.
»Noch einige Monate«, antwortete Freddie. »Bis nächsten Sommer muss sie sich entschieden haben, ob sie Psychologie studieren will oder etwas anderes machen möchte.«
»Können wir denn wirklich schon von einem Mord ausgehen?«, kam Leo zum eigentlichen Grund ihrer Besprechung zurück.
Skalecki winkte ab. »Ja, da brauchen wir gar nicht abzuwarten, was in Rickis Bericht stehen oder die Staatsanwaltschaft entscheiden wird. Die Wunden in der Brust und dem Bauchraum kann er sich nicht selbst zugefügt haben.«