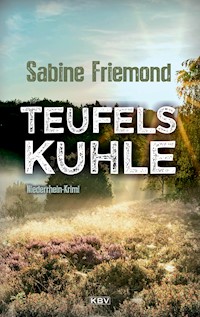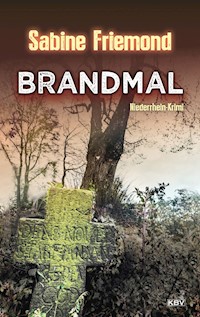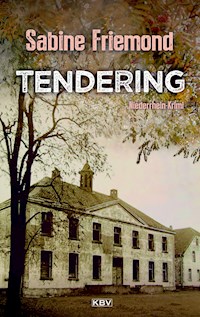Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Christin Erlenbeck
- Sprache: Deutsch
Wenn das Kinderlachen verstummt Im beschaulichen Rheindorf Löhnen hat sich eine rechtsextreme Wohngemeinschaft, die ihr Leben streng nach den Gesetzen der Natur ausrichtet, in einem alten Herrenhaus niedergelassen. Als eine der Mitbewohnerinnen bei der Hausgeburt ihres Babys stirbt, wird dies von der Staatsanwaltschaft als Unglück eingestuft, und die Ermittlungen werden eingestellt. Die Polizistin und Psychologiestudentin Laura Bauer ist fassungslos und lässt sich zum Schein als Anhängerin völkischer Ideologie in die Gruppe einschleusen. Als in einer nahen Lehmgrube durch den sinkenden Grundwasserspiegel eine Kinderleiche auftaucht, wird nicht nur das Voerder Polizeiteam mit alten Geheimnissen konfrontiert. Auch Pfarrerin Christin Erlenbeck wird in einen Strudel von Erinnerungen gerissen – Erinnerungen daran, dass vor vielen Jahren genau hier ein Kind verschwand ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Friemond
Schwesterlein
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Hochbahn
Teufelskuhle
Tendering
Brandmal
Hitzewelle
Sabine Friemond, geb. 1968 in Duisburg, wuchs in der Gemeinde Spellen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Ihre Liebe zu Büchern ist bereits daran ersichtlich, dass sie am Niederrhein eine Buchhandlung in Voerde betreibt. Ihre Heldin Pastorin Christin Erlenbeck ermittelt bereits in ihrem sechsten Fall.
Sabine Friemond
Schwesterlein
Kriminalroman
Originalausgabe
© 2024 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von
© AungMyo - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-705-6 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-716-2 (e-Book)
Alle Ereignisse und Personen, die in meinem Krimi
im und um »Haus Löhnen« geschildert werden,
sind völlig frei erfunden.
Die Aktivitäten nationalsozialistischer oder völkischer
Neusiedler leider nicht.
Ich danke den Eheleuten Milz,
Besitzer von »Haus Löhnen«, dass sie mir gestattet haben,
ihr wunderschönes, geschichtsträchtiges Haus
als Schauplatz für meinen Krimi zu nutzen.
Selbstverständlich gibt es dort kein Spirituelles Zentrum,
keinen Arno und keine Dussmanns.
Mögen Stolpersteine uns den Weg zeigen.
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Ein Wort an die Leser
Prolog
Das hatte sie nicht gewollt, so hatte sie es sich nicht vorgestellt.
Während ihr Körper durch die Hölle ging, hatte sich ein kleiner Teil ihres Bewusstseins abgespalten und schwebte wie ein Spiegelbild über ihrem Blickfeld. Der Mund in dem Gesicht, das sie dort sah, war zu einem süffisanten Lächeln verzogen.
Bisher war alles so gut gewesen. Noch nie hatte Johanna sich so umsorgt und geliebt gefühlt. Sie hatte einen Platz in der Gemeinschaft, sie wurde geachtet, ja fast verehrt. Zum ersten Mal fühlte sie sich nicht als ein Mensch, auf den ständig Rücksicht genommen werden musste.
Aber warum lag sie jetzt hier und nicht in einem Krankenhaus? Ach ja: die Willenserklärung, die zu schreiben Arno ihr nahegelegt hatte. Er hatte ihr dabei geholfen, sie ihr eigentlich sogar diktiert. Wie naiv sie gewesen war! Sie hatte natürlich gedacht, dass man letztendlich doch einen Krankenwagen rufen würde, wenn es nicht gut lief.
Und es lief eindeutig nicht gut. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Sie kannte ihren Körper genau und wusste, dass sie gleich wegdämmern und dann ins Koma fallen würde. Sie brauchte jetzt sofort Insulin.
Gerlinde – ihrer aller »große Schwester« –, Klara und Hilke waren bei ihr. Sie hielten ihre Hände, sprachen ihr Mut zu. Bei Gerlinde hatte sie das Gefühl, dass sie sich eher selbst Mut zusprechen musste, denn ihr Blick drückte Verunsicherung aus. Johannas letztes bisschen klarer Verstand stellte die Frage, ob die Hofherrin schon jemals bei einer Entbindung eines menschlichen Babys dabei gewesen war.
»Nein, noch ist es nicht so weit«, sagte Gerlinde in regelmäßigen Abständen, und als sie Johannas zweifelndem Blick begegnete, fuhr sie hastig fort: »Gleich, bestimmt gleich. Schön weiteratmen und pressen.«
»Bitte«, flehte Johanna jetzt mit leiser Stimme, »ich möchte in ein Krankenhaus.«
Klara, der Johanna immer mit großem Respekt begegnet war, sah sie jetzt mit unerbittlicher Härte an und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie, »du wirst das schaffen. Und wenn nicht, so ist dies der große Plan der Natur, die gibt oder nimmt. Du wirst in den großen Kreis allen Lebens eingehen.«
Johanna entging am Rande ihres schon eingeschränkten Blickfelds nicht, wie Klara sie ansah, streng und etwas unzufrieden, als ob sie dafür verantwortlich wäre, dass die Geburt des Babys nicht weiterging.
In den letzten Sekunden ihres Lebens dachte Johanna nicht an das Kind, dem sie das Leben schenken wollte. Sie dachte auch nicht an Robert, dem sie durch die Eheleite, bei der ihre Verbindung feierlich vor der Gemeinschaft erklärt worden war, zur Frau gegeben worden war und den sie vor Kurzem auch standesamtlich geheiratet hatte, nicht an ihre Eltern und nicht an ihre Zukunft, die sie nicht mehr haben würde.
Sie dachte nur an Frieda, ihre Schwester.
Die so wie sie schwanger war und die so wie sie hier lebte.
In diesem Haus.
Hilke merkte als Erste, wie ruhig Johanna plötzlich geworden war. Kurz glaubte sie, dass dies ein gutes Zeichen war, hatte die Hoffnung, dass es die Ruhe vor dem Sturm, dem Hinausgleiten des Babys in die Welt, war. Sie hatte sich immer den feierlichen Moment ausgemalt, in dem sie mit dem Baby in ihren Armen aus dem Zimmer trat und es Arno und Robert wie ein Geschenk, wie eine Opfergabe, präsentierte. Ein Geschenk für die Gemeinschaft. Hilke ließ ihren Blick über den bizarr gewölbten Leib Johannas schweifen. Sie selbst war nur ein Jahr älter und bisher noch nicht schwanger geworden, obwohl ihr Mann und sie sehr oft miteinander schliefen.
Aber nein. Schlagartig wurde ihr klar, dass eine Frau, die gleich ein Baby bekommen sollte, bestimmt nicht so leblos dalag.
»Gerlinde, Klara«, Hilke stand abrupt auf, »Johanna atmet nicht mehr!«
Gerlinde erstarrte. Sie beugte sich über Johanna, schaute verunsichert die leblos daliegende junge Frau an, rief ihren Namen, tätschelte ihre Wange.
»Ich hole jetzt den Arzt«, rief Hilke hektisch aus, »wir müssen doch bestimmt einen Krankenwagen rufen!«
»Warum?«, knurrte Klara unwirsch und beugte sich nun ebenfalls über Johanna. »Sollen die Rettungssanitäter dann das Baby bekommen? Johanna ist bestimmt nur kurz weggetreten. Das ist gut so, so kann sie Kräfte sammeln. Nein, auch Arno ist dagegen.«
Hilke schlug die Augen nieder, verbarg so, dass sie ganz anderer Ansicht war. Sie könnten Arno doch wenigstens fragen? Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, zu Arno zu gehen, und dem Respekt gegenüber Klara, blieb sie, wo sie war. Es stand ihr nicht zu, die Meinung der älteren Kameradin zu kritisieren. Sie, die eins mit der Natur war und deren Rhythmus im Blut spürte.
Das blutige Gemetzel, das Hilke in den folgenden Minuten erlebte, würde sie nie mehr vergessen. Wenn sie sich zukünftig morgens wusch und das warme Wasser über ihre Hände floss, färbte es sich vor ihrem inneren Auge tiefrot. Wenn sie das Frühstück zubereitete und sie den Kindern Milch austeilte, strömte ein tiefroter Strahl in die Tassen. Wenn sie die schmutzige Wäsche bearbeitete, meinte sie, tiefrote Flecken auf den Hemden ihrer Gefährten zu sehen. Und wenn Eike in der Nacht ihr Hemd hochschob und sie beschlief, sah sie nur Gerlinde vor sich, wie sie mit verbissenem Gesichtsausdruck das Baby aus Johannas totem Leib zerrte.
1. Kapitel
März 2023
Es sah aus, als ob die junge Frau sich mit beiden Händen die Ohren zuhielte, aber in Wirklichkeit presste sie ihre Handflächen an ihren Kopf, weil sie meinte, dass er sonst zerspränge.
Sie hatte gehofft, dass die laute Musik, das stroboskopische Licht, der Alkohol und der Joint, den sie vorher geraucht hatte, das Hämmern in ihrem Kopf verdrängen würden, aber nichts dergleichen war passiert. Stattdessen wurde ihr immer schlechter, obwohl sie ihre schnellen und ruckartigen Bewegungen zu der Musik einige Gänge heruntergeschaltet hatte.
In ihr kristallisierte sich langsam eine Erkenntnis heraus. Das Schlimmste war, dass sie nicht die tiefe Traurigkeit empfand, die sie eigentlich empfinden sollte.
Hamza hatte ihre Beziehung beendet, und obwohl sie noch wenige Tage davor davon überzeugt gewesen war, dass sie ihn tief und aufrichtig liebte, hatte sie ganz, ganz tief unten in ihrem Herzen Erleichterung gespürt.
Was stimmte nicht mit ihr?
War sie beziehungsunfähig?
Sie war jetzt fast achtundzwanzig Jahre alt, stand kurz vor ihrem Bachelor in Psychologie und wusste, dass sie auf jeden Fall mindestens ein Kind haben wollte. Natürlich nicht sofort, aber auch nicht erst, wenn sie kurz vor der Menopause stand. Warum hatte sie sich dann nicht mehr um ihre Beziehung mit Hamza gekümmert? Hatte sie offenen Auges voneinander wegdriften lassen? Hatte da ihr Unterbewusstsein bereits gewusst, dass Hamza nicht der Mann ihres Lebens war? Was absurd war. Sie hatten beide die gleiche Sicht auf das Leben, sowohl was die großen Themen wie Politisches und Weltanschauliches anging als auch bei den kleinen, privaten Dingen wie die Liebe zum Sport und zur Natur, oder den gleichen Sinn für intelligenten und hintergründigen Humor. Sie beide wollten gerne Kinder, waren Familienmenschen und liebten gutes Essen. Sie passten eigentlich perfekt zueinander.
Eigentlich.
Was hatte ihr gefehlt? Laura war davon überzeugt, dass Hamza dies schon länger gespürt hatte und sich deswegen innerlich von ihr zurückgezogen hatte. Ihre Kehle schnürte sich zu, und in ihr stieg ein Schluchzen hoch. Die laute Musik schluckte jedes Geräusch, das die Tanzenden machten, sodass sie nicht befürchten musste, dass jemand auf sie aufmerksam werden würde. Das grell flackernde Licht tat sein Übriges.
Abrupt blieb sie stehen, dann bahnte sie sich einen Weg durch die Menschenmenge auf der Tanzfläche zurück zur Bar. Sie begutachtete die Auswahl an Getränken, aber sie merkte, dass ihr Magen anfing zu rebellieren. Gut so, dachte sie, jetzt ist Schluss. Irgendwie muss ich ja noch nach Hause kommen. Gerade als sie sich leicht benommen von der Bar abwandte, bemerkte sie einen Mann, der plötzlich sein Gesicht abwandte und hinter einer Gruppe von feiernden Menschen verschwand. Im Grunde genommen hatte sie ihn kaum gesehen, weder sein Gesicht noch seine Statur oder seine Kleidung wirklich wahrgenommen, aber irgendetwas beunruhigte sie jetzt. Sie konnte dieses Gefühl nicht fassen, es war komplett diffus, und als sie sich wieder auf ihr Vorhaben, den Club zu verlassen und nach Hause zu fahren, konzentrierte, verflüchtigte sich dieser leise Hauch der Angst, der sie kurz gestreift hatte.
Christin Erlenbeck schaute auf das saubere, ungenutzte Gedeck, das wie ein Fremdkörper zwischen den Brötchenkrümeln, den Eierschalen und dem schmutzigen Geschirr und Besteck der anderen auf dem Esstisch stand. Sie bemerkte Freddies Blick, der ebenfalls darauf starrte.
»Sollen wir das jetzt wegräumen oder noch stehen lassen?«, fragte sie ihren Mann.
Freddie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung! Wenn wir es stehen lassen, kann es sein, dass Oskar gar nichts isst. Wenn wir es wegräumen, könnte er maulen, dass wir nicht für ihn mitgedeckt haben.«
Die Pfarrerin guckte auf ihre Uhr. »Es ist jetzt elf Uhr. Wenn Oskar meint, ausschlafen zu müssen, dann ist das ab jetzt sein Problem. Ich räume es weg. Er hat seine Chance gehabt.«
Freddie schaute seine Frau erschrocken an, dann trat ein fast wehmütiger Ausdruck in seine Augen.
Christin musste lachen. »Sehnst du dich jetzt schon nach den Zeiten zurück, als ein gemeinsames Frühstück eher einer Szene in einem Piratenfilm ähnelte?« Sie strich ihm liebevoll über die Wange.
»Dass es so schnell geht«, tatsächlich blickte ihr Mann sie ernst an. »Gestern noch haben wir uns nach etwas mehr Ruhe und Ordnung gesehnt, heute …«, er zögerte und betrachtete Flora, seine kleine Tochter, die völlig vertieft in ein Bilderbuch war, »jetzt fangen sie an, ihre eigenen Wege zu gehen.«
»Ja«, bestätigte Christin, »die Großen glänzen mehr durch Abwesenheit, aber die Sorgen bleiben. Wenn Oskar nicht langsam anfängt, wirklich vernünftig für die Schule zu lernen, braucht er gar nicht erst in die Oberstufe zu gehen. Und Matti ist auch zu selbstsicher. Auch wenn sie immer eine gute Schülerin war, muss sie ein wirklich Superabi hinlegen, um eine Chance auf einen Studienplatz für Psychologie zu haben.«
Freddie beugte sich zu Flora herüber und drückte ihr einen Kuss auf ihre blonden Locken. »Du weißt noch nix davon, wie wichtig die Schule ist!«
Unwirsch hob seine Tochter ihre Hand und drückte ihren Vater weg.
Flora, das gemeinsame Kind der Pfarrerin Christin Erlenbeck und des Polizisten Frederick Neumann, war erst vier Jahre alt. Manchmal wurde Freddie angst und bange bei dem Gedanken, wie seine temperamentvolle und durchsetzungsstarke Tochter in der Schule zurechtkommen würde. Gerne hätte er, so wie seine Frau, das feste Vertrauen in die Zukunft, dass Flora ihren Weg durch die Schule gut machte, aber tief in seinem Inneren zweifelte er daran. In Flora steckte die explosive Mischung aus Temperament und Intelligenz.
Polterige Schritte auf der Treppe rissen ihn aus seinen Gedanken. Er schaute in den Flur, und kurz darauf erschien Oskar. Trotz der noch kühlen Jahreszeit trug er nur ein ausgebeultes T-Shirt und Boxershorts. Der Teenager gähnte herzhaft, und als er in die reservierten Mienen seiner Mutter und seines Stiefvaters blickte, riss er reflexartig die rechte Hand zum Mund hoch. Dabei rutschte ihm sein Handy aus den Fingern und fiel auf die Fliesen im Flur.
»Scheiße!«, rief er.
»Oskar!«, entfuhr es Christin und Freddie gleichzeitig entrüstet.
Flora schaute über den Rand ihres hohen Bilderbuches und grinste. »Das gibt Ärger«, krähte sie schadenfroh.
Nachdem Oskar sein Handy aufgehoben und es mit kritischem Blick gemustert hatte, ging er zu seiner kleinen Schwester und riss ihr das Buch aus den Händen. Sofort schrie Flora empört auf, rutschte von ihrem Kinderstuhl und stürmte auf Oskar zu, der das Bilderbuch hoch über seinen Kopf hielt.
»Oskar!«, rief Freddie, aber seine Stimme ging in dem Geschrei des Teenagers und des Kleinkindes unter. Halb belustigt, halb resigniert wandte er sich an seine Frau. »Worüber haben wir gerade gesprochen?«
Christin lachte. »Lass es uns genießen!«
Kurze Zeit später war Christins fröhliche Stimmung wie weggeblasen. Obwohl Sonntag war, musste sie etwas arbeiten, was Freddie ihr »erlaubt« hatte. Die Arbeitsbelastung als Pfarrerin war in der Fastenzeit und angesichts des anstehenden Osterfestes immens hoch, zudem hatte es in der letzten Zeit einige Todesfälle gegeben, sodass es für sie sinnvoll war, an einem freien Sonntag mit ein, zwei Stunden Arbeit den Druck aus der kommenden Woche zu nehmen.
Jeder Todesfall betrübte sie, und sie bereitete ganz eindeutig lieber einen Traugottesdienst vor als eine Trauerfeier. Aber die meisten Beerdigungsgottesdienste waren für Verstorbene, die schon ein gewisses Alter erreicht und ihr Leben gelebt hatten.
In diesem Fall aber nicht.
Eine junge Frau war bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Sie hatte sich bewusst für eine Hausgeburt entschieden, obwohl sie Diabetikerin war. Somit hatte eine Risikoschwangerschaft bestanden, und eine komplizierte bis lebensgefährliche Entbindung war vorprogrammiert gewesen. Christin seufzte schwer auf. So unnötig, dachte sie. So sinnlos. Es kam ihr wie ein Bericht aus längst vergangenen Zeiten vor, als jede Geburt ein Risiko barg und Entbindungen für eine hohe Todesrate unter den gebärenden Frauen sorgten.
Welche Worte konnten den unendlichen Schmerz der Eltern der Verstorbenen lindern? Die Pfarrerin dachte an das kurze Gespräch mit ihnen zurück. Beide Elternteile waren sehr verschlossen gewesen, fast wütend, und konnten kaum sprechen. Auf Christins vorsichtige Frage nach dem Vater des Kindes und ob er nicht auch bei diesem Gespräch dabei sein sollte, war der Vater der jungen Frau so abrupt aufgestanden, dass dabei sein Stuhl nach hinten fiel. »Den will ich nicht am Grab meiner Tochter stehen sehen. Gar keinen von denen!«, hatte er wütend gezischt. So etwas hatte die Pfarrerin noch nie zuvor in einem Trauergespräch gehört. Sie hatte erwartet, dass seine Frau versuchen würde, ihn zu beschwichtigen, aber diese hielt den Blick auf ihre ineinander verschränkten Hände gesenkt. Christin hatte das Gespräch kurz darauf beendet und den trauernden Eltern zugesichert, dass sie jetzt genügend Anregungen für ihre Worte zur Beerdigung habe. Sie hatte allerdings nicht den Eindruck gehabt, dass es die beiden wirklich interessierte.
2. Kapitel
Einige Monate zuvor
Jasina umschloss die beiden Hände der alten Frau und drückte sie leicht. »Jetzt wieder schön«, sagte sie aufmunternd. »Sohn sieht schöne Mama.«
Die alte Frau verzog resigniert den Mund. »Als ob ihn das interessieren würde«, antwortete sie. »Wie lange bist du heute da?«
Jasina sah den hoffnungsvollen Ausdruck in den alten, schon etwas blassen Augen der Frau. »Ich sein da bis acht Uhr.«
»Ich bin da … nein, besser: Ich bin bis acht Uhr da«, korrigierte die alte Dame.
»Ich sei … bin … bis acht Uhr da«, wiederholte die Pflegerin langsam.
Die trüben Augen der Alten leuchteten auf. »Gut! Vergiss es nicht. Ist aber auch schwierig«, sie winkte ab. »Wenn du das nächste Mal da bist, frage ich dich die ›Sein‹-Formen ab. Die musst du können. Und schön, dass du noch da bist, wenn mein Sohn wieder weg ist. Dann …«, sie zögerte etwas und senkte dabei die Augenlider, »dann kannst du mir auf der Toilette helfen, bevor ich zu Bett gehe.«
Jasina drückte noch einmal sanft die Hände der alten Frau. »Ich machen das.«
Die alte Frau wollte sie wieder korrigieren, lächelte dann aber nur.
Jasina stand auf, verließ das Zimmer von Thea Wagner und setzte sich ins Dienstzimmer. Heute war Sonntag, und normalerweise ging dann alles etwas entspannter zu. Viele Bewohner des Seniorenheims bekamen Besuch, der sich an diesem Tag um einige alltägliche Bedürfnisse der alten Angehörigen kümmerte. Leider bekam auch Frau Wagner fast jeden Sonntag Besuch von ihrem Sohn. Groß, blond, breitschultrig, mit eigentlich attraktiven Gesichtszügen, wäre da nicht sein immer abschätziger, ja fast feindseliger Blick, wenn er Jasina ansah. Sie kannte diese Typen. Sie wusste, was diese Blicke bedeuteten. So gut es ging, versuchte sie ihm auszuweichen, wenn er seine Mutter in ihrem Rollstuhl über die Gänge schob, entweder zum Ausgang, um mit ihr einen Spaziergang im Freien zu machen, oder in eines der kleinen Wohnzimmer, die es in jedem Wohnbereich gab, um mitgebrachten Kaffee und Kuchen zu essen.
Aber es war ja nicht so, dass Thea Wagner ihr anfangs nicht auch mit Reserviertheit entgegengetreten wäre. Auch ihre abschätzigen Blicke hatte sie gespürt, etwa wenn sie sich bückte, um ihr in die Schuhe zu helfen. Und hatte sie bis zu diesem »Vorfall« nicht extra so getan, als ob sie Jasina nicht verstehen würde? Hatte erst mit spöttischem Lächeln, dann mit offensiver Ungeduld: »Hä? Mein Gott, lerne Deutsch!«, ausgerufen.
Eine Begebenheit hatte dann aber alles verändert. Wenn Jasina daran dachte, musste sie schmunzeln. Für sie, die schon in ihrer Heimat Syrien als Krankenschwester gearbeitet hatte und jetzt hier in Deutschland als Altenpflegerin angestellt war, gehörte es zum Alltag, aber für Thea Wagner war es ein großer Einschnitt in ihrem Leben gewesen. Sie hatte es wie ein kleines Kind nicht mehr rechtzeitig zur Toilette geschafft und ihren Darminhalt ziemlich plötzlich und würdelos in ihre Hose verloren, gerade in dem Moment, als Jasina ihr das Frühstück brachte. Thea war entsetzt gewesen, sie hatte vor Scham das Gesicht verzogen. Sie hatte versucht, sich in das kleine Badezimmer zurückzuziehen, aber Jasina hatte sie verständnisvoll lächelnd begleitet.
»Ich helfen«, hatte sie gesagt.
Thea Wagner hatte angefangen zu weinen und versucht, die Pflegerin wegzuschieben, aber Jasina war hartnäckig geblieben. Sanft hatte sie die verunsicherte alte Dame in die Dusche geschoben, ihr aus ihren Pantoffeln, der Hose und den Strümpfen geholfen und ihr dann den Unterleib gewaschen. Danach hatte sie ihr wieder in saubere Kleidung geholfen und ihr dabei wie selbstverständlich eine Vorlage in die Unterhose gelegt. Thea Wagner hatte ihr dabei nicht ein einziges Mal in die Augen geschaut, sie hatte weiterhin ihren Blick verschämt gesenkt gehalten. Erst kurz bevor Jasina das Zimmer verlassen wollte, hatte sie aufgeschaut.
»Vielen Dank«, hatte sie leise gemurmelt. »Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, ich habe mir vielleicht Magen-Darm eingefangen.«
»Passiert«, hatte Jasina geantwortet und dabei mit den Schultern gezuckt. »Allen. Ganz normal.«
Seitdem war Thea Wagner ihr gegenüber wie verwandelt. Sie lächelte ihr zu und berührte oft liebevoll-großmütterlich die Hände oder Arme der Pflegerin. Irgendwann war es ihr zur Gewohnheit geworden, Jasina zu korrigieren, und sie verlangte von ihr, ihre Sätze in richtigem Deutsch zu wiederholen. Ihre Kolleginnen und Kollegen hatten Jasina darauf angesprochen. »Findest du das gut? Ist das nicht übergriffig? Du gehst doch schließlich zu deinen Deutschkursen!«, wollten sie wissen.
Jasina hatte mit den Schultern gezuckt. »Nein, ist okay.«
Tatsächlich meinte die junge Frau sogar, dass sich ihre Grammatik durch Thea Wagners Hartnäckigkeit schon verbessert hatte.
Heute kam also wieder der Sohn. Irgendwie würde Jasina es auch an diesem Sonntag schaffen, ihm und seinen stechenden Blicken aus dem Weg zu gehen.
3. Kapitel
März 2023, Sonntag
Christin Erlenbeck und Laura Bauer hatten beschlossen, nach langer Zeit wieder einmal in dem Waldstück am Risselweg spazieren zu gehen.
Kurz nach dem Sonntagsfrühstück hatte Christin eine WhatsApp-Nachricht von Laura bekommen. Kann ich heute kommen? Ich muss dringend mit euch sprechen, stand in der Nachricht, die von verzweifelt aufheulenden Emojis begleitet war.
Klar. Du kannst ab etwa vierzehn Uhr kommen, dann gehen wir eine Runde mit Laika!? Kuss-Emoji, Hund-Emoji.
Als Antwort kamen ein Daumen-hoch-Emoji und ebenfalls ein Kuss-Emoji.
Christin ahnte schon, was ihre junge Freundin auf dem Herzen hatte. Sie hatte schon beim letzten gemeinsam verbrachten Abend das Gefühl gehabt, dass irgendetwas zwischen Laura und ihrem Freund Hamza nicht mehr stimmte.
Sie parkten auf dem Parkplatz des Kommunalfriedhofs, der direkt an der B8 lag und hinter dem der Wald begann, durch den sie gehen wollten.
Beide schwiegen, als sie den Risselweg entlanggingen und nach einigen Metern an die Stelle kamen, an der Lauras Mutter Nicole vor vielen Jahren, als Laura noch ein kleines Kind war, getötet worden war. Sie hielten an, und Christin sprach ein kurzes Gebet. Dann legte sie ihren Arm um Lauras Taille und zog die sichtlich aufgewühlte junge Frau mit sich in den Wald hinein. Christin war froh, dass Freddie bereitwillig mit Flora zu Hause geblieben war, so konnten die beiden Frauen ungestört reden.
»Hamza hat Schluss gemacht«, stieß Laura nach einer Weile hervor.
Christin sagte nichts, wartete ab, ob Laura von allein weiterredete.
Und das tat sie. Sie formulierte all ihre Selbstzweifel zu ihrer Beziehungsfähigkeit oder, wie sie meinte, Beziehungsunfähigkeit und geißelte sich selbst als verkorksten Psycho.
»Laura!«, unterbrach Christin sie nach einiger Zeit scharf. »Jetzt ist aber mal gut. Natürlich hast du mit Hamza einen absolut tollen Mann verloren, aber akzeptier doch einfach, dass Gott oder das Schicksal euch anscheinend nicht füreinander gemacht haben!«
Laura merkte, wie gut es ihr tat, mit Christin zu reden. Langsam kam sie auf andere Gedanken, und die Frauen erinnerten sich an einigen Stellen im Wald an das Verbrechen, das sie einige Jahre zuvor, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, gemeinsam gelöst hatten und das hier, in der sagenumwobenen Teufelskuhle, ein dramatisches, für Laura beinahe tödliches Ende genommen hatte.
Als sie wieder in dem Pfarrhaus an der Grünstraße ankamen, lief ihnen Flora in die Arme. Die Kleine vergötterte Laura, da ihre große Freundin meist zu wilden Spielen bereit war. Auch Freddie freute sich, sie wiederzusehen, und sie setzten sich zum Kaffeetrinken an den großen Esstisch. Christin spürte, dass es Laura schon besser ging.
»Matti hat mich zu Theo eingeladen«, verkündete Laura, nachdem sie kurz in ihre WhatsApp-Nachrichten geschaut hatte. »Wenn ich schon mal wieder in Voerde bin, soll ich unbedingt noch heute Abend vorbeikommen und mit ihnen gemeinsam essen.« Sie tippte schnell eine Antwort. »Dann gebe ich mir heute die volle Erlenbeck-Neumann-Dosis«, grinste sie.
»Papa?« Sigrid schaute zu ihrem Vater auf, der sie fest an der kleinen Hand hielt. Sie hatte das »Papa« auf dem zweiten A betont, sodass es sich wie »Papaa« anhörte.
»Jaa?« Ihr Vater ging auf das Spiel ein. Er ahnte, was nun kommen würde. An den Tagen, an denen sie ihn auf seinen Touren nach Löhnen begleitete, holte sie die gemeinsame Zeit mit ihm nach, die er im Alltag nicht für sie hatte.
Immer wenn die ersten Wespen auf dem kleinen Balkon in der Bergarbeitersiedlung in Möllen zu sehen waren, schaute sie ihn erwartungsvoll an. »Bald«, sagte er dann schmunzelnd, »vielleicht nächstes Wochenende.«
Und jetzt war es endlich so weit. Die Zwetschgen waren reif.
Schon kurz nach dem Frühstück hatte ihr Vater den alten Handkarren aus dem Schuppen hinter dem Mietshaus, in dem sie wohnten, herausgeholt. Im Kopf hatte Sigrid den Weg in das kleine Dorf in Etappen eingeteilt. Das erste Stück war der Weg aus der Siedlung heraus zur Frankfurter Straße. Ihre rechte Hand neben der ihres Vaters am Griff der Zugstange des Karrens, versuchte sie eifrig, mit ihrem Vater Schritt zu halten. Doch schon bald spürte sie, dass ihr Vater ungeduldig wurde. Es war anstrengend für ihn, sich auf die Höhe seiner kleinen Tochter herunterzubeugen. Die Schichtarbeit unter Tage im Bergwerk Walsum hatte ihren Tribut von seinem Körper gefordert, oft tat ihm jeder Knochen weh. Der Ausflug nach Löhnen, in der hellen Sonne, mit der Weite des Landes um ihn herum, tat ihm gut. Der Weg war eben und somit ein Leichtes für ihn. Früher war es selbstverständlich für ihn gewesen, ständig bergauf oder bergab zu gehen, denn er hatte seine Kindheit und Jugend im Bayrischen Wald verbracht und war erst vor einigen Jahren mit seiner Frau hierhergezogen. Er vermisste das dunkle Grün seiner Heimat, die ruhige Vertrautheit der Menschen in seinem Dorf Bischofsmais, die so ganz anders war als die offene Art der Menschen hier am Niederrhein. Aber in seinem Heimatort oder dort in der Nähe war es unmöglich für ihn gewesen, eine Familie zu ernähren. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, und so hatte er sich, wie viele andere aus seiner Heimat, dazu entschlossen, ins Ruhrgebiet zu ziehen und unter Tage in einem Bergwerk zu arbeiten. Denn arbeiten konnte er. Und mit den Jahren hatte er sich in dieser Landschaft, die so gar nichts mit seiner Heimat gemeinsam hatte, eingelebt.
Immer wenn er seine Tochter Sigrid betrachtete, hatte er das Gefühl, dass sie mehr unter der Zerrissenheit der Zugezogenen litt als er. Sie hatte keine Freundinnen, und auch die Lehrerin monierte regelmäßig, dass Sigrid im Unterricht zu still sei. Vielleicht, schlug sie dann vorsichtig vor, solle man zu Hause etwas mehr Hochdeutsch mit Sigrid sprechen? Bei dieser Erinnerung seufzte er tief auf. Wenn er am Abend, nach einem harten Tag unter Tage und einem gut halbstündigen Heimweg mit dem Fahrrad, zu Hause war, wollte er sich nicht noch anstrengen müssen, mit seiner Frau Ilse Hochdeutsch zu sprechen.
Jetzt, wo sie die Frankfurter Straße überquert hatten, würde Sigrid ihn bitten, ihr die Sage von dem alten Mann aus dem Berg zu erzählen. Er hatte sie ihr schon zigmal erzählt, aber seine Tochter konnte sie nicht oft genug hören.
»Erzählst du mir die Geschichte von dem alten Mann aus dem Berg?«, bat sie ihn dann auch wie erwartet.
Ihr Vater lachte. »Soll ich dir nicht vom Teufelstisch in Bischofsmais erzählen?«
»Das kannst du später«, antwortete Sigrid diplomatisch.
»Na gut«, knickte ihr Vater ein, scheinbar mit dem Angebot seiner Tochter, später den Sagen aus seiner alten Heimat zu lauschen, einverstanden. »Also: Letztens war wieder einer meiner Kumpel ganz ruhig und redete nichts …«
4. Kapitel
März 2023, Sonntagabend
»Laura!« Mathilda lief ihrer älteren Freundin schon entgegen, als die sich noch einen Weg durch die Pfützen und den Matsch suchte.
Ja, Matti hatte ja auch Gummiclogs an, sie schien sich schon an das Landleben angepasst zu haben. Laura war garantiert alles andere als etepetete, aber ihre neuen Sneaker wollte sie sich doch nicht sofort ruinieren.
»Du bist ja schon fast eine Bäuerin geworden«, bemerkte die Polizistin dann auch mit einem Blick auf Mattis erdverkrustete Schuhe. Sie ließ sich von ihrer jüngeren Freundin in den Arm nehmen und drückte sie mindestens ebenso fest, wie Mathilda sie drückte. Arm in Arm gingen sie dann auf ein großes Gebäude zu.
Laura guckte sich neugierig um. Viel hatte der Hof, der einmal Mathildas Freund Theo gehören würde, nicht mit einem Bilderbuchbauernhof gemeinsam. Alle Gebäude wirkten trotz des durch den Regen allgegenwärtigen Matschs gepflegt, aber eher funktional als bäuerlich-idyllisch. Auch das Wohnhaus sah modern aus, einzig mehrere alte, kleine Zinkwannen, die mit vielen bunt blühenden Pflanzen bepflanzt und über den ganzen Hof verteilt waren, lockerten den etwas tristen Anblick auf. Umso überraschter war Laura, als sie in das Bauernhaus trat. Das Äußere täuschte. In Wirklichkeit war das Haus wohl sehr viel älter, als es von außen wirkte. Liebevoll waren viele ursprüngliche Elemente wie die Holzdecke, die Bodendielen und der Kamin, in dem natürlich ein gemütliches Feuer brannte, aufgearbeitet worden und strahlten Gemütlichkeit aus, ohne altmodisch zu wirken.
Auch Theo begrüßte sie mit einer festen Umarmung und führte sie dann in ein großes Esszimmer. An dem langen Tisch saß schon ein älteres Pärchen, das Theo ihr als seine Eltern Karla und Christian vorstellte. Auf dem Tisch stand eine riesige, dampfende Auflaufform. Bei dem Duft lief Laura das Wasser im Munde zusammen.
Beim Essen der Gemüselasagne entspann sich sofort ein lebhaftes Gespräch, aber trotzdem war Laura froh, als sich Theo mit seinen Eltern etwas später zurückzog. »Entschuldige uns bitte«, sagte der angehende Bauer zu ihr, »meine Eltern und ich müssen noch besprechen, was in der nächsten Woche anliegt.«
»Die scheinen ja wirklich sehr nett zu sein«, sagte Laura mit gesenkter Stimme anerkennend.
Matti nickte. »Ja, die sind echt nett und total unkompliziert.«
Laura drückte über den Tisch hinweg die Hand ihrer Freundin. Dann fragte Matti sie über ihr Studium aus und natürlich auch über das Ende ihrer Beziehung zu Hamza. Aber Laura spürte, dass das nicht alles war. Schon wenig später bestätigte sich ihr Verdacht. Es klingelte an der Haustür, und Laura registrierte, dass Mathilda nicht überrascht war.
Die junge Frau druckste nun ein wenig herum. »Laura, ich habe dich noch aus einem anderen Grund hierhin eingeladen.«
Noch bevor diese etwas sagen konnte, öffnete sich die Tür zum Wohnzimmer, und herein kamen Theo, seine Eltern und ein weiteres Paar.
Fragend blickte Laura in die Runde.
»Ich hoffe, Sie sind nicht böse, aber«, Karla nickte zu dem fremden Paar »das sind Marga und Dirk Hochberg.« Sie räusperte sich unsicher. »Sie sind die Eltern von Johanna. Ihre …«, sie stockte und suchte nach Worten, »Tochter ist vor einigen Wochen verstorben.«
5. Kapitel
Einige Monate zuvor
Jasina spürte den bohrenden Blick wie eine Messerspitze in ihrem Rücken.
Blonde, akkurat geschnittene Haare. Blaue, wie arktisches Eis glänzende Augen, die sie anstarrten. Nicht, dass Jasina jemals die Arktis gesehen hätte, aber sie hatte Bilder von dem klaren, blauen Himmel, der das Eis und den Schnee zum Leuchten brachte, gesehen. Die schwarze Lederjacke endete kurz über dem Gesäß, und man konnte gut die breiten Schultern, die schmalen Hüften und die muskulösen Beine erkennen. Ein Bild von einem Mann. Einem deutschen Mann.
Stefan Wagner saß mit Thea im Gemeinschaftsraum, für den auch Jasina an diesem Sonntagnachmittag eingeteilt war, und leistete seiner Mutter Gesellschaft beim Abendessen. Neben ihnen saßen Elfriede und Elfriede, zwei Bewohnerinnen, die neben ihrem Vornamen auch eine Demenzerkrankung gemeinsam hatten. Ein anstrengendes Pärchen, zumindest für Menschen, die nicht in der Altenpflege arbeiteten.
»Ich habe Durst«, verkündete Elfriede, die im Gegensatz zu ihrer namensgleichen Mitbewohnerin groß und schlank war. Ihre Hand schob sich zu dem vollen Glas mit Apfelschorle, das Thea Wagner vor sich stehen hatte. »Kann ich das haben?«
»Nein«, knurrte Thea, »das ist meins. Sie haben schon gegessen. Wollten Sie nicht gerade gehen?«
Elfriede guckte enttäuscht, stand dann aber auf.
»Komm«, mischte sich nun die andere Elfriede ein, »wir müssen doch noch den Bus kriegen.« Hektisch blickte sie zur Tür, die auf den Flur und anscheinend zu einem Ziel führte, das sie heute noch gerne erreichen wollte.
»Jaja!«, ermunterte Thea Wagner die beiden und zwinkerte ihrem Sohn zu. »Der Bus kommt gleich.«
Die durstige Elfriede setzte sich wieder und schob ein weiteres Mal ihre Hand in Richtung der Apfelschorle. »Ich habe so einen Durst. Kann ich das haben?«
»Nun komm doch!«, insistierte die kleine, etwas dickliche Elfriede. Sie war der Verzweiflung nahe. »Der Bus fährt gleich.«
Jasina beobachtete amüsiert, wie unwohl sich Theas Sohn fühlte. Die beiden dementen Bewohnerinnen gingen ihm sichtlich auf die Nerven, aber er wusste nicht, wie er sie loswerden konnte.
Nun suchte auch Thea Wagner Jasinas Blick, indem sie den Kopf mühsam über ihre Schulter wandte. Eine schon weit fortgeschrittene Arthrose engte ihren Bewegungsradius stark ein. Ihr Sohn bemerkte Theas Versuch, sich bei der Altenpflegerin bemerkbar zu machen, und runzelte die Stirn.
Kurz überlegte Jasina, so zu tun, als ob sie Theas Hilfe suchenden Blick nicht gesehen hätte, entschied sich dann aber anders. Im großen Bogen, um möglichst nicht mit dem Sohn in Kontakt zu kommen, näherte sie sich dem Tisch. Sie fasste die sitzende Elfriede, die immer noch auf das volle Glas starrte, sanft am Arm. »Komm, Elfriede, du vielleicht gucken Fernsehen?« Dann wandte sie sich an die andere Elfriede, deren Blick immer wieder hektisch zwischen ihrer Freundin und der Tür hin und her ging. »Und Sie bleiben vielleicht eine Nacht hier? Bus ist schon weg.«
Die Erleichterung über diese Möglichkeit war sofort in Elfriedes Gesicht zu sehen.
»Du bist ein Engel«, hörte Jasina Thea Wagner sagen, als sie die beiden Bewohnerinnen sanft aus dem Speiseraum führte.
Der stechende Blick aus den Augen ihres Sohnes war Jasina jedoch nicht entgangen.
6. Kapitel
März 2023, Sonntagabend
Als Laura in die verzweifelten Augen von Marga und Dirk schaute, schämte sie sich ein wenig für den Unmut, den sie gegenüber Mathilda, Theo und seinen Eltern verspürt hatte. Das ganze Treffen war eingefädelt worden, damit die trauernden und verzweifelten Eltern sich an sie wenden konnten. Laura zweifelte nicht daran, dass ihre jüngere Freundin sie wirklich hatte sehen wollen und sich sehr über ihren Besuch gefreut hatte, aber Mattis Hauptintention war es wohl gewesen, Laura in ihrer Eigenschaft als Polizistin auf den Hof einzuladen.
Widerstrebend hatte Laura sich von Marga und ihrem Ehemann die tragische Geschichte ihrer Tochter Johanna erzählen lassen. Nachdem sie fertig waren, herrschte lange Schweigen an dem großen Tisch. Nur das trockene, kurze Knallen der verbrennenden Holzscheite im Kamin war ab und an zu hören. Laura hatte sich ein halbes Glas Rotwein einschenken lassen, auf das sie jetzt starrte.
Dann gab sie sich einen Ruck. »Habt ihr das Dokument noch?«, fragte sie. »Entschuldigt, das Du ist okay?«
Johannas Eltern nickten. »Ja, natürlich haben wir es noch.«
»Und es ist wirklich echt?«, hakte Laura nach. »Ich meine, handgeschrieben?«
Wieder nickten Marga und Dirk.
»Ja«, bestätigte Dirk mit brüchiger Stimme. »Es besteht kein Zweifel.«
»Johanna war volljährig …«, setzte Laura behutsam an, wurde aber rüde unterbrochen.
»Johanna wurde einer Gehirnwäsche unterzogen«, fuhr Marga auf. »Es gibt genug Fälle, in denen vor Gericht dieser Aspekt einbezogen wurde und die dominanten, manipulativen Täter verurteilt worden sind!«
»Nichtsdestotrotz war es Johannas Entscheidung, sich dieser Gruppe anzuschließen«, entgegnete Laura ruhig, »Sie war über achtzehn, war eine gesunde, normale und intelligente Frau und hatte das Recht, diesen Weg zu gehen.«
»Sie war nicht gesund«, warf Dirk ein.
»Sie war geistig gesund«, korrigierte Laura sich und fragte sich im selben Moment, ob dies die richtige Ausdrucksweise war. »Also, ich meine, voll zurechnungsfähig. Sie hätte genauso gut entscheiden können, eine Mount-Everest-Besteigung zu machen.«
»Ehrlich jetzt? Du vergleichst die komplette Selbstaufgabe unserer Tochter in dieser bekloppten, sektenähnlichen Gruppe mit einer Berg-Challenge?« Dirk stand auf und verschränkte wütend die Arme vor der Brust.
»Entschuldigt.« Ehrlich zerknirscht senkte Laura den Blick. »Es tut mir leid. Aber ich bin nur eine einfache Polizistin und im Moment sogar für mein Studium freigestellt. Und wenn die Staatsanwaltschaft eine Klage gegen diese … dieses Spirituelle Zentrum abgewiesen hat, und dies sogar relativ schnell, was soll ich da machen?« Dann schaute sie Mathilda an. »Es tut mir leid, wenn Matti euch falsche Hoffnungen bezüglich meines Einflusses gemacht hat, aber …« Sie ließ den Satz unbeendet.
»Mathilda hat gar nichts damit zu tun«, mischte sich nun Theos Vater in das Gespräch ein. »Es war meine Idee. Matti hat viel über dich geredet. Du inspirierst sie dazu, auch Psychologie studieren zu wollen. Ich …«, er stockte kurz, »ich kannte aber auch deine Mutter und hab ein bisschen von deinen … wilden Jahren gehört. Deswegen weiß ich, dass du dich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kannst. Und deswegen dachte ich, dass du mit deinem Eintreten für Johannas Fall in eurer Truppe vielleicht doch noch etwas bewegen könntest.«
Laura presste die Lippen zusammen und dachte nach. Dann hörte sie das unterdrückte Schluchzen von Marga Hochberg. Johannas Mutter nestelte an dem Reißverschluss ihrer Tasche, die sie die ganze Zeit auf ihrem Schoß gehalten hatte. Erst dachte Laura, sie würde nach einem Taschentuch suchen, doch dann bemerkte sie, dass Marga etwas anderes aus der Tasche zog.
»Das ist unsere Tochter Johanna«, sagte die trauernde Mutter jetzt mit fester Stimme und schob eine Fotografie über den Tisch in Lauras Richtung. Laura betrachtete das Foto. Eine junge Frau mit blonden, langen Haaren grinste den Betrachter breit an. Ein fester Blick aus leuchtend blauen Augen.
»Und dies ist Frieda«, ein weiteres Foto schob sich in Lauras Blickfeld. »Unsere jüngere Tochter. Volljährig. Wie Johanna und ich ebenfalls Diabetikerin. Seit einem halben Jahr Bewohnerin des Spirituellen Zentrums. Und, wie wir gehört haben, schwanger.«
Nur in dem wenigen Licht, das die Leuchte der Dunstabzugshaube spendete, saß Laura schon kurze Zeit später ihrer Stiefmutter gegenüber.
»Gemütlich«, sagte sie anerkennend, den Blick über den kleinen Tisch mit den bequemen Stühlen wandern lassend.
Claudia lächelte leicht, fast etwas verlegen. »Dein Vater und ich sind ja fast nur noch zu zweit.«
Beide hatten sie einen Ramazotti mit viel Eis und einer Zitronenscheibe vor sich stehen, an dem sie genüsslich nippten.
Unterschiedlicher konnten zwei Frauen kaum sein. Claudia war sehr zielstrebig, stets gut organisiert und immer pragmatisch. Laura hatte sich lange treiben lassen, bis sie ihre Berufung zu einer Laufbahn bei der Polizei erkannt hatte. Darüber hinaus neigte sie zu spontanen Entscheidungen, und Ordnunghalten fand sie völlig überbewertet. Jahrelang hatte sie ihre Stiefmutter abgelehnt; erst als vor einigen Jahren das Geheimnis um den Tod von Lauras leiblicher Mutter gelüftet worden war, hatten die beiden es geschafft, eine wirklich innige und harmonische Beziehung aufzubauen. Zu dieser Vertrautheit gehörte mittlerweile auch ein spätabendliches Gespräch, wenn Laura in Voerde bei ihren Eltern übernachtete. Claudia war oft noch wach, wenn Laura mitten in der Nacht ankam; so wurde es beiden zu einer lieb gewonnenen Gewohnheit, noch einen gemeinsamen Absacker zu trinken und dabei über Dinge zu reden, die Laura besser mit ihrer Stiefmutter als mit ihrem Vater besprechen konnte. Dabei entdeckten sie ihre gemeinsame Vorliebe für Ramazotti.
»Puh!«, stöhnte Laura auf und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Noch etwas mochte Laura an den Gesprächen mit Claudia. Sie konnte sich hundertprozentig darauf verlassen, dass alles, worüber sie mit ihrer Stiefmutter sprach, in dieser Küche blieb. Mit wenigen Worten erzählte sie Claudia von dem Gespräch mit Marga und Dirk.
»Oh mein Gott!«, entfuhr es Claudia. »Das ist furchtbar. Davon habe ich ja gar nichts gehört.«
Laura nickte zustimmend. »Sie haben es auch ziemlich unter Verschluss gehalten. Marga und Dirk machen sich selbst unwahrscheinlich große Vorwürfe, und sie wollen auf gar keinen Fall, dass sie von allen möglichen Leuten angesprochen werden.«
»Das glaube ich. Wenn ich mir vorstelle, dass solche Typen dich … also, völlig manipulieren und …« Claudia presste wütend die Lippen aufeinander. »Die armen Eltern werden sich den Rest ihres Lebens fragen, ob sie ihre Tochter noch hätten retten können. Warum sie sie nicht einfach gekidnappt und in ihr Kinderzimmer gesperrt haben.«
Mit gesenktem Blick nickte Laura. »Aber du weißt selbst«, seufzte sie und schaute ihre Stiefmutter dann mit einem bitteren Zug um die Mundwinkel an, »dass das nicht immer geht. In diesem Fall haben Marga und Dirk auch bestimmt nicht damit gerechnet, dass Johannas Begeisterung für dieses Spirituelle Zentrum zu ihrem Tod führt.«
Einen Moment schwiegen sie wieder. Nur das leise Klirren der Eiswürfel in den mittlerweile fast leeren Gläsern war zu hören.
»Verstehe ich das richtig«, brach Claudia das Schweigen, »diese Typen von diesem Zentrum da in Löhnen haben gewusst, dass Johanna Diabetikerin war?«
»Ich denke, ja.«
»Und denen kam nicht in den Sinn, dass man da eventuell keine Hausgeburt machen kann? Ich finde schon, dass das … na ja, zumindest grob fahrlässig war.«
»Ja«, bestätigte Laura. »Das war ja auch der Ansatz von Johannas Eltern. Aber die Staatsanwaltschaft hat keinen Anlass gesehen, Margas und Dirks Anzeige stattzugeben. Das Dokument, in dem Johanna versicherte, alles aus freiem Willen zu tun und von ihrem Mann und der Gemeinschaft zu nichts gezwungen worden zu sein, entlastet dieses Spirituelle Zentrum.«
»Was stellen sich die beiden denn dann vor? Du hast doch keinen Einfluss auf die Staatsanwaltschaft. Du bist doch nur, entschuldige bitte, ein kleines Licht in dem System und zudem als Studentin gerade gar nicht aktiv im Polizeidienst.«
Laura stieß ein Schnauben aus. Claudia zog die Augenbrauen in die Höhe, sie kannte ihre Stieftochter und wusste, dass ihre letzte Bemerkung eher Lauras Kampfgeist weckte, als sie zu entmutigen.
»Einer der Duisburger Staatsanwälte ist einer meiner besten Freunde«, entgegnete diese dann auch energisch. »Mit einer seiner Kolleginnen stehe ich auf gutem Fuß. Mit dem neuen Polizeipräsidenten habe ich schon ein sehr gutes Gespräch über meine Zukunft geführt. Also …«, sie zuckte mit den Schultern, leerte ihr Glas und stellte es wieder exakt in den feuchten Kreis, den es auf dem Tisch hinterlassen hatte. »Ich würde sagen, dass ich zumindest Gehör finden werde.«
Obwohl sie in diesem Jahr schon den dritten Sommer mit ihrem Vater nach Löhnen auf den Hof der Dussmanns kam, war sie wieder beeindruckt vom Anblick des großen, strahlend weiß leuchtenden Hauses. Natürlich war das Haus Löhnen, wie ihr Vater es immer nannte, nicht strahlend weiß. Wenn man genauer hinschaute, sah man die grünen, moosigen Stellen, die sich langsam auf dem Putz ausbreiteten. Auch die dunklen Flecken, die wie graue Regenwolken aussahen, schienen von Jahr zu Jahr größer zu werden. Aber für Sigrid, die nur die Enge der Mehrfamilienhäuser in ihrer Straße in Möllen und das kleine, fast schon baufällige Bauernhaus ihrer Großeltern in Niederbayern kannte, mutete dieser Hof fast schon wie ein Schloss an. Es gab sogar eine Zufahrt zum Haupteingang, mit einer Brücke, die über einen kleinen Wassergraben führte.
Und dieses Mal saß Hein auf einer kleinen Mauer aus Backsteinen.
Hein war der Sohn der Dussmanns. Er war nur etwas älter als Sigrid, genauso groß und wie sie ein Einzelkind. Als sie das erste Mal mit ihrem Vater zum Zwetschgenpflücken nach Löhnen gekommen war, hatte Hein sie anfangs nicht beachtet und weiter mit wichtigtuerischem Gebaren seine Arbeiten auf dem Hof verrichtet. Lene Dussmann, seine Mutter, hatte Mitleid mit dem dünnen Bergmannskind, das gelangweilt am Rand der Obstwiese stand. Sie forderte ihren Jungen mit strenger Stimme auf, Sigrid mitzunehmen und ihr den Hof zu zeigen. Widerwillig fügte Hein sich, aber dann taute der mürrische Junge immer mehr auf, und schließlich rannten beide lachend durch die Ställe.
Sein freudiges Lächeln war unter seinem dicken Haarschopf, der ihm wie immer ins Gesicht fiel, kaum zu sehen, aber Sigrid nahm es wahr. Kurz wunderte sie sich. Beide waren wieder ein Jahr älter geworden, es waren Ferien, und in Löhnen gab es auch andere Kinder, natürlich auch Jungen in seinem Alter, mit denen Hein in die Löhnener Dorfschule ging. Warum saß er dann alleine dort und schien auf sie gewartet zu haben? Doch dann dachte Sigrid an die Mädchen und Jungen, die in Möllen in ihrer Nachbarschaft wohnten und zu denen sie bisher auch noch nie ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt hatte. Vielleicht war Hein auch so wie sie?
Auch Sigrid ließ sich ihre Freude auf die zwei bevorstehenden Tage, an denen sie mit ihrem Vater zu Dussmanns kam, nur wenig anmerken. Die Bäuerin und der Bauer wurden freundlich mit einem kleinen Knicks begrüßt, Hein dagegen ignorierte sie.
Dann stand der Junge von der Mauer auf. »Komm«, sagte er nur. Und Sigrid folgte ihm.
Sigrid wusste, dass sie jetzt viel Zeit haben würden. Bei der Ernte brauchte sie immer noch nicht zu helfen. Es war für ein zehnjähriges Mädchen viel zu gefährlich, auf der Leiter, die stellenweise schon ziemlich ausgetretene Sprossen hatte, zu stehen und sich zu den Zwetschgen zu strecken. Außerdem hatte sie fast schon panische Angst vor den Schweinen, die auf den Obstwiesen frei herumliefen.
»Was ist das für ein Loch?«, hatte Sigrid gefragt, als sie das erste Mal bis an das Ende der Wiese gekommen war, die hinter dem Bauernhaus lag. Sie standen vor einer Senke, deren Wände teilweise mit Brettern verkleidet waren.
»Das ist eine Lehmgrube«, hatte Hein ihr geantwortet.
»Geht es da in den Berg?«
»Nein!« Hein hatte überrascht aufgelacht. »Siehst du hier irgendwo einen Berg?« Er hatte dabei mit der Hand auf die Wiese um sie herum gedeutet. Dann war ihm eine Idee gekommen. »Meinst du was anderes?« Er hatte sich daran erinnert, dass Sigrid manchmal andere Wörter verwendete, zum Beispiel sagte sie Semmel für Brötchen.
Sigrid hatte überlegt. »Ja. Ob es dahinter, hinter diesen Brettern, in ein Bergwerk geht.« Dann hatte sie den Kopf geschüttelt. »Na. Wahrscheinlich net. Aber wenn«, sie hatte sich zu Hein umgedreht und mit leiser Stimme weitergeredet, »dann könnten wir den alten Mann im Berg suchen, und vielleicht würde er uns dann zu ganz großen Schätzen führen.«
Hein hatte sie mit großen Augen angestarrt. Dann lachte er laut auf. »Woran ihr so alles glaubt! Hier gibt es keine Schätze. Nur Mist und Dreck.«
7. Kapitel
März 2023
Es hatte Laura einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, die beiden Staatsanwälte Melanie Neuwerth und Rolf Trautmann gleichzeitig in ein Besprechungszimmer des Duisburger Polizeipräsidiums zu bekommen. Beide steckten bis zum Hals in Arbeit.
Laura hatte ihre Dokumente und Notizen vor sich liegen. Etwas nervös umfasste sie den kleinen Stapel Papiere, richtete ihn auf, stupste ihn mehrmals auf den Tisch und legte ihn genauso ordentlich, wie er vorher gewesen war, wieder hin. Rolf Trautmann warf seiner Kollegin Melanie Neuwerth einen fragenden Blick zu, doch diese schüttelte nur unmerklich den Kopf.
Dann räusperte sich Laura. »Mir wurde ein Fall angetragen, von dem ich mir wünschen würde, dass ihr ihn euch noch einmal anschaut«, sagte sie.
Wieder tauschten die beiden Staatsanwälte Blicke aus, dann warteten sie auf weitere Erklärungen.
»Also«, fuhr Laura nun mit festerer Stimme fort. »Es geht um eine junge Frau, die im Februar durch unterlassene Hilfeleistung zu Tode gekommen ist.« Sie nahm das erste Dokument von dem ordentlichen Stapel. »Johanna Hochberg. Sie ist mit einundzwanzig Jahren bei der Geburt ihres Kindes gestorben. Zu dem Zeitpunkt lebte sie in einer …«, sie stockte kurz, suchte nach dem passenden Wort, »ich denke, es ist eine Art WG, also Wohngemeinschaft, in Löhnen.«
Laura berichtete den beiden Staatsanwälten von den tragischen Umständen, die zu Johannas Tod geführt hatten, von der Anzeige der Eltern gegen das Spirituelle Zentrum und von der Diabeteserkrankung Johannas. Sowohl Melanie Neuwerth als auch Rolf Trautmann hörten ihr zwar aufmerksam, insgesamt aber eher ungerührt zu. Nur als sie das Spirituelle Zentrum erwähnte, hatte Laura das Gefühl, dass die beiden einen kurzen Blick tauschten.
»Nun«, begann Rolf Trautmann zögerlich, »das hört sich wirklich nach, wenn nicht unterlassener Hilfeleistung, dann doch billigend in Kauf genommenem Schaden an. Warum haben die Kolleginnen und Kollegen denn nicht weiterermittelt?«
Mit zusammengepressten Lippen schob Laura den beiden ein weiteres Dokument zu.
Melanie Neuwerth spitzte die Lippen. »Da liegt der Hase also begraben.« Sie schüttelte den Kopf. »Da können wir nichts machen.«
Laura ballte die Hände zu Fäusten. »Johanna war gerade erst einundzwanzig Jahre alt. Und sie stand unter dem Einfluss dieser Leute in dieser Kommune. Spirituelles Zentrum. Da finde ich gar nichts drüber, noch nicht einmal im Netz. Was sind das überhaupt für Leute? Vielleicht haben die ihr Drogen gegeben? Dann wäre diese Willenserklärung nichtig.« Sie stand auf, verschränkte die Arme vor der Brust. »Ihre kleine Schwester Frieda ist jetzt auch bei diesen Typen. Sie ist auch Diabetikerin. Und schwanger!« Lauras Stimme schraubte sich immer mehr in die Höhe. »Soll sie erst sterben, bevor man diese Leute mal unter die Lupe nimmt?«
Der Staatsanwalt hielt eins der Dokumente in seinen riesigen Händen. »Hier steht, dass weder dieser Leiter des Zentrums, Arno Gehrenberg, noch der Vater des Kindes, Robert Spieker, vorbestraft oder der Polizei durch irgendein Fehlverhalten schon einmal aufgefallen sind.«
»Das heißt doch gar nichts«, erwiderte Laura. »Und das wisst ihr auch.«
Melanie Neuwerth warf ihrem Kollegen wieder einen Blick zu. »Rolf und ich werden uns den Fall noch einmal angucken.« Sie stand auf. »Mehr können wir dir im Moment nicht zusagen.«
Als Laura wieder alleine in dem kleinen Besprechungsraum saß, schob sie die Papiere zusammen und räumte sie in ihre Tasche. Sie musste sich sehr anstrengen, die Unterlagen nicht wütend durch den Raum zu werfen. Sie wusste, dass sie lernen musste, mit »so etwas« zu leben, wenn sie weiter bei der Polizei arbeiten wollte, aber es war das erste Mal, dass sie selbst in Berührung mit so einem für sie absolut ungerechten Vorgehen kam. Ihrer Ansicht nach lag ganz offensichtlich ein Verbrechen vor, aber für die Justiz bestand nach gesetzlichen Verfahrensweisen kein Anlass, tätig zu werden.
Wahrscheinlich erst, wenn auch Frieda gestorben ist, dachte sie, und Bitterkeit stieg in ihr hoch.
Um sich abzureagieren, rannte sie durch das Treppenhaus, um in die Tiefgarage zu kommen, in der ihr Auto stand. Eine kleine Chance bestand noch, dachte sie, als sie sich Stufe für Stufe dem Untergeschoss näherte. Immerhin hatten die beiden Staatsanwälte ihr zugesichert, sich den Fall noch einmal anzugucken.
Gerade als die schwere Tür, die zu den parkenden Autos führte, mit einem lauten Krachen hinter ihr zufiel und sie im Halbdunkel stand, sah sie, wie sich ein paar Schritte weiter die Tür des Aufzugs, der in die oberen Stockwerke des Präsidiums fuhr, schloss. Es war nur ein ganz kurzer Blick, den sie auf die Person in dem Aufzug erhaschte, aber sie hatte auf einmal das Gefühl, diese Person zu kennen. Und sie verband keine angenehmen Erinnerungen mit ihr.
Später saß Laura zu Hause an ihrem Schreibtisch und starrte auf den Bildschirm ihres PCs. Viel zu viele Gedanken fuhren in ihrem Kopf Karussell. Immer wieder ertappte sie sich dabei, gerne mit Hamza sprechen zu wollen, dann wollte sie Begriffe wie »Diabetes« und »Schwangerschaft« googeln, statt weiter an ihrer Bachelorarbeit zu arbeiten. Und über all diesen Gedanken schwebte ein Name. Stefan Wagner.
Wie lange war es jetzt her? Laura dachte kurz nach. Die vergangenen Jahre waren so ereignisreich gewesen, hatten ihr so viele Veränderungen gebracht, dass sie fast schon nicht mehr nachkam. Von der betrunkenen, durch ihr Leben trudelnden jungen Frau zur ausgebildeten Polizistin, dann zur Psychologiestudentin, die ihre Bachelorarbeit schrieb und ihre Zukunft bei der Polizei sah.
Drei Jahre.
Vor fast genau drei Jahren hatte sie sich fast buchstäblich in die Höhle des Löwen begeben, um Freddie zu helfen. Laura hatte gehofft, dass Stefan Wagner im Besitz von entlastenden Beweisen war, und da Wagner, ein polizeibekannter Anführer rechtsradikaler Skinheads, natürlich nicht mit der Polizei kooperierte, hatte sie sich mit einer falschen Identität in seine Wohnung geschleust. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie diesem Mann irgendwann wieder über den Weg laufen würde.
Oder er sie fand.
Und Rache üben wollte.
Aber konnte es sein, dass er ihr im Polizeipräsidium aufgelauert hatte? Das wäre doch zu gewagt gewesen. Laura hatte ihren Lebensstil nicht verändert, lief immer noch nachts alleine durch Parks oder andere einsame Gegenden, wo er genug Möglichkeiten gehabt hätte, sie abzufangen und sich zu rächen. Aber was hatte er dann im Präsidium gewollt?
Sie schnaubte spöttisch. Wahrscheinlich hatte er eine Vorladung bekommen. War in irgendwelche Übergriffe auf Ausländer verwickelt.
Der durchdringende Klingelton ihres Smartphones ließ sie aufschrecken. »Ja?«, bellte sie etwas atemlos in das Handy.
»Laura?«, hörte sie Skalecki verunsichert fragen.
»Ja, klar. Entschuldige.« Jetzt musste sie lachen. »Ich war total in Gedanken. Ich … äh … sitze vor meiner Abschlussarbeit. Was gibt’s?«
»Dann will ich dich auch gar nicht lange stören«, antwortete die Kriminalhauptkommissarin. »Rolf hat mir vorhin von eurem Gespräch heute auf dem Präsidium erzählt.«
»Und?«, fragte Laura aufgeregt.
»Nichts ›und‹. Ich wollte …«, jetzt zögerte Skalecki, »ich wollte dich nur warnen, keine Alleingänge zu unternehmen.«
Stille.
»Alleingänge?«, wiederholte Laura dann.
»Ich meine, in dieses Spirituelle Zentrum«, antwortete Skalecki ungeduldig. »Ich kenne dich doch. Rolf und ich haben Befürchtungen, dass du auf eigene Faust dorthin gehst und dieses andere Mädchen finden und befreien möchtest.«
Laura presste die Lippen zusammen. »Tatsächlich habe ich bis gerade eben gar nicht daran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst … ich werde mal darüber nachdenken!«
»Laura«, rief Skalecki streng ins Handy. »Das war doch wohl jetzt ein Scherz. Hör zu, Rolf und Melanie prüfen den Fall noch einmal. Darauf kannst du dich verlassen. Aber bitte konzentriere du dich auf deine Bachelorarbeit und lass die beiden ihre Arbeit machen.« Sie machte eine kurze Pause. »Glaube mir, Rolf geht der Tod von dieser Johanna auch sehr an die Nieren. Was meinst du, wie der hier vorhin getobt hat! Und diese Typen leben ja auch noch in Löhnen, das ist bei uns ja direkt um die Ecke.«
Im letzten Jahr hatten die Kriminalhauptkommissarin und ihr Ehemann, der Staatsanwalt Rolf Trautmann, ein Haus in Mehrum, einem Rheindorf im Stadtgebiet Voerde, gekauft. Nachdem der Tod eines Ehepaars fast das ganze Dorf unter Verdacht gestellt hatte, hatten sie befürchtet, dort nicht glücklich werden zu können. Zu ihrem großen Glück klärte sich der Fall aber zu ihren Gunsten, und sie genossen in vollen Zügen die traumhafte Lage, die netten Nachbarn und die Ruhe.
»Dann seht zu«, konterte Laura fast bissig, »dass die Ermittlungen zu Johannas Tod wiederaufgenommen werden.«
8. Kapitel
Einige Monate zuvor
M