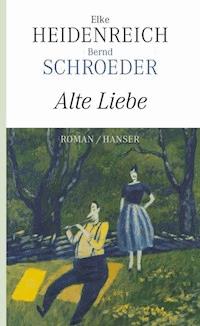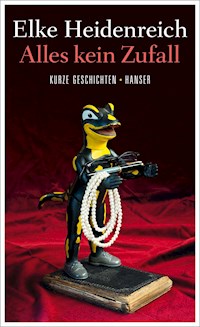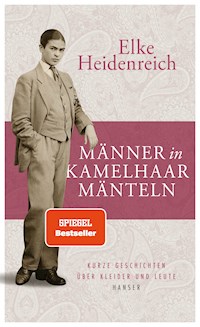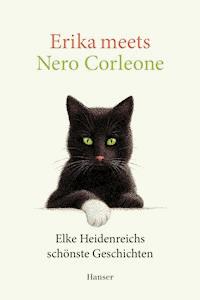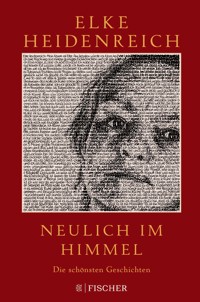Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Hanser Berlin LEBEN
- Sprache: Deutsch
Reihe Leben: Elke Heidenreich schreibt ganz persönlich über ein Thema, das uns alle betrifft. Ein ehrliches Buch über das Altern, das Mut macht. Alle wollen alt werden, niemand will alt sein. Der Widerspruch ist absurd, das Leiden daran real. Wie lernen wir, so gut wie möglich damit zurechtzukommen? Geht das, alt werden und ein erfülltes Leben führen? Elke Heidenreich hat sich mit dem Altwerden beschäftigt. Herausgekommen ist dabei ein Buch, wie nur sie es schreiben kann. Persönlich, ehrlich, doch nie gnadenlos, mit einem Wort: lebensklug. Sie denkt über ihr eigenes Leben nach, und das heißt vor allem, über ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Im Alter trägt man die Konsequenzen für alles, was man getan hat. Aber mit ihm kommt auch Gelassenheit, und man begreift: "Das meiste ist vollkommen unwichtig. Man sollte einfach atmen und dankbar sein."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Das Leben lesen: Elke Heidenreich schreibt ganz persönlich über ein Thema, das uns alle betrifft. Ein ehrliches Buch über das Altern, das Mut macht.Alle wollen alt werden, niemand will alt sein. Der Widerspruch ist absurd, das Leiden daran real. Wie lernen wir, so gut wie möglich damit zurechtzukommen? Geht das, alt werden und ein erfülltes Leben führen? Elke Heidenreich hat sich mit dem Altwerden beschäftigt. Herausgekommen ist dabei ein Buch, wie nur sie es schreiben kann. Persönlich, ehrlich, doch nie gnadenlos, mit einem Wort: lebensklug. Sie denkt über ihr eigenes Leben nach, und das heißt vor allem, über ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Im Alter trägt man die Konsequenzen für alles, was man getan hat. Aber mit ihm kommt auch Gelassenheit, und man begreift: »Das meiste ist vollkommen unwichtig. Man sollte einfach atmen und dankbar sein.«
Elke Heidenreich
Altern
Hanser Berlin
Ich widme dieses Buch mit Dank und Liebe meiner Freundin Elisabeth von Borries, die, während ich es schreibe, im 106. Lebensjahr ist und mir, als ich ein unglücklicher Teenager war, Liebe gab, Wärme, ein Nest.
Cicero, De senectute: »Mir jedenfalls war die Abfassung dieses Buches so angenehm, dass sie nicht nur sämtliche Beschwerden des Alters beseitigt, sondern das Alter sogar behaglich und angenehm gemacht hat.«
Ich habe mein Leben komplett in den Sand gesetzt.
Geboren wurde ich noch im Krieg, meine Eltern waren keine netten Leute, und ich war kein nettes Kind. Als die Konflikte unerträglich wurden, kam ich zu Pflegeeltern in ein ebenso gefühlskaltes wie intellektuelles evangelisches Pfarrhaus, Diskussionen am Abendbrottisch über Heidegger und Habermas. Klavierstunden, Nachhilfe in Mathematik, Abitur. Studium nach zwölf Semestern abgebrochen, langer Krankenhausaufenthalt: Lungenoperation. Die Ärzte gaben mir noch fünf Jahre. Klar, ich hatte seit Jahren Kette geraucht. Danach erste, zu frühe Heirat, nach wenigen Jahren Scheidung. Zweite Heirat, nach fünfundzwanzig Jahren Trennung, nach zweiundvierzig Jahren dann die zweite Scheidung. Krankenhaus: Krebs. Klar, falsches Leben. Fürs Fernsehen gearbeitet, und die beste Sendung, die ich je gemacht habe — die Buchsendung »Lesen!« — in den Sand gesetzt, weil ich das ZDF einen kulturlosen Haufen genannt habe, raus war ich. Umzug nach Köln, das damals aufregend war und heute zur Provinz verkommen ist. Hier sitz ich jetzt, bin achtzig und kann nachts nicht schlafen und denke: wie lange geht das wohl noch so weiter?
Ich hatte ein unfassbar wunderbares Leben.
Von den zwei Jahren Krieg am Anfang meines Lebens habe ich kaum noch etwas mitgekriegt, und meine Eltern liebten mich, obwohl sie mit Deutschlands Wiederaufbau und ihrer zerbrochenen Ehe ziemlich überfordert waren. Ich blieb weitgehend mir selbst überlassen und war dabei, ein bisschen zu verlottern, als mein Konfirmationspfarrer eingriff und mich mit nach Bonn nahm. Großes Pfarrhaus, Bildung, Bücher, Klavierunterricht, 1 a Abitur und Studium. Schwere Krankheit überwunden, netten klugen Mann geheiratet, aber wir waren zu jung, sind Freunde bis heute. Meine zweite Ehe hielt sehr lange, nach der Trennung Zusammenleben mit einem hochbegabten, wenn auch sehr komplizierten Musiker, sehr viel jünger als ich. Schöne Arbeit beim Fernsehen, viel Geld verdient, erfolgreiche »Lesen!«-Sendung gemacht, aber wegen totaler Erschöpfung schließlich abgebrochen. Schönes Haus, gute Freunde, netter Hund, keine Sorgen, achtzig ist kein Problem, und wenn ich nachts wach liege, bin ich dankbar, für alles, für ein so langes Leben in einem demokratischen Land ohne Krieg.
So.
Und nun suchen Sie sich aus diesen zwei Lebensversionen doch bitte eine aus.
Zu ergänzen wäre, um es komplett zu machen, dass ich mein Leben lang zu viel geraucht, zu viel getrunken habe und zu leichtsinnig schnell früher Motorrad, später Auto gefahren bin, ich habe nie wirklich irgendeinen Sport betrieben, habe kein Talent zu sexueller Treue und war also nicht besonders gut zur Ehe geeignet. Ich habe zig Bestseller geschrieben, bin also sorgenfrei, was ganz wunderbar ist, und da sitz ich jetzt in einem Haus voller Bücher und denke: ist doch ein großartiges Leben.
Ja, und dann das Alter. Wieso das denn? Seit wann? Wo kommt denn das auf einmal her? Warum?
Eins wollen wir mal klarstellen: eine Frau, die — wie ich — nie Mutter wurde (ich wollte nicht, ein Abbruch in sehr jungen Jahren), die also auch nicht Großmutter sein muss oder darf, die immer nur ihr eigenes Leben leben kann und konnte, die altert naturgemäß anders als jemand im Familienverbund. Es ist ein ganz anderer Lebensentwurf. Und ganz andere Leben haben auch ganz andere Alter. Mütter haben im Alter Kinder, die sich unter Umständen kümmern, die finanziell und praktisch helfen. Hab ich nicht. Meine Kindheit war trostlos, meine Eltern waren unglücklich und machten mich zu einem lästigen, unglücklichen Kind. Und darum war mir schon ganz früh klar: so wollte ich nicht werden, nicht so eine überforderte Mutter, ich wollte kein Kind haben — ich würde es wahrscheinlich auch ständig ohrfeigen, so wie ich ständig geohrfeigt wurde. Irgendetwas in mir hat sich einer eigenen Familie schon sehr früh und sehr gründlich verschlossen. Das Wort, das mir immer mehr Angst machte als Krankheit, Unglück, Trennung, das ist das Wort Abhängigkeit. Ich war nie abhängig von irgendeinem Partner. Ich habe immer für mich selbst gesorgt und werde das bis zuletzt tun, wenn es sein muss, mit bezahlter Pflege, möglichst im eigenen Haus. Also: kein Aufgefangen werden von Familie, ich habe keine Familie, und mein Lebenspartner ist achtundzwanzig Jahre jünger als ich, ein weltfremder Künstler, der eignet sich nicht zum Pfleger. So sieht’s aus.
Was macht das jetzt mit mir, das Alter?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur: ich stelle mich ihm, ich verleugne es nicht, ich versuche nicht jünger zu wirken, als ich bin. Und ich finde schon gar nicht, dass das Leben im Alter weniger wert ist.
Vielleicht mache ich mir da was vor, aber ich finde: Ich sehe noch ganz gut aus in dem Sinn, dass ich nicht zerknittert bin. Ich war nie eine Schönheit, aber auf meine Haut ist Verlass (niemals warmes Wasser ins Gesicht!). Ich kriege, wie alle Frauen in unserer Familie, fast keine Falten. Gutes Bindegewebe. Manchmal aber sehe ich mein Gesicht plötzlich irgendwo im Spiegel, meist im Kaufhaus, auf der Rolltreppe, und dann denke ich: wer ist denn diese mürrische Alte mit den zerzausten Haaren? Und dann bin das ich. Man sieht natürlich an den Händen und am Hals, dass ich alt bin.
(Ha! So beginnt Natalia Ginzburg 1971 ihre Erzählung »Die Frauen«: »Das erste, was bei den Frauen alt wird, ist der Hals. Eines Tages sehen sie im Spiegel ihren Hals voller Falten. ›Wie ist das bloß passiert?‹ sagen sie und meinen: ›Wieso ist das bloß mir passiert? Mir, die ich von meiner Natur her und für immer jung war‹?«)
Im Gesicht habe ich kaum Falten, und, nein, ich habe nichts machen lassen. Ich würde nie etwas machen lassen, ich mute meinem Körper keine Narkose zu für etwas, das nicht sein muss. Reicht mir gerade, dass ich wegen meiner schlechten Sehkraft alle paar Wochen Spritzen in die Augen kriege, was so grauenhaft ist, dass ich mir da ab und zu eine kurze Narkose leiste.
In einem Gedicht der von mir so sehr geliebten österreichischen Dichterin Christine Lavant heißt es in der ersten Strophe:
Mein Augenlicht ist nichts mehr wert,
auch das Gehör geht langsam ein,
bald werde ich so sinnlos sein
wie ein verbrauchtes Gruben-Pferd,
doch niemals so ergeben.
Mein Wille lässt mich beben (…)
Mein Wille lässt mich beben — und leben! Das ist doch eine gute Einstellung.
Klar, ein paar Falten sind da. Die habe ich mir erworben in langen Nächten mit Freunden, bei diesem ganzen ungesunden, wunderbaren Leben mit so viel Lachen und Lieben. Und es sind auch Falten, die von den Tränen kommen, deshalb bereue ich doch nicht, geweint zu haben — aus Kummer, aus Liebe, aus Glück. Nichts davon würde ich je wegmachen lassen, von pornographisch aufgespritzten Lippen reden wir schon mal gar nicht. Wie sehen diese aufgespritzten Frauen aus mit achtzig? Bestimmt nicht alle wie Jane Fonda oder Cher, und schon da stimmt nichts, wenn man sich das verlogene Strahlen genauer ansieht. Ich will kein Kunstprodukt sein, ich will ICH sein, mit meinen Haaren, die immer schon mausig waren und nun wunderbarerweise fast nicht grau werden. Mit meinen Brillen. Mit all den Narben von all den Unglücken und Krankheiten.
Marguerite Duras beginnt ihren Roman »Der Liebhaber« so:
»Eines Tages, ich war schon alt, kam in der Halle eines öffentlichen Gebäudes ein Mann auf mich zu. Er stellte sich vor und sagte: ›Ich kenne Sie seit jeher. Alle sagen, dass Sie schön gewesen sind, als Sie jung waren, ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, dass ich Sie jetzt schöner finde als in Ihrer Jugend, ich mochte Ihr junges Gesicht weniger als das von heute, das verwüstete.‹«
Ich finde die alten, ja: die vom Leben verwüsteten Gesichter von Jeanne Moreau oder Louise Bourgeois wunderschön, sie erzählen von prall gefülltem Leben sehr viel mehr als die Gesichter von Frauen mit prall gefüllten Botoxwangen.
Wir werden anders alt als unsere Eltern. Früher war man mit fünfzig abgearbeitet und alt. Heute sind viele Achtzigjährige geistig und körperlich noch fit und im täglichen Rennen. Die Welt ist im Wandel, wir wandeln uns mit, wir sind länger beweglich im Kopf, als es unsere Eltern waren, wir haben auch eine viel bessere medizinische Versorgung.
In einer Kolumne für eine Frauenzeitschrift schrieb ich vor mehr als zehn Jahren:
»An manchen Tagen fühle ich mich wie hundertacht und sehe auch genauso aus. Manchmal fühle ich mich wie vierzig und sehe auch genauso aus, das sind die Tage, an denen ich leuchte. Heute fühle ich mich wie neunundsechzig und sehe auch genauso aus. Ich bin neunundsechzig. Die Knochen tun mir heute weh, am liebsten wollte ich gar nicht aus dem Bett, aber ich zwinge mich: halb neun aufstehen, immer, halb zehn am Schreibtisch, immer. Dass die Knochen weh tun, liegt am Muskelkater, und der liegt daran, dass ich neuerdings nach einem Bandscheibenvorfall in ein Fitnesscenter gehen muss, ich ziehe voller Verachtung Sportklamotten an (aber nicht etwa dieses neonfarbene Zeugs, nein, alles elegant in trauerschwarz!) und lasse mich von der schönen Janine quälen: ich muss auf einem Bällchen liegen und mit dem Oberkörper hochkommen, zwei Kilo Hanteln in jeder Hand. Das soll gut für meine Bauchmuskeln sein. Ich muss auf einer wackeligen Platte stehen und in die Knie gehen, das soll gut für mein Gleichgewicht und für die Oberschenkel sein. Immer, wenn ich nicht mehr kann, sagt Janine: »Noch acht!« und ich sage: »Noch vier!« und dann sagt sie: »Gut, noch sechs.« Ohne sie würde ich das überhaupt nicht tun, und ich bezahle sogar noch dafür, dass sie mich triezt. So ist das, wenn man älter wird und gesund bleiben will. Ich gebe zu: es klappt, und ich verdanke dieser Tatsache und der, dass es ja zum Glück für die Liebe in keinem Alter zu spät ist, die Tage, an denen ich wie vierzig aussehe und leuchte. Es gibt sie, wenn auch seltener.«
Ja: mitunter ist man so alt, wie man sich fühlt. Aber meistens ist man älter. Eines der hinreißenden Models in Vogue hat mal in einem Interview gesagt, sinngemäß: Ich weiß natürlich, dass ich nicht für immer jung bin und »auch mal dreißig sein werde«. Zu schön.
Sport treibe ich inzwischen nicht mehr, sorge aber dafür, dass immer ein Hund da ist, mit dem ich zwei Stunden täglich spazieren gehe. Also, alles in allem komme ich ganz gut klar mit diesem vermaledeiten Älterwerden, weil es ja auch bedeutet, dass ich immer noch am Leben bin, und das ist für eine, die mit dreiundzwanzig (vor einer schweren Lungenoperation) vorsichtshalber schon mal ihr Testament machen musste (»meine Kinderbuchsammlung soll in eine Bibliothek, meine Klassiker und das Akkordeon erbt Albrecht, mein Konto bitte für meine Beerdigung nehmen und Teddy Fritz bitte mit ins Grab!«), schon allerhand.
Wie war mein eigenes Leben?
Die Kindheit — das war nicht einfach in den Fünfzigerjahren, mit überforderten Eltern nach dem verlorenen Krieg, und mit schlagenden Lehrern aus der Nazigeneration. Was war ich für ein einsames, lesendes Kind verbissen berufstätiger Eltern! Ich saß auf der Nähmaschine meiner Mutter, über der ein Spiegel hing, und unterhielt mich mit mir selbst im Spiegel in verschiedenen, erfundenen Sprachen, ich sagte mir Gedichte auf, ich las mir meine Bücher laut vor, nur um an diesen langen stillen Nachmittagen eine Stimme zu hören. Wie furchtbar war sechzehn, siebzehn mit dem ständig gebrochenen Herzen! Meine larmoyanten Tagebücher von 1958ff. enthalten nur Jammer, Jammer, Jammer — er liebt mich nicht, er kommt nicht, ich kann das nicht, ich will nicht mehr leben, all dieses Zeug. Wie viel sinnlos verschwendete Lebenszeit heulend im Bett und nächtelang am Tagebuch! Auch damals halfen mir schon die Bücher. Ich las »Die Grasharfe« von Truman Capote und darin den Satz: »Ich war elf, und später wurde ich sechzehn. Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre.« So was brachte mich zum Nachdenken. Sollte doch was dran sein an der Jugend?
»Man müsste noch mal zwanzig sein und so verliebt wie damals«, heißt es in einer Schlagerschnulze. Bloß nicht! Was hat man denn schon gewusst mit zwanzig von der Liebe? Hineingesprungen ist man, kopfüber, wie in einen einladenden See, und oft stieß man sich den Kopf sehr heftig an Untiefen und war lange in der Seele gelähmt. Ich war nicht glücklich mit zwanzig. Die Männer, das Studium, die Bücher — alles so verwirrend, und kein Zuhause mehr, nur noch möblierte Zimmer. Kein Hund, kein Garten, keine Katze. Kein innerer Ort. Noch kein richtiges Gesicht. Aber zwanzig war wenigstens nicht mehr ganz so schrecklich wie siebzehn, als man noch nicht mal annähernd selbstständig war und zu Hause gegängelt wurde.
Nein, die Jugendzeit war nicht schön. Dreißig zu werden, das war schön. Vierzig — ein wunderbares Alter! Aber, schrieb die italienische Autorin Natalia Ginzburg in den 1970ern in ihrer Erzählung »Die Frauen«: »Mit vierzig haben sie begonnen, sich zu fragen, was sie tun könnten, um nicht jenes lächerliche, unsympathische und traurige Tier zu werden, das ›eine Frau mittleren Alters‹ genannt wird.«
Fünfzig: voller Melancholie, aber auch erstaunlich gelassen. Sechzig: Jetzt wurde es langsam ernst, erste Tagebücher und Liebesbriefe auf dem Speicher wurden schon mal entsorgt. Alles über sechzig ist ein Geschenk, fast alles unter dreißig war eine Quälerei. Ich bin heute stärker und selbstbewusster als damals mit dem koketten pinkfarbenen Lippenstift. (Es war mein erster und blieb mein einziger.) Etwas klüger hätte ich sein sollen, mit zwanzig — nicht ganz so viel rauchen, vielleicht. Mehr und besser essen. Ein paar Affären weniger. Nicht ganz so früh heiraten. Nicht so entsetzlich oft umziehen, mehr Ruhe zulassen. Aber ich war eben nicht klug. Ich war auf dem Sprung in das, was man das LEBEN nennt, und vieles habe ich gründlich missverstanden, damals. Mein dickes Tagebuch von 1963, als ich zwanzig war, ist voll von Bitterkeit und Fragen, gespickt mit Zeilen aus Gedichten wie »als an deinem steinernen Herzen meine Flügel brachen« oder: »Bin immer auf See und lande nicht mehr« (Else Lasker-Schüler) oder »du möchtest dir ein Stichwort borgen — allein bei wem?« (Gottfried Benn) Ein Eintrag vom 25. April 1963, groß, mit wilder Schrift: »Was will ich eigentlich?« Heute weiß ich es. Ich habe alles erlebt, was nötig war, um jetzt zu wissen, was ich will. Ich will wach sein, aufmerksam, ich will Zeuge der Welt sein, aber nicht mehr für alles zuständig.
Damals habe ich Goethes »Die Leiden des jungen Werthers« nach der Schule noch einmal gelesen und mir notiert, was Werther an seinen Freund Wilhelm schrieb:
»Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiss ist’s, dass unser Herz allein sein Glück macht.«
Mit zwanzig ist unser Herz unfertig und zagend, voller Sehnsucht nach Ichweißnichtwas, und wenn wir glücklich sind, spüren wir es nicht und wissen es erst hinterher, wenn das Glück verloren ist. »Ich war eine glückliche Frau« —