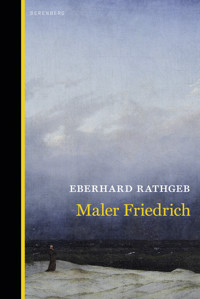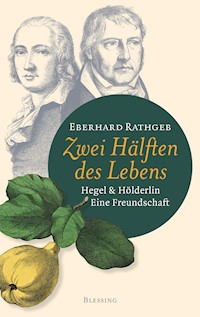11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heimat als Gedanke und Gefühl
Wie kommt es, dass ein Mensch sich in Deutschland zu Hause fühlt? Dass er sagt: Hier ist meine Heimat? Die Antwort darauf führt durch die Verschlingungen eines komplizierten Gefühls. Und sie zeigt, was Heimat heute bedeutet und wie man dennoch offen für die Fremde bleiben kann.
Am Faden der Lebensgeschichte seines Vaters erzählt Eberhard Rathgeb von Erfahrungen, die mit dem Tag beginnen, an dem einer auf die Welt kommt. Die individuell sind und dennoch in den Biografien berühmter Künstler und Denker ihren Widerhall finden. Vom Aufwachsen im Kleinen, dort, wo einer Verbundenheit fühlt, von Prägungen, die Seele, Geist und Gemüt erfahren, von Flucht, Exil und Tod, von der Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat, von heimatlichen Fantasien und vertrauten Gedanken, von Nähe und Fremde.
Bei der Suche nach der deutschen Heimat und deren Bedeutung für ein Leben helfen unter anderem auch Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Albrecht Dürer, Tilman Riemenschneider, Rahel Varnhagen, Heinrich Heine, Stefan Zweig, ein Wolfsjunge und namenlose Flüchtlinge, die eines Tages im Nachbardorf auftauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wie kommt es, dass ein Mensch sich in Deutschland zu Hause fühlt? Dass er sagt: Hier ist meine Heimat. Die Antwort darauf führt durch die Verschlingungen eines komplizierten Gefühls. Und sie zeigt, was Heimat heute bedeutet und wie man dennoch offen für die Fremde bleiben kann.
Am Faden der Lebensgeschichte seines Vaters erzählt Eberhard Rathgeb von Erfahrungen, die mit dem Tag beginnen, an dem einer auf die Welt kommt. Die individuell sind und dennoch in den Biografien berühmter Künstler und Denker ihren Widerhall finden. Vom Aufwachsen im Kleinen, dort, wo einer Verbundenheit fühlt, von Prägungen, die Seele, Geist und Gemüt erfahren, von Flucht, Exil und Tod, von der Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat, von heimatlichen Phantasien und vertrauten Gedanken, von Nähe und Fremde.
Bei der Suche nach der deutschen Heimat und deren Bedeutung für ein Leben helfen unter anderem auch Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Albrecht Dürer, Tilman Riemenschneider, Rahel Varnhagen, Heinrich Heine, Stefan Zweig, ein Wolfsjunge und namenlose Flüchtlinge, die eines Tages im Nachbardorf auftauchen.
Eberhard Rathgeb, 1959 als Sohn deutscher Einwanderer in Buenos Aires geboren, übersiedelte als Kind 1963 mit seiner Familie nach Deutschland. Er war Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ihrer Berliner Sonntagsausgabe. 2007 veröffentlichte er Schwieriges Glück. Versuch über die Vaterliebe. 2013 erhielt er den Aspekte-Literaturpreis für seinen Debütroman Kein Paar wie wir. 2014 erschien sein Roman Das Paradiesghetto.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält
technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere
in elektronischer Form, ist untersagt und kann
straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Eberhard Rathgeb
Am Anfang war Heimat
Auf den Spuren eines deutschen Gefühls
Blessing Verlag
1. Auflage 2016
Copyright: Eberhard Rathgeb
und Karl Blessing Verlag, München, 2016
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-18328-8V001
www.blessing-verlag.de
INHALT
Vorwort
Personen
Die Größe der Provinz
Ein Gefühl für Deutschland
Fremde kommen
Zu Hause im Ausland
Die Angst vor der letzten Heimat
Die Welt von gestern
Im Gehäuse der Gelehrsamkeit
Die Linde
Romantische Bodenständigkeit
Einführung in die Tradition
Die Sturheit der Erinnerung
Das junge Leben auf dem Land
Deutscher Geist
Heimatpflege
Das alte Reich
Der Schatz der Rheintöchter
Heimkehr
Heimweh
Späte Einsicht
Literaturhinweise
Personenregister
VORWORT
Oft entsteht ein Vorwort erst am Ende einer Arbeit, nachdem klar ist, was getan wurde. Wenn es nicht nur zusammenfassen soll, worum es in einem Buch geht, dann mag es dazu nützlich sein, sich zu vergewissern, wo eine Darstellung begann und wo sie endete und warum dieser und nicht ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Über Heimat zu reden ist nicht einfach, so wie überall dort Schwierigkeiten auftreten, wo Erkenntnisse, die aus einer Sache gewonnen werden, und Empfindungen, die mit ihr verbunden sind, sich nicht trennen lassen, weil die einen mit den anderen eng zusammenhängen.
Heimat ist ein Gefühl wie Liebe und Hass, das heißt, auch sie lässt sich nicht mit ein paar Worten einkreisen und definieren, anders als Sonne, Vogel oder Kuchen, auf die notfalls erklärend hingewiesen werden kann wie auf andere Gegenstände der Wahrnehmung: Das ist eine Katze, das ist ein Berg, das ist ein Baum. Irgendwo stehen, eine ausladende Bewegung mit dem Arm machen und sagen: Das ist meine Heimat, bedeutet, Dinge und Landschaften herauszuheben, ihnen einen bestimmten Status zu geben und sie zu etwas zusammenzufassen, worauf ein Dritter, ein Unbeteiligter erst einmal nur mit einem offenen Blick, einem verständigen Kopfnicken reagieren kann. Aber dann müsste er nachfragen, da sich ihm mit einem solchen apodiktischen Ausruf nicht erschließt, warum einer hier oder dort seine Heimat zu haben glaubt und was er dabei empfindet. Gefühle lassen sich in einzelnen Fällen beschreiben, was eine fühlt, wenn sie liebt oder hasst, und entsprechend was einer meint, wenn er beteuert, dort sei seine Heimat, hier fühle er sich heimisch.
In jeder Heimat liegt deswegen eine Geschichte beschlossen: Sie beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod, sie handelt vom Aufwachen und Aufwachsen, vom Heimischwerden und vom Abschiednehmen, vom Zuhausesein und vom Alleinsein, von Geborgenheit und Fremde, von einem Lebensgefühl, dem nahezukommen besser gelingt, sobald davon erzählt und nicht nur darüber räsoniert wird.
Aus dieser Mischung von Erkennen und Empfinden ist kein Roman entstanden, aber so etwas wie ein Roman, wenn sich darunter das Bemühen verstehen lässt, den Leser in eine Geschichte hineinzuziehen, in der die Behauptungen und, hoffentlich, die Erkenntnisse ihm dabei helfen, der Heimat und dem Gefühl, das sie in ihm wachruft, näher zu rücken.
Empfindungen lassen sich unterscheiden und bis zu einem gewissen Grad auch analysieren, aber manchmal ist es besser, sie zu wecken und zu schauen, wie sie entstehen und woher sie kommen, wie sie sich über den ersten Anlass hinaus ausbreiten und mit welchen Erkenntnissen sie sich vermischen. Verstehen und Einfühlen hängen eng zusammen, wenn Herz, Seele und Gemüt, und nicht nur der Verstand, mitspielen, oder wie immer die Membran genannt werden mag, die Haut, die sich an der Welt reibt und etwas umschließt, das wir unser Eigen nennen, auch wenn wir es nicht gut kennen.
Alle Vermutungen zur Psychologie des Heimatgefühls, was es ist und wie es entstehen kann, laste ich deswegen auf den folgenden Seiten meinem Vater auf, und auch für eine kurze Strecke meinem Großvater und anderen nahen Verwandten. Ihm konnte ich zu nahe treten, er würde mir, dachte ich, diese übermäßige Vertrautheit nachsehen, weil er am besten weiß, wie viel und wie wenig er mit dem Vater zu tun hat, von dem ich hier spreche und der sich viel offener und zugänglicher zeigt, als mein Vater, was ich nicht bedaure, jemals gewesen ist. Mein Vater, der echte, hätte sich zu Recht über die Nähe, die ich mir hier anmaße, gewundert, aber die meiner Heimatforschung zugrunde liegende Bemühung gutgeheißen und deshalb ein Auge zugedrückt.
Alle Vermutungen zur Ethnographie des Heimatgefühls, wo, wann und wie einer sich unter guten oder widrigen Umständen zu Hause fühlt, wie einfach und schwierig es sein kann, eine Heimat zu finden und zu bewahren, schiebe ich auf bekannte Fremde wie Heidegger, Adorno, Rahel Varnhagen, Hannah Arendt und andere. Bei ihnen konnte ich mir keine einfühlsamen Zudringlichkeiten erlauben und musste voraussetzen, dass sie die Differenzen zwischen dem, was sie selbst von sich hielten, und dem, was ich von ihnen berichten würde, wenn ich mich ihnen wie Verwandten näherte, nicht akzeptiert hätten. Sie hätten diese Abweichungen nicht mit einem wohlwollenden und großzügigen Handstreich weggewischt, wie es mein Vater getan hätte, der mit dieser Geste gerne bekundete, dass er zu unterscheiden und zu akzeptieren wisse, was nur Dichtung und was Wahrheit sei, ob etwas für ihn wichtig oder unwichtig war.
Wenn der Leser am Ende des Buches das Gefühl hat, besser verstanden zu haben, was Heimat ist, und wenn er dazu angeregt wird, nachzudenken, wie er selbst zu diesem Gefühl kam und was es für ihn bedeutet, wann es sich einstellte und wie er es sich erhielt und bewahren kann, wäre ich froh und hätte erreicht, was ich mir vorgenommen hatte: eine Geschichte zu erzählen, in der das Besondere der Anfang ist, um zum Allgemeinen zu gelangen, wie eine Treppe, die aufs Dach führt, eine Geschichte, in der das Allgemeine immer schon im Besonderen steckt, wie die Wörter im Kopf, mit denen wir uns gegenseitig verständlich zu machen versuchen.
Die Lücken, die durch Auswahl, Zugang, Wissen und Zeit bedingt sind, ließen sich so wenig vermeiden wie ein Wurm in einem Eimer voller Pflaumen. Der einzige, der, soweit ich weiß, von sich behauptete, dass er alles im Griff hatte, sogar den letzten Wurm, war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Wer ihn nur ein wenig kennt, wird bestätigten, dass schon der Versuch vermessen wäre, es in dieser Hinsicht mit ihm aufnehmen zu wollen.
Es ist müßig aufzuzählen, was dieses Buch nicht ist, auf jeden Fall ist es keine Kulturgeschichte Deutschlands. Dass es im Untertitel behauptet, eine Spurensache, eine Art Roman zu sein, ist der Einsicht geschuldet, dass sich vor allem erzählend Klarheit über Gefühle gewinnen lässt. Die Kapitelüberschriften sind Wegweiser, sie führen nicht in einen Wald, mitten auf eine Lichtung oder in ein Tal, wo sich der Leser umsehen, die Sonne, die Bäume und die Aussicht genießen mag, in der Gewissheit, es gebe nicht mehr zu sehen und zu erfahren. Sie weisen hin auf problematische Bereiche, Knotenpunkte, an denen sich Aussagen aus einem bestimmten Feld von Erscheinungen, Erkenntnissen und Empfindungen häufen. Der Leser mag danach weiterziehen, mit einem nach der letzten Runde hoffentlich offeneren Blick und einem geschärften Sinn für sein eigenes Heimatgefühl.
Personen, die nicht nur, wie zahlreiche andere, die hier vorkommen, erwähnt werden, sondern eine mehr oder weniger wichtige, manchmal sogar tragende Rolle spielen:
Theodor W. Adorno, Philosoph und Soziologe, Emigrant und Rückkehrer
Albrecht, mein Vater, Heimkehrer
Albert, mein Großvater, Auswanderer
Hannah Arendt, politische Philosophin, Jüdin, blieb im Exil in Nordamerika
Rudolf Borchardt, Dichter, ein Jude, der kein Jude sein wollte
Brunhilde, die Starke aus den Nibelungen, eine Frau, die betrogen wird
Wilhelm Dilthey, Philosoph und Erforscher der Weltanschauungen
Junge Dienstmädchen, die unglücklich waren
Dorfbewohner, namenlos
Albrecht Dürer, Maler mit langen Haaren aus dem 16. Jahrhundert
Flüchtlinge, namenlos
Stefan George, Dichter aus Büdesheim bei Bingen am Rhein, Künder des Neuen Reichs
Catharina Elisabeth Goethe, die resolute Mutter des berühmten Dichters
Johann Wolfgang Goethe, Dichter, Italienreisender und lebendes Kunstwerk
Gunther, Schwächling aus den Nibelungen, spielte mit falschen Karten
Johann Peter Hebel, Dichter aus dem Alemannischen mit Hang zum Volk
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosoph, engster Vertrauter und bester Kenner des Weltgeistes
Martin Heidegger, Philosoph, Skifahrer, Hüttenbesitzer
Heinrich Heine, Dichter, Jude, Intellektueller, ging ins Exil nach Frankreich
Theodor Heuss, ehemaliger Bundespräsident, Schwabe
Adolf Hitler, Diktator, der zum Schluss sein Volk nicht mehr mochte
Ricarda Huch, Schriftstellerin und Historikerin, lebhafte Dame mit Drang zum Höheren
Wilhelm von Humboldt, Bildungsreformer, ließ nichts auf die alten Griechen kommen
Ida, die Mutter meines Vaters, schiffte sich an der Seite ihres Mannes nach Südamerika ein
Karl Jaspers, Philosoph und Psychiater, verließ Deutschland bald nach dem Zweiten Weltkrieg
Søren Kierkegaard, Philosoph aus Kopenhagen, selbsternannter Spion Gottes
Krimhilde, die Schöne aus den Nibelungen, tat einmal unabsichtlich das Falsche und das andere Mal absichtlich das Böse
Hubertus Prinz zu Löwenstein, Historiker und Schriftsteller, ging ins Exil in die Vereinigten Staaten und kehrte wieder zurück
Karl Marx, Ökonom und armer Kritiker des Kapitalismus, korrigierte sogar den Weltgeist
Thomas Mann, Schriftsteller, Bestsellerautor, Kulturvertreter, ging ins Exil nach Nordamerika, Lebensabend in der Schweiz
Ein Mönch, der nicht sagt, was er will
Die Mutter meines Schuldfreundes, Vertriebene aus dem Osten
Paula, Idas und Ruths Mutter, meine Urgroßmutter, verbrachte ihr ganzes Leben in demselben Dorf
Erwin Panofsky, Kunsthistoriker, Jude, ging in die Vereinigten Staaten ins Exil, blieb dort, Bewunderer der großen klugen Äbte
Tilman Riemenschneider, Holzschnitzer aus dem Mittelalter, Bürgermeister von Würzburg, Opfer des Bauernkrieges
Ruth, Idas Schwester, meine Großtante, zog nur ein Dorf weiter und blieb dort bis zum Ende
Friedrich Schleiermacher, Philosoph und protestantischer Theologe, Experte für bessere Verständigung
Siegfried, starker Held aus den Nibelungen, Draufgänger, Angeber, Vorbild
Germaine de Staël, Schriftstellerin, Tochter aus gutem Haus, Feindin von Napoleon, unermüdliche Liebhaberin
Rudolf Steiner, Anthroposoph und Alleswisser, Geheimniskrämer
Adalbert Stifter, Dichter, österreichischer Melancholiker und Selbstmörder
Veit Stoß, Holzschnitzer aus dem Mittelalter, verurteilt in Nürnberg
Rahel Varnhagen, Salondame, Briefeschreiberin, Jüdin und Seelenkennerin
Der Vater meines Schulfreundes, ehemaliger Wehrmachtsoldat, Arbeiter beim Straßenbau
Aby Warburg, Kunsthistoriker, Jude, Indianerkenner, kam für eine Weile in die Psychiatrie
Ludwig Wittgenstein, Philosoph, Jude, verschenkte sein Millionenerbe, Exil in England
Heinrich Wölfflin, Kunsthistoriker, Freund und Förderer der Formen
Der Wolfsjunge aus den französischen Wäldern
Stefan Zweig, Schriftsteller, Jude, Kulturgenießer, nahm sich im brasilianischen Exil das Leben
1
DIE GRÖSSE DER PROVINZ
Hitler, Himmler, Goebbels, Göring und Eichmann dachten, träumten und redeten auf Deutsch. Sie waren voll des deutschen Geistes, vorausgesetzt, ein Geist ist dann deutsch, wenn er sich nicht anders als in der deutschen Sprache ausdrücken und verständigen kann. Was wäre aus ihnen geworden, wenn sie als Schüler ein Jahr in Frankreich, Italien, Spanien oder in den Vereinigten Staaten gelebt hätten, wenn sie nach dem Abitur ins Ausland gegangen wären, nach Namibia, Chile, Neuseeland, Australien, Russland oder China, um dort zu leben und zu arbeiten, Land und Leute kennenzulernen? Aber sie blieben daheim hocken, sie schauten nicht über den Tellerrand, sie gruben sich ein, und da sie keine philosophischen Köpfe waren, die ihre fehlende Weltläufigkeit durch grenzenlose Metaphysik und internationale Logik wettmachen konnten, waren sie deutsch im Sinne eines die Erfahrung beschränkenden Mangels. Alles, was sie taten, was sie dachten und träumten, musste ihnen wie ein Erguss des deutschen Geistes erscheinen, der in ihnen war, rein und unschuldig wie ein Quell im Gebirge.
Durch jeden, der ein Deutscher war, floss das Wasser dieser Quelle, wie das Blut durch die Adern. Darin lag der Heimvorteil der sesshaften Deutschen, die nichts anderes kannten und schätzten als ihr Land und die nicht infiziert worden waren durch Einflüsse, denen sie im Ausland ausgesetzt gewesen wären. Die einzigen, sagten die Wächter des deutschen Geistes, die noch das Quellwasser der geistigen Heimat beschmutzen konnten, waren die Juden, die, erkannt und unerkannt, unter den Deutschen lebten, mit einer Selbstverständlichkeit, als gehörten sie dazu, Fremde, Eindringlinge, die sich in etwas einmischten, das sie nichts anging. Die Juden mussten deswegen entfernt werden, ebenso alles, was je ein Jude geschrieben, komponiert, gemalt und gedacht hatte oder ein Deutscher, der sich bei ihnen oder bei den Ausländern angesteckt hatte. Die Nazis verbrannten Bücher, um den bösen nichtdeutschen Geist auszutreiben, und erließen Gesetze zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und Rassengesetze, mit denen verhindert werden sollte, dass der gute deutsche Geist durch fremdes, undeutsches Blut ausgehöhlt werde.
Die Idee vom deutschen Geist haben nicht die Nazis erfunden, aber den Wahn, dass er rein sein solle, haben sie zu verantworten. Der Geist der Völker kommt schon bei Montesquieu, Herder und bei Hegel vor, als etwas ganz Besonderes, das sich im Laufe der Geschichte eines Volkes entwickelt habe und sich in Recht, Kultur und Sitte ausdrücke. Mit der industriellen Revolution und der modernen Arbeitswelt verloren diese Besonderheiten an Gewicht, die Wirtschaft schuf eine grenzüberschreitende Gleichheit zwischen den Armen auf der einen und den Reichen auf der anderen Seite. Karl Marx interessierte sich für die Lage der arbeitenden Klasse, ob in England, Deutschland oder Frankreich, und nicht für deren Bräuche. Er betrieb keine Volkskunde, er war kein Ethnologe. Der Geist der marxistischen Kritik der politischen Ökonomie war international, auch wenn er an dem deutschen Philosophieprofessor Hegel geschult war. Das Kapital schafft all die Unterschiede ab, die es nicht braucht.
Die Nazis wollten von dieser radikalen Kritik am Kapitalismus nichts wissen. Sie nachzuvollziehen hätte für sie bedeutet, die Heimat als den Boden aller rechtschaffenen Deutschen zu verlassen, sie aufzugeben und einzutauschen gegen die Klasse des Proletariats und der Bourgeoisie, durch die das deutsche Volk in Arbeiter einerseits, in Angestellte, Beamte, Militärs und einflussreiche Unternehmer andererseits gespalten worden wäre. Stattdessen nahmen sie, was sie zur Hand hatten, sich selbst und solche, die waren wie sie, Deutsche, die im Ersten Weltkrieg ihre ersten und einzigen Auslandserfahrungen gemacht hatten und sich jetzt vornahmen, die Konkurrenz der Nationen durch eine Konkurrenz der Rassen zu verschärfen und zu vereinfachen. Der Hinweis auf den deutschen Geist rechtfertigte jedes Vorgehen, jedes Unrecht, jede Schandtat, jedes Verbrechen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Ermordung der europäischen Juden war es mit dem deutschen Geist als Heimat einer Nation, eines Volkes endgültig vorbei. Einen bedeutenden Philosophen gab es in Deutschland, dem war diese Entwicklung nicht recht. Er beharrte darauf, weiterhin auch beim Denken den heimatlichen Boden unter seinen Füßen zu spüren.
Im Jahr 1927 veröffentlichte der in Meßkirch in Baden 1892 geborene Philosoph Martin Heidegger ein Buch mit dem Titel Sein und Zeit, das ihn sofort berühmt machte. Wer glaubte, auf diesen Seiten etwas über die konkreten Lebensverhältnisse des beginnenden 20. Jahrhunderts zu erfahren, der sah sich enttäuscht. Das Werk war eine komplizierte philosophische und keine empirische soziologische Untersuchung, auch wenn darin ein Grundphänomen der modernen Gesellschaft abgehandelt wurde, die Masse, der Durchschnitt, das große dunkle »man«.
Das Buch versprach, eine phänomenologische Hermeneutik des Daseins zu liefern, was in den Ohren von Heideggers Zeitgenossen neu und vielversprechend klang, es hörte sich so an, als ginge es um das Leben, das existentielle Ganze und nicht um philosophische Spezialgebiete wie Logik, Ethik, Psychologie und Metaphysik. Phänomenologisch war die Untersuchung insofern, als Heidegger von seinem Lehrer Edmund Husserl gelernt hatte, sich nicht mit der Wiederholung und Kritik der Ideen seiner Vorgänger zufriedenzugeben. Er wollte zurück zu den Ursprüngen der Existenz, dem Fundament der Lebenserfahrung, zu den großen Fragen nach dem Sinn von Sein und Dasein. Hermeneutisch war sie insofern, als Heidegger von dem Philosophen Wilhelm Dilthey gelernt hatte, dass das Verstehen die Grundlage des Geistes und des Lebens bildete, was nichts anderes hieß als anzuerkennen, dass die Frage nach dem Sinn von Sein und Dasein sich nur beantworten ließ, wenn sie als Selbstauskunft des Existierens verstanden wurde. Der Mensch sollte über sich nicht ethisch, wie er handeln sollte, was gut und was böse sei, und nicht logisch, wie er dachte, was richtig und falsch war, und nicht psychologisch, wie er fühlte, was Empfindung und Einbildung war, und auch nicht metaphysisch, wer er war als Geist, in Bezug auf Gott und auf die Ewigkeit, sondern vor allem existentiell denken: Was hieß es, ein Leben zu führen, und was bedeutete es, sich selbst in Frage stellen, über das Dasein nachdenken zu können?
Das war ein radikal neuer philosophischer Anfang, mit dem das Gefühl einer in den Universitäten und im Alltag ungewohnten Lebensintensität verbunden war, als habe die Stunde der Entscheidungen und der Wahrheit geschlagen, als würde die entfremdete, vergesellschaftete Existenz der Zeitgenossen, die ihr Dasein in den Städten mit Arbeit, Konsum und in größter Gedankenlosigkeit dahinbrachten, einer grundlegenden Kritik unterzogen. Heidegger kippte die Philosophie aus der Horizontalen der Tradition, wohin sie sich wie in ein Bett, in dem sich gut schlafen ließ, verkrochen hatte, in die Vertikale des gelebten Augenblicks. Der Hahn krähte, die Philosophie musste aufstehen und sich dem Tag stellen. Das Existieren gewann mit diesem Weckruf aus Süddeutschland an Tiefgang, es galt, mehr als ein bürgerliches Leben zu führen und mehr von sich zu verlangen als die Verbesserung der eigenen sozialen Lage.
Wie die marxistische Kritik des Kapitalismus aus den Nationen Schauplätze von Klassenkämpfen machte, so wurden durch Heideggers Kritik des alltäglichen Lebens alle Menschen Brüder und Schwestern in einem existentialistischen Geiste. Das Ziel der Kommunisten war die klassenlose Gesellschaft, der Weg dorthin durch Revolutionen zu erreichen. Wohin Heidegger steuerte, wie eine Gemeinschaft der existentiell Erleuchteten aussah, blieb unklar. Mehr ließ sich nicht annehmen, als dass der von ihm philosophisch befreite Mensch keine Lust haben würde, sich den Beschränkungen zu unterwerfen, die die bürgerliche Wirklichkeit seinem Dasein durch Schule, Ausbildung, Beruf, Maschinen, Arbeit, Geld und Industrie auferlegte. Existieren bedeutete etwas substanziell anderes.
Als Hitler an die Macht kam, dachte Heidegger, dass eine erfüllte Zeit anbrechen, eine Revolution aller Lebensverhältnisse beginnen würde, in der sich der existentielle Druck seiner Philosophie entladen könnte. Der Nationalsozialismus war radikal, er setzte einen neuen Anfang, er behauptete, Geschichte nicht zu erleiden, sondern zu machen. Sein und Zeit, Denken und Existenz fanden zusammen wie Kopf und Hand, sobald einer sich der neuen antibürgerlichen Bewegung anschloss, die für das Wohl des ganzen Volkes zu handeln vorgab. Die Parteinahme für Hitler bedeutete auch für Heidegger eine Verschiebung der eigenen Zuständigkeit und Verantwortung als Dozent und Bürger auf höhere Stufen einer politischen Hierarchie. Wer für das Volk, das Ganze war, der konnte nichts falsch machen, und wer wusste, was das Volk zu tun hatte, welchen Auftrag es erfüllen sollte, der gehörte zur Avantgarde, zur Elite der neuen Bewegung.
Heidegger trat in die NSDAP ein und schwang als Rektor der Universität Freiburg begeisterte Reden über den Geist der Erneuerung. Das Volk als Ganzes war eine Art Mysterium, ein Abgesandter höherer Mächte, und wer auf seinem Rücken saß und mit ihm auf und davon ritt, der kam nahe an die Erfüllung der Zeit heran, der sah, was in ihr als Sinn verborgen lag, verschüttet unter Geschäften und Umtriebigkeit, falschem Leben und beschränktem Denken, rationaler Enge und bürgerlicher Vorsicht. Heidegger glühte vor Ergriffenheit. Die Stille des philosophischen Seminars, die Einsamkeit des Studierens lag weit hinter ihm. Er war jetzt mittendrin im Getöse und Gestöber, im Herzen der Ereignisse, in wohltuender Gefahr.
Berlin war ihm ein Graus. Für das großstädtische Leben, das den Soziologen Georg Simmel reizte, fehlte ihm der Sinn. Die Moderne war abstrakt, wie der Bankkredit, die Zirkulation der Waren und die Massenproduktion, sie vernichtete die Verwandtschaftsverhältnisse der Dinge, die Traditionen der Regionen, den Bezug zum einfachen Leben. Heidegger vergaß und verleugnete nicht, dass er in einem Dorf aufgewachsen war, im Gegenteil, er kehrte sein Herkommen hervor, auf dessen Boden er seinen philosophischen Einwand gegen den Fortschritt stellte. Die Provinz erhob ihr Haupt und behauptete ihr Recht.
Karl Marx, mit dessen Theorien in Deutschland noch in den Zwanzigerjahren Kommunisten versuchten, Anhänger zu gewinnen und Politik zu machen, hatte gesagt, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse die Arbeiter von den Produkten der Arbeit entfremdeten und sie zu Handlangern der Maschinen, zu Opfern der Ausbeutung degradierten. Heidegger erklärte, dass die moderne Technik und Lebensweise die Menschen von ihrer wahren, den Dingen nahen Herkunft entfremdeten, dass sie ihnen das Gefühl und das Bewusstsein davon raubten, was es hieße, ein Bewohner der Erde zu sein, zu existieren. Auf den Dörfern kannte jeder jeden, gab es Bauern, die die Felder bestellten und sich um die Tiere kümmerten, und Handwerker, Schuster, Bäcker, Schmiede.
In Todtnauberg im Schwarzwald, abgeschieden in der Natur, lag eine Holzhütte, in die er sich seit 1922 immer wieder zurückzog, um unter elementaren Bedingungen elementarer denken zu können. Die Berge sollten den Gedanken unter die Arme greifen, sie auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Eigentliche, wie Heidegger sagte, bündeln. In dieser unberührten Landschaft schrieb er Sein und Zeit. Hier war er ganz bei sich, ein Mensch unter einfachen Dingen, Stuhl, Tisch, Brot, Bett, Wasser, ein Glas Wein, eine Wurst, mehr nicht, auf sich gestellt, ein Wanderer ohne Karte, der sich zur Orientierung auf Sonne, Mond und Sterne verlassen musste, fern der normalen Lebenszusammenhänge, ein Bürger ohne die Bürden der Gemeinschaft, ein Universitätsangestellter ohne die Pflichten zur Lehre und Forschung, nur fragende, suchende, sich erlebende Existenz, ein neuer Anfang von allem, der sich aus sich selbst entwickeln sollte. Heideggers Herz klopfte. Die Erfahrung des Denkens war ein Abenteuer.
Auch als Rektor der Universität Freiburg ging er mit seinen Studenten auf die Hütte und machte Übungen im Denken mitten in der Natur. Wie bei Kastanien sollten unter freiem Himmel die stachligen Schalen aufplatzen, die Zivilisation und Wissenschaft um die jungen Menschen gelegt hatten. Die Stille der Provinz wurde nur von einem Vogelruf, dem Schlagen der Kirchglocken, dem Rauschen der Bäume durchbrochen, kein Verkehrslärm, kein Kabarett, keine Fabriksirene, keine Drängelei auf den Bahnsteigen. Am Waldesrand und auf dem Feld kam der philosophisch und existentiell befreite Mensch seiner Herkunft wieder nahe, seiner wahren Heimat, die er vergaß, wenn er sich von der Erde, vom Grund des Denkens, löste, und in der er wieder auflebte, wenn er sich als ein Wesen verstehen lernte, das Sinn in die Welt brachte, wie die Saat auf den Acker.
Heidegger hörte in sich die Trommel eines Erlösers schlagen, er musste, um zur Tat zu schreiten, die ihn beglückte, nicht wissen, was um ihn herum vor sich ging, was ein bürgerlicher Staat sei, was Geld, Außenhandel, Diplomatie und Politik. All diese Dinge schlug er auf die Seite der zeitbedingten Kultur, in die einer hineingeboren wurde und die sein unbedachtes Dasein prägten, die Faktizität, wie er sagte. Er schob sie beiseite, sie verstellten ihm die Aussicht. In dieser herrschaftlichen und abschätzigen Geste gegenüber der Realität, er war deutscher Staatsbürger, Steuerzahler, wahlberechtigt, erfüllte sich eine Art Ermächtigungsgesetz des Denkens. Der Jurist Carl Schmitt, der Hitler mit offenen Armen entgegenlief, hatte in der Schrift Politische Theologie, die 1922 erschienen war, erklärt, souverän sei, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, das hieß, wer die Macht sich nahm, zu erklären, was richtig und falsch war, wer hochfahrend genug war, behaupten zu können, was existentiell wichtig und unwichtig war. Heidegger trat vor die Tür und sah in den Morgennebel, der sich von den Wäldern und Wiesen hob. Es war, als wäre er allein auf der Welt. Elementar, dachte er, unmittelbar, nackt, vital, wie im alten Griechenland. Er beugte bei dem Gedanken an die Griechen den Kopf etwas nach unten, der Reflex eines Bücherlesers, murmelte einige altgriechische Worte und wippte leicht in seinen fest geschnürten Wanderschuhen.
Heidegger blieb auch nach dem 23. April 1934, als er vom Posten des Rektors zurücktrat, gegenüber der politischen Wirklichkeit »souverän« genug, sich nicht in den Widerstand treiben zu lassen. Vielmehr erklärte er sein praktisches Einverständnis mit der Diktatur philosophisch, indem er Sein, Mensch und Sinn entkoppelte. Der Sinn des Seins sollte sich jetzt nicht mehr dadurch erschließen und erschöpfen, dass einem Schaffner, Lehrer, Friseur, Fabrikarbeiter ein Licht aufging und er erfuhr, was es bedeutete, als Mensch zu existieren, so wie ein Deutscher ein Nazi wurde, weil er von den Nazis überzeugt war und sich ihnen anschließen wollte. Das war eine persönliche Entscheidung, die einer traf, ein anderer nicht. Der Geist der Zeit konnte sich eine solche Wankelmütigkeit, eine solche Abhängigkeit von persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen nicht erlauben, es war besser, dachte Heidegger, alle zögen, alle hingen an einem Strang. Ein Volk war nur dann ein Volk, wenn es eine Volksgemeinschaft war, wenn es sich bewusst wurde, dass es ein Volk war. Dafür brauchte es einen Führer, der es leitete, und ein Reich, das es zusammenhielt.
Heidegger verwandelte diese politische Vorstellung in eine philosophische, indem er von einem Sein zu reden begann, dass sich nur aus eigenem Antrieb den Menschen offenbarte, das Sein zog in diesem Fall den Vorhang der gewohnten Erkenntnisweisen beiseite und ließ den Blick in die Tiefe des Geistes gehen, wo es leuchtete und die Gesetzmäßigkeiten und Bewegungen entwarf, die von den nichts ahnenden Zeitgenossen Denken genannt wurden. Das Sein bestimmte das Bewusstsein. Der Führer befahl dem Volk auf der politischen Ebene, das Sein befahl ihm auf der geistigen und existentiellen Ebene. Wenn Hitler und das Sein in dieselbe Richtung marschierten, dann war der deutsche Totalitarismus als Einheit von Tat und Gedanke perfekt, dann gab es aus ihm kein Entkommen, als würde einer auf dem offenen Meer treiben, rundum am Horizont nichts anderes als Meer und nochmals Meer.
Heidegger blieb Prophet, und er war es mit der neuen Fassung des Begriffs vom Sein nicht mehr nur aus persönlicher Überzeugung, wie sein Leben zu führen wäre. Ihm war eine größere Wahrheit zuteil geworden, und er konnte jetzt streng genommen nicht mehr für das, was er tat und dachte, verantwortlich gemacht werden. Er erfüllte nur seine Pflicht als Denker, wenn er die Wirklichkeit so ließ, wie sie war, und sein Ohr an sie legte und lauschte, ob und was das Sein ihm zu sagen hätte. Ein Ruf von weit oben war an ihn ergangen und er folgte ihm, so wie andere ihrer Pflicht als Soldat der deutschen Wehrmacht nachkamen, wenn ein Befehl sie erreichte.
Nach dem Krieg wurde Heidegger für eine Weile die Lehrbefugnis entzogen. Doch sein Einsatz für Hitler beschädigte sein Ansehen als Philosoph nicht nachhaltig, die Zahl seiner Bewunderer in Frankreich und in Deutschland stieg, sie sahen in ihm den Vollender und Zerstörer der Metaphysik, deren Geschichte er aufrollte als eine Abfolge von weltauslegenden Gedankensystemen, die ab den Sechzigerjahren auch Diskurse genannt wurden. Wie in architektonischen Grundrissen legten diese metaphysischen Aufrisse fest, über welche Weisen und Möglichkeiten der Erkenntnis eine Zeit verfügte. Wer mehr sehen, weiter denken wollte, musste die Lücken in der Epoche des Seins, in der er lebte, entdecken. Archäologie des Wissens nannte der französische Philosoph und Soziologe Michel Foucault diese sich bei der Analyse vergangener Jahrhunderte bewährende Arbeit.
Vor allem die vormetaphysischen griechischen Philosophen und später einzelne Dichter waren in den Augen Heideggers Auserwählte, deren Einsichten über den Horizont der normalen Sterblichen reichten. Durch sie hoffte er verstehen zu lernen, was es hieß, auf dem Gipfel einer Zeit zu stehen. Er ließ das Tal, in dem die Menschen ihren Geschäften und Leidenschaften nachgingen, hinter sich und stieg auf, weit und lange, bis die Bergwelt ihn geschluckt hatte. Das Gefühl einer großen Einsamkeit hob seine Brust, seitdem er den Bewohnern der Niederungen abhandengekommen war, er gehörte nicht mehr zu ihnen, er war ein Einzelner, der unter Bäumen und an Steinwänden entlangschritt, auf einem Grad zwischen Himmel und Erde, als hielte er die beiden zusammen. Hier oben war er auf sich gestellt, keiner war da, mit dem er reden konnte, der die Erfahrungen, die er machte, mit ihm teilte, er war von allen abgenabelt, der Erste und der Letzte auf Erden, ausgeliefert den Mächten der Natur und dem Unbekannten.
Ganz ungefährlich war es hier oben nicht, die Stille der Abgeschiedenheit schier grenzenlos. Der Wanderer wurde hellhörig für den Wechsel der Winde und für jedes winzige Geräusch, hellsichtig für die Farben des Himmels zu jeder Stunde, er lief mit offenem Blick und offenem Ohr, jeder Schritt ein erster Schritt in eine unbekannte Welt hinein. Der Mensch, der aus dem Tal gekommen war, wurde immer kleiner, und der Mensch, der in die Berge hinaufstieg, wurde immer größer.
Als er auf einem Plateau angelangt war und verschnaufte, drehte er sich um und schaute hinab, und ihn überfiel ein leichter Schwindel. Er hob, wie um zu sich zu finden, einen Stein vom Weg auf, wog ihn in der Hand, als würde er ihn prüfen oder bedenken, und sagte, Stein, mehrmals sagte er es, beschwörend, nachsichtig, zweifelnd, ob das Wort wisse, was es bedeutete, ob der Stein und das Wort dasselbe meinten. Darauf steckte er den Stein in die Jackentasche, wie etwas, das ihm durch das Wort, die Bezeichnung, die er dem Stein gegeben hatte, ähnlicher geworden war. Der Stein war jetzt nicht mehr irgendein Stein, sondern ein besonderer, von ihm erkannter, er hatte ihn aus der namenlosen Ansammlung der Dinge gelöst und zu sich genommen, und er dachte, wenn er den Himmel auf die gleiche Weise aus dem Zusammenhang der namenlosen Welt lösen und in die Hand nehmen und zu ihm mit seherischer Inbrunst sagen könnte, Himmel, dort, wo einst die Götter wohnten, dann wäre der Himmel nicht nur irgendein Himmel, eine blaue Fläche, über die die Wolken zogen, sondern ein besonderer, den er verstanden hätte, ein Dach, ein Gewölbe, ein Thron. Dann hätte er den Gipfel einer umfassenden, an das hohe Sein heranreichenden Weltaneignung erreicht.
Er nahm einen Apfel aus der Tasche und biss hinein. Brot wäre ihm auch recht gewesen, Käse, Wurst. Die Wissenden und Suchenden waren einsam, sie trugen ihr Schicksal wie einen schweren Rucksack mit sich herum. Er knöpfte sich den obersten Hemdknopf auf und wischte den Schweiß von der Stirn, hinter der er, ein Geist, saß, viel größer und mächtiger als der andere, der Körper, der hier stand mit dem Apfel in der Hand. Er dachte an den Philosophen Friedrich Nietzsche, der es unter den Menschen nicht ausgehalten hatte und in Sils Maria im Engadin um den See und durch die Berge gewandert und schließlich verrückt geworden war, und er dachte an den Dichter Friedrich Hölderlin, der von Bordeaux, wo er als Hauslehrer bei einem Weinhändler gearbeitet hatte, nach Hause ins Schwäbische gelaufen und ebenfalls verrückt geworden war.
Heidegger aß den Apfel auf, drehte den Stiel zwischen den Fingern und schnippte ihn weg. Die Mühsal und die Gefahren des Denkens, dachte er und blinzelte in die Sonne, als sähe er die Abgründe, in die einer stürzen konnte, wenn er sich aus dem Altbekannten löste, Neues wagte, höher hinauf strebte, einen Ruf vernahm. Hohe Tannen standen zu beiden Seiten des Weges. In der Ferne hörte er einen Bach rauschen. Die Götter stiegen vom Himmel herab zu den Lebenden, zu einigen Auserwählten, sie vermummten sich als Idee, Einfall, Inspiration. Die Dichter waren das Gefäß, in das sie sich am liebsten ergossen. Ihnen, den Dichtern, fühlte sich Heidegger verwandt, dem hohen Ton, der nicht von dieser Welt war und sie doch umfasste und durchdrang. Das Denken war ihm zur Heimat geworden, die Wörter und Gedanken waren ihm vertraut wie die Wege zur Schule und zur Kirche, die er als Kind gegangen war. Er schlug die Werke von Kant, Hegel, Aristoteles, Platon, Nietzsche und Schelling auf, und ihm war sofort zumute, als würde er einkehren in den inneren Bezirk seines Ich. Zwischen ihm und ihnen bestand ein elementares Verwandtschaftsverhältnis, er hatte ihre Nähe gesucht, wie zu Gleichgesinnten, Freunden im Geiste, mit denen er in einem nicht abreißenden Gespräch war. Die Jahrhunderte, die es dabei zu überbrücken galt, spielten keine Rolle. Der Geist löste sich aus den Sätzen, die er las, er kam auf ihn zu, nahm ihn auf. Das Geheimnis, das Sein, lag gefaltet in der Welt, es war da, verborgen, und einer, der mutig und dazu berufen war, musste hinsehen und hinhören, musste die Sinne offen und das Denken beweglich halten, um ihm nahe zu kommen. Heimzukehren hieß, dort zu sein, wo der Geist wühlte, die Erde aufwarf, aus der er entstanden war, und den Himmel nach Zeichen absuchte, unter dem er aufgewachsen war.
Am Abend saß Heidegger todmüde, aber glücklich in seiner Holzhütte, froh, rechtzeitig umgekehrt zu sein und dem Erlebnis auf dem Berg ein Ende gesetzt zu haben. Er wäre, dachte er, in den Bergen bei Nacht verloren gegangen. Sterben wollte er noch nicht, er war des Lebens nicht überdrüssig. Beim Denken kann einer sich verlaufen, dachte er, und nicht der Zeit achten und die Übersicht verlieren. Und doch, wer kein Wagnis einging, der machte keine neuen Erfahrungen, der lernte keine neuen Wege kennen. Im Tal blieben die Untätigen hocken, denen die Gewohnheiten lieb waren, die sich fügten. Zufrieden legte er sich ins Bett, und obwohl er müde war und die Glieder schwer, fühlte er sich leicht von der himmlischen Höhe und der frischen Luft. Die Hütte schlummerte in weiter heller Stille. Der Himmel war übersät mit Sternen.
Als er Tage später mit seinem Bruder Fritz in einer Gastschänke bei einem Glas Rotwein saß, hatte er Mühe, in einfache Worte zu fassen, wie ihm in den Bergen zumute gewesen war. Doch erzählen wollte er ihm, was er erlebt hatte. Er versuchte, sich mit einer alltäglichen Erfahrung verständlich zu machen, eine Brücke zu schlagen, und sagte, dort oben sei es so gewesen, wie wenn er mit den Skiern nicht ins Tal hinab, sondern in den Himmel hinaufgesaust wäre, nur dass dort oben keiner wäre, den er kennen würde. Er hätte keine Angst gehabt, weiter zu gehen, ins Unbekannte, ins Offene, wie Hölderlin dazu gesagt habe. Erst als er sah, dass der Tag seinen Zenit weit überschritten hatte, habe er sich in seinem Drang Einhalt gebieten und zur Umkehr zwingen müssen. In den Bergen sei ein Licht, ein Leuchten gewesen, wie es unten im Tal nicht schiene. Er müsse einmal eine Nacht dort oben verbringen. Seine Augen blitzten und seine Backen glühten, und der Bruder hob das Glas und trank dem waghalsigen Martin zu.
Heidegger hat sich nicht dafür interessiert, die Welt und ihre unterschiedlichen Bewohner und Kulturen kennenzulernen, er war nicht in Amerika, nicht in Afrika und auch nicht in Asien. Weiter als bis nach Griechenland, wo das abendländische Denken begonnen hatte, kam er nicht. In den Siebzigerjahren folgte er den Einladungen des französischen Dichters und Widerstandskämpfers René Char und hielt Vorträge in der Provence. Mehr sinnliche Weltfülle brauchte er nicht.
Er grub sich ein in den Boden, auf dem er geboren worden war und wo er aufwuchs, er schätzte das einfache Leben in den Kleinstädten und Dörfern und zog aus Berg, Feld, Weite, Stille, Himmel das Ideal einer neuen philosophischen Unmittelbarkeit: freies, direktes Denken und freies, direktes Sagen, wie es nach seinem Gefühl einigen Dichtern eigen war. Dieses Ideal kollidierte bei ihm mit einer Sprache, die ihn oft dunkle Umwege gehen ließ, wie einer, der bei Nacht, wenn kein Licht zu sehen ist, den Weg nach Hause sucht durch Ahnung und Gegenwart, mit tastenden Schritten und die Hände weit von sich ins Dunkle gestreckt.
Wenn er zu einfacher denkenden Menschen redete, in der geliebten Provinz, konnte er mit verständlichen Worten sagen, worum es ihm ging. Am 22. Juli 1961 hielt er in Meßkirch einen Vortrag über Heimat. Die kleine Stadt, stolz auf ihren berühmten Sohn, feierte ihr siebenhundertjähriges Bestehen. Heidegger war einer von ihnen geblieben, auch wenn kaum einer in der Stadt verstand, was er schrieb. Er gehört dazu, und darüber wollte er reden, über die Tiefen der Verbundenheit, über den gemeinsamen Boden. Er sagte kein überflüssiges Wort. Seine Stimme war bedächtig und etwas schrill, eine Alarmanlage.
In den Fernseh- und Rundfunkempfängern, die bald überall in den Städten und Dörfern wären, sah er die Zeichen einer kommenden Zeit. Er schaute in die Gesichter der Zuhörer. Sie alle hatten Fernseh- und Rundfunkempfänger im Wohnzimmer stehen. Er würde ihnen ins Gewissen reden, eine Mahnung, bevor es zu spät war.
Diese Geräte zeigten, und jetzt machte er eine kleine Pause, die die Neugier reizte, dass die Menschen nicht mehr dort zu Hause seien, wo sie wohnten. Das Wort »wohnen« hatte er betont, darauf kam es ihm an, er legte eine Spur aus. Sie würden von den Geräten täglich, stündlich in fremde, aufreizende, nur manchmal belehrende Bezirke weggezogen. Diese Einschränkung musste er machen, nicht nur in Erinnerung an die Reden der Nazis, welche die Deutschen an ihren Volksempfängern sich angehört hatten.
Die Menschen vor den Geräten würden nirgendwo länger verweilen, sondern ständig von einem zu anderen, vom Neuen zum Neuesten wandern, in dessen Bann sie geraten seien. Auf diese Weise verlören sie alle Bindungen zum Heimischen und landeten im »Unheimischen«. Das letzte Wort klang so, als sei damit das Unheimliche gemeint, wohin keiner gehen mochte, weil es ihm Angst machte. Wo Angst war, konnte die Gefahr nicht weit sein, und mit der Zufriedenheit eines Schneiders, der feststellt, dass der Anzug dem Kunden wie angegossen passt, legte Heidegger den Schluss nahe, dass die Heimat, das heißt alles, was einmal so genannt wurde, sich auflösen und verfallen werde.
Er warf einen ernsten Blick in die Runde der Zuhörer vor ihm. Wem es vorher noch nicht klar gewesen war, der erfuhr es jetzt, dass Heidegger nicht hier war, um die Lage schönzureden, um ins Blaue abzuschweifen. Der Verfall lauerte überall, er nagte sich wie ein Holzwurm durch das Gebälk.
Als Taxifahrer in Rom oder Börsenmakler in New York wäre Heidegger verloren gewesen. Seine Welt, Meßkirch, war einerseits viel kleiner, andererseits unermesslich größer, das Sein. Alles, was dazwischenlag, Großstädte, Volkswirtschaften, die Soziologie, das Kino, amerikanische Romane und Fernreisen, gehörte zum Fortschritt, war Fortschreiten, Weggehen, Verlassen, ökonomischer und technischer Erfolg, folgenreicher Verlust. Er schaute zur Rückwand des Saales, dachte an die alten Gebäude der Stadt, an die Gaststube, in der sie nachher beim Wein zusammensitzen würden, und trotzte der Gefahr.
Rettung sei möglich, sagte er, und zwar am ehesten dort, wo die Natur und die Tradition sich bei der Hand fassten, wo das Herkommen und die alten Sitten dem Leben unter die Arme griffen. Den Zuhörern fiel ein Stein vom Herzen, ihre Gesichter hellten sich auf, und Zufriedenheit breitete sich in ihnen aus, weil sie zur rechten Zeit am richtigen Ort waren und nicht anders konnten, als Gutes zu tun. Als Heidegger in seiner Rede fortfuhr, saßen sie da wie hingerückt in Reih und Glied, einig über die kleinen Zerwürfnisse in der Stadtverwaltung hinweg und bereit, auch die nächsten siebenhundert Jahre gemeinsam zu meistern.
Diese große Aufgabe, und mit diesen Worten legte Heidegger den Menschen in Meßkirch gleichsam die Hand auf die Schulter, könnten heute nur die dörfliche und kleinstädtische Provinz erfüllen, vorausgesetzt, und seine Stimme gewann jetzt an Höhe wie ein Falke, der aufsteigt, um das Terrain besser nach Beute sondieren zu können, dass sie sich immer wieder klar machten, worin ihre Bestimmung liege, und sie eine Grenze zögen zwischen sich auf der einen Seite und den Großstädten mit ihren Industrieanlagen auf der anderen und nicht in Versuchung gerieten, dem urbanen Leben nachzueifern, sondern das Eigene festhielten, das Heimische bewahrten.
Die Zuhörer mussten nicht lange überlegen und sich nicht ansehen, um zu wissen und sich gegenseitig zu bestätigen, dass es gut war, wenn alles so blieb, wie es war. Sie warfen ihre Fernseh- und Rundfunkgräte nicht aus dem Fenster, sondern saßen immer länger vor den Bildschirmen und sagten sich, dass sie schon seit eh und je vor den Bildschirmen gesessen hätten, und kauften sich neue, um besser zu sehen und zu hören, was draußen in der Welt geschah und glücklicherweise nicht bei ihnen. Heidegger selbst schummelte, er zeigte sich im Fernsehen und ließ sich im Radio hören. Was aber das Eigene und das Heimische sei, das es zu bewahren gelte, sagte er ihnen nicht.
Im Jahr 1944 hatte er eine Interpretation des Gedichts Andenken veröffentlicht, ein Versuch, Hölderlins geschichtsphilosophischen Ort und seine poetologischen Ideen von antiker und moderner Dichtung, vom Zusammenhang des Eigenen mit dem Fremden zu deuten. Den Bewohnern von Meßkirch, die keine philosophischen Seminare besucht hatten, wäre mit diesen etwas vagen Ausführungen über Ursprung, Ausfahrt, Ankunft, Kolonie und Mutterland des Geistes nicht geholfen gewesen, was hätten sie sich darunter vorstellen sollen, und deswegen schwieg er jetzt lieber, statt sich auf einsamen Wegen zu verlieren, und trat in ihre Reihen zurück, schüttelte die Hände, die sie ihm ehrfurchtsvoll hinstreckten, und redete hier und dort ein einfaches, gutes Wort. Er konnte nicht mehr tun als mahnen. Gegen die Logik des Zerfalls gab es keine Rezepte, dagegen half nur das Beharrungsvermögen.
Die Bewohner fanden an diesem Festtag nicht heraus, was sie tun sollten, um im Heimischen zu bleiben und die Heimat zu retten, sie taten, was sie gewohnt waren, sie gingen nicht fort, sie blieben in der Enge der Provinz, machten die nötige Arbeit, pflegten das Dorf, die regionalen Bräuche, die einheimische Küche und sagten den jungen Leuten immer wieder, dass nicht alles Alte schlecht sei, was die Söhne und Töchter aber nicht daran hinderte, Jimi Hendrix zu hören und in die großen Städte zu ziehen, auf der Suche nach einer anderen, neuen, größeren Welt, in der sie sich einnisteten, eine Welt aus Gewohnheiten, Bekannten, Freunden, Familie, Beruf, festen Ansichten, und das hieß aus stabilen Beziehungen. Letztendlich war auch sie eine Art von Provinz.
2
EIN GEFÜHL FÜR DEUTSCHLAND
Deutschland ist ein gutes Land, dachte mein Vater ohne jede Leidenschaft, und er sagte das nicht, weil es sich von selbst verstand, und wenn da einer gewesen wäre, dem er das erst hätte sagen und erklären müssen, mit dem hätte er nicht lange geredet. Wer das nicht sah und nicht merkte, wo lebte der, dachte er und schwieg, erfüllt von der Ruhe eines jahrzehntelangen Einverständnisses, vom Gefühl der Zugehörigkeit. Unmöglich oder ungeheuerlich wäre es für ihn, wenn einer schlecht über das Land redete, und sobald er darüber nachdachte, regte er sich auf, aber dann sagte er bloß: Ach, und winkte mit der Hand ab. Und wir Kinder dachten, er führt wieder Selbstgespräche, jetzt bricht er die Diskussion ab, gleich steht er auf und geht, weil es sich nicht lohnt, mit so einem, der nichts versteht, weiterzureden. Auch der Blick aus dem Fenster weckte in ihm keinen Zweifel am Leben in Deutschland. Weder die monotonen Einfamilienhäuser noch ihre Vorgärten und die Supermärkte, noch die Menschen, die hier wohnten, irritierten ihn, von einigen Ausnahmen abgesehen. Auch die Kinder störten sich nicht daran und spielten im Garten Fußball, gingen die Straße hinunter zur Schule, den Ranzen auf dem Rücken, fuhren mit dem Fahrrad zum Schwimmbad, und wenn ein Einkauf im Supermarkt anstand, waren sie sofort dabei und drängelten sich zwischen den Regalen und holten sich ihre Tüten mit Süßigkeiten.
Mein Vater ertrug das Leben stoisch, als sei es gut so, wie es war, oder als hätte er keine Wahl, als sei das Leben, wie es sich ihm zeigte, nicht zu ändern. Und wie ihm erging es den anderen auch, sie machten allesamt einen zufriedenen Eindruck: Familie, Arbeit, Haus, Garten, Auto. Er setzte voraus und forderte, dass Gesetze, Regeln und Konventionen eingehalten wurden und nannte das: sich benehmen können. Selten hörte er Musik, am liebsten Beethoven, und dann konnte es passieren, dass er mitten im Wohnzimmer stand, den Kopf nach vorne gebeugt, den einen Arm angewinkelt, die Finger der Hand ausgestreckt, und diese Gerade ging im Takt auf und ab, und er sagte dazu leise, Tack, tack, tack, er dirigierte ein unsichtbares Orchester, er ordnete seine Welt und vergaß die Politik, die ihn immerzu auf Trab hielt, ging es doch um sein Land.
Nur auf dem Sterbebett dachte er nicht mehr daran, dass die Regierung sich des Landes als würdig erweisen und das Richtige tun sollte. Die Verantwortlichen müssten nur vernünftig sein, dachte er, dann wäre alles einfach und das Land würde nicht kaputt gehen, nicht zerstört werden wie ein Haus, das zusammenfiel, weil die Bewohner es verrotten ließen. Diese Sorge trieb über mehrere Flüsse bis an die Landesgrenzen und darüber hinaus. Der Satz, der sich anschloss und als halbe Portion in der Luft hängen blieb, lautete: Wenn die Menschheit nur vernünftig wäre … Darauf schwieg er, weil die Annahme keinen Sinn machte, und die Folgen aufzuzählen erübrigte sich für ihn, er war kein Träumer, der glaubte, dass es irgendwann keine Kriege mehr geben werde, keinen Hunger, kein Leid und keine Not.
Er hielt die Zeitung in den Händen aufgeschlagen vor sich, ein Dach, ein Zelt, unter dem er für Stunden verschwand, zur Hälfte unsichtbar geworden, ein Denkmal des informierten Bürgers, und las jeden Satz, aus Interesse an der Gegenwart, um ein Teil von etwas Größerem zu werden, und weil er wissen wollte, was um ihn herum geschah, mit ihm und in seinem Sinne oder gegen seine Vorstellungen. Er vertiefte sich in die Zeitung auch, um die Zeit bis zum Mittagessen totzuschlagen und der Enge zu entkommen, in die das Alter ohne Beruf ihn geführt hatte. Diese Stunden waren für ihn die besten am Tag. Auf sie freute er sich, er verließ das Haus, ohne sich bewegen zu müssen, er kam durch die Welt, er traf auf Menschen, die wichtig genug waren, dass über sie berichtet wurde. Er vergaß sich selbst, wo er war und wie alt er war. Wenn er die Zeitung beiseitelegte, wurde das Leben schwieriger, es gab für ihn nichts zu tun, nichts Notwendiges, Sinnvolles, keine Arbeit.
In den Regalen standen Bücher, traurig und stumm, Überbleibsel einer anderen Lebensverbundenheit. Er las keine Bücher mehr, dafür hatte er keine Zeit, nicht einmal wenn er sich langweilte und mit sich nichts anzufangen wusste. Die Zeit, die ihm noch blieb, ging schnell dahin, er musste mit ihr haushalten und vorsichtig mit ihr umgehen. Romane waren in dieser Zeitnot eine Provokation, historische Werke ein Affront für einen, der kaum noch Leben und Zukunft besaß, er würde den Rest seiner Tage nicht anderen Geschichten, auch nicht der Vergangenheit opfern, und so machte er sich regelmäßig für einige Stunden daran, die Zeit selbst, wie sie in der Gegenwart sich zeigte, zu verfolgen, das Zeitgeschehen. Er schüttelte den Kopf, wenn Politikern Fehler unterliefen, er ärgerte sich, wenn sie kein Einsehen hatten und nicht verstanden, was sie falsch gemacht hatten, wenn sie nicht sahen, was zu tun war, und er regte sich auf, wenn erkennbar wurde, dass sie dem Land mit Absicht schadeten. Langsam arbeitete er sich in der Zeitung voran, Spalte für Spalte, von Deutschland in die Welt, in Gegenden, wo Leid, Not und Hunger herrschten und Kriege geführt wurden, und kaum ging es auf dem einen Flecken Erde wieder besser, fing auf einem anderen ein Übel an. Er saß geschützt in seinem Haus, bedroht nur vom eigenen Verfall, von Krankheit und Tod, dem normalen Lauf der Dinge, gegen den sich nichts machen ließ. Dankbarkeit erfüllte ihn, Demut, dass er hier war und nicht in einem Land der Katastrophen und Bürgerkriege.
Alles, was aus ihm wurde, wäre anders gekommen, wenn er nicht hier und in jenem, seinem Jahrzehnt im letzten Jahrhundert geboren worden wäre. Auch er selbst wäre ein anderer geworden. Ein Großteil dessen, was er als Gefühl von sich selbst in sich trug und was er kaum beschreiben konnte, es war diffus und schwierig zu greifen, hatte er Deutschland zu verdanken, der Region und der Zeit, in der er aufwuchs, sowie seinen Eltern, die Deutsche waren und aus jener Region stammten, keine Zugezogenen, sondern Eingewachsene. Diese feinfaserige Ausstattung der Seelen war auf den alten Fotografien, die er nicht mehr anrührte, nicht zu sehen. Auf ihnen war nichts Bedeutsames zu erkennen. Er wusste, was fehlte, er hatte es ja erlebt.
Hinzu kam, dass sein Leben vorbei war, die Erinnerungen taugten zu nichts mehr. Er zählte die Zeit, die ihm blieb, in Tagen, so eng war die Aussicht geworden. Noch hundert Tage, dachte er, um sich Mut zu machen. Er sagte nicht, noch einen Frühling oder noch einen Sommer, wenn der Frühling oder der Sommer gerade vorüber waren. Das wäre Selbstbetrug gewesen, und eine Jahreszeit, an deren Anfang er stand und die seine Hoffnung gleich erfüllt hätte, war zu kurz, um auf diese Länge hin dem Leben noch Vertrauen schenken zu können. Wie schnell gingen ein Sommer und ein Herbst vorbei, und dann wusste er nichts mehr von ihnen, und wie traurig musste ein Sommer sein, von dem er annehmen musste, dass es der letzte sei. Ein Tag war ein gutes, flüchtiges und blasses Maß, es versprach Gegenwart, Halt, im besten Falle Fülle, dass ihm noch etwas Zeit blieb, mehr als er mit den Fingern einer Hand, beider Hände zeigen konnte. Noch viele Tage würden kommen, was war damit verglichen ein einziger Tag, er löste sich aus der Nacht und verschwand wieder dorthin zurück.
Mein Vater wollte wissen, was in dem Land passierte, in dem er lebte, was vor sich ging auf der Welt, deren Teil Deutschland war. Der Gedanke an den Tod, der in den leeren Stunden, die nicht mit den Nachrichten aus der Welt zu füllen waren, heranrückte, war jetzt weit weg, die Zeitung hatte ihn vertrieben. Das schaffte kein Gedicht. Das Land lag da, reich und schwer, und er war mittendrin.
Jeder wird sich vor dem Tod zu verstecken versuchen, wird in den Wald rennen und sich im Unterholz vergraben, die Lippen zusammenbeißen und die Tränen hinunterschlucken und hoffen, dass der Tod ihn nicht findet. Aber der Tod sieht und hört alles, und es ist so, als hätte sich einer, der klein ist, vor vielen, die groß sind, versteckt, er hat keine Chance, es sind einfach zu viele, die nach ihm suchen, sie werden ihn finden, aber er gibt die Hoffnung nicht auf, die Zuversicht, dass er entwischt, ist zäh, bis der Tod vor ihm steht und sich zu ihm hinunterbeugt, ganz so, als sei er ein lieber Onkel, der nur Gutes tut, und ihn fragt, ob er nicht hervorkommen wolle, na mach schon. Der kleine Mensch in seinem Versteck, so groß wie ein Bett, fühlt sich immer noch sicher, er redet sich ein, dass der Tod ihn nicht aus dem Unterholz herausziehen kann, er hat sich doch so tief darin vergraben, und wenn der Tod einsieht, dass alle Mühe vergeblich ist, dann wird er weitergehen und ihn hier zurücklassen und vergessen. Aber der Tod gibt nicht nach, und er gibt auch nicht auf, er schiebt die Hand durch das Unterholz und packt den kleinen, zitternden Menschen und zieht ihn hervor, klemmt ihn sich unter den Arm und geht mit ihm davon, und eine Zeitung rutscht vom Stuhl, ein Buch bleibt aufgeschlagen auf dem Bett liegen, eine Flasche fällt um, und der Wein kleckert auf das Kleid der toten alten Frau, ein Klavierkonzert hört nicht abrupt auf, nur weil keiner im Zimmer mehr zuhört, und ein Fernseher läuft weiter, obwohl keiner mehr zusieht, auch nicht das Häuflein Mensch, das dort im Sessel sitzt, und die zusammengerechten Blätter werden vom Wind hochgewirbelt und wehen über den toten alten Mann dahin.