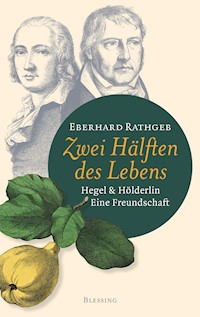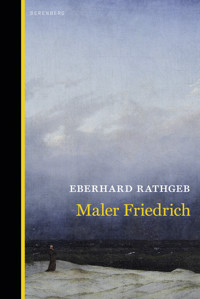
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Natur und Mensch: Damit ist es nicht gut ausgegangen, und Caspar David Friedrich hat das Malheur schon gemalt. Ausgerechnet Friedrich? Eberhard Rathgeb zeigt, warum dieser verschlossene und universal denkende Künstler heute, da Natur auch Angst macht, seine Aura mächtiger denn je entfaltet. Was waren die Lebensumstände des schon zu seiner Zeit berühmten und umstrittenen Malers, Hauptfigur der deutschen Romantik, aus der er zugleich herausfällt – weshalb er besonders intensiv leuchtet ? Dieses Buch erzählt das Leben des Künstlers und erklärt die Wirkung seines berühmten inneren Blicks, mit dem er bis heute berührt und verunsichert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EBERHARD RATHGEB
Maler Friedrich
BERENBERG
Selbstbildnis
, 1800
Selbstbildnis mit Mütze und Visierklappe
, 8. Mai 1802
Selbstbildnis mit aufgestütztem Arm
, um 1802/03
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Einige Anmerkungen zum Schluss
Über den Autor
1
Dass Caspar David Friedrich, geboren am 5. September 1774 in Greifswald, immer noch so viele Besucher ins Museum lockt, hängt an seinem Kunstkonzept, daran, dass es ihm letztlich um das Sehen, um das Sichtbare und das Unsichtbare ging und er der erste Maler war, der die Natur so darstellte, als wäre die Geschichte der Menschen an ihrem Ende angelangt. Er hat, als er sich um 1800 in der Natur umschaute, mehr wahrgenommen als andere, eine erhabene Leere und geheimnisvolle Reserviertheit. Seine Natur lächelt nicht, sie öffnet nicht die Arme, sie sagt kein Wort. Sie steht da wie ein letzter Zeuge, eine Erinnerung daran, dass die Geschichte mit dem Menschen einmal groß und gut gemeint gewesen war. Die Geschichte ist schlecht ausgegangen.
Irgendetwas hat er gesehen, das den Zeitgenossen entging, als hätte er ein verstecktes Fenster geöffnet und hinausgeschaut. Dieser Blick, der auf den besten seiner Bilder zu entdecken ist, bannt Museumsbesucher heute noch.
Friedrich ist der modernste unter den Romantikern, weil er, was er sagen wollte, in einer anderen Sprache vortrug, in Bildern, die sich nicht in Worte übersetzen lassen. Gefühl und Erkenntnis hat er in ihnen zu einer unauflöslichen Einheit verbunden. Man muss vor seinen Bildern fühlen, was er erkannte, man muss sehen lernen, was er sah.
Ohne den Protestantismus, der die geistigen und kulturellen Umbrüche um 1800 prägte, wäre er ein anderer geworden. Er war in diesem Sinne ein Kind seiner Zeit, nicht anders als Kant, Fichte, Hegel und Schleiermacher. Die protestantische Selbstprüfung und die pietistische Erziehung öffneten ihm den Innenraum, in dem seine inneren Bilder hingen, die Originale, die er auf die Leinwand übertrug. Die Landschaftsbilder, die er malte, sind ein Spiegel der modernen Einsamkeit. Er schaute auf seinen vielen Wanderungen in die Natur mit großer Wachheit und Aufmerksamkeit, aber auch mit dem Staunen der Verlorenheit, ganz so, als stände die Zeit still.
Auf seinen besten Bildern ist die Welt in ein absurdes Licht getaucht. In ihr scheint der Mensch nicht mehr vorgesehen zu sein. Die Natur hat ihn von sich abgestoßen, sie hat sich von ihm gelöst. Es gibt keinen Weg zurück. Was bleibt, ist zu warten, darauf, was noch passieren könnte. Es liegt nicht in der Hand des Menschen. Die Natur wird das letzte Wort haben.
2
Das bürgerliche Leben bietet Freiheiten und Risiken. In Jena stand gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Philosoph vor seinen Studenten und lobte das Ich, das eine ganze Welt aus sich heraus schuf, ein Ich, das das Nicht-Ich setzte. Nach Jena sind es von Dresden, wo Friedrich seit 1798 wohnte, rund 150 Kilometer. Da hätte er, großes Interesse vorausgesetzt, ein paar Tage wandern müssen. Von 1794 bis 1799 lehrt Fichte dort Philosophie. Er war damals eine Attraktion, von Goethe für den Lehrstuhl empfohlen, und zog viele junge Männer an, die sich den Kopf zerbrachen über den Zusammenhalt der Welt, was es mit ihr auf sich habe, mit Denken und Sein, Wahrheit und Wissen, und die sich Gedanken darüber machten, was ihre Bestimmung, ihre Aufgabe als Mensch sei.
Friedrich hatte anderes zu tun. Aus ihm soll ein Maler werden, einer, der in Bildern, mit Formen und Farben sagt, was er sieht, fühlt und denkt. Da half es ihm eines Tages nicht viel weiter, dass er in Greifswald gelernt hatte zu zeichnen. Es geht ihm nicht darum, etwas gut, wirklichkeitsgetreu abzumalen, ein Bild, auf dem dies oder das zu sehen ist, eine Kuh, eine Szene mit Hafenarbeitern, ein lieblicher Landstrich mit Heuschobern. Er möchte zu einer eigenen Weltsicht finden und sie zum Ausdruck bringen können.
So viel Subjektivität aus dem Stand heraus zu behaupten ist für den Sohn eines Handwerkers keine einfache Sache gewesen. Mit Handgriffen, Technik und Übung war es nicht getan. Ihm bleibt nichts anders übrig, als sich an sich selbst heranzutasten. »Auf sein geistiges Selbst ist der Mensch, ist der Maler angewiesen«, schreibt er in seiner klugen und polemischen Äußerung bei Betrachtung einer Sammlung von Gemälden von größtenteils noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstlern, die um 1830 entstehen. Das Selbst ist der Kern, der Charakter, der zum Ausdruck drängt. »Jedes Bild ist mehr oder weniger eine Charakterstudie dessen, der es gemalt, so wie überhaupt in allem Tun und Lassen eines jeden sich der innere geistige und moralische Mensch ausspricht.«
Diese Vorstellung ist ganz und gar protestantisch, pietistisch, eine Folge der reformatorischen Gewissenserforschung. Für ein gutes, reines Gewissen, eine saubere innere Stube war jeder Protestant selbst verantwortlich. Er fegt sich aus. Den Besen, den er dabei in die Hand nimmt, nennt er Selbsterforschung und Selbstprüfung.
3
Mit Kant begann die philosophische Revolution des 18. Jahrhunderts. 1781 erscheint die Kritik der reinen Vernunft. Der künftige Maler ist sieben, ein kleiner Junge, dessen Mutter in jenem Jahr starb, keine vierunddreißig Jahre alt. Die älteste Schwester übernimmt den Haushalt und kümmert sich um die Geschwister. Eine Haushälterin hilft ihr.
Kant sitzt in Königsberg und führt sein Werk mit geometrischer Gründlichkeit aus, er vermisst Verstand und Vernunft. Er hat Zeit und die für ein solches Projekt nötige Geduld und Ruhe. Er geht mit sich zu Rate, prüft seinen Verstand und seine Vernunft. Auch Friedrich wird seine Bilder geometrisch aufbauen, als würde er Gärten anlegen. Kunst, Verstand und Vernunft brauchen Struktur, so wie in der Natur, in jedem Blatt, jeder Muschel, jeder Ähre, im Lauf der Sonne, im Spiel von Licht und Schatten eine Ordnung sich abzeichnet.
Kant zieht dem Geist Grenzen, die ihm sagen, was er wissen kann und was nicht. Für die Zeitgenossen ist diese Gebietserfassung erleichternd und erschütternd, sie verstehen endlich, was in ihren Köpfen vor sich geht, wenn sie denken, und müssen sich dafür mit verwirrenden Einsichten abfinden. Die Kritik der reinen Vernunft ist eine Konstruktionsanalyse und eine Gebrauchsanleitung. Über dem Buch werden Generationen grübeln. Der erste Rezensent fordert vom Autor eine leichtere Fassung, die Kant, der verstanden werden möchte, mit den Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können 1783 liefert. Der junge Draufgänger Fichte, der bald in Jena Furore machen wird, rennt täglich über Wiesen und Felder, um seinen Kopf freizubekommen und aufnahmefähig, bevor er sich an das Studium des Buches setzt, das alle lesen, die sich ihm gewachsen fühlen.
Für Kant sind Raum und Zeit keine objektiven Gegebenheiten, die draußen in der Welt existieren, sondern subjektive Bedingungen des Erkennens, sie gehören zur Innenwelt, obwohl der unmittelbare Eindruck gegen diese Annahme spricht. Folgt die Nacht nicht auf den Tag, der Winter nicht auf den Herbst? Überragt der Kirchturm nicht die Dächer des Dorfes? Die Welt des Raumes und der Zeit, mit Berg, Wald und Meer, mit Augenblick, Gestern und Morgen, wie sie dem Menschen erscheint, wenn er sie wahrnimmt, ist in ihrer Grundstruktur ein Spiegelbild seines Geistes. Niemand erfährt und sieht die Natur, wie sie an und für sich ist. Nach Kant schiebt kein noch so scharfsinniger Kopf den Vorhang des Scheins beiseite, wie auf einer Theaterbühne, und dringt bis zu einer im Hintergrund liegenden Wahrheit vor.
Friedrich wird die Kritik der reinen Vernunft nicht gelesen haben. Aber es gab ja die Prolegomena, Rezensionen und Gespräche. Und es gab Pastor Franz Christian Boll aus Neubrandenburg, mit dem er befreundet ist. Boll hat in Jena studiert. Er hätte Bescheid wissen können.
4
Selbstporträts sind ein möglicher Weg für eine erste Selbstvergewisserung, und vielleicht auch eine Form des Bekenntnisses. Bei diesen Versuchen hat Friedrich sich selbst in der Hand, deren Vermögen von seinen Fähigkeiten begrenzt ist. Aber wie er sich sieht oder sich sehen möchte, das kommt aufs Papier.
Ein Porträt um 1800 zeigt einen jungen Mann mit leicht zur Seite gewandtem Kopf und großen Augen, ganz so, als wundere er sich über etwas, lasse sich aber davon oder von seinem Gegenüber nicht überrumpeln. Er sieht aus wie einer, der sich zu wehren weiß, er macht einen eigensinnigen und unberechenbaren Eindruck, als könnte ihm eine direkte Bemerkung rausrutschen, auch eine, die verletzen kann, eine Beleidigung. Er ist jung und hat offensichtlich noch nicht den Platz in der Welt eingenommen, der ihn ruhig und zurückhaltend werden lässt. Das Staunen beherrscht ihn, wie überall dort, wo die Empfindsamkeit durch die Wirklichkeit herausgefordert ist und ein Mensch sich orientieren muss. Sein Mund ist voll und weich, nicht verbissen und verkniffen, was nur dem gelingt, der genug Selbstvertrauen besitzt, dass er seinen Weg finden wird. Der wache Blick ist durch quälende, übermäßige Lektüre nicht abgestumpft und müde geworden, so wie die ganze Physiognomie des jungen Mannes, die Kontur seines Gesichts, eine deutliche Abwehr gegen das trostlose Grau der Gelehrtenwelt zu erkennen gibt und eine viel größere Nähe zum Reichtum der Anschauungen verrät. Er sucht das Unmittelbare, Sinnliche, nicht das Vermittelte.
Ein anderes Mal, datiert um 1802/03, sitzt ein junger Mann, immer noch ohne Backenbart, an einem Tisch vor einer Zeichnung. Er stützt den Kopf in die rechte Hand, die den Zeichenstift hält, und schaut verträumt aus dem Fenster, als könnte für sein Gefühl auf diese leise Weise der ganze Tag vergehen, ohne dass er sich deswegen grämen würde. Die Gedanken, denen er nachhängt, stimmen ihn zufrieden und er scheint darüber den Rest der Welt zu vergessen. Er sieht friedlich aus und möchte am liebsten in Ruhe gelassen werden, damit er Zeit für sich hat. Er hat sich ganz nahe an den Tisch herangerückt, als wollte er sich einigeln. Sein linker Arm liegt schwer auf dem Papier, als wäre sein Tagwerk abgeschlossen. Die Anforderungen der Realität hat er beiseitegeschoben, er sucht sich mit der Welt auf eine Art zu verbinden, bei der nicht Arbeit und Forschung maßgeblich sind, sondern Träumen und Sinnen, er möchte sich in sich selbst und in eine Anschauung versenken, ohne einem Zweck, einer Absicht zu folgen. Der Blick ist wehmütig, wie bei Verliebten, die nicht zusammen sind, aber aneinander denken. In seinem Gefühlsüberschwang könnte der junge Mann mit dem weichen Gesicht Gedichte schreiben. Dafür würde er die richtigen Wörter finden, er müsste nicht viel machen, sie fielen ihm zu, durch das Fenster, das nicht nur den Blick nach draußen öffnet, sondern auch nach innen. Träte jetzt ein Besucher ins Zimmer, der junge Mann würde nicht aufmerken, und wenn, er würde wie aus einem Tagtraum erwachen und sich verwundert umsehen.
Auf einem weiteren Porträt, datiert vom Künstler auf den 8. Mai 1802, trägt er eine Mütze und eine Visierklappe, die er zum besseren Sehen, zum Fixieren von Dingen und Details beim Zeichnen in der Natur verwendet. Er ist frontal zu sehen. Der aufmerksame, durchdringende Blick aus dem freien großen Auge ist streng und unerbittlich geradeaus gerichtet, wie bei einem Jäger, dem kein Tier in der nebeligen Morgendämmerung auf der Lichtung entgehen soll. Dieser junge Mann lässt sich nichts sagen, er prüft die Dinge von seinem Gesichtspunkt aus, und lieber widerspricht er, als dass er gleich nachgibt. Er besteht darauf, seine eigenen Erfahrungen zu machen, und er ist bereit, dafür Wegezoll zu zahlen. Im Fall eines Malers bedeutet das, dass er nicht den akademischen Regeln folgen und sich nicht mit unerheblichen Arbeiten abfinden wird, wie sie zur Finanzierung der Existenz nötig sein können, zum Beispiel Kopieren und Kolorieren. Er ist voller Hoffnung, Zuversicht und Tatendrang, und er vertraut seinen Kräften, deren Ausmaß ihm noch nicht bewusst ist.
Ein Kieler Freund, der Maler Johan Ludvig Lund, hat ihn um 1800 porträtiert, ein Medaillon-Bildnis. Friedrich hat hellblondes Haar, große blaue Augen und macht einen selbstgewissen Eindruck, nicht überheblich, aber seiner Sache sicher. Er ist fast im Profil zu sehen und sein Blick, der leicht nach oben gerichtet ist, schaut offen in die Zukunft, wie bei einem Mann, der gute Aussichten hat und sich etwas zutraut. Schüchtern sieht er nicht aus, eher so, als könnte er sich schnell aufregen und sich dann nicht mehr im Griff haben, als würde bei ihm, ohne dass er weiß, wie ihm geschieht, für Sekunden die Sicherung durchbrennen. Nicht dass er jähzornig ist, aber in ihm steckt ein ungezähmtes Potential, wie eine Erinnerung, die, kaum dass sie von irgendetwas berührt worden ist, hochschießt und ihn paralysiert. Er scheint zu wissen, dass er von solchen Kräften heimgesucht werden kann und dass er sich vor ihrer Eruption schützen muss. Nirgendwo in seinem Gesicht nistet die Dumpfheit, die sich dem Schicksal tatenlos überlässt, das die eigenen dunklen Gefühle einem Menschen bereiten. So wie er hier locker sitzt und beherzt schaut, ähnlich einem kleinen französischen Landadeligen vor der großen Revolution, von der er nichts ahnen möchte, scheint er zuversichtlich zu sein, dass es ihm immer besser gelingen wird, sich in den Griff zu bekommen und seine Gefühle ins rechte Fahrwasser zu leiten.
Ein Selbstbildnis um 1802, die Zeichnung für einen Holzschnitt, den sein Bruder herstellen wird, zeigt Friedrich im Profil mit Backenbart. Hier sieht er städtisch und energisch und etwas intellektueller aus, als ginge er zu einem Treffen der Romantiker, wo viel geredet wird und jeder sagt, was er denkt und fühlt. Es kommt nicht darauf an, viel gelesen zu haben, sondern darauf, eigene Ideen und Empfindungen vortragen zu können, die letztlich um einen selbst und die eigenen Projekte kreisen, um das, was man macht und sich vorgenommen hat. Das Profilbild als solches trägt dazu bei, den Charakter des Porträtierten stabil wirken zu lassen. Der Mensch, den es zeigt, hat eine eindeutige Kontur, die ihn, wie eine scharfgezogene Grenze, sowohl mit der Umgebung verbindet als auch von ihr abgrenzt, was sich als Zeichen einer sozial erfolgreichen Selbstbehauptung sehen ließe. Dieser junge Mann kennt seinen Weg, und er hat ihn zu seiner Zufriedenheit eingeschlagen. So sieht ein Maler aus, der auf erste Erfolge zurückblicken kann, der überzeugt ist, dass dieser Erfolg kein Zufall ist, sondern seinem Talent geschuldet, und der davon ausgeht, dass der gute Stern über ihm nicht erlöschen wird.
Auf einer Zeichnung um 1810 ist Friedrich sichtlich gealtert, er wirkt sehr hager. Jetzt ist er sechsunddreißig Jahre alt. Den Kopf hält er etwas gesenkt, leicht schaut er von unten nach oben, wie jemand, der Distanz wahren möchte und skeptisch ist gegenüber den kursierenden Ansichten und Meinungen und sich fragt, ob er all den Leuten trauen kann. Der Blick aus den großen Augen wirkt streng, beobachtend, kritisch. Er trägt einen rauschenden Backenbart. Ganz sicher wird er immer unverblümt sagen, was er denkt und fühlt, und er wird dabei keine Rücksicht auf Konventionen nehmen oder auf ein Wohlgefallen, das er wecken möchte. Die Dinge, mit denen er sich beschäftigt, ja das ganze Leben, sie sind zu ernst, als dass er sich und anderen etwas vorspielen möchte. Doch das bedeutet nicht, dass er einfach preisgibt, was ihn zutiefst bewegt. Er ist unnahbar und reserviert, als traute er dem freundlichen Schein nicht, den üblichen Oberflächlichkeiten des gemeinen sozialen Lebens. Sein Misstrauen scheint noch tiefer zu reichen. Nicht dass er vor sich selbst misstrauisch wäre und voller Anspannung auf der Lauer liegen würde, aber es fällt ihm schwer, sich emotional gehen zu lassen und völlig unbeschwert zu sein und auf diese Weise herauszufinden aus inneren Zwängen, was er tun und was er unterlassen soll, und aus selbstgestellten Grundsatzanforderungen, wer er ist und wie er ist. Vielleicht hat er bei entsprechenden Versuchen und unverhofften Erlebnissen schlechte Erfahrungen gesammelt.
In der Alten Nationalgalerie in Berlin hängt in einem Saal, der seinen Werken gewidmet ist, ein Porträt von ihm, das Caroline Bardua malte und das in Dresden im Jahr 1810 ausgestellt wurde. Er schaut jetzt etwas jünger aus als auf der Zeichnung, die er von sich mit sechsunddreißig Jahren gemacht hat, jünger und erholt, ein Eindruck, der sicher auch der fremden Hand geschuldet ist, die ihn im Glanz und mit der Würde eines erfolgreichen Künstlers porträtieren wollte. Er wirkt ernst, intelligent, selbstbewusst, wie einer, der sich gut überlegt hat, was er denkt und was er tut, der ein gewisses Ansehen bei seinen Mitbürgern genießt, wie es ein Künstler erfährt, der mit seinen Bildern Aufsehen erregt hat und ins Gespräch gekommen ist. Dieser Mann ist um eine wohlgesetzte Antwort nicht verlegen, er sagt seine Meinung klar und deutlich, wenn er es für nötig hält, so wie er nur in seinem Stil malt. Er sieht nicht aus wie jemand, der viel redet oder schwadroniert, ständig in Kneipen sitzt, trinkt und Karten spielt, sondern wie einer, der zu arbeiten versteht, der feste Ansichten hat und sie zu verteidigen weiß. Die Kneipen sind Friedrich nicht fremd gewesen. Am 9. Mai 1815 schreibt er an die Malerin und Schriftstellerin Louise Seidler, er habe Geld mit zwei Freunden im Gasthaus »versoffen«. Das wird nicht oft vorgekommen sein. Als Junge sind ihm, wie seinen Geschwistern, vom Vater Sprüche eingebläut worden, was man tun und was man lassen, wie man sich verhalten soll, Merksätze aus dem pietistischen Hausschatz, mit denen man über sich Gericht halten konnte.
Der Mann auf dem Bild von Caroline Bardua ist freundlich, aber knorrig, der Typ, der alleine sein kann, für sich, und der zu grübeln, in sich hineinzuhorchen versteht. So einer muss aus dem dünn besiedelten Norden stammen, vom flachen, melancholischen Land, ein Kind der rauen Küste, kalten Wind und graues Meer gewohnt, ein vom Wetter geschüttelter Baum am Rand eines Ackers. Es liegt auf der Hand, dass er lutherischen Glaubens ist und dass ihm Pomp, Ausschmückung und Bilderpracht, wie in katholischen Kirchen üblich, fremd sind. Er vermag auf den eigenen Füßen zu stehen, auch und gerade vor Gott. In dem Brief, den Friedrich dem Rat der Stadt Stralsund schickt wegen der Wiedereinrichtung der St. Marienkirche und der dort am 27. März 1818 mit seinen Zeichnungen einging, schreibt er: »Ein Gebäude, so zu Gottes Verehrung bestimmt ist, muß nach meiner Meinung möglichst einfach geordnet seyn … Wenigstens der so mit lauteren reinen Herzen ins Gotteshaus tritt, muß nicht durch eine widrige Anordnung und formlosen Hausputz und Überladungen in seiner Stimmung gestöhrt werden.« Ein guter Protestant braucht nicht viel Unterstützung von außen für seinen Glauben, er liest die Bibel und macht sich seine eigenen Gedanken. Eine solche selbständige Haltung scheint Friedrich von jedem anderen Mann erwartet zu haben.
Mit dem Pastor von Neubrandenburg, Franz Christian Boll, war er verwandt. Im Sommer 1800 haben die beiden zusammen eine Wanderung gemacht. Friedrich hat Boll immer wieder treffen können bei seinen häufigen Besuchen in Neubrandenburg, wo seine Brüder Samuel und Adolf seit 1801 lebten. Adolf geht später zurück nach Greifswald und übernimmt den väterlichen Betrieb, in dem Seifen und Kerzen hergestellt werden. Pastor Boll war aktiv in der Erweckungsbewegung in Mecklenburg. Er schrieb ein Buch über den Verfall und die Wiederherstellung der Religiosität, das 1808 und 1809 erschien. Ob Friedrich es gelesen hat? Er hat mit Boll über dessen Ansichten ganz sicher geredet. Dass ihm, dem Maler, die Religion am Herzen lag, dass ihn ein tiefes religiöses Gefühl durchdrang, das kann man aus seinen Gesichtszügen lesen, die von protestantischer Aufrichtigkeit und Standfestigkeit gezeichnet sind, einem Lebensstil, dessen rechthaberischer Ernst von einem inneren Kerzenlicht erleuchtet zu sein schien. In Mecklenburg, davon konnte Pastor Boll dem Maler Friedrich lange erzählen, leerten sich um 1800 die Kirchen. Es gab Dörfer, in denen die Gottesdienste ausfielen, weil keiner mehr hinging. Neubrandenburg hat fünftausend Einwohner, aber oft stehen nur noch hundert in der Kirche und beten. Boll sieht die Ursache des Verfalls nicht nur bei der Aufklärung und bei Kant. Der Verfall begann seiner Ansicht nach viel früher, mit der Reformation, mit ihrem Glauben an das abstrakte Wort, mit ihrer kritischen Haltung, die sich nur an den Verstand richtet und für die Stimmung und den Ritus, die bei den Katholiken herrschten, wenig Sinn hat. Hier setzten seine Reformpläne an. Lehrer sollen Orgel spielen lernen, ein Gesangbuch für das ganze evangelische Deutschland muss her, Beerdigungen sollen bei Tage durchgeführt werden, weil der Tod zum Leben gehört wie das Jenseits zum Diesseits, Trauungen sollen in der Kirche vollzogen und die Gemeinden in Bezirke der Seelsorge aufgeteilt werden.
Und der Maler, hätte er nicht mit seinen Bildern seinen Teil zur Belebung des Glaubens beitragen können? Ungewöhnlich sind religiöse Themen unter Männern um 1800 nicht. Die Religion spielt überall mit, bei der Moral, bei der richtigen Lebensführung, in der Kunst und in der Philosophie, und sie zieht den Maler aus Greifswald heraus aus der Sphäre der Geschäfte, Projekte und des Alltags, dem sich die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts zugewandt hatte, und hinein in eine florierende Innenwelt, in ein Gespinst von Vorstellungen und Ideen. Wie eine dünne Nebelschicht legt sie sich über die Wirklichkeit und macht sie unwirklich, als sei, was dort vorfällt, zwar notwendig, aber letztlich nicht wichtig, nur sekundär. Überall lauert eine andere, höhere Welt, deren protestantischer Stellvertreter auf Erden der Geist ist. Jeder Mensch trägt ihn mit sich herum. Von einem romantischen Furor gepackt, fängt der Geist um 1800 an, in der Natur nach seinem Spiegelbild zu suchen, nach einer verlorenen Einheit.
Der Gott der Theologen wird durch das Göttliche des Universums und der Natur ersetzt, der Schöpfer, den die Bibel verkündet und dessen Worte und Taten die Kirche auslegt, durch seine Schöpfung. Fern der Dogmen breitet sich ein freies Land aus, das erhabene Ansichten bietet, Bergmassive, tiefe Wälder, Auen der Harmonie. Die Ausdrucksformen dieses neu erweckten religiösen Gefühls können individuell und vielfältig sein. Ein offenes Christentum predigt Friedrich Schleiermacher in seinen populären Reden über die Religion, die 1799 veröffentlicht werden. Alles, was war und wurde, die Mineralien, die Pflanzen, die Landschaften, die Geometrie, die Träume, barg von nun an ein Geheimnis, ein Zeichen, weil alles mit allem zusammenhängt und möglicherweise einen großen Organismus bildet, eine große Offenbarung. Dieser romantischen, spirituellen Vorstellung, die den ungeheuren Erfolg der Naturwissenschaften in verschwörerischen Nischen überleben wird, hing Friedrichs Freund Carl Gustav Carus an, Arzt, Naturforscher, Maler und Autor zahlreicher Bücher. Das Weltall, so Carus, sei ein einziger Organismus, und man dürfe deshalb auch nicht unterscheiden zwischen einem Reich des Todes und einem Reich des Lebens. Alles sei in Entwicklung, lebe, auch die Sonne, auch die Erde. Eine kurze Schrift mit diesem Bekenntnis zum Einheitsdenken trägt den programmatischen Titel Geheimnisvoll am lichten Tag. ›Über die Natur‹. Ein Maler mit diesen Ideen im Kopf wird Flüsse und Berge anders malen, als handle es sich um beseelte Wesen und als ließe sich deren Herkunft aus einem größeren Zusammenhang nicht mehr verbergen. Die Natur wird durchlässig für ein überirdisches Licht.
Organismisch und in Analogien zu denken bedeutete, die Welt mit philosophisch-religiöser Phantasie zu durchdringen, als wäre jetzt ein Künstler am Werk. Wer dies tat, belebte und formte die Wirklichkeit nach seinem inneren Sinn, er legte sie nach seinen Vorstellungen aus, einer Mischung aus Stimmung, Ahnung und Wissen. Diese Freiheit, seinen Assoziationen und Ideen zu folgen, ganz so, als sprächen die Dinge in einer geheimen Sprache und man müsste ihnen nur zuzuhören verstehen, brauchte eine Struktur, um nicht im Wahn zu enden. Wo die Korrektive an den Wissenschaften und der Empirie fehlten, musste aus eigenem Selbsterhaltungstrieb nach Zeichen, nach Ordnungen gesucht werden, die den Kontakt mit der Realität und ihren Formen hielten. Die Romantik war ein Sog aufs Meer der Einbildungskraft. Die religiöse Erneuerung, die sich Pastor Boll um 1800 erhoffte, konnte mit stabileren Gemütern rechnen. In den Reihen der Gemeinden hielten sich alle Erweckten an der Hand und gingen sich nicht verloren.
Friedrich suchte in der Malerei eine Ordnung für die Gefühle. Doch damit allein war es nicht getan. Verachtung, Hass und Verzweiflung sollten nicht den Pinsel führen. Nur mit geläuterter Seele durfte der Maler vor dem Bild stehen. »Die einzig wahre Quelle der Kunst«, schreibt er, »ist unser Herz, die Sprache eines reinen kindlichen Gemütes. Ein Gebilde, so nicht aus diesem Borne entsprungen, kann nur Künstelei sein. Jedes echte Kunstwerk wird in geweihter Stunde empfangen und in glücklicher geboren, oft dem Künstler unbewußt aus innerem Drange des Herzens.« Die Einheit der Welt kann nur wahrnehmen, wer nicht mit ihr zerfallen ist. Wenn ein Zerwürfnis droht, das Herz zu empören und zu schädigen, muss man sich, um das reine, kindliche Gemüt vor ihm zu retten, in die eigene, intakte Weltvorstellung zurückziehen. Sein Weg als Künstler war damit vorgezeichnet. Irgendwann, wenn sein Stil, seine Art des Malens, seine Sujets aus der Welt fallen, vom Publikum nicht mehr beachtet werden, wird er sich einkapseln und versuchen, nur noch für sich zu sein, seinen Weg zu Ende zu gehen. Zu grundlegenden Korrekturen war er nicht gemacht. Seine frühen Selbstporträts haben es ahnen lassen.
5
Die Landschaften, die er zeichnete und malte, bestehen aus hohem Himmel, schweren Wolken und vollem Mond, gestaffelten Bergen und weitem Meer, auf dem Segelschiffe fahren, aus Küsten mit Fischernetzen und Tälern mit Ruinen von Klöstern, mit kargen Eichen, dickem Schnee und grünen Wiesen, mit Kirchtürmen und strikten Horizonten, und vielleicht dass einmal ein Pferd zu sehen ist, und wenn Menschen auftauchen, stehen sie da, als wollten sie nicht gestört werden, sie haben sich abgewandt und sind von hinten zu sehen, als hätte der Maler vermeiden wollen, dass es zu einer unmittelbaren Begegnung und Auseinandersetzung mit ihnen kommt. Als Gegenstand der Kunst interessieren ihn die Menschen nicht sehr, anders als die Natur, vor allem die von Menschenhand unberührte. Figuren sind, das schreibt er am 28./29. Mai 1816 an seinen Bruder Christian, den Holzschnitzer, »so eigendlich meine Sache nicht«.
Von Städten und Dörfern sind oft nur Silhouetten zu erkennen, nahezu nie sind Straßenszenen zu sehen, wo etwas passiert, Leute zusammenstehen oder in die Kirche gehen, ein Fuhrwerk auf den Markt fährt, ein Haus gebaut wird, eben Ereignisse aus dem alltäglichen Leben. Friedrich war kein Chronist, keiner, der etwas schildert, erzählt, festhält, der vom Alltag überwältigt und fasziniert ist, vom sozialen Gewusel, den Charakteren, dem Zusammenspiel der Hände. Die Natur drückt bei ihm all das zur Seite. Hier, in der Natur, muss alles stimmen, jeder Grashalm an seinem Fleck stehen, jede Baumart zu erkennen sein. Da sieht er genau hin, und er merkt sofort bei anderen Malern die Fehler. Über einen seiner Kollegen, der nicht aufpasste, schreibt er:
»Eigen war diesem Künstler, daß er, was ihn in der Natur richtig ansprach, oft ohne alle Rücksicht auf Zeit, Gegenstand und Ort anwandte. So liebt er zum Beispiel den Abendhimmel mit aller Farbenglut gleich nach Sonnenuntergang, aber seine Landschaft war immer noch im Sonnenlicht, und die Schlagschatten der Gegenstände oft ganz kurz wie am Mittag. Die Färbung eines Kiefernwaldes in der Natur entzückte sein Auge, und ohne Rücksicht wandte er auch dies auf Laubholzwaldung an. Verschüttete Ruinen, wo er in Bergschluchten etwa gesehen und gezeichnet, versetzte er auf Felsengipfel, wo sie doch nicht verschüttet sein konnten.«
Dieser Vorwurf kam aus einer genauen Kenntnis der Natur. Man könnte ihn auch und gerade auf jene ausdehnen, die heute ohne gründliche Naturerfahrung und ohne auf Wanderungen erworbenes Wissen von der Natur in Museen vor Landschaftsbildern stehen. Sie genießen Aussichten in ein ihnen fremdes Land, wie auf Postkarten, und sehen statt Kastanien und Eichen nur Bäume, statt Eulen und Krähen nur Vögel, statt Granit nur Stein. Wie mit wachem Blick und steter Begeisterung die Natur betrachtet und ihre Schätze erforscht werden konnten, lässt sich in Goethes Tagebüchern nachlesen, die zur selben Zeit entstanden wie Friedrichs Bilder. Männer, Laienforscher auf den Gebieten der Botanik, Mineralogie und Geologie, streiften durch Wälder und Berge und sammelten Eindrücke und Fundstücke, um die Übermacht, die sie umgab, die Natur in ihrem Werden und Wirken besser zu verstehen.
Später, als Legenden und Meinungen um ihn schwirrten, war dort noch Platz genug für die Vermutung, dass Friedrich nicht derjenige geworden wäre, als der er berühmt wurde, der Maler der Romantik, der Deutschen, des Nordens, wenn er nach Italien gekommen wäre, sich hier länger aufgehalten, die italienische Landschaft, das Licht des Südens studiert und die andere Lebensart kennengelernt hätte. Obwohl er Freunde und Bekannte hatte, die in Italien gewesen sind, fuhr er nicht. Ein Landschaftsmaler brauchte seiner Ansicht nach nicht tausend Kilometer von zuhause wegfahren, er sollte sich stattdessen daheim umsehen, die Gegend vor der Tür kennenlernen, genau hinschauen. Alle Welt wollte nach Italien wegen der alten Meister und weil das Leben unter der südlichen Sonne ganz anders sein sollte. Friedrich blieb im Norden, weil hier seine große Lehrerin war, die Natur, die auf eine geheime Weise zu ihm passte.
Der Autor des Artikels ›C. D. Friedrich‹ in der Allgemeinen Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, Leipzig 1849, behauptet dort, Friedrich wäre nach Italien gefahren, wenn seine finanzielle Lage es ihm erlaubt hätte. Eine Gräfin, die er auf ihrer Reise dorthin hätte begleiten können, habe das Angebot zurückzogen, als sie hörte, dass der Maler sich ausbedungen habe, sie nicht gnädige Gräfin oder gnädige Frau nennen zu müssen. In seinen Gemälde-Betrachtungen ist Italien weit aus seinem Horizont gerückt. »Denen Herren Kunstrichtern«, heißt es hier, »genügen unsere teutsche Sonne, Mond und Sterne, unsere Felsen, Bäume und Kräuter, unsere Ebenen, Seen und Flüsse nicht mehr. Italienisch muß alles sein, um Anspruch auf Größe und Schönheit machen zu können.« War er froh, dass er nicht nach Italien kam? In einem Brief behauptet er, dass er nicht dorthin fahre, weil der Weg zurück nach Hause ihm zu schwer fallen würde. Dem befreundeten Maler Johan Ludvig Lund, der ihn nach Rom einlädt, wohin er hätte aufbrechen können, da ihn noch keine eigene Familie zuhause festhält, schreibt er am 11. Juli 1816:
»Dank für die freundliche Einladung, nach Rom zu kommen, aber ich gestehe frei daß mein Sinn nie dahin getrachtet. Aber jetzt, da ich einige der Zeichenbücher des H((errn)) Faber durchblättert bin ich fast anders Sinnes worden. Ich kann mir es jetzt recht schön denken nach Rom zu reisen und dort zu leben. Aber den Gedanken, von da wieder zurück nach Norden könnte ich nicht ohne Schaudern denken; daß hieße nach meiner Vorstellung so viel: als sich selbst lebendig begraben. Stillzustehen lasse ich mir gefallen, ohne Murren, wenn es das Schicksall so will; aber rückwärts Gehen ist meiner Natur zuwider dagegen empört sich mein ganzes Wesen.«