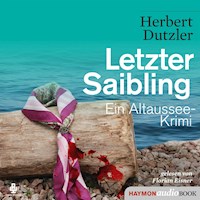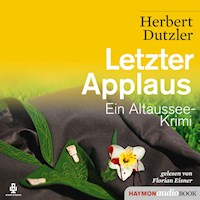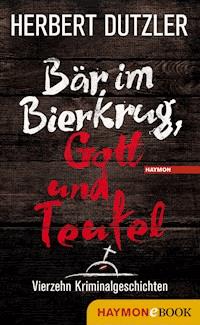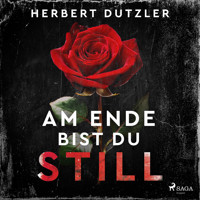
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist ein schmaler Grat, der ein scheinbar normales Leben vom Abgrund trennt Sabine kann sie nicht mehr ertragen: ihre Mutter, die sie ständig überwacht und die ihr, schon seit sie ein kleines Mädchen war, vorschreibt, was sie zu tun, zu fühlen, zu denken hat. Und die auch ihre erwachsene Tochter nicht loslassen will. Bis Sabine nur noch einen einzigen Ausweg sieht: Sie muss sich befreien. Ihre Mutter muss sterben. Aufwachsen unter den Augen einer Helikoptermutter Herbert Dutzler nimmt uns mit zur Wurzel des Bösen: in Sabines Kindheit mit einer alles kontrollierenden Mutter und einem passiven Vater, der selbst daran scheitert, den Ansprüchen seiner Frau gerecht zu werden. Wir erleben, wie aus einem verletzlichen Kind eine Erwachsene wird, die sich wehrt, die in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und Rache zu allem fähig ist. Ein beklemmendes Feuerwerk aus verstörender Spannung, vielschichtiger Psychologie und dem drängenden Wunsch nach Vergeltung. Herbert Dutzler, ein empathischer Blick in menschliche Abgründe Herbert Dutzlers Markenzeichen? Wenn er nicht gerade beschauliche Regionalkrimis oder nostalgische Romane schreibt, nimmt er uns dort mit hin, wo es so richtig wehtut, und zwar direkt in die Köpfe von Mörder*innen. Seite für Seite führt er uns tiefer in deren zerstörerische Gedankenwelt und zeigt einfühlsam, aber schonungslos, wie sie sich zu dem entwickeln konnten, was sie geworden sind: mörderisch.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Herbert Dutzler
Am Ende bist du still
Kriminalroman
I
Die Scheiben sind beschlagen. Ich male mit dem Finger ein lachendes Gesicht in den feuchten Belag. Hinter den klar gewordenen Stellen zeichnet sich Nebel ab, Nieselregen. „Lass das!“, sagt Mama und biegt rechts ab. „Das sieht man dann auch noch, wenn es trocken ist. Und ich kann wieder alles sauberwischen.“ Sauberwischen. Das ist ein wichtiges Wort für meine Mutter. Ständig wird alles saubergewischt. Wenn ich ein leeres Glas auf dem Wohnzimmertisch stehen lasse, räumt sie es sofort in die Spülmaschine. Aber nicht, ohne argwöhnisch zu kontrollieren, ob es womöglich einen Ring auf der Tischplatte hinterlassen hat. Und nicht ohne einen Seufzer und einen Blick, der mich wissen lässt, dass ich ihr wieder Arbeit gemacht habe. Dann wird saubergewischt. Sogar, wenn mit freiem Auge kein Schmutz zu erkennen ist.
„Lass mich hier raus!“ „Kommt gar nicht in Frage! Zuerst dreh ich um, damit du nicht über die Bundesstraße musst.“ „Aber da ist doch eh ein Zebrastreifen. Und ein Schülerlotse!“, protestiere ich. „Ja, ja“, Mama nickt ungeduldig, „auf die darf man sich nicht verlassen. Die meisten Fußgänger werden auf Zebrastreifen überfahren.“
Als wir umgedreht haben, bleibt Mama, weil es keinen Parkplatz gibt, direkt am Straßenrand stehen. Gleich nach dem Zebrastreifen. Die bösen Blicke der Schülerlotsen, die sieht sie ja nicht, mit denen muss ich zurechtkommen. „So. Pass gut auf dich auf. Und wenn die Schule früher aus ist, vergiss nicht, dass du mich anrufst. Und wenn du den Musiktest zurückbekommst, dann rufst du mich auch an. Oder schickst mir zumindest eine SMS. Und spann den Schirm auf!“ Ich antworte nicht. Was soll ich ihr auch sagen? Dass wir in der Schule kein Handy verwenden dürfen? Dass die meisten in meiner Klasse gar keines haben? Dass ich mir lächerlich vorkommen würde, wenn ich wegen einem Musiktest, der eigentlich gar kein Test war, sondern nur eine Übung, gleich zu Hause anrufe? Dass es das Lächerlichste überhaupt wäre, für die paar Meter einen Schirm aufzuspannen?
Ich schlage die Autotür zu und ziehe mir meine Kapuze über den Kopf. Hoffentlich fährt sie gleich weg und schaut mir nicht noch zu, wie ich die wenigen Schritte zum Schultor gehe und darin verschwinde. Am besten, ich drehe mich gar nicht mehr um. Direkt am Eingang rempelt mich jemand an. Vincent. „Na, du Schlampe? Wieder einmal im Taxi gekommen?“ Eigentlich sind Schimpfwörter verboten. Aber ich hab’s aufgegeben, mich darüber aufzuregen. Wenn man sich beschwert, gibt’s höchstens in der Pause Ärger und Vincent reißt mich an den Haaren. Er und ein paar der anderen Buben reden Mädchen immer nur mit so blöden Sprüchen an. Und wenn man Glück hat, sagen sie „Alter“ zu einem.
Zu Hause darf ich solche Wörter gar nicht in den Mund nehmen, aber manchmal rutscht mir doch eins raus. Dann gibt es Kopfschütteln und einen entsetzten Blick von Mama. Solange sie sich noch unter Kontrolle hat, ist lautes Geschimpfe bei ihr tabu, denn das ist anscheinend pädagogisch falsch. Und sie macht ja alles richtig. Zumindest erklärt sie Papa mindestens dreimal am Tag, wie Erziehung geht.
Ich hab nachgeschlagen, was eine Schlampe ist. Steht sogar im Duden. Eine unordentliche, unmoralische Frau soll das sein. Aber ich glaube, Vincent hat gar keine Ahnung, was das Wort bedeutet.
„Hallo, Paula!“, sage ich zu meiner Sitznachbarin, während ich mir die Stiefel ausziehe. Die sind übrigens nur deswegen so sauber, weil Mama sie jeden Tag putzt und eincremt. Sie waren teuer, sagt sie, und sind aus nachhaltiger Produktion, allerhöchste Qualität. Und das Leder braucht seine Pflege. Am Wochenende muss ich sie selber eincremen und bürsten. Ich hätte lieber solche Stiefel wie Paula. Die glänzen, haben ein paar Glitzersternchen drauf und müssen sicher nicht jeden Tag geputzt werden. Paula würdigt mich keines Blickes und wirft ihre Stiefel unter die Garderobenbank. „Wartet auf mich!“, ruft sie den anderen Mädchen nach und lässt mich stehen. Wahrscheinlich ist sie neidisch, weil ich jeden Tag mit dem Auto zur Schule gebracht werde. Und ihre Mutter hat sicher kein so tolles Auto wie meine. Das neue hat sogar eine Klimaanlage. Obwohl wir die jetzt im Winter überhaupt nicht brauchen.
Ich hänge meinen Rucksack um die Schultern und plage mich die Stiege hoch, die von den Garderoben im Keller zu unserem Klassenzimmer im ersten Stock führt. In der Früh bin ich immer so müde. Ich glaube, ich könnte gar nicht zu Fuß in die Schule gehen. Ich schaffe ja kaum die paar Stufen.
Oben in der Klasse ist schon der Teufel los. Das ist nichts Besonderes, so laut ist es immer. Ein paar Buben flitzen zwischen den Bänken herum und werfen sich den staubigen Tafelschwamm zu. Mein Pult ist voller Kreidestaub, wahrscheinlich ist der Schwamm einmal dort gelandet. „Hast du die Deutsch-Hausübung?“, fragt Paula. Ich nicke. Ich habe immer jede Hausübung, weil Mama so lange nachfragt, bis ich ihr jede Einzelheit eines Schultages erzählt habe. Außerdem holt sie immer alle meine Schulsachen aus dem Rucksack, kontrolliert sie auf Eselsohren und schaut nach, welche Aufgaben ich angekreuzt habe. Die Deutsch-Hausübung habe ich zweimal geschrieben. Einmal auf einen Zettel und danach ins Heft. Mama lässt mich nicht gleich ins Heft schreiben, das wird nicht schön genug, sagt sie. „Kann ich die Nummer 64 abschreiben? Da hab ich mich nicht ausgekannt!“ Ich nicke. Wenn sie was von mir will, kann Paula also doch wieder freundlich sein. Oder zumindest so tun, als ob. Ich schiebe ihr das Heft hin. Gerade, als sie beim dritten Satz ist, kommt Frau Augenthaler herein, wahrscheinlich angelockt von dem Geschrei der Buben. „Vincent! Kevin!“, schreit sie. „Her mit dem Schwamm!“ Sie hält die Hand auf, während die Buben erstarren. Schnell lässt Paula mein Heft in ihrem Pult verschwinden. Frau Augenthaler hat nichts gemerkt. „Legt den Schwamm zurück. Und bis zum Läuten werdet ihr zwei mich begleiten, damit ihr nicht noch mehr Unsinn anstellen könnt.“ Die beiden folgen ihr unter Stöhnen auf den Gang, schneiden Grimassen hinter ihrem Rücken. Nun ist es für ein paar Minuten ruhiger.
Als es läutet, lege ich meine neue Federschachtel auf den Tisch. Paula und die anderen sollen sehen, was ich bekommen habe. Es gibt da diesen neuen Film, den alle sehen wollen. Oder schon gesehen haben. Und dazu gibt es – seit gestern erst! – die passenden Schulsachen. Ich bin die Erste, die sie hat. Und das dürfen auch ruhig alle sehen. Auf beiden Seiten sind die Tiere aus dem Film abgebildet. Ich rücke sie mehrmals zurecht, weil mir vorkommt, als würde Paula ganz bewusst in eine andere Richtung schauen. Dabei weiß ich genau, dass sie nichts lieber hätte als genau diese Federschachtel.
Mama hat sie mir gestern gekauft. Natürlich hab ich lange betteln und raunzen müssen, schließlich war das Ding nicht ganz billig. Aber sie hat sich selber wieder einmal eine ziemlich teure Tasche gekauft, da ist ihr nichts anderes übriggeblieben, als mir auch was zu kaufen. Vor allem, wo ich ja die ganze Woche überhaupt nichts angestellt habe. Und sie hat garantiert mehr Taschen als ich Federschachteln. Die alte war an den Rändern auch schon ein bisschen abgeschabt, und außerdem ist ein total kindisches Motiv drauf, das schon lange nicht mehr in ist.
„Na, was haben wir denn da?“ Kevin schnappt sich in der Pause meine neue Federschachtel und schwingt sie drohend vor meinem Gesicht hin und her. Ich sage nichts, und Paula steht auf und geht. Ich weiß aus Erfahrung, dass es schlimmer wird, wenn man sich wehrt. „Na, was haben wir denn da? Was hat unser Tussi-Schlampen-Mäuschen denn da wieder bekommen? War das teuer?“ Ich glaube, er weiß nicht recht, was er jetzt anfangen soll. Keiner von seinen Freunden ist auf uns aufmerksam geworden, und ohne Zuschauer macht es ihm wohl keinen Spaß, mich weiter zu quälen. Er hält meine Federschachtel hoch über seinen Kopf, macht den Reißverschluss auf und leert den Inhalt auf den Boden. Dann wirft er die Federschachtel in den Mistkübel und verschwindet.
Ich fische sie wieder heraus und putze sie gerade ab, als Frau Augenthaler wieder hereinkommt. Die Federschachtel ist im Mistkübel auf einer glitschigen Bananenschale gelandet, aber sonst ist ihr nichts passiert. „Hat’s Ärger gegeben?“, fragt Frau Augenthaler. Ich schüttle den Kopf. Würde ich erklären, was passiert ist, hätte ich nach der Stunde ein noch viel größeres Problem. „Ist mir runtergefallen.“ Frau Augenthaler zieht die Stirn in Falten. Natürlich glaubt sie mir nicht, sie kennt die Buben in unserer Klasse. Und außerdem weiß sie, dass ich nicht so ungeschickt bin, meine Sachen in der Klasse zu verstreuen.
„Kannst du bitte einen Augenblick warten?“, fragt mich Frau Augenthaler nach der letzten Stunde. „Ich möchte noch kurz mit dir reden.“ Ich nicke nicht, schüttle auch nicht den Kopf, bleibe aber vor dem Lehrerpult stehen, bis alle verschwunden sind. „Wer war’s denn diesmal?“, fragt sie und klingt etwas entnervt dabei. „Niemand“, sage ich. Sie seufzt. „Du weißt aber schon, dass es nichts bringt, sich alles gefallen zu lassen?“ Ich denke daran, dass Mama wahrscheinlich schon mit laufendem Motor draußen wartet. Sie regt sich immer auf, wenn ich zu lange brauche, um nach draußen zu kommen. Es gibt ja kaum Parkplätze, und wenn sie warten muss, ist sie dem Schulbus und den Fußgängern im Weg. Und damit ist sie nicht die Einzige, es gibt eine ganze Reihe von Müttern wie meine, die ihre Kinder nicht zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren lassen und draußen alles verstopfen.
Ich schweige. „Vielleicht solltest du dir überlegen, ob es gut ist, ständig auffällig teure Sachen in die Schule mitzubringen“, sagt Frau Augenthaler schließlich. „Erstens bringt dir das keine Freunde, und zweitens gibt’s Probleme, wenn sie dann kaputt gemacht oder gar gestohlen werden.“ Mir fällt nichts ein, was ich darauf sagen könnte. Hoffentlich ist Mama nicht schon zornig. „Na, dann!“, sagt Frau Augenthaler noch und lächelt. Ich laufe aus dem Klassenzimmer in die Garderobe und suche einen meiner Stiefel, den ich schließlich in einer Ecke finde, in die ich ihn sicher nicht geworfen habe. Fast alle anderen Kinder sind schon weg.
„Wo warst du denn so lange?“, zischt Mama, als ich endlich einsteige. Sie fährt ruckartig an, noch bevor ich Zeit habe, mich anzuschnallen. „Ich hab noch aufs Klo müssen“, sage ich. „Aufs Klo hättest du zu Hause auch gehen können! Du weißt doch, dass ich warte!“ Ohne auf die Kinder zu achten, fährt Mama über den Zebrastreifen.
1
Sie hätte doch Jus studieren sollen, wie ihre Mutter es ihr geraten hatte. „Da lernst du die richtigen Leute kennen. Die Söhne von Rechtsanwälten, Bankdirektoren und so weiter.“ Ihre Mutter hatte nicht im Traum daran gedacht, dass man als Frau zu irgendeinem anderen Zweck studieren könnte, als um sich einen reichen Mann zu angeln.
Dennoch. Soviel Unsinn sie manchmal von sich gab, in diesem Punkt hatte sie recht gehabt. Germanistik war doch nicht das Wahre. Die Studenten, die um sie herum saßen, waren nicht einmal gepflegt. Von attraktiv ganz zu schweigen. Ausgebeulte Hosen, fleckige T-Shirts, zottelige Haare und Bärte. Man durfte ernsthaft bezweifeln, dass auch nur einer von ihnen aus halbwegs gutem Hause war. Natürlich war sie sich dessen bewusst, dass sie sie mit ihren Blicken förmlich auszogen. Die Mädchen hier waren ja, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht viel besser.
Gelangweilt blätterte Sabine um. Eine Seite hatte sie schon mitgeschrieben, obwohl ihr nicht ganz klar war, was der Professor mit dieser Vorlesung überhaupt bezweckte. Faust durch die Jahrhunderte, na und? Wen interessierte das, und vor allem: Brauchte man das als Lehrerin? Allerdings, ganz unattraktiv war der Mann nicht, sie hatte etwas übrig für graumelierte Herren. Und er trug einen guten Anzug, womöglich sogar italienisch. Ob er verheiratet war? Vielleicht dazu noch seine Sekretärin vögelte, oder eine Doktorandin? Zuzutrauen war es ihm. Sie konnte ja bei ihm eine Prüfung über die Vorlesung ablegen, so würde sie ihn vielleicht näher kennenlernen. Oder, noch besser, einfach einmal in seiner Sprechstunde auftauchen. Sie konnte ihn ja fragen, ob er ihre Masterarbeit betreuen wollte – warum nicht? Es würde ihm sicher auffallen, wie stilsicher und sorgfältig sie gekleidet war.
„Ja, meine Damen und Herren, das war es für heute mit meinen Ausführungen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder.“ Noch bevor er ausgesprochen hatte, verließen die meisten Studenten fluchtartig den Hörsaal. Es waren ohnehin schon viel weniger gewesen als zu Beginn des Semesters.
Sorgfältig strich sie ihren Rock glatt und stand von ihrem Platz in der zweiten Reihe auf. Der Professor nickte und lächelte ihr zu. Sie erwiderte sein Nicken, ebenso das Lächeln. Man tat gut daran, den Professoren aufzufallen. Weit vorne zu sitzen und auf ein makelloses Äußeres zu achten, gehörte dazu. Der Professor würde sich daran erinnern, dass sie regelmäßig seine Vorlesung besucht und immer fleißig mitgeschrieben hatte. Zumal sie immer auf demselben Platz gesessen war. Langsam stieg sie die Stufen zum Ausgang hinauf. Ein paar Studenten saßen noch auf den Kanten der Pulte im Hörsaal und unterhielten sich. Über Fußball, glaubte sie zu hören.
Draußen warf sie einen Blick nach rechts. Mehrere Grüppchen standen rauchend vor dem Haupteingang, ein paar strebten den Fahrradständern zu, der Rest verteilte sich in Richtung Toiletten und Bibliothek. Sabine nahm ebenfalls die Stiege hinunter zur Toilette. Sorgfältig zog sie Lidstrich und Lippenstift nach. Es war immerhin schon früher Nachmittag, eine kleine Make-up-Auffrischung war um diese Zeit angesagt.
„Hallo!“ Er stand da, als hätte er vor der Toilette auf sie gewartet. „Darf ich dich auf einen Kaffee einladen?“ Sie musterte ihn skeptisch. Sie wusste lediglich, dass er Daniel hieß, außer der Faust-Vorlesung auch noch ein Seminar mit ihr gemeinsam besuchte und ein blauweißes Rennrad besaß, das er mit einem riesigen Bügelschloss vor der Uni ankettete. Er war nicht unattraktiv, sein mittellanges Haar war allerdings verwuschelt und offenbar rasierte er sich nicht täglich. Aber er roch gut, das musste sie eingestehen.
Sie zuckte mit den Schultern. „Wo?“ Er zeigte mit einer Kopfbewegung hinauf ins Erdgeschoß. „Uni-Buffet?“ Sie seufzte. „Wenn’s sein muss.“ Prinzipiell hatte sie nichts dagegen, eingeladen zu werden, aber es musste nicht unbedingt das Uni-Buffet sein. Es gab schließlich auch gepflegte Innenstadtcafés. Eigentlich hätte er sie vorangehen lassen sollen, dachte sie bei sich. Keine Umgangsformen. Andererseits hatte sie so Aussicht auf einen knackigen Hintern und eine schlanke, offensichtlich muskulöse Silhouette. Was er wohl von ihr wollte?
„Ich hab schon besseren Kaffee getrunken.“ Sie setzte die Tasse ab. Er lächelte. „Aber nicht in so angenehmer Gesellschaft.“ Ziemlich billige Anmache. Aber ein charmantes Lächeln. „Du redest nicht viel. Und nicht mit allen. Das gefällt mir.“ Sie zog die Augenbrauen hoch. „Dich hab ich noch nie mit einer Freundin gesehen.“ Etwas gekünstelt breitete er die Arme aus und zog eine Grimasse. Sie schlug bewusst langsam ihre Beine übereinander. Tatsächlich senkte er kurz seinen Blick. „Ich hab nicht viele Freundinnen. Da bin ich ein bisschen wählerisch.“ Sie nahm noch einen Schluck von ihrem Kaffee. Mit etwas Zucker wäre er sogar annehmbar gewesen. In der Öffentlichkeit allerdings legte sie großen Wert darauf, nicht beim Verzehr von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln gesehen zu werden. Es ließ auf Disziplinlosigkeit schließen. Und das Letzte, was sie tun wollte, war, sich gehen zu lassen.
„Ich habe da so eine Idee, wegen dem Mittelalterseminar“, sagte er. Sie ahnte, worauf er hinauswollte, und fühlte sich sofort ein wenig in die Enge getrieben. Die Seminararbeit konnte auch in Partnerarbeit erledigt werden, man erhoffte sich dadurch Synergieeffekte, interessantere Ansätze. Sie hatte bisher nicht nach einem Partner gesucht, und dabei hatte sie es eigentlich auch belassen wollen.
„Würdest du die Arbeit mit mir schreiben? Es könnte Spaß machen.“ „Spaß? Mittelalter?“ So wie sie das sah, ging es mehr oder weniger um endloses Exzerpieren und Zusammenfassen der gängigen Literatur zum Thema. Oder war er lediglich auf ein Abenteuer mit ihr aus? „Weißt du was?“, sagte sie und stand auf. „Ich schreib meine Arbeiten lieber alleine. Und wenn du mich anmachen willst, lass dir etwas Kreativeres einfallen.“ Sie ließ ihn stehen. „Kann ich wenigstens deine Telefonnummer haben? Falls mir was Kreatives einfällt.“ Sein Lächeln war wirklich irgendwie … Sie wusste selbst nicht, was sie tat, als sie einen Stift hervorkramte, nach seiner Hand griff und ihre Nummer auf seinen Handrücken kritzelte.
Nur wenige Stunden später hatte sie eine Nachricht von ihm auf ihrem Handy. Erstens, so schrieb er, habe er schon einige Vorarbeit geleistet. Sie solle sich den mitgesandten Link ansehen. Zweitens schlug er vor, sich zu einer ernsthaften Besprechung im Café Melchior zu treffen. Das war schon eher nach ihrem Geschmack. Und drittens meinte er, mittelalterliche Epen würden sich auch hervorragend zur Umarbeitung in erotische Romane eignen. Ob sie auf eine Kostprobe Lust habe. Das war schon unverschämt. Sie öffnete ihren Laptop und fand den Link, den er ihr geschickt hatte. Er enthielt nicht nur einen brauchbaren Entwurf für eine Gliederung der Arbeit, sondern auch schon die Rohfassung eines ersten Kapitels. Sie beschloss, es mit ihm zu versuchen. Allerdings wollte sie, so angenehm sie das Lokal auch fand, mit ihm nicht ins Café Melchior. Dort wurde sie lieber mit anderen Leuten gesehen. Er könne morgen Nachmittag zu ihr kommen, schrieb sie. Sie schickte ihm ihre Adresse.
Zwar war es ihr ein wenig peinlich, dass sie im Studentenheim wohnte, doch war sie ausnahmsweise dem Rat ihrer Mutter gefolgt und hatte ein Zimmer im Heim einer konservativen Studentenorganisation genommen. Dort stünden die Chancen höher, Leute aus dem richtigen Umfeld zu treffen, hatte Mama gemeint. Das Zimmer war geräumig und komfortabel, dafür aber auch teuer. Zudem stellte sich heraus, dass die Leute, die ihre Mutter als „die Richtigen“ bezeichnete, überhaupt nicht in Studentenheimen, sondern in eigenen Wohnungen lebten. Bei einem Besuch zu Hause war wieder einmal ein heftiger Streit zwischen ihren Eltern losgebrochen, als sie davon berichtet hatte. „Da siehst du es!“, hatte ihre Mutter gezischt – und den Vater daraufhin mit Vorwürfen überhäuft, die alle darauf hinausliefen, dass er zu wenig tüchtig sei, zu wenig verdiene, dass sie ihre Karriere, ja, ihr ganzes Leben ihm geopfert habe, und nichts, gar nichts, sei dabei herausgekommen. Ihr war das peinlich gewesen, sie hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, das ihre Mutter unverändert gelassen hatte, seit sie ausgezogen war. Der Rückzug hatte nichts genützt, die schrillen Schreie ihrer Mutter wurden selbst durch die geschlossene Tür kaum gedämpft. Sie beschloss, sich ehestmöglich selbst eine Wohnung zu besorgen.
Daniels Vorarbeit war nicht schlecht, soweit sie das beurteilen konnte. Sie hatte sich mit der Thematik noch kaum auseinandergesetzt, das hatte, so fand sie, Zeit. Bestimmt war er in der Lage, eine gute Note für sie herauszuholen. Und wenn sie es geschickt anstellte, musste sie selbst nicht allzu viel Arbeit investieren. Er hatte erotische Mittelalterromane erwähnt. Sie überlegte.
Als sie mittags nach Hause kam, hatte sich die Sonne gerade durch die Wolken gekämpft, die am Morgen noch für Nieselregen gesorgt hatten. Sie trat auf den Balkon. Der Boden war bereits getrocknet, der Beton unter ihren nackten Füßen warm. Man konnte sich in die Sonne setzen. Nach den vier Stunden in Seminaren und Vorlesungen am Vormittag hatte sie sich das redlich verdient. Sie zog ihren Pullover über den Kopf, entledigte sich ihrer Strumpfhose und klappte den Liegestuhl auseinander. Ein paar Windstöße ließen sie gelegentlich frösteln, doch die Sonne wärmte ihre Haut schnell wieder auf. Sie sah auf die Uhr. In einer halben Stunde würde Daniel kommen. Sofern er pünktlich war. Pünktlichkeit, das war ihr wichtig. Sie selbst kam nirgendwohin und zu keinem Anlass zu spät, das machte schließlich kein gutes Bild und zeugte von mangelnder Selbstdisziplin. Die Studenten, die ständig zu spät kamen, fand sie, konnte man schon an ihrem Äußeren erkennen. Ungepflegt, schlampig. Ringe unter den Augen. Leute, die ihr Leben nicht im Griff hatten.
Ihr wurde heiß. Sie stand auf, ging ins Zimmer zurück, kramte im Schrank nach ihren Bikinis, die sie seit letztem September nicht getragen hatte. Als sie einen fand, schnupperte sie daran. Er roch ein bisschen nach Sonnenöl, ein wenig nach Waschmittel. Sie zog sich um, legte sich wieder in ihren Stuhl und spürte die Wärme auf ihrer Haut.
Es klopfte an ihrer Tür. Vier Minuten zu spät. Sollte sie etwas über den Bikini ziehen? Sie entschloss sich, es nicht zu tun, und öffnete. Daniel schien überrascht, lächelte und musterte sie von oben bis unten. Was er sah, schien ihm zu gefallen. „Komm doch rein!“ Etwas unsicher trat er ein paar Schritte in den Raum und hob seine lederne Umhängetasche leicht an. „Ich hab …“ „Es ist so schön sonnig draußen. Der erste richtig warme Tag …“, rechtfertigte sie sich. Er zog Bücher aus seiner Tasche. „Ich hab“, wiederholte er, „ein paar Texte mitgebracht. Damit wir gleich weitermachen können.“ Seine Blicke wanderten zwischen ihr und dem Liegestuhl auf dem Balkon hin und her.
„Soll ich mir was anziehen?“ Er zuckte mit den Schultern. „Mir egal. Wenn dir nicht kalt ist …“ Fast meinte sie, ein wenig Ablehnung zu spüren. War er nicht an ihr interessiert? Er war es doch, der zu flirten begonnen hatte. Sie setzte sich aufs Bett und überkreuzte die Beine. „Zeig einmal her!“ Sie streckte die Hand nach den Büchern aus. Sie rochen ein wenig muffig. Altes Zeug. Die Hand an seiner Umhängetasche, stand Daniel mitten im Zimmer. Sie klopfte neben sich auf das Bett. „Setz dich doch her!“ „Ich weiß nicht …“, murmelte er. Er wirkte plötzlich wie ein kleiner, schüchterner Bub. Diese Seite an ihm war neu, die hatte sie bisher noch nicht kennengelernt. Vorsichtig setzte er sich auf die Bettkante.
„Daraus habe ich schon die wichtigsten Stellen exzerpiert“, meinte er und zeigte auf einen dicken grünen Wälzer. Der war es, stellte sie fest, der so unangenehm roch. „Und wenn wir zusammenarbeiten, dann könntest du vielleicht aus diesem da …“ Er zeigte auf einen schmäleren, kartonierten Band, der offenbar neueren Datums war. Sie warf einen Blick in den hinteren Teil des Buches. Es hatte nicht einmal zweihundert Seiten. Das war ihr recht. Auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, wenn Daniel auch diese Aufgabe übernommen hätte.
Sie beugte sich über das Buch und gab vor, darin zu lesen. Dass Daniel dadurch einen guten Blick auf ihren Busen bekam, war ihr nur recht. „Weißt du“, sagte sie, „ich bin momentan noch wahnsinnig mit meinem Englischseminar beschäftigt. Dystopische Literatur. Voll anspruchsvoll.“ Daniel sah sie an. „Was hast du?“ „The Handmaid’s Tale“, sagte sie. Er nickte. „Spannende Geschichte. Hab ich voriges Jahr … nein, vor zwei Jahren gelesen. Zu Weihnachten bekommen. Von …“ Er stockte. Hatte er es von seiner Freundin bekommen und innegehalten, weil er nicht über sie sprechen wollte? Interessant. Sie hatte das Buch noch nicht einmal gekauft. Wahrscheinlich würde sie das Seminar ohnehin abbrechen. Aber als Ausrede konnte es gute Dienste tun.
Tatsächlich schielte Daniel nach ihrem Busen, wandte seinen Blick aber sofort wieder ab, als er sich ertappt fühlte. Sie spürte, wie sich ihre Brustwarzen aufrichteten und gegen den dünnen Stoff drückten. „Also, äh …“, stotterte er. „Was ist jetzt? Wollen wir zusammen an dem Thema arbeiten? Ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen trocken und so …“ Sie nickte. „Wenn du mir Zeit lässt. Für mein Englischseminar?“ Sie schenkte ihm ein Lächeln. Wenn er sich hinhalten ließ und in den nächsten Wochen Vorarbeit leistete, konnte sie ja am Schluss mehr oder weniger Korrektur lesen und so ihren Beitrag leisten. Er nickte. Seine Blicke verrieten, dass er sich mehr erhofft hatte, aber sie hatte nicht vor, sich ausnutzen zu lassen. Auch nicht von einem relativ gutaussehenden Mann.
„Magst du einen Kaffee? Wir könnten uns noch ein bisschen auf den Balkon setzen und plaudern?“ „Äh, ja …“ Seine Blicke irrten über ihren Körper und die Balkontür. Er war eindeutig verunsichert. Sie stand auf und füllte den Wassertank der Kaffeemaschine. „Da steht noch ein Liegestuhl draußen“, sagte sie. „Du kannst ihn dir aufstellen.“ Er verschwand auf den Balkon, schien froh, eine Beschäftigung zu haben. Als sie mit den Kaffeetassen auf den Balkon trat, saß er vornübergebeugt in seinem Liegestuhl. „Zucker? Milch?“ Er schüttelte den Kopf. „Heiß!“ „Ja“, grinste sie. „Wird mit kochendem Wasser gemacht.“ „Nein!“ Er deutete zur Sonne. „Ich meine …“ Warum schaffte er es plötzlich nicht mehr, vollständige Sätze von sich zu geben?
„Du kannst dich ruhig ausziehen. Hier sieht uns niemand.“ Er starrte sie an. Belustigt setzte sie sich in ihren Liegestuhl und lehnte sich zurück. Er streifte seinen Pullover ab. Darunter trug er ein kurzärmeliges T-Shirt, das einen schlanken, muskulösen Oberkörper erkennen ließ. Auf dem linken Oberarm wurden Ansätze eines Tattoos sichtbar. Kein bestimmtes Motiv, sondern Linien und Bögen, die sich bis zur Schulter hinauf zu erstrecken schienen. Sie nahm einen Schluck Kaffee.
Offenbar hatte er gemerkt, dass sie sein Tattoo genauer betrachtete. „Magst du Tattoos?“ Sie zuckte mit den Schultern. „Ich hab keins. Will auch keins. Oft ist es ein bisschen ordinär.“ Das war gelogen. In Wirklichkeit hatte sie schon länger überlegt, sich tätowieren zu lassen. Zwischen den Schulterblättern. „Oh!“, antwortete er. Sie lächelte. „Deins nicht!“, beruhigte sie ihn. Er entspannte sich etwas. „Es ist ein Tribal“, erklärte er und schob seinen Ärmel hinauf, sodass sie das gesamte Kunstwerk bewundern konnte. „Kommt von den Maori in Neuseeland“, sagte er. Das Thema schien ihn zu fesseln. „Die sind meistens am ganzen Körper tätowiert, sogar im Gesicht.“ „Möchtest du das auch?“, fragte sie. Er schüttelte den Kopf. „Das reicht!“ Er zeigte auf seinen Oberarm. „Du könntest das T-Shirt ausziehen. Damit ich es ganz sehen kann.“ Verblüfft sah Daniel sie an. In seinem Gesicht arbeitete es. Es war ihr bewusst, dass er gerade überlegte, ob ihre Worte als Aufforderung zum Sex gemeint waren. Dennoch zog er sein T-Shirt über den Kopf. Über dem Brustbein hatte er ein paar dunkle Haare, sonst war sein Oberkörper haarlos, aber schweißnass. „Du hast noch gar nichts von deinem Kaffee getrunken.“ Sie nickte in die Richtung seiner Tasse. Er nahm sie zur Hand und lehnte sich nun endlich in seinen Liegestuhl zurück.
„Hier kann man sich auch nackt in die Sonne legen“, sagte sie. Schon fuhr sein Kopf wieder hoch. „Aber die anderen Balkone?“ Sie zuckte mit den Schultern. „Die Nachbarn haben Besseres zu tun, als über die Begrenzung zu gucken“, sagte sie. Er stürzte seinen Kaffee hinunter. „Ich muss jetzt weg, hab noch zu tun.“ Ihm schien die Situation unangenehm zu werden. War wohl doch nur Angeberei gewesen, sein Flirten. Inklusive der Anspielung auf erotische Romane. Schade. Doch je mehr er sich für sie interessierte, desto eher würde er bereit sein, den Löwenanteil der Arbeit zu übernehmen. Für heute, so entschied sie, hatte sie genug getan.
Er stand auf, suchte nach seinem T-Shirt. Sie stellte sich neben ihn. „Tschüs!“ Sie legte einen Arm um seine nackte, tätowierte Schulter. Sie war warm. Er bekam einen Kuss auf die Wange, erwiderte ihn und berührte sie ebenfalls an der Schulter. Seine Hand war heiß. Er musterte sie noch einmal. Ein Träger des Bikini-Oberteils war von ihrer Schulter gerutscht. Sie bemühte sich nicht, ihn wieder hinaufzuschieben, als er in sein T-Shirt fuhr. Fast gehetzt wirkte er nun. „Ich lass dir das Buch dann trotzdem da! Du kannst mir’s ja zur Uni mitbringen, wenn du’s nicht mehr brauchst!“ Er drückte ihr das neuere, kartonierte Buch in die Hand. „Wir können uns auch wieder hier treffen, zur Besprechung?“, meinte sie. „Oder bei dir?“ Er nickte, zog seinen Sweater über den Kopf, stopfte die übrigen Bücher in seine Tasche und hastete zur Tür. Mit einem dumpfen Ploppen fiel sie ins Schloss.
Irgendwie war sie verärgert. Es war nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Aber in der Zusammenarbeit mit Daniel würden sich noch mehr Chancen ergeben.
„Darf ich mich zu dir setzen?“ Fast schüchtern wirkte Daniel heute. Sie hatten in den letzten Tagen ein paar E-Mails ausgetauscht. Um ihn bei Laune zu halten, hatte sie ein wenig in dem kartonierten Buch gelesen und ihm ein paar Häppchen zukommen lassen, die, das musste sie sich eingestehen, nicht viel mehr waren als teils wortidente Zusammenfassungen von Seiten aus dem Original. Er dagegen hatte ihr bereits eine überarbeitete Gliederung und ein neues Kapitel der Arbeit geschickt, das sie überflogen hatte. Mit Beistrichsetzung und Groß- und Kleinschreibung hatte er es nicht so, da konnte sie gern helfend eingreifen. Seine Fehler erinnerten sie an ihre Schulzeit. Damals hatte sie auch Rechtschreibprobleme gehabt. Seit sie von zu Hause weg war, war es besser geworden. Viel besser. Und sie hatte sich in die entsprechenden Regeln vertieft. Eine schlechte Rechtschreibung zu haben, machte keinen guten Eindruck. Und einen guten Eindruck zu hinterlassen, war ihr wichtig.
Sie nickte ihm zu, schenkte ihm ein Lächeln. Er hatte sich sogar um etwas Stil bemüht und auf ein schlabbriges T-Shirt verzichtet. Stattdessen trug er ein dunkelblaues, leicht glänzendes Hemd mit langen Ärmeln, die bis zu den Ellenbogen aufgerollt waren. Von seinem Tattoo war nichts zu sehen. „Bitte!“ Sie wies auf den freien Platz neben sich. Daniel setzte sich, nahm seine Ledertasche auf den Schoß und kramte darin. „Bist du weitergekommen?“, fragte er. „Ein bisschen. Du weißt ja. Das Dystopie-Seminar.“ Er nickte, aber es war ihr, als habe sie auch ein leichtes Augenrollen wahrgenommen, das Missfallen ausdrückte.
„Einen schönen Nachmittag, die Herrschaften!“ Frau Doktor Leistner-Rahl betrat den Raum. Der leicht ironische Unterton in ihrer Begrüßung war nicht zu überhören. Sie hielt sich für unendlich überlegen und hatte so eine gewisse Art, auf Studenten hinabzublicken. Was ihr nicht sehr schwerfiel, denn sie war mindestens eins achtzig und trug zudem hohe Absätze. Mit ihrem langen schwarzen Haar und dem schmalen Gesicht war sie ziemlich attraktiv, zumal sie sich auch gut kleidete. Bei ihr, das wusste Sabine, musste man vorsichtig sein. Zu auffälliges Styling und übertrieben präsentierte Reize konnten das Missfallen von Frau Doktor Leistner-Rahl erregen, denn sie hielt sich viel auf ihre feministische Grundhaltung zugute. Sie blieb stets sachlich und neutral, manchmal sogar beinhart. Bei ihr konnte man am besten mit Zurückhaltung punkten. Deshalb trug Sabine in ihrem Kurs immer einfache Jeans und Pullover, ohne jeden Schmuck. Und wenn nicht sorgfältig gegendert wurde … Gute Nacht! Am liebsten, so schien es Sabine manchmal, waren ihr deklariert schwule Männer. Von denen es im Kurs, soweit sie das überblickte, nur zwei gab. Einer davon, Andreas, gab sich übertrieben feminin, der andere, dessen Namen sie nicht kannte, fiel weder durch sein Äußeres noch durch sein Verhalten auf. Sie wusste lediglich, dass er schwul war, weil er mit seinem Partner häufig händchenhaltend über den Campus spazierte.
Der Vortrag war langweilig. Das gesamte Mittelalter und mit ihm seine Literatur konnte ihr gestohlen bleiben. Was gab es da noch zu forschen? Das hatten Germanisten bereits die vergangenen 200 Jahre getan, ohne dass der Welt etwas entgangen wäre, wenn sie es nicht getan hätten. Intellektuelle Selbstbefriedigung, ihrer Meinung nach. Und jetzt sollten sie sich zu den Einleitungsszenen der wesentlichen Artusepen Gedanken aus den Hirnwindungen saugen. Und erklären, warum es je nach Version und Landstrich leichte Abweichungen zwischen den Handschriften gab. Ihrer Meinung nach waren die Mönche, die das ganze Zeug kopierten, einfach unkonzentriert oder kurzsichtig oder beides gewesen. Oder ständig besoffen. Alles andere waren übertriebene Spekulationen.
„Sie haben bereits zusammen an Ihrem Thema gearbeitet?“ Sabine hatte völlig übersehen, dass Frau Doktor Leistner-Rahl an ihren Tisch getreten war und es an ihnen war, einen Zwischenbericht über den Stand ihrer Recherchen abzugeben. Den anderen Teams, die das bereits getan hatten, hatte Sabine nur am Rande zugehört, nachdem ihr Handy vibriert und sie einen Anruf ihrer Mutter weggedrückt hatte. Was wollte die schon wieder? Sie wusste doch, dass sie dienstags nicht erreichbar war, weil sie den ganzen Tag auf der Uni verbrachte.
Daniel sah zu Frau Doktor Leistner-Rahl auf und versuchte ein Lächeln. Er tauschte einen kurzen Blick mit ihr, sie nickte ihm zu. Daniel fasste es als Zustimmung dazu auf, dass er reden sollte. Er räusperte sich. Die Dozentin schien ihn mit ihrem Lächeln nervös zu machen. Dazu kam, dass ihre Augen durch die Brillengläser zusätzlich vergrößert wurden. Dennoch gelang ihm eine übersichtliche und sinnvolle Darstellung dessen, was sie bisher getan hatten. Er war sogar in der Lage, in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen, fiel Sabine auf. Das konnte man nicht von allen Mitstudenten behaupten. Manche von denen stotterten herum, als seien sie direkt von der Sonderschule an die Uni geschickt worden. Daniel hatte außerdem eine unaufgeregte, aber dennoch energische Gestik. Sie ertappte sich, wie sie insgeheim seine gebräunten Unterarme mit dem feinen blonden Flaum darauf betrachtete.
„Und Sie?“, fragte Frau Doktor Leistner-Rahl plötzlich, an Sabine gewandt. Die nannte den Titel des dünnen kartonierten Buches, das Daniel ihr dagelassen hatte, und kramte einige Zitate daraus hervor. Frau Doktor Leistner-Rahl rümpfte die Nase. „Da sollten Sie sich aber schon noch ein bisschen genauer damit beschäftigen. Kritisch hinterfragen, vergleichen mit anderen Quellen.“ Sabine lächelte und nickte. Sie musste aufpassen. Die Dozentin durfte nicht auf den Gedanken kommen, sie wolle sich Arbeit ersparen und einfach an Daniels Arbeit mitnaschen. Man musste vorsichtig sein.
Mama schon wieder. Diesmal musste sie den Anruf aber annehmen, zu oft hatte sie sie schon weggedrückt. Sie warf sich auf ihr Bett, schob sich einen Polster in den Nacken und hob ab. „Mein Liebes! Endlich erwisch ich dich einmal!“ Der süßliche Ton ihrer Mutter ging ihr so auf die Nerven, dass sie am liebsten gleich wieder aufgelegt hätte. Was war bloß mit ihr los? Wie konnte man seine eigene Mutter hassen? Auf die Frage ihrer Mutter, wie denn die Woche bisher so gewesen sei, wusste sie nichts Rechtes zu antworten. Sie rang sich ein paar Sätze zu den Seminaren ab, die sie gerade besuchte. „Und, schon jemanden kennengelernt?“ Die unvermeidliche Frage, in lüsterner Neugier vorgetragen. Sabine musste an Daniel denken. Kennengelernt? Sicher nicht so, wie ihre Mutter das meinte. „Falls du wissen möchtest, ob ich diese Woche schon jemand Neuen gevögelt habe: Nein!“ In der gleichen Sekunde bereute sie diese Grobheit. Manchmal sollte man sich Dinge einfach bloß denken und nicht aussprechen, schalt sie sich. Mit ein bisschen belanglosem Smalltalk hätte sie ihre Mutter eine Weile unterhalten und dann auflegen können. Stattdessen musste sie einen Streit vom Zaun brechen. Ihre Mutter schluchzte unterdrückt. „Dass du so böse zu mir bist. Wo ich doch alles für dich tu!“ „Entschuldige, Mama. Ist mir so rausgerutscht. Weil mich die Fragerei nervt. Du fragst ja immer das Gleiche.“ Ihre Mutter hatte sich gefangen und setzte zu einer längeren Erklärung an. „Weißt du …“, begann sie. Sabines ausfällige Bemerkung schien sie schon wieder vergessen zu haben. „Ab einem gewissen Alter …“ Sabine nahm die Fernbedienung in die freie Hand und schaltete den Fernseher ein, um sich von ihrer Tirade abzulenken.
„Wann du wieder einmal heimkommst, habe ich gefragt!“ Sabine hatte ihr Geplapper völlig ausgeblendet. „Bald, Mama!“, sagte sie. Und in diesem Moment läutete es an ihrer Tür. Das musste Daniel sein. „Mama, ich hab jetzt eine Besprechung! Tschüs!“ Noch bevor ihre Mutter fragen konnte, mit wem sie sich denn besprechen wolle und ob das vielleicht ein interessanter Mann für sie sei, hatte sie aufgelegt.
„Komm doch rein!“ Sie strahlte Daniel entgegen, in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass sie sich keine einzige Minute mit dem Inhalt des Buches beschäftigt hatte, seit sie am Dienstag im Seminar nebeneinandergesessen hatten. „Magst du einen Kaffee?“ Daniel nickte. Sie wandte sich der Kaffeemaschine zu und öffnete einen Knopf ihrer Bluse.
Als sie die beiden Kaffeetassen auf dem Schreibtisch abstellte, begegnete ihr ein skeptischer Blick Daniels. „Du hast nichts gemacht seit Dienstag, oder?“ „Das kann man so nicht sagen!“, verteidigte sie sich und beugte sich beim Abstellen der Kaffeetassen vor, um Daniel etwas abzulenken. Der schien es nicht zu merken. „Ich hab mir Gedanken gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass in deinen Texten Fehler sind. Die kann ich korrigieren. In puncto Rechtschreibung kann mir niemand was vormachen.“ Das war zumindest übertrieben, wenn nicht gelogen. Daniel seufzte. „Ich brauch aber keine Lektorin, die meine Texte korrigiert, sondern jemanden, mit dem ich zusammen eine wissenschaftliche Arbeit schreiben kann. Zusammen, verstehst du!“ Er streute ein Säckchen Zucker in seinen Kaffee. „Hast du auch Milch?“ Sie nickte und warf die Haare zurück. „Warum hast du eigentlich eine Kapselmaschine? Das ist voll unökologisch, das weißt du schon?“ Was ging es ihn an, was für eine Kaffeemaschine sie benutzte? Aber besser, ihn nicht zu verärgern. „Ich weiß. Weihnachtsgeschenk. Sobald ich genug Geld habe, besorg ich mir eine andere.“ Daniel nickte. „Und kommende Woche häng ich mich voll rein, versprochen!“ Irgendwie musste sie sein Misstrauen abbauen. Wieder nickte er und schien besänftigt.
Die nächste Viertelstunde verbrachte er damit, ihr zu erklären, was er in der vergangenen Woche gelesen hatte, wie er es in die Arbeit zu integrieren gedachte und welche Schlussfolgerungen er aus seiner Lektüre gezogen hatte. Er schien vom Thema gefesselt, wodurch ihm völlig entging, dass Sabine nur dasaß, gelegentlich nickte und Interesse heuchelte, während sie tatsächlich sein rechtes Ohr und seinen Hals fixierte. Er schob den Ärmel seines Pullovers hoch. Die gebräunte Haut und die feinen Härchen, die zum Vorschein kamen, fand sie interessanter als die Rittergeschichten, von denen er faselte.
„Kann ich noch einmal dein Tattoo sehen?“ Sie hatte eine Pause genutzt, die Daniel machen hatte müssen, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Überrascht sah er auf. „Hä?“ Offenbar war er gerade ganz woanders. Sie musste ihn hierher zurückholen. „Ja. Es gefällt mir. Vielleicht möchte ich auch so eins.“ Er starrte sie an, immer noch die Kaffeetasse in der Hand haltend. „Ist aber mehr ein männliches Motiv.“ „Jetzt zeig endlich!“
Er zuckte mit den Schultern, stand auf und zog seinen Pullover über den Kopf. Darunter trug er ein enganliegendes graues T-Shirt. Auch das zog er aus. Etwas betreten stand er vor ihr. Man konnte ihm ansehen, dass er nicht wusste, wohin mit seinen Händen. Schließlich entschloss er sich, sie ineinanderzulegen, um seine Finger zu kneten. Sabine trat auf ihn zu und strich über die Linien, die sich von seiner Schulter über seinen Oberarm zogen. Dann trat sie einen Schritt zurück, öffnete die wenigen Knöpfe ihrer Bluse und ließ sie hinter sich fallen. Sie nahm seine Hand in ihre. „Da. Da hätte ich es gerne.“ Sie legte seine Hand auf ihre Schulter und ließ sie den Oberarm hinuntergleiten.
Plötzlich zuckte Daniel zurück. „Ich … ich“, stammelte er. „Doch. Du darfst.“ Sie griff noch einmal nach seiner Hand, legte sie an ihre Brust. Sofort zog er sie wieder zurück. „Ich … ich möchte das nicht. Ich habe eine Freundin und ich …“ Sie verschränkte ihre Arme. „Du willst ihr treu sein? Kannst du ja auch. Aber gegen ein bisschen Spaß ist doch …“ „Das hat mit Spaß nichts zu tun!“ Er griff hastig nach seinem T-Shirt. „Ich mag dich … und alles, aber …“ Sabine warf einen Blick auf seine Hose und konnte seine Erregung deutlich erkennen. Er war ja nicht einmal mehr in der Lage, ganze Sätze von sich zu geben. Daniel hatte schon seinen Pullover übergestreift, stopfte hastig seine Unterlagen vom Schreibtisch in seine Ledertasche. „Es tut mir leid“, krächzte er. „Aber …“ Rückwärtsgehend tastete er nach der Türklinke und war wenige Sekunden später verschwunden. Sabine stand wie erstarrt.
Das war eine Unverschämtheit. Was sie ihm angeboten hatte, konnte man nicht zurückweisen. Hatte noch nie einer zurückgewiesen. Das war eine Beleidigung sondergleichen. Sie hatte ihm ihren Körper schenken wollen. Na ja, nicht schenken. Zur Benutzung überlassen. So musste man es sehen. Und dieser Körper hatte einiges zu bieten. Männer wurden in der Regel zu sabbernden Idioten, wenn sie ein derartiges Angebot bekamen. Und er wagte es, es auszuschlagen. Sie bückte sich nach ihrer Bluse. Das würde Daniel ihr büßen. Bitter. Sie hoffte nur, dass er wenigstens für sich behielt, was er heute hier erlebt hatte.
Sie war pünktlich. Überpünktlich. Die Sprechstunde von Frau Doktor Leistner-Rahl begann um 10:45. Sie checkte noch einmal den Terminkalender. Gott sei Dank war sie die Erste, die sich für die heutige Sprechstunde eingetragen hatte. Und bislang auch die Einzige. Sie hatte sich etwas überlegen müssen nach dieser Pleite mit Daniel. Und sie hatte sich etwas überlegt. Gegenüber der Tür war ein Glasfenster, das zu irgendeinem Nebenraum führte. Der Blick durch die Scheibe war durch einen Vorhang versperrt. Sie konnte ihr Spiegelbild im Fenster sehen und zupfte ein paar Haarsträhnen zurecht. Sie sah gut aus. Schlicht gekleidet, dennoch gepflegt.
Kurze Zeit später hörte sie das Klacken von Absätzen auf dem Gang. Frau Doktor Leistner-Rahl. Sie lächelte. „Sie warten schon auf mich?“ Sabine nickte. Die Dozentin schloss die Tür auf und bat sie, einzutreten. Frau Doktor Leistner-Rahl trug, wie meist, einen schwarzen Hosenanzug und lächelte durch ihre große, ebenfalls schwarze Brille. Sie deutete auf den Besucherstuhl gegenüber ihrem Schreibtisch. „Bitte nehmen Sie Platz. Ich nehme an, es geht um das Mittelalter-Seminar?“
Sabine nickte und zögerte. Das Wichtigste war, bescheiden aufzutreten. Sie war das Opfer. Es hatte ihr peinlich zu sein, darüber zu sprechen. Sie hatte lange mit sich ringen müssen, um den Weg hierher zu finden. So sollte es Frau Doktor Leistner-Rahl sehen. Sabine räusperte sich. „Es ist wegen Ihrer Arbeit zur Artusepik. Zusammen mit Herrn Sagmeister“, stellte die Dozentin fest. Sabine nickte. „Sie geben auf? Sie wollen die Arbeit ihn alleine machen lassen?“ Sabine erkannte den leicht ironischen Unterton. Offenbar traute Frau Doktor Leistner-Rahl ihr nicht zu, einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit zu leisten. Sabine schüttelte den Kopf, dass ihre ordentlich zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare flogen. „Es ist … wegen ganz etwas anderem.“ Sie senkte den Kopf. „Ja?“, fragte die Frau Doktor interessiert. Sabine sah auf ihre Knie. „Es ist schon richtig“, flüsterte sie, „dass ich Schwierigkeiten mit der Literatur habe. Ich habe auch noch ein schwieriges Seminar in Englisch …“ „Das hätten Sie sich auch vorher überlegen können! In Ihrem Alter sollte man in der Lage sein, so zu planen, dass die eigenen Kapazitäten für die Kurse ausreichen, die man belegt!“ Sabine nickte ergeben. „Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Es hat … wir haben uns zum Arbeiten bei mir getroffen. In meinem Zimmer. Und eben, weil ich … weil ich ein bisschen hinten bin, da hat Daniel … Herr Sagmeister …“ Es gelang ihr, ein wenig zu schluchzen. „Ja?“ Die Dozentin schien hellhörig geworden zu sein. Sabine hob den Kopf und sah ihr direkt ins Gesicht. „Es hat einen sexuellen Übergriff gegeben. Wenn ich schon nichts für die Seminararbeit mache, dann könnte ich wenigstens für ihn etwas tun.“
Frau Doktor Leistner-Rahl schien ehrlich erschüttert. Sabine wusste, sie hatte ihre empfindliche Stelle getroffen. Und sie hatte glaubwürdig gewirkt. Die Dozentin legte die Ellenbogen auf ihren Schreibtisch und beugte sich vor. Ihre Haare fielen bis auf die Tischplatte. „Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, aber das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Sie kann bis zum Ausschluss von der Uni führen. Haben Sie überlegt, eine Anzeige bei der Polizei zu machen?“ Sabine schüttelte den Kopf. „Es … das würde ich nervlich nicht durchhalten. Ich habe gehofft, dass Sie … dass Sie mit ihm reden und dann Ruhe ist.“ Die Dozentin lehnte sich zurück und nickte. „Sie können sich darauf verlassen, dass ich das tun werde. Sexuelle Belästigung können wir hier nicht brauchen. Da wäre Herr Sagmeister nicht der Erste, der seine Uni-Karriere deswegen beenden muss. Aber eins muss ich noch wissen: Ist es zu einer …“ Sie musste den Satz nicht vollenden, bevor Sabine den Kopf schüttelte.
„Er hat nur sein … seinen …“, stotterte Sabine. „Er hat Ihnen seinen Penis gezeigt?“ Frau Doktor Leistner-Rahl war es gewohnt, die Dinge nüchtern anzusprechen. Das hatte Sabine gewusst. Sie nickte. „Und er wollte, dass ich … dass ich …“ Die Frau Doktor neigte den Kopf. „Wollte er Oralverkehr?“ Sabine nickte wieder. „Und dann hab ich, dann hab ich geschrien, und er hat versucht, mir den Mund zuzuhalten, und ich hab mich losgerissen und im Klo eingesperrt. Da bin ich dann über eine Stunde gesessen.“ Frau Doktor Leistner-Rahl schüttelte den Kopf und zischte durch die Zähne. „Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist. Auf jeden Fall hab ich mich irgendwann herausgetraut, als ich länger nichts mehr gehört habe.“ „Ich würde sagen, da haben Sie noch einmal Glück gehabt. Aber das kann keine Entschuldigung sein.“ Frau Doktor Leistner-Rahl zog einen Notizblock zu sich heran und kritzelte ein paar Wörter drauf. „Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass wir die Polizei ganz aus dem Spiel lassen“, sagte sie. Sabine nickte. „Wegen der Seminararbeit noch, wie …“ Die Dozentin sah sie an. „Sie sollen auf keinen Fall zu Schaden kommen. Ich meine, zu weiterem. Das geht ja gar nicht, dass Sie wegen dieser Attacke womöglich ein Semester verlieren. Da finden wir eine Lösung.“ Sabine atmete erleichtert auf. Es schien, als habe ihr die Dozentin Glauben geschenkt. Sieg auf der ganzen Linie – Daniel würde sich wundern.
Trotzdem hatte Sabine Angst vor dem nächsten Dienstag. Was würde passieren? Würde Daniel im Seminar sein? Würde er sie ansprechen? Was würde Frau Doktor Leistner-Rahl inzwischen unternehmen?
Sie bemühte sich, möglichst wenig um sich zu blicken, als sie sich im Seminarraum setzte. Sie war eine der Ersten. Bis das Seminar begann, hatte sie Daniel nicht erblickt. War er bereits ausgeschlossen worden? Die 90 Minuten zogen sich, wie üblich, endlos. Ein Student, der ein Referat über seine Arbeit zu halten hatte, hatte ein Thesenpapier verfasst und ausgeteilt. Es war in kleinstmöglicher Schriftart völlig chaotisch vollgekritzelt, hatte keinen Ansatz irgendeiner Struktur. Ähnlich unkoordiniert trug er seine Thesen vor. Wann immer Frau Doktor Leistner-Rahl klärend einzugreifen versuchte, begann er zu stottern und verhedderte sich nur noch mehr in Unklarheiten. Es war ein entwürdigendes Schauspiel. Noch dazu begann der Kollege zu schwitzen. Sabine fiel auf, dass er zudem schon schütteres Haar über der Stirn hatte. Was für ein Loser.
In der Pause blieb sie zunächst sitzen, warf dann einen Blick zur Tür und sah Daniel durch dieselbe auf den Gang hinaustreten. Es war ihr so, als habe er ihr davor noch einen Blick zugeworfen. Sie selbst wagte nicht aufzustehen. Außer ihr waren noch drei, vier andere sitzen geblieben, aber niemand schien sie zu beachten. Frau Doktor Leistner-Rahl klappte ihren Laptop zu, erhob sich und trat auf Sabine zu. Sie versuchte, sich hinter ihrem eigenen Gerät zu verschanzen, doch die Dozentin beugte sich einfach darüber. „Wenn Sie nach dem Seminar kurz zu mir ins Büro kommen könnten?“ Schon hatte sie sich wieder aufgerichtet und verschwand ebenfalls durch die Tür. Sabine fühlte sich alles andere als wohl. Es konnte doch nicht sein, dass sie mit Daniel gesprochen und ihm mehr Glauben als ihr geschenkt hatte? Frauen mussten doch zusammenhalten. Bestimmt hatte die Frau Doktor auch schon unangenehme Erlebnisse mit Männern gehabt, da waren die Professoren an den Unis nicht besser als andere Männer, Sabine hatte genug Geschichten gehört.
Als sich der Seminarraum wieder füllte, bemühte sie sich, in ihren Bildschirm vertieft zu erscheinen, um einen eventuellen Blickkontakt mit Daniel zu vermeiden.
„Frau Meißner, ich habe mit Herrn Sagmeister gesprochen.“ Der Schuh an ihrem Fuß wippte. Frau Doktor Leistner-Rahl war mit der Ferse herausgerutscht und balancierte den schwarzen Pumps auf den Zehen. „Ja?“, versuchte Sabine, das Schweigen zu überbrücken. Die Dozentin seufzte. „Es steht Aussage gegen Aussage. Wie Sie sich vorstellen können. Herr Sagmeister stellt die Situation völlig gegenteilig dar.“ Sie schwieg wieder. Wollte sie Sabine Gelegenheit geben, sich zu rechtfertigen? „Aber …“, begann sie. Die Leistner-Rahl hielt ihr die Handfläche entgegen. „Ich verstehe schon. Frauensolidarität. Ich kann doch einem Mann nicht mehr glauben als Ihnen. Habe ich recht?“ Sabine nickte. Die Frau Doktor stellte ihren Schuh auf dem Boden ab und schlüpfte wieder hinein. „Sehen Sie, ich aber bemühe mich um größtmögliche Neutralität. Sie kennen mich, und Sie wissen das. Sie haben beide recht glaubwürdig eine Situation dargestellt. Natürlich aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln, mit gänzlich verschiedenem Inhalt. Es gibt nur zwei Unterschiede, die mir zu denken geben.“ Sie lehnte sich zurück, verschränkte die Hände und begann, die Daumen umeinander zu drehen. Sabine blieb still. Die Frau Doktor brach das Schweigen als Erste. „Sehen Sie, Herr Sagmeister ist mehr oder weniger zusammengebrochen, als ich ihn mit Ihrer Anschuldigung konfrontiert habe. Er schien völlig überrascht, war sehr emotional, und ich denke, meine Urteilsfähigkeit reicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass er mir nichts vorgespielt hat. Sie dagegen haben bei Ihrer Aussage zu diesem Thema recht kühl gewirkt. Distanziert. Ich betone, dass ich daraus keine Schlussfolgerungen ziehe.“ Sie legte eine Pause ein. Sabine verzichtete einstweilen auf eine Rechtfertigung. Zuerst musste sie hören, was die Frau Doktor noch vorzubringen hatte. Sie fuhr auch gleich fort. „Zum Zweiten habe ich den Eindruck gewonnen, dass Herr Sagmeister einen weit größeren Anteil an der bisher geleisteten Arbeit hat als Sie. Wie gesagt, ein Eindruck. Vor diesem Hintergrund habe ich davon abgesehen, Herrn Sagmeister mit irgendwelchen Konsequenzen zu drohen. Wenn Sie also gegen ihn vorgehen möchten, müssen Sie sich an die Polizei wenden. Ich werde es nicht tun.“ Sabine starrte sie an. „Das war’s!“, fügte Frau Doktor Leistner-Rahl noch hinzu.
Sabine wusste nicht, was jetzt zu tun war, auf diese Situation war sie nicht vorbereitet. „Und was … was ist … mit der Arbeit? Die Note?“, stammelte sie. Fast kamen ihr die Tränen. Vielleicht war das gut, am Ende wollte die Dozentin Tränen sehen, damit sie auch sie für glaubwürdig hielt. „Ich hatte mir schon gedacht, dass Ihnen das wichtig ist.“ Sabine meinte, einen ironischen Unterton herauszuhören. „Wir machen es so: Die bisher geleistete Arbeit rechnen wir Ihnen beiden an. Damit ist auch Herr Sagmeister einverstanden. Unabhängig voneinander stellen Sie die Arbeit fertig, natürlich in einem geringeren Umfang als zunächst geplant. Ich gehe davon aus, dass keiner von Ihnen beiden noch Interesse an einer Zusammenarbeit hat?“ Sabine nickte, stand auf und drückte sich aus dem Büro. Irgendwie, so schien es, war ihr Plan nach hinten losgegangen. Bei Frau Doktor Leistner-Rahl würde sie keinen Kurs mehr besuchen können. Und wer konnte wissen, ob sie die Geschichte nicht auch noch im Kollegium herumerzählte? Es blieb ihr nichts anderes übrig, als diese Scheißarbeit selber fertig zu machen. Und zu hoffen, dass sowohl die Leistner-Rahl als auch Daniel den Mund halten würden.
II
Endlich haben sich Johannas Brüder vor ihr Fußballtor verzogen. „Und hopp!“ Wir haben unsere Hände losgelassen und versuchen jetzt, so zu springen, dass wir abwechselnd vom Trampolin hochfliegen. Eine oben, eine unten. Johanna oben. Ihre Haare fliegen über ihrem Kopf. Jetzt ich oben. Es klappt gut! Ich quietsche vor Vergnügen. Das war knapp! Ich habe Johanna bei der Landung fast gestreift. Ich muss ein wenig zurück, ein wenig nach hinten hüpfen … Das war zu viel! Ich rudere mit den Händen, komme aus dem Gleichgewicht und treffe nicht das Trampolin, sondern den Rand. Au! Ich rutsche auf dem glatten Metall aus und schlage mit dem Kopf auf die Umrandung. Einen Moment lang weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Um mich herum ist alles schwarz. Johannas Gesicht über meinem. „Sabine! Sabine! Was ist los?“ Ihre Stimme klingt ganz verzagt. Doch es geht schon wieder. Mir brummt zwar der Schädel, aber ich kann mich langsam aufsetzen. Durch mein Fußgelenk zuckt ein Schmerz, als ich versuche aufzustehen.
„Oh Gott!“ Johanna schlägt die Hände vor den Mund. Plötzlich merke auch ich, dass etwas nicht stimmt. Von meinem Kopf tropft Blut. Ich drücke die Hand gegen meine Stirn, wische darüber und ziehe sie wieder weg. Alles voller Blut. „Mama! Mama!“, schreit Johanna. Sie läuft weg. Ich kann nicht aufstehen. Sekunden später ist Johannas Mutter auf das Trampolin geklettert und nimmt mich in den Arm. „Wie geht’s dir? Tut dir was weh?“ Sie streichelt mich, tätschelt beruhigend meinen Rücken. Dennoch beginne ich zu schluchzen. „Der Fuß, ich kann nicht aufstehen!“ Johannas Mutter schiebt mein Hosenbein hoch, während sich Johannas Brüder neugierig am Rand des Trampolins drängen. „Wow, so viel Blut!“, sagt Leo fast bewundernd. „Lass mal sehen!“ Johannas Mama streicht durch meine Haare. „Gott sei Dank nur eine kleine Platzwunde. Das blutet leider manchmal so stark, wenn man sich den Kopf anhaut. Ich trag dich mal rein, dann verbinden wir das.“ Sie springt vom Trampolin und nimmt mich auf ihre Arme.
In der Küche setzt sie mich auf einem Stuhl ab. „Ihr bleibt draußen!“, verscheucht sie Johannas Brüder. Mein Fuß tut schon nicht mehr so weh. Aber meine Mama wird ein fürchterliches Theater machen, das weiß ich jetzt schon. Wieder und wieder hat sie mir erklärt, dass dieses Trampolin brandgefährlich ist. Und wenn Johanna und ihre Brüder draußen waren, hat sie immer wieder die Gardinen beiseitegeschoben, in den Nachbargarten hinübergelugt und den Kopf geschüttelt. „Wie man das den Kindern nur erlauben kann! Umbringen werden sie sich noch. Umbringen!“, hat sie geflüstert. Und mir natürlich strengstens verboten, jemals auf dieses Teufelsding zu steigen.