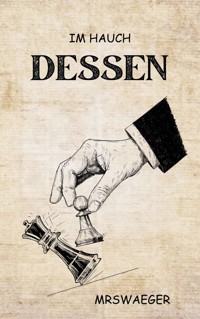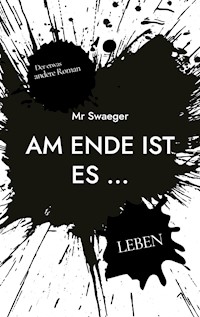
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für das Leben eines Kindes geht der Autor selbst einer Frage nach. Gebettet in stillen Tagen tiefer Kinderaugen. Die dieser Krankheit bewusst niemals gegenüber treten werden. Muss der Vater seine Suche in einer Entscheidung finden. Informativ und erläuternd beschreibt der Autor Momentaufnahmen zum Mut eines Lebens. Findet sachdienliche Hinweise und führt ein Interview mit einer Pflegekraft. Informationen und mehr: www.mrswaeger.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Für das Leben eines Kindes, muss der Autor selbst einer Frage nachgehen, wie weit die Liebe eines Vaters die Erkrankung seines Kindes erträgt? Aufopfernd und dürstend. Wachsend in seiner Schilderung lebendig, muss der Vater am Horizont des neugeborenen Lebens, eine Entscheidung finden.
Über den Autor:
Der Autor lebt mit seiner Familie am Niederrhein. Seine Werke publiziert er unter einem Pseudonym. Unter der Schirmherrschaft von Peter Prange veröffentlichte er seinen ersten literarischen Auszug.
Für die Kinder im Schatten
Inhaltsverzeichnis
Auf ein Wort davor
Mut zum Leben
Krankheitsbilder
Es gibt davon so viele
Wenn es alleine ...
Mit den Monaten ...
Zeit für Wunden
Das West-Syndrom in Kürze
Der Tag der Abreise
Sehen und gesehen werden
Ambulant an die Wand
Die Tage der Pflegedienste
Vier Wände zur Öffentlichkeit
Das sechste Lebensjahr
... Abend im Jahre 2009
Nur schauen reicht nicht
Sterben im Hospiz
Der Abstand vor der Ferne
(K)ein Ende in der Nacht
Stand der Dinge (Interview)
Mit Blick zum Interview
Am Ende des Buches
Auf ein Wort davor
An dieser Stelle ein paar Worte zu diesem Werk, das (k)ein Ratgeber wird und ist. Betrachten Sie es mit Weitblick.
Ich möchte nicht der Grund sein, dass Sie nachher denken, die tiefgehende Betreuung seines eigenen erkrankten Kindes ist spitze.
Erst recht möchte ich nicht der Auslöser dafür sein, dass sie menschlich weglaufen. Wenn ihre Entscheidung sie umringt, vor der Pflege eines Angehörigen zu stehen. Zu dem die Antworten bereits erklingen. Dafür oder dagegen.
Sie stellen es sich, als unmöglich vor?
Dann möchte ich sie beruhigen dürfen. Ganz so schwer wird es nicht. Es besteht zumindest die Möglichkeit dazu.
Solange der Zusammenhalt, und eine gute Rückendeckung in ihrer Familie lebt. Warum nicht? Ich habe mich dazu entschieden ihnen, lieber Leser einen Blick über den Tellerrand zu schenken. Deswegen habe ich bewusst bloß Ausschnitte gewählt und diese in Einblicke gehüllt.
Den unhygienischen Teil habe ich vorsätzlich nicht geschildert. Ich setze voraus, dass Sie, lieber Leser dieser Niederschrift, über genügend Vorstellungskraft verfügen, dass ich den Teil dieser Notwendigkeit in gewissen Situationen nicht tiefer beschreiben muss. Nur das, was weiter unaufhaltsam seinen Lauf nimmt.
Vor einigen Monaten begann es. Worte zu finden. Diese Zeilen zu schreiben. Diese jetzt näher zu beschreiben, dazu fehlt die Zeit. Denn, die habe ich nicht.
Ihnen als Leser möchte ich einen Zugang ermöglichen, der das Leben einer Mutter und eines Vaters beschreibt, die ihr eigenes erkranktes Kind freiwillig pflegen. Dieses von Geburt an in ihrem sich entwickelnden Krankheitszustand zu begleiten. ... noch dazu mit einem wachsenden und wandelnden Krankheitsbild.
Wäre dies ein lesenswertes Thema für Sie?
Allein nur aus dem Grund, um mal einen Blick zu bekommen. Quasi als eine Art Sicht über die Schultern eines Angehörigen. Sollte es Sie aber zu sehr aufwühlen und unter einer Schicht von Mitgefühl begraben, so weit, dass sie es anhand dieser Erzählung, lieber das Weite suchen? Dann klappen Sie es eine Weile zu. Denn gelegentlich fragt niemand danach. Näher dran zu sein.
Ich hoffe, es trifft Sie nie. Diese eine Ansicht. Vor der Pflege ihres eigenen schwer erkranktem Kindes zu stehen. Oder, die eines Angehörigen. Ohne einen Erfolg zu sehen.
Bereit, die ersten Kapitel dieses Buches zu lesen? Wie es dann ist und was es mit einem macht? Dann lade ich Sie hiermit herzlich ein. Zu dieser beginnenden Reise leichter Einblicke. Denn ...
Nahezu aller Anfang ist mit einer Leichtigkeit behaftet. Im Laufe der Jahre erst, wird es spürbar, wofür man nicht gelebt hat. Denn alles hat seinen Preis.
Vertiefen Sie sich und urteilen Sie selbst. Aus dem Lebendigsein eines alltäglichen Bestehens.
Mit vielen gelungenen und auch schmerzhaften Rückschlägen. Die dennoch euphorisch genug erscheinen, wenn kein Weiterkommen bevor stand. Momente, in dem man sich selbst übertrumpft. Total im Ausufern seiner Gefühle einen Sieg feiern will.
Die Mir-nichts-dir-nichts-Auswirkung. Zu dem das ungeschminkte, eigene Spiegelbild den Wiedererkennungswert spürt. Und doch, egal wie man es betrachtet, kaum erlangt.
Zur entstehenden Hilflosigkeit hineinschaut, die zupackt. Einengt. Von innen heraus. Kriechend, die eigene Energiereserve schmälert.
Um in den vielen Nächten in einem schlaflosen Herumirren zu enden. Um dennoch sich selbst tröstend, wach zu bleiben. Damit das Bezeichnende ich, sich in der Dunkelheit des tosenden Krankheitsbildes nicht verliert.
Um jene erdenklich gut klingenden Strohhalme auszuprobieren, die den Weg der Hoffnung, zielstrebig ansaugen und der Becher darunter, längst den Füllstand nicht mehr hält.
Die Stille und Ruhe vor der nächsten Offensive, in einem einmaligen Spielzug zu packen. Und dann am Ende des Tages keinen einzigen Schritt, im Zieleinlauf erreichen zu können.
Krankheiten und ihre Erscheinungsbilder sind vielseitig. Es gibt zahlreiche und alle haben ein anderes Bild. Jenem Anblick, dem ich jedem Tag gegenüber stehe, möchte ich Ihnen hier beschreiben.
Die anschauliche Perspektive, die ich gewählt habe, stellt die Sicht dar, so wie ich sie seit der Geburt meiner Tochter in den Tagen und Jahren ihres Niemals-Erwachsen-Werdens erlebe. Es sind und bleiben Momentaufnahmen.
Dazu ein wenig sachdienliche Informationen, sowie Wissenswertes, habe ich als kleine Beigabe hineinfließen lassen. Passend zur jeweiligen beschriebenen Situation.
Um sie nicht im Regen stehen zu lassen.
Die Namen der Personen, die ich in diesem Werk beschreibe, wurden verändert.
Mit einem herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser 2.Auflage meines ersten Buches wünsche ich, Ihnen eine gesunde Portion Freude beim Lesen.
Für Anregungen, Fragen und Anmerkungen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an [email protected].
Ich nehme mir die Zeit und versuche, jede zu beantworten. Niederrhein, im Winter 2022/23.
Herzlichst
MrSwaeger
Eins noch ... bevor sie weiterlesen wollen.
Ich muss darauf hinweisen, dass dieses Buch Handlungen und Personen beschreibt, die nicht aus der kreativen Feder des Autors erschaffen worden sind. Geschildert wird hier ein reales Leben.
Mut zum Leben
Zu dem, was hier geschah, fehlten mir sämtliche Worte. Verstummt und in mich gekehrt, starrte ich einem, grau erschlafften, leblos wirkenden kleinen Körper hinterher. Und ich fragte mich.
Sieht so der Tod aus?
Eine Geburtshelferin brachte ihn hinaus. Mit den Händen in eine Decke gewickelt und zu mir hochhaltend, konnte ich einen flüchtigen Blick erhaschen, bevor sie durch die OP-Türe zum Vorraum eilig verschwand.
Der Anästhesist sah mich an, sagte etwas, was ich nicht verstand. In diesem Moment starrte ich in meiner Aufmerksamkeit nur noch auf die sich dahinter schließenden Türen. Hinter der Geburtshelferin her. Und verstand seine Worte.
»Gehen Sie. Gehen Sie zu ihrem Kind!«
Ich sah auf den OP-Tisch. Vor mir lag Eve. Sie hat das Bewusstsein verloren, was mir in diesem Moment nicht bewusst wurde. Ich schaute zu den Türen, die in ihrer Bewegung auspendelten. Blickte erneut den Narkosearzt an. Und war mir sicher, was ich sah.
»Es ist ohne Leben, ... haben Sie es gesehen?«
»Nein, das sah nur so aus. Gehen Sie ihrem Kind hinterher«.
Blass im Ausdruck, fühlte ich mich meiner Gesichtsfarbe beraubt. Vereinigt mit der Farbe der OP-Wände, die uns umgaben. Dabei löste sich meine Hand von Eves Unterarm, in der keine Regung mehr spürbar wurde.
Ich war mir sicher, dass dieses kleine Bündel tot ist. Grau, fahl und ohne eines gesunden Teints, suchte ich nach Halt.
»Was für eine Scheiße läuft hier?«, erklang mein geflüstertes Wort, laut schreiend tief in mir. Dann verstummte meine Mimik. In dem Auge einer unabdingbaren Gewissheit, die sich wie ein Umhang eines stillen Schmerzes um mich herum legte.
Monitorgeläut durchbrach die Stille. Deren Anzeigen flackerten in verschiedenen Tönen. Zeichneten einen fahlen Beigeschmack zu den sich hier abspielenden Bildern. Kalt flackernd.
Eine Hand erfasste meinen Arm. Half mir ungefragt zur Türe und führte mich in den Zwischenraum. Heraus aus dem OP-Saal. Vermischend mit dem vor mir liegenden Tunnelblick. Eine OP-Schwester, die mir deutlich zu verstehen gab, dass meine Anwesenheit im OP-Raum kein Nutzen hat.
Geräuschkulisse und hektisches Treiben im OP-Raum musste ich hinter mir lassen.
Mit mutmachenden Worten sollte ich zu meinem leblosen Neugeborenen gehen, das gerade von einem Kinderarzt untersucht wird. Muss ich ...
Ich streifte mir den Schutzkittel vom Oberkörper. Suchte nach einem festen Stand. Sah mit einem Mal den kleinen Jungen in mir. Traf ihn in dem kleinen Seelenzimmer meines eigenen Ichs wieder. Unter dunklen, farblosen Wänden. Das kleine Fenster über dem Stuhl meines gefühlt abgekoppelten Abstellraumes, das meine Eltern als Kinderzimmer sahen. Auf dem ich dort saß. Zu dem ein kleines Lichtbündel einer Laterne, durch die Vorhänge der Nacht mein Gesicht zur Hälfte streifte.
Meine oft ausgestoßenen Rufe in dem Zimmer meiner Kindheit, die lautlos im Treppenhaus verhallten. Im Hort meiner Kindheit.
Selbige Empfindung innewohnt, gefühlt zu dem Hier und jetzt.
Ich hielt die Unterarme verschränkt vor mir. Presste sie fest an meinem Oberbauch und ließ mich seitlich gegen die Wand im Vorraum gleiten. Schloss dabei meine Augen. Wie früher. In diesen kindlichen Augenblicken einer Angst.
Die Türe zum Vorraum wurde geöffnet und die Geburtshelferin sah mich an. Deutete in die Richtung, in der mein neugeborenes Kind lag. Sie selbst musste zurück in den OP, aus dem hektisches Treiben durch das Schwingen der Türen getragen wurde. Eine andere Hebamme saß hinter einem Pult. Erfragte den Namen meines Kindes. Das Gehörte versuchte mich, innerlich zu erreichen.
Einen Namen für ein lebloses Kind?
Ich sagte ihr, dass ich erst mein leblos, geborenes Kind noch einmal sehen wollte. Bevor ich einen Namen nenne.
Diese Leere. Diese Stille, die in mir zum Tragen kam. Ich war mir sicher, dass ich in den nächsten Stunden alleine die Türe zur Wohnung aufschließen werde.
Dann sah ich einen Arzt. Er gestikulierte mir irgendwas zu. Suchte nach Worten, um diese Situation zu schildern. Doch mehr wie ein Nicken bekam ich nicht aus mir heraus.
Seinen Worten kaum lauschend, fiel mein Blick auf dieses in sich kämpfende, schwach atmende Wesen, das sich scheinbar ins Leben rangelte. Es klang in mir so herzzerreißend, die Worte aus seinem Mund, dem er ein Lächeln nachschickte.
»Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Tochter.«
Emotionen, die in mir nicht wussten, wie sie sich zum Ausdruck formieren sollten. Weinen oder Freuen. Mir war zum Heulen. Doch ich hielt es aus. Versuchte es. Irgendwie.
Neben diesem Bild eine Krankenschwester. Sie hieß Cora. Liebevoll kümmerte sie sich in voller Hingabe. In dieser Situation ein Lächeln fand und hoffnungsfrohe Worte schenkte.
Ich versuchte weiterhin, aufrecht zu stehen. Gefühlt einer Träne nah, in den Fluten eines Meeres meiner Emotionen.
In den folgenden Wochen hörte ich viele Worte, aus den Mündern studierter Ärzte, die in dieser Stadt, in dieser Klinik, auf dieser Kinderstation versuchten zu erklären, dass dieses neugeborene Kind gesund sei. Absolut.
Weit gefehlt. Es würde nie so sein.
Die Ärzte holten Eve zurück. Und brachten unsere Tochter dazu, aus eigener Kraft ein Leben zu erhalten. Nur anders, als erhofft.
Liebe zum Kind, Geduld und schlaflose Nächte, lagen vor Eve und mir. Gespräche mit Außenstehenden, die kaum Vorstellungen hatten, wie es sich anfühlt, in diesen Schuhen zu bestehen, stellten sich als Situationsfreunde vor. Fanden aber nicht den Mut, begleitend darin zu gehen, um zuzusehen. Und um zu verstehen. Wie es sich anfühlt!
Ein Satz zurückliegend aus diesen ersten Tagen, an dem unsere Tochter geboren wurde, drängt mir ins Bewusstsein zurück. Jetzt, beim Verfassen dieser Zeilen.
Worte, die uns ein Oberarzt der Kinderstation des Krankenhauses, in dem unser Kind geboren wurde, herz- und empathielos ausrichtete. Ohne nur eine Regung an Mitmenschlichkeit ließ er seine Äußerungen über seine Lippen heraus.
Nachdem er begriffen hatte, dass Eve und ich, mir die Schuhe nicht mit der Kneifzange anzogen. Sondern, ganz klar verstanden, was hier mit unserer Tochter nicht stimmte.
Und gegen seine, von ihm höchstpersönlich erstellten Diagnose Veto einlegten, verschloss er sich mehr und mehr. Denn, er war der best geschulte Facharzt hier. Niemand sonst.
Für ihn gab es keine derartigen Auffälligkeiten und Anzeichen, dass unser Neugeborenes irgendetwas habe, obwohl es bereist erkennbar war.
Bereits einige Tage nach dem OP im Kreißsaal entließ er unsere Tochter als gesund. Jedoch Tage später suchten wir diese Ärzteschaft der Kinderklinik wieder auf, um ihnen mitzuteilen und besonders darauf aufmerksam zu machen, was uns an unserer Tochter auffiel.
Sein Gehör hatte kein Platz für ersichtliche Details. Denn nach den ersten Wochen, in denen wir abwechselnd unser Kind versorgten, bekamen wir Bedenken, dass das, was wir sahen und wie unser Kind sich verhielt, so in Ordnung zu sein schien.
Eve fielen dazu weitere Merkwürdigkeiten auf. Ihm gegenüber das bereits erahnten, was das MRT Bild nun in seiner Deutlichkeit wenige Wochen später zeigen sollte. Jenes Bild, das unserer Beobachtung voraus war. Viel zu spät gab er unserer Erfassung recht. Bei einer Visite, nachdem ein MRT-Bild aufgenommen wurde.
Tiefschürfend klaffend trafen seine Worte und spürbar klang seine nüchterne Einsicht, die er in seinen Worten nicht verschönerte ...
»Sie haben recht. Auf den Bildern des MRT kann man deutlich erkennen, dass ihr Kind nur eine Gehirnhälfte hat und die vorhandene, ebenfalls angegriffen ist ...
Daher wird ihr Kind nie Pilot werden, und den Führerschein wird es auch nie schaffen. Mit diesem Krankheitsbild wird es nicht älter als 6 Jahre werden«
Ausgesprochen und mit einem empathielosen verblassten Lächeln starrte er uns an.
»Sind Sie jetzt fertig?«, zu mehr war ich nicht imstande. Versuchte, inmitten des anwesenden Ärzteteams meine Emotionen zu kontrollieren. Einem Teil von Ihnen fehlten selbst die Worte. Gedankenblass stand ich regungslos zwischen Bett und Fenster.
Versuchte, irgendwie das eben Gehörte zu ergreifen. Zu begreifen. In diesem sterilen, still gewordenem Klinikzimmer neben unserer Tochter.
Mit einem aus der Mode gekommenen Zirkusposter an der Wand, einem Teddy zu ihrer Linken, hielt ich mich an dem Bett unserer Tochter fest. Suchte den Boden unter mir. Ihn mit meinen Füßen zu ertasten.
Machtlos in dem ohnmächtig klingenden Augenblick. Hilflos. Stehend neben unserer Tochter, die unbefleckt, von dem Gesagtem ihren Blick zur Decke emporhob. Im nächsten Moment nach rechts schaute, ihren Arm bewegte, ihre Finger an der Hand und ihr Bein strampeln ließ. In diesem Bett.
Einen weiteren Moment der stille an ihrer linken Körperseite eine kontrollierte Bewegung suchte, wo keine zu finden war. Dennoch fröhlich wirkte, als hätte die Aussage des Arztes keine weitere Bedeutung für ihr bevorstehendes Leben. In diesem Augenblick fühlte ich nur eins.
Ich wollte für mein Kind ein Behüter sein. Sowie ihre Mama Eve, die, mit Tränen in den Augen, gefasst eine finstere Mimik gewann. Und wir trafen unabhängig voneinander eine Entscheidung.
Nur war mir damals nicht bewusst ...
Für die weite Ferne!
Krankheitsbilder
Es nützt nichts. Damit Sie als Leser verstehen, welchem Krankheitsbild ich mich hier stelle, möchte ich dieses Kapitel nicht auslassen.
Ein Krankheitsbild ist die Gesamtheit aller, für eine Krankheit charakteristischen Erscheinungen, die in den unterschiedlichsten Ausformungen, beobachtet werden.
In diesem und in den Jahren der Begleitung traf ich auf viele Erscheinungsbilder. Denen ich mit Erschrecken, im Beginn mit einer mulmigen Hilflosigkeit, später mit Ruhe und Geduld, als Vater tagtäglich zu tun bekam und noch heute erlebe. Manchmal wünsche ich mir Zeit. Zeit, in der die Uhren aussetzen und stehen bleiben. Um durchzuatmen. Ruhe zu tanken. Um dann gestärkt weiterzumachen.
Zum Glück konnte mit unserer Tochter mitwachsen. Sodas ich nach und nach die Sichtweise erlernte, zu verstehen, was mit unserer Tochter in ihrem wachsenden Krankheitsbild nach und nach geschah.
Von dem Tag der Geburt an bis zur heutigen Zeit. Stand somit nicht von heute auf morgen vor einem Desaster.
Und doch, irgendwie schon. Das mit der Zeit, immer wieder zu spüren, ist zermürbend.
Mit dem Wissen dazu, dass jeder Tag endgültig sein kann. Nur diese Aussage äußert niemand, wie lange mein Kind noch durchhalten wird. Das traute sich bisher nur einer und er lag falsch. Dennoch könnte morgen der Tag X da sein. An dem es unweigerlich zum Abschied kommen wird. Oder übermorgen. In einer Woche. Oder doch, beim nächsten Pulsschlag ...
Wäre nicht das erste Mal, an dem ich mit Eve kurz davor standen. Tief verankert von diesem im Krankheitsbild getränktem Leben.
Wenn ich heute gefragt werde, dann spreche ich die Erkrankung meines Kindes nur noch kurz an. In knapper Darstellung rede ich über den Grad des Handicaps. Über ihre Art und über die vielen gesundheitlichen Einschränkungen.
Falls daraus eine längere Unterhaltung wird, erzähle ich dann irgendwann doch vor ihrem Leben. Behutsam und bei allem, was recht ist, direkt. Ohne Distanz. Um sie so zu sehen, wie sie ist. Diese Form schreckt erst mal viele ab. Meist weit genug, dass sie lieber einen großen Bogen um das Geschehen machen. Selbst in der eigenen Familie. Als offiziell wurde, was alles in dem Handicap steckte, kamen wenige. Nahmen sich Zeit, für ein Begleiten am Rande des Weges.
Gaben Zurufe.
Dass es schön sei, mit anzusehen, wie gut und liebevoll es mein Kind hat. Doch auch hierbei ist der Abstand in einer Form weit gewählt. So lief ich größtenteils abgeschieden in den Schuhen. Die meine eigenen bleiben.
Am Ende des Tages sind Entscheidungen, die ich traf, relativ individuell. Wenn diese ihre Wirkung zeigen und nicht vorher viele Wege durchdacht wurden, kann es weiterhin sein, dass es kein brauchbares, tolles Ergebnis gibt. Oder ein hoffnungsvolles Aushalten damit einhergeht, dass der Moment besser wird. Wird er aber nicht.
Denn ...
Direkt nach der Geburt fiel auf, dass sie linksseitig kaum Bewegungen mit Arm und Bein verübte. Erst gar nicht mit der linken Hand. Sie lag wie frisch gebacken neben meinem Kind. Ein lebloses, unbrauchbares Anhängsel.
Wenigstens wirkte die rechte Körperseite normaler. Abgesehen von der Geburt selbst, war in den darauffolgenden Tagen nichts Schlimmeres an zusätzlicher Tragik passiert. Auffällig waren zuckende Bewegungen und ein Zappeln der Arme und Beine, die auf Nachfrage, gerichtet an die Ärzteschaft im Krankenhaus, als ein stilles Überbleibsel des Kaiserschnittes erklärt wurden.
In ein paar Tagen wäre dieser Zustand sicherlich abgeklungen und vorbei.
Zum guten Schluss ist sie als gesund entlassen worden. Und was ich denn wollen würde?
Bald ist doch alles super. Die Annahme und Aussagen der Ärzteschaft trugen zumindest einen gewissen Keim der Hoffnung in sich.
Doch ...
Zu Hause hörte es nicht auf, und besser wurde es nicht mehr. Plötzlich auftretende, leicht zitternde Veränderungen. Aus dem Nichts heraus. Wie ferngesteuert. Ohne erkennbaren Auslöser. Als würde sie sich vor irgendetwas erschrecken. Das machte mich stutzig und ich suchte nach einer plausiblen Erklärung.
War es das Radio. Waren es Geräusche aus dem Fernseher. Das schrillende Telefon, an dem ich extra einen eintönigen, sanften Klingelton einstellte. Weil ich dachte, da ist der Grund zu finden.
Suchte daraufhin weiter. Ausgedehnter nach einem verständlichen und passenden Auslöser. Stellte Fragen, erhaschte mir die Antworten und filterte sie nach Lösungen. Bestritt Wege für Veränderungen und sah mich vor einem Berg voller Entscheidungen.
Eine musste her. Schlussendlich ist man mit den Entschlüssen, die man trifft, relativ alleine. Eve hingegen fand in ihrer Suche zahlreiche Bücher, die jenes Krankheitsbild tiefer beschrieben. Telefonierte mit den Ärzten und nahm die Position der Sprecherin ein. Eve war es wichtig, dass wir als Vater und Mutter unserer Tochter das Sprachrohr für sie wurden. Entscheidungen wurden mehr und mehr durch Eve in die Öffentlichkeit getragen. Während ich mich beruflich erweiterte und mein väterliches Dasein zum Besten gab.
Wenn bereits vorher schon so viele Wege durchgedacht wurden, und es dennoch zu keinem sinnvollen Ergebnis führte, dümpelten und wuchsen weitere Gedankenzweige heran. Zum guten Schluss bleibt die eine Hoffnung, dass egal wie, alles wieder gut werden wird. Wird es nicht. Die Realität bot eine andere Sicht.
Gefühlt jedes Mal härter. Alleine das Bild des MRT, dass ich jetzt hier beim Verfassen dieser Worte wieder vor mir sehe, brennt dieses Unwohlsein und diese vorhandene Schneise tiefer hinein in eine menschliche Psyche. Als wäre es gestern gewesen.
Ich weiß, warum manche Kapitel im Leben gelesen bleiben sollten. In sich ruhend und fest verschlossen. Besonders jene Aufnahme ihres Kopfes in einem MRT-Bild.
Das innen liegende Gehirn auf einem Bild. Ungeachtet dessen diese eine erkennbare Substanz, die zu schweben schien. Wie ein hängendes Objekt, in einem dunklen Raum. Indem die Spiegelbilder der Seiten nicht identisch sind. Teile fehlen. Unsichtbar unter einer Schädeldecke. So etwas will man bei seinem Kind nicht sehen. Nie und niemals.
Das MRT-Bild in Worten ...
Die linke Gehirnmasse ist deutlich in der Struktur erkennbar. Der Hirnstamm anliegend und angegriffen darunter verankert. Die danebenliegende rechte Gehirnhälfte ist deformiert. Verschwunden. Nur ein winziger Bruchteil, verödet und verkümmert, grenzt an der Mitte. Die Hirnseite rechts war nicht mehr da. Diese dunkle Fassade greifbar leer.
Sie sollten es mal sehen ... was mich betraf ...
... fühlte es sich an wie ein Schlag durch Mark und Bein. Ein unangenehmes Gefühl traf mich und erhob sich in mir. Breitete unter mir seine Tiefe aus. Ich fiel gefühlt mit einem gepackten Fallschirm ohne Reißleine, geformt zu einem Regenschirm. Der nicht imstande war, ein Schutz der tropfenden Tränen und der Deckung zu werden.
Brauchte mehr als einen Augenblick, um das Ganze zu verarbeiten. Einen Moment für mich und unserem Kind. Es verweilt bis heute nach.
Inzwischen betrachtete ich das Geschehen vor und während der Kaiserschnitt-OP mit offenen Augen. Diese Abläufe, die so dezentral wirkten. Wie eine spätere vereidigte Untersuchung feststellte, verstrich zu viel Zeit bis zum rettenden Kaiserschnitt. Die Frage nach dem Warum klärte sich nie. Eine Stellungnahme kam nie zum Tragen. Im erstellten Gutachten beschrieb man es so ...
... Ihr Kind befand sich ein paar Tage über den errechneten Geburtstermin. Als dieses durch den Geburtskanal wollte, kam es zu Komplikationen an der Nabelschnur. Diese verhinderte eine normal verlaufende Geburt. Bei der anschließenden Überprüfung ... wurde grünliches Fruchtwasser festgestellt ... Weitere Minuten verronnen, ohne dass wichtige Maßnahmen unternommen wurden ...
Insgesamt verstrichen über 45min bis zum erforderlichen Kaiserschnitt. Lange genug, um diese Spuren zu hinterlassen.
Einige CTG-Bilder sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Nachweislich. Weiter heißt es ...
... in diesen langen Minuten führte der hohe Sauerstoffmangel zu einem Absterben der rechten Gehirnmasse. Mit der durchgeführten Untersuchung, ein MRT des Schädels von unserem Kind zu bekommen, fühlte sich nur eine Assistenzärztin Wochen später, dieser Kinderstation in der Verantwortung, ein ehrliches Gespräch mit Eve und mir zu suchen.
Nachdem dieses MRT-Bild nun vorlag.
Kurz bevor sie dieses aber tat, kam es auf dem Flurbereich zwischen diesem Oberarzt der Kinderstation und ihr zu einem nicht leisen Wortwechsel. Jener, mit kalter Stimmfarbe.
Ich hörte, vor der Klarheit über ihr MRT-Bild, wie die Zimmernummer unserer Tochter ausgesprochen wurde. Sekunden später stand jene Ärzteschaft der Visite, ihrer Mama Eve und mir gegenüber. Behutsam und dennoch, ohne die Situation mildern und verschönern zu können.
Diese Assistenzärztin schien neu auf der Kinderstation zu sein. Gehörte nicht zu der Ärzteschaft, die bereits seit Jahren in diesem Klinikteil arbeiteten.
Nach einem tiefen Atemzug setzend, begann sie. Als begleiteten ihre Worte einen hörbaren, wärmenden Augenblick tragend, der die tiefe Eiseskälte, die die Oberfläche meiner Haut durchbohrte, für einen Moment zur Seite trug. Die eisige Kälte, die der Aussage des Oberarztes bereits anhaftete. In uns beiden, den Moment der Standfestigkeit Wärme und Verständnis zur Seite neigten.
Bei alledem fühlte ich in mir das Kartenhaus, des werdenden Vaters in sich zusammen fallen. Eines Vaters, der die Vorstellung trug, mit seinem ersten Kind, all das Wunder der Entwicklung erleben zu können. Vor allem mit diesem neugeborenen Leben unserer Tochter.
Eine Armlänge neben mir liegend, wird sie nie den Wunsch in mir aufleben lassen, mit ihr ein normales Kinderleben erleben zu können.
Ich suchte eine Wärme, die mir Dickfelligkeit bescherte. Mich trug. Im Hier und Jetzt. Immer.
Im nächsten Moment schaute ich in die Augen von Eve. Sie wand sich ab. Erwiderte meinen Blick nicht.
Eve erstarrte in sich selbst. Verschränkte ihre Arme über den Hüften, blickte zum Oberarzt, der zurück im Flurbereich stand und ins Zimmer hineinschaute.
Immer und immer wieder hörte ich an diesem Tag, diese tief erschütternden Worte. Und jene ernüchternde, ankündigende Botschaft, ohne einer tragenden Hoffnung am zu weit entfernten Horizont. Mit diesem MRT-Bild vor Augen. Mit dem ich nun klarkommen musste.
Lauschte nur oberflächig den weiteren Worten der anwesenden Ärzte. Suchte den Blick der Assisistenzärztin, die mit gesenktem Haupt vor mir einen festen Haltepunkt suchte. Um meinen Blick auszuweichen. Ihre Fassung versuchte zu bewahren. Als sie ihre Worte aussprach ...
»Sie lagen mit Ihrer Vermutung richtig. Und hatten Recht. Mit Ihrer Annahme. Es muss bei der Geburt passiert sein. Ich, ...
... kann nicht mehr sagen. Sie bekommen dazu noch einen Arztbrief. ... er wird Ihnen mit der Post zugestellt. Es tut mir leid, was mit ihrem Kind geschehen ist. Geben Sie den Glauben nicht auf. Sie schaffen das. Wer sonst, wenn nicht sie.«
Mit gesenktem Kopf verließ sie darauf das Klinikzimmer. Zügig. Ich blickte ihr nach. Solange ich es von dem Platz konnte, an dem ich stand. Bewegte mich nicht.
Hörte den Oberarzt, der ihr irgendwas hinterherrief, was ich nicht mehr verstand, als sie den Raum, vorbei an den anderen Ärzten, verließ.
Der Bedeutung mehr als bewusst. Blieb ich stehend an dem Krankenbett unserer Tochter zurück. Rang nach Fassung, die unerreichbar schien. Suchte Abstand.
Zur Aussage der Assistenzärztin. Zu den Blicken der jetzt still gewordenen Ärzte. Zum Oberarzt, der nichts weiter mehr sagte. Der aus purer Ablenkung zur Anzeige des Überwachungsmonitors schaute, der weiter mit monotonem Klang den Herzschlag des Kindes ins Zimmer trug.
Eve setzte sich ans Bett. Umfasste unsere Tochter und hüllte sie sanft in Worte.
»Ich pass auf, dass Dir nichts mehr geschieht. Niemand wird Dir mehr zu nahe kommen. Niemand wird Dich jemals mehr so verletzten. Ich werde über Dich wachen. ...«
Es waren noch mehr Worte, die folgten. Ich hörte nicht mehr zu. Suchte weiter nach einem Augenblick des Verstehens. Des Vergessens der verbalen Bebilderung der Innenansicht des Kindskopfes. Die nicht mehr aus meinem Kopf verschwinden wollte.
Daneben standen felsig die Worte des Oberarztes, wie ein Monument der Ewigkeit. Die seiner Ansicht nach umschreiben sollten, was unsere Tochter nie erreichen wird. Worte, die alles veränderten. Sie brannten. Brachten meine Welt ins Wanken. Mich selbst.
Vor mir baute sich ein Neuland auf, von dem ich keine Ahnung hatte. Wie ich es betreten kann. Versuchte das noch vorhandene Vertrauen zu finden, den Ärzten in dieser Klinik, die Hand zu reichen, die seit der Geburt unser Kind betreuten. Vertrauen auf Basis dieses Risses, hatte kaum noch eine gute Verbindung.
Diese Klinik sollte jedoch weiterhin der erste Ansprechpartner sein. Da es in dieser Stadt und umliegend kaum eine Kinderstation gab, die so viel an technisches Design besaß.
Am Bett unserer Tochter entschied ich mit Eve, den Weg einzuschlagen, bei dem jene Assistenzärztin, als unsere begleitende weitere Ansprechpartnerin werden könnte.
Was blieb uns anderes. Jedoch, auf unsere Anfrage hin, mit ihr eine Zusammenarbeit zu erhalten, hieß es uns gegenüber, sie sei Teil einer Umstrukturierung des arbeitenden Ärzteteams der Kinderstation.
Momentan befände sie sich im Urlaub und wäre daher im Augenblick nicht zu sprechen.
Wenige Wochen später teilte man Eve mit, dass die Ärztin nicht mehr in dieser Kinderklinik tätig sei. In dem Schreiben, dass einige Tage nach der Äußerung der Ärzte im Briefkasten landete, wurde dann für ein anderes Krankenhaus geworben. Trotz alledem gehöre dieses Kind in eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Klinik.