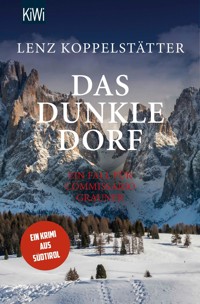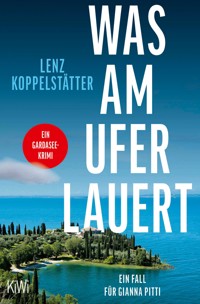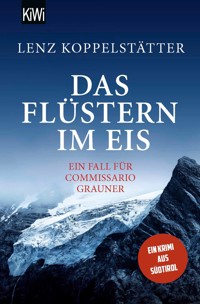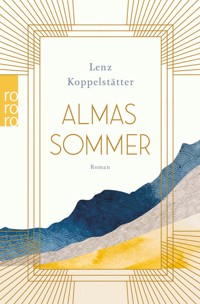5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Commissario Grauner hat es getan. Er hat mit seiner Frau Alba tatsächlich eine Weltreise unternommen, während Tochter Sara die Calm Alm zu einem Urlaubsresort umbauen ließ. Nach seiner Rückkehr will Grauner es alles erst einmal ruhiger angehen lassen, doch es kommt anders. Ein tödliches Unglück beim Skiweltcup im Grödental. Der junge Lokalmatador stürzt. Schnell stellt sich heraus: Er wurde von einer Gewehrkugel getroffen. Auf einem Jägerstand finden die Ermittler erste Spuren, die zum Täter führen könnten: Im Hotelzimmer des Toten sind Bargeldbündel zu einer Pyramide gestapelt. Commissario Grauner, Saltapepe und Co. tauchen ein in die Welt des Wintertourismus und Alpinsports. Es ist ein Milliardengeschäft, bei dem skrupellose Hoteliers, Liftbetreiber, Geschäftsleute, Sponsoren und Sportfunktionäre mitmischen. Grauner muss selbst auf die steilen und eisigen Pisten, um in diesem Fall dem Bösen auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Am Hang des Todes
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Er arbeitet als Medienentwickler und als Reporter für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Salon. 2015 startete die erfolgreiche Reihe um den Südtiroler Commissario Grauner. Seine zweite Krimireihe, in dessen Zentrum die Journalistin Gianna Pitti steht, spielt am Gardasee und wurde 2024 gelauncht.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach seiner Weltreise wollte Commissario Grauner es eigentlich ruhig angehen lassen, auf der Ofenbank liegen, mit seiner Frau Alba Urlaubsfotos anschauen und seinen Kühen im Stall Mahler vorspielen. Doch es kommt anders. Er erhält einen Anruf seines neapolitanischen Kollegen Saltapepe aus dem Grödental. Dort haben sich in diesen Tagen Tausende Sportbegeisterte und Journalisten aus aller Welt eingefunden, um einem beispiellosen Spektakel beizuwohnen: Während des Skiweltcups stürzen sich Athleten die berüchtigste Piste Südtirols hinunter und riskieren dabei alles. Ein junger Sportler, ein Nachwuchstalent aus dem Tal, stirbt vor den Augen der Zuschauer. Schnell ist klar: Es war kein Unfall, er wurde erschossen. In seinem Hotelzimmer finden die Ermittler eine Viertelmillion Euro und ein rätselhaftes Schreiben. Wie hängt sein Tod mit dem mysteriösen Dopingfall und dem Verschwinden eines anderen jungen Skisportlers im Jahr zuvor zusammen? Südtirols beliebtestes Ermittlerduo folgt den Spuren, die es tief in die knallharte Welt des Skisports und auf eisige Pisten in luftigen Höhen führen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © gettyimages Roberto Moiola / Sysaworld
Karten: Oliver Wetterauer
Illustration als Abschnittstrenner im Text: Oliver Wetterauer
ISBN978-3-462-31361-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/karten-hang-des-todes
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zu Personen und Handlungen
Motto
Prolog
16. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
17. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
19. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Epilog
Danke
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. In Bezug auf Ortsbeschreibungen nimmt das Buch sich Freiheiten heraus.
Und wenn du lange in den eisigen Abgrund blickst, dann zerrt er alsbald an dir, zieht dich ins dunkle Tal, verschlingt dich, zerbricht dich.
Prolog
Es gab schon einmal einen Toten, aber der zählte nicht. Zumindest nicht, wenn man die Männer fragte, die an den Theken der Gasthäuser in Gröden saßen. Denn dieser eine Tote, das war keiner von den tollkühnen, mutigen Kerlen, keiner von den Weltcup-Fahrern, kein Ski-Ass, kein Pistenheld. Nur einer dieser Thekenhelden, von denen der Ungerer Franz, der Wirt der Langsteinhütte am Rande der Saslong, in seinem Leben schon unzählige gesehen hatte.
So ein Dreikäsehoch, der einmal im Jahr mit den Eltern für ein paar Tage nach Gröden kam, in das Tal, das sich hinter einer felsigen Schlucht zwischen mächtigen Gipfeln versteckte. Nirgends sonst auf der Welt war man dem Himmel so nah, sagten die Grödner. Doch wo der Himmel nah ist, ist auch der Tod nie weit, der dich hoch zum Herrgott bringt. Oder runter in die Hölle, zum Teufel. Je nachdem.
Ob dieser eine, den es vor rund einem Jahr kurz vor Weihnachten erwischt hatte, in den Himmel gekommen war oder in die Hölle, das wusste der Ungerer Franz nicht. Wie es ihm selbst ergehen würde, ebenso wenig. Er hatte dem skifahrenden Sprössling einen Birnenschnaps hingestellt, und dann noch einen und dann noch einen. Auch wenn die Carabinieri die Hüttenwirte längst ermahnt hatten, den Skifahrern nicht mehr so viel einzuschenken, auch wenn aus Rom längst die Anordnung gekommen war, auf den Pisten Alkoholkontrollen durchzuführen – der Schnaps floss in Strömen.
Wozu war so eine Skihütte denn da? Vom Himbeersaft allein konnte ein Hüttenwirt nicht leben. Auch wenn der Himbeersaft, den die Julitta, Ungerers Frau, ausschenkte, der beste im ganzen Tal war. Das sagten alle. Sie sagten auch, dass sie die beste Preiselbeermarmelade mache, nicht nur die beste im Tal, sondern der ganzen Welt. Weil sie die Früchte, die hinter der Hütte am Waldrand wild wucherten, schon im Herbst für den Winter einlegte, mit viel Zucker und ein wenig Zitrone.
Am späten Nachmittag, wenn die Oberschenkel der übermütigen Urlauber bei jeder Kurve schmerzten, als würde ihnen ein Dutzend Messer ins Fleisch stechen, wenn die Pisten nicht mehr glatt waren, sondern bucklig, dann wagten sich die Skidilettanten noch einmal an die steile Abfahrt – und kehrten auf halbem Weg noch einmal beim Ungerer ein. Angelockt von der Pistengaudimusik, die aus den Boxen dröhnte. Ziehorgelgedudel. Birnenschnapslyrik. Zipfl eini, Zipfl aussi. Und in der Vorweihnachtszeit auch ein bisschen Last Christmas, die Techno-Version.
Der, den es damals erwischte, sechzehn war der vielleicht, höchstens siebzehn, ein Holländer, wie sich später herausstellte, mehr Flachländer ging ja nicht, der hatte nach dem zweiten Schnaps angefangen mitzuwippen, nach dem dritten tanzte er Walzer, drehte sich selbstvergessen in seinen Skischuhen zwischen den anderen Gästen. Nach dem fünften versuchte er, einen der Tische zu erklimmen, an dem eine Gruppe hessischer Skifahrer saß und irgendeinen Song, in dem es um die Hölle und den Wahnsinn ging, mitgrölte.
Er schaffte es nicht. Ein paar der Bauern aus dem Tal, die alles mit stoischer Unbekümmertheit beobachtet hatten, halfen dem Unglücklichen wieder auf die Beine. Gemeinsam mit dem Ungerer trugen sie ihn zur Tür hinaus, halfen ihm in die Skier, drückten ihm die Stöcke in die Hand, klopften ihm ein letztes Mal auf die Schulter.
»Viel Glück, Möchtegern-Tomba, husch, husch, ins Hotel, das Klo vollkotzen, den Rausch ausschlafen!«, sagte der Hüttenwirt noch, da sah er schon, wie der Mann mit einer Mordsgeschwindigkeit den ersten Buckel erreichte, in die Höhe geschleudert wurde und auf dem vereisten Grund hart aufkam, komischerweise nicht hinfiel, noch schneller wurde, sich dem Pistenrand näherte, dem dunklen Wald, der mächtigen Fichte, die da wohl schon gestanden hatte, als es hier im schönen Grödental noch keine Touristen gegeben hatte, keine Hütten, keine Pisten.
»Glatter Schädelbruch«, sagte der Dorfdoktor, und der Notarzt im Bozner Spital beteuerte: »Da konnte der Helm leider auch nichts mehr ausrichten. 2,2 Promille.«
»Muss jeder selbst wissen, wie viel er trinkt«, sagte der Ungerer Franz, als die Carabinieri ein paar Tage später bei ihm vorbeikamen, um herauszufinden, was mit dem Mann geschehen war, bevor er starb.
»Muss jeder selbst wissen«, sagte er – und die Bauern, die am Tresen saßen, nickten zustimmend.
»Was weiß ich, was der den ganzen Tag über schon alles in sich reingeschüttet hat. Da werden meine zwei, drei Birnenschnäpse keinen Unterschied mehr gemacht haben, oder?«
Das Brummen der Bauern. Sogar einer der beiden Carabinieri nickte.
»Wer die Saslong runterfährt, ist für sich selbst verantwortlich. Die ist kein Spaß, diese Piste. Die ist was für Könner. Wer Anfänger ist, der sollte es lassen. Nüchtern oder voll, der hat da nichts zu suchen.«
Nun, ja, nun gab es wieder einen Toten. Wieder einer, der mehr Bub als Mann war. Und dieser Tote zählte, sagten die Bauern. Weil er ein Könner war. Ein Nachwuchstalent im Abfahrtslauf. Und obendrein einer von hier.
Viele Profirennläufer hatte der Sport schon das Leben gekostet, noch nie jedoch hatte es einen auf der Saslong erwischt.
Der Ungerer-Wirt hatte die ersten Rennläufer, die sich einer nach dem anderen die Piste hinabgestürzt hatten, kaum beachtet. Die Langsteinhütte war voll gewesen, wie immer, wenn der Weltcupzirkus ins Tal kam. Dann saßen die Fans und Reporter schon um neun Uhr früh unter Ungerers Schindeldach, obwohl die ersten Fahrer erst um halb zwölf starteten.
Unten am Ziel hatten sich Massen versammelt, sie verfolgten die Rennläufer auf der Leinwand, bis zu dem Moment, an dem sie vor ihnen am Hang auftauchten, die letzte steile Rechtskurve nahmen, noch einmal in die Hocke gingen, auf den letzten Hügel zusteuerten. Alle schrien, wenn die Skier abhoben, sie hielten den Atem an, wenn sie wieder landeten, auf den roten Zielbogen zuhielten. Alle Blicke richteten sich auf die Zeitanzeige.
Oben beim Ungerer war man näher dran. Auf halbem Weg stand die Langsteinhütte direkt an der Piste. Nur ein rotes Sicherheitsnetz trennte die Zuschauer von den Wahnsinnigen, die sich da runterstürzten. Als der sechste Fahrer unterwegs war, rief der Wirt seine Frau Julitta, als der siebte an der Hütte vorbeirauschte, kam sie aus dem Keller, in dem sie sich um ihre eingeweckten Früchte gekümmert hatte. Sie übernahm den Thekendienst. Allein. Weil an der Theke nun eh nicht mehr viel zu tun war. Weil ihr Mann bereits alle Gäste, Fans und Journalisten mit Kaffee, Wein, mit Preiselbeermarmelade gefüllten Krapfen, mit Speck und Essiggurken belegten Vinschgerlen versorgt hatte. Nun war die Hütte leer.
Der Ungerer-Wirt hatte noch nie verstanden, warum es seine Julitta nicht hinauszog. Warum sie lieber ein paar leere Gläser zusammenräumte, als zuzuschauen, wenn ihr Sohn die Piste hinabflog. Wenn er in der Ferne ein Rennen fuhr, in Beaver Creek, in Bormio, auf der Streif in Kitzbühel, machte sie die Wäsche, während Franz am Fernseher hing. Sie hatten ihm einmal gesagt, dass sie das nicht packe. Die Aufregung! Das Adrenalin! Sie hatte ihm gesagt, dass sie kein Adrenalinmensch sei. Sie sei ein Preiselbeereinweckmensch. Ein Preiselbeereinweckmensch war so ziemlich das Gegenteil von einem Adrenalinmenschen. Sie fuhr nicht einmal Ski. Was schon ziemlich ulkig war für jemanden, der in Gröden lebte und eine Hütte direkt an der Piste bewirtschaftete. Franz Ungerer trat zur Tür, warf noch einen Blick über die Schulter. Julitta füllte gerade die Körbchen mit Schüttelbrot auf, richtete ein paar Speckbretteln her. In einer Viertelstunde, zwanzig Minuten höchstens, würden die besten Läufer die Saslong hinabgerauscht sein, der Sieger feststehen. Auch wenn oben am Hang noch weitere, weniger profilierte Sportler auf die Abfahrt warteten, würden alle wieder reingehen. Bestellen. Wein, Schnaps, Speck. Das Spektakel machte durstig. Hungrig.
Noch aber standen alle draußen. Der Franz bahnte sich den Weg durch die Menge und stellte sich an das rote Sicherheitsnetz. Da vernahm er schon das scharfe Geräusch der Skier auf dem Eis, er spürte die Gänsehaut auf seinem Rücken, als der Athlet vorbeischoss. Er hatte die Kurve nicht richtig genommen und wertvolle Zeit verloren. Kurz darauf war er verschwunden.
Nun war Philipp dran. Er trug die Nummer fünfzehn. Auf der kleinen Leinwand neben der Terrasse sah Franz, dass sein Sohn einen sehr guten Start hingelegt hatte. Die erste Kurve erreichte er mit einem knappen zeitlichen Vorsprung. Der Wirt ballte die Hand zur Faust. Er hatte es gewusst. Philipp war in Bestform, er würde gewinnen, es allen zeigen. Endlich. Wieder erklang das scharfe Geräusch der Skikanten auf dem Eis.
»Hopp, Phil, hopp, dai!«
»Aléaléaléalé!«
»Vaivaivaivai!«
»Vollgas, Philipp, volle Pulle!«
Die Köpfe schnellten herum, als der junge Läufer vorbeizog. Franz beugte sich vor, blickte auf den Rücken seines Sohnes, der sich rasch entfernte, auf die Startnummer auf dem blauen Rennanzug, der so eng war, dass es aussah, als wäre er aufgemalt.
Die Piste wies an dieser Stelle einige Unebenheiten auf, die berüchtigten Kamelbuckel. Kaum hatte er sie erreicht, schien es, als hätte eine unsichtbare Hand den jungen Ungerer am Kragen gepackt. Die Skier flogen nach vorn, während der Oberkörper nach hinten geschleudert wurde. Franz riss den Mund auf zum stummen Schrei.
16. Dezember
1
Nein, sie hatte keine Lust gehabt auf den Rummel. Obwohl sie den Sport über alles liebte. Aber heute hatte sie mit ihm allein sein wollen, den Tag zu zweit in der unberührten Natur verbringen wollen. Um ihm endlich die Frage zu stellen, die sie nun schon so lange umtrieb. Die Frage, die man sich doch irgendwann stellte, wenn man eine Weile verheiratet war. Aber sie hatte ihm den Wunsch nicht abschlagen können.
Silvia Tappeiner und Claudio Saltapepe hatten sich in einer kleinen Hütte auf der Nordseite des Grödentals eingemietet. Am Hang der Seceda, jenes zackigen Gipfelreigens, der mit etwas Fantasie aussah wie die Zähne eines Krokodils. Wo sich im Sommer mittlerweile so viele Selfie-Touristen tummelten, dass die Bauern Geld verlangten, wenn sie mit ihren Flipflops über ihre Wiesen laufen wollten. Die Hütte, die sich die beiden ausgesucht hatten, lag abgeschieden am Rand einer der Wiesen, war von der Bergstation des Lifts nur zu Fuß zu erreichen. Hier war es, nun, um diese Jahreszeit, ruhig. Die beiden hatten in ihren Rucksäcken alles hochgeschleppt: Schlafsack, Nudeln, Sugo, eine Flasche Blauburgunder aus dem Unterland.
Es gab weder Strom noch fließendes Wasser. Perfekt. Die Holzscheite brannten alsbald im Ofen, eine schönere Wärme gab es nicht. Und einen schöneren Ausblick auch nicht. Besonders abends. Wenn die Sonne die weißen Gipfel zum Leuchten brachte. Wenn weit unten im Tal die Lichter funkelten.
Während sich unten die Massen versammelten, um dem Alpinen Weltcup beizuwohnen, hatten sie hier oben ihre Ruhe. Nur ihre Spuren waren im tiefen Pulverschnee zu sehen. Und vielleicht noch die eines Rehkitzes.
Tags zuvor hatten sie eine Eisklettertour an einem der Nordhänge unternommen. Mit Pickeln hatten sie sich vorgearbeitet. Dass ihr rechter Zeigefinger fehlte, störte Silvia beim Eisklettern nicht. Zumindest weniger als beim Klettern in der Halle oder am Felsen. Viel weniger als bei den allmonatlichen Schießübungen der Polizei. Sie schoss nun mit links. Beinahe schon so gut, wie sie mit rechts geschossen hatte.
Claudios Kletterkünste waren stetig besser geworden. Ihr zuliebe hatte er auch das Skifahren gelernt und unglaubliche Fortschritte gemacht, schon zwei Touren im Tiefschnee hatten sie gemeinsam unternommen. Langsam wird aus dem stolzen Neapolitaner doch noch ein Bergmensch, hatte sie schmunzelnd gedacht.
Heute früh waren sie von der Sonne, die den Schnee vor der Hütte zum Glitzern gebracht hatte, aufgeweckt worden. Claudio hatte Kaffee gekocht. Und als sie den ersten, göttlichen Schluck genossen, sagte er: »Eigentlich würde mich das schon mal interessieren, wie schnell diese Verrückten die Piste hinabbrettern.«
Sie schaute ihn skeptisch an. »Zehntausend Leute versammeln sich im Stadion am Ziel. Du willst wirklich lieber in diesem Getümmel diesen schönen Tag verbringen als in aller Ruhe, in …«
»Du, ich kenne ja einen der Carabinieri im Dorf, den Luigi«, unterbrach er sie schnell, »der war mit mir früher mal in der Spezialeinheit, vor zwei Jahren haben sie ihn nach Gröden versetzt.«
»Gröden?!«, sagte Tappeiner, »warum denn Gröden?«
»Ach«, Saltapepe zuckte die Schultern, »wahrscheinlich hat er sich Feinde gemacht, wahrscheinlich musste man ihn aus der Schusslinie nehmen. Das Tal war zwar früher mafiaverseucht, aber darum haben wir uns ja gekümmert. So schnell kommen die nicht wieder. Niemand würde daran denken, ihn da zu suchen. Wie dem auch sei: Er hat mir gesagt, dass es direkt an der Piste eine Hütte gibt, die Langsteinhütte. Da hat er heute Dienst, er muss die Zufahrt abriegeln, sobald das Gelände voll ist, würde uns aber durchlassen. Er hat mir außerdem gesagt, dass die Hüttenwirtin die beste Preiselbeermarmelade der Welt macht.«
Sie hatte überlegt, ihn mit großen Augen zu fragen, ob er wirklich lieber dorthin wolle, als einen schönen Tag mit ihr zu zweit zu verbringen. Sie hatte gewusst, dass er dann klein beigeben würde. Musste. Sie hatte geseufzt. Ja, wahrscheinlich zogen viele diese Karte in einer Ehe. Irgendwann. Aber sie hatte es nicht tun wollen. Noch nicht.
Und deshalb standen sie nun da. Und sie musste sich eingestehen, auch wenn sie es ihm niemals sagen würde, dass sie es gar nicht so schlimm fand. Auf der Terrasse tummelten sich zwar viele Menschen, aber sie war ganz sicher nicht so überfüllt wie die Zuschauertribüne unten am Ziel. Sie hatten zwei Speckbrote bestellt. Dazu zwei Gläser des hausgemachten Himbeersafts, der auf der Schiefertafel angepriesen wurde. Silvia hatte noch nie einen so guten Himbeersaft getrunken.
Sie hatte schnell noch ein Glas Preiselbeermarmelade gekauft, es in die Jacke gesteckt. Sie hatten sich, als sich das Innere der Hütte alsbald geleert hatte, auch nach draußen gestellt, sich ein bisschen weiter nach vorn durchgekämpft, näher an das rote Sicherheitsnetz heran. Silvia hatte der Slalom immer mehr als die Abfahrt fasziniert. Pure Kraftmeierei, hatte sie gedacht.
Nun schaute sie auf die Piste. Sah, wie steil sie war. Wie vereist sie war. Zwei Fahrer waren schon an ihnen vorbeigerauscht. Die Nummer dreizehn. Und die Nummer vierzehn. Ein Schweizer und ein Norweger.
Mit gehörigem Tempo verschwanden sie in der Ferne.
»Santo cielo«, staunte Saltapepe neben ihr.
Mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtete sie ihn. Ihr Claudio ließ sich für gewöhnlich nicht so leicht beeindrucken. Der hatte in seiner Zeit in Neapel zu viel erlebt. Sie fasste sich an den Handschuh. Dort, wo sich ihr Finger befunden hatte, kitzelte es. Es war unerklärlich: Immer, wenn ihr kalt war, spürte sie das Kitzeln, als wäre der Finger noch da.
»Nun kommt der Lokalmatador«, sagte sie zu Saltapepe.
»Wer?«, fragte er. Seine Augen leuchteten.
»Philipp Ungerer, er ist aus dem Tal. Ein Grödner. Das ist seine erste Weltcup-Saison, doch er zählt schon zur Weltspitze. Und das, obwohl er noch so jung ist. Zwanzig oder einundzwanzig, so genau weiß ich es nicht. Vor ein paar Wochen stand er schon mal auf dem Treppchen. Ist Dritter geworden, in Wengen. Gestern beim Super-G wurde er guter Fünfter, obwohl ihm diese Disziplin bei Weitem nicht so sehr liegt wie die Abfahrt.«
Hinter ihnen kamen die Zuschauer noch näher, Silvia bemerkte, dass sich viele auf die Zehenspitzen stellten. Die Blicke waren nach oben gerichtet, auf die Stelle, wo die Piste den Wald teilte. Die blonde Frau im roten Mantel neben ihr hob ihr Handy, filmte. Das hatte die Polizistin noch nie verstanden. Warum man ein Ereignis lieber filmte, um es sich später anzuschauen, als es live zu genießen.
Erst hörte Tappeiner das anschwellende Raunen. Ein Ahhh und Ohhh, ein paar der Umstehenden hoben die Hand, zeigten auf den blauen Punkt, der nun in die steile Passage einfuhr.
Ungerer hatte das Tor eng passiert, enger als der Athlet zuvor, das belastete die Skier, die Wadel, aber es brachte Zeit, kostbare Zeit, Millisekunden, nur darum ging es in diesem Sport, ein, zwei Hundertstelsekunden entschieden über Sieg oder Niederlage. Freude oder Schmerz.
Nun raste der heimische Athlet direkt in Richtung der Hütte, hielt sich zunächst in der Hocke, richtete sich dann auf, breitete die Arme aus, lehnte sich nach rechts, belastete den Talski, nun, für ein, zwei, drei Sekunden, war er ganz nah bei den Zuschauern, sie riefen seinen Namen, jubelten ihm zu.
Dann erreichte er die Pistenwellen, die Kamelbuckel. Die Menge schrie auf. So fällt man nicht, dachte Tappeiner noch, als Ungerer nach hinten geworfen wurde und hart auf dem vereisten Boden aufschlug. Er rutschte noch ein paar Meter bergab, dann blieb er regungslos liegen.
Tappeiner hatte schon einige Stürze im Fernsehen gesehen. Stürze, bei denen man glaubte, der Gefallene würde nie wieder aufstehen. Und dann, man konnte es kaum glauben, regte er sich, drehte sich auf die Seite, hievte sich hoch, schüttelte sich, hob den Kopf und den Arm, schließlich den Daumen.
Ungerer jedoch blieb liegen. Zwei Pistenaufseher näherten sich ihm. Tappeiner schaute sich um, schaute in entsetzte Gesichter, sie drehte sich zu Saltapepe, der langsam den Kopf schüttelte. Rechts von ihr zerrte ein Mann am Sicherheitszaun, als ob er ihn zerreißen wolle, um auf die Piste zu kommen. Aber so ein Zaun ließ sich nicht einfach so zerreißen, der war genau dazu da, dass er nicht riss.
»Philipp!«, rief der Mann. »Mein Philipp!«
Drei, vier Umstehende hielten ihn fest, redeten auf ihn ein. Von hinten ertönte ein Schrei. Tappeiner fuhr herum. Die Wirtin stürmte aus der Hütte.
»Philipp!«, schrie auch sie.
Tappeiner verstand erst nichts, dann alles. Dieser Wirt, er war der Vater des Rennläufers. Diese Wirtin, sie war die Mutter. Die Ermittlerin spürte einen Kloß im Hals, sie griff nach Saltapepes Arm, bekam ihn zu fassen, klammerte sich daran fest.
In die Schreie der verzweifelten Eltern mischten sich knatternde Motorengeräusche, die anschwollen. Als Tappeiner sich wieder umdrehte, sah sie den gelben Hubschrauber der Bergrettung, der sich ihnen vom Tal aus näherte. Die Baumwipfel wogten, zwischen den Buckeln winkte einer der Weltcup-Mitarbeiter zum Hubschrauber empor, der andere kniete beim Athleten, bei Philipp, beugte sich zu ihm hinab, machte sich an seinem orangenen Helm zu schaffen.
Der eine Ski hing noch an Ungerers Bein, der andere war weitergerutscht, bis an den Waldrand. Der Gestürzte lag immer noch regungslos da in seinem azurblauen Anzug.
2
Johann Grauner, der oben über dem Eisacktal auf dem Graunerhof Viechbauer war und unten in der Questura von Bozen Commissario, ging langsam über die mit Schnee bedeckte Wiese. Früher hatte er von dieser Stelle aus, hier, wo der große Findling stand, schon den Giebel der alten Schindeldachhütte gesehen. Drei Schritte weiter lag sie dann vor ihm. Seine Alm. Nun? Sah er nichts. Nichts? Er ging hastig weiter, stoppte.
Grauner, der erst vor wenigen Wochen in die Heimat zurückgekehrt war, traute seinen Augen nicht. Das durfte nicht wahr sein. Es konnte sich nur um eine Sinnestäuschung handeln, diese ganze Weltenbummlerei, zu der ihn seine Frau angestiftet hatte, all die neuen Eindrücke, die er in den vier Monaten gesammelt hatte, sie hatten sein Graunerhirn völlig durcheinandergebracht. Ja, das musste es sein, eine Art Kurzschluss, der ihn Dinge sehen ließ, die nicht real waren.
Grauner blinzelte. Schaute weiter auf das, was vor ihm lag. Auf die Stelle, wo einst seine Alm gestanden hatte. Aus dunklem Holz gezimmert, von der Witterung gezeichnet. Das, was er da jetzt sah, dieses weiße Ding, es schimmerte in der Sonne. Er stammelte leise vor hin. »Es ist, das ist … es ist …«
Als sie nach den endlos langen Wochen zurückgekommen waren, war Grauners Erleichterung groß gewesen. Als der Hof hinter der letzten Kehre vor ihnen aufgetaucht war, hatte ihn ein warmes Gefühl durchflutet. Er ging sofort in den Stall. Seine Kühe muhten, die Freude, ihn wiederzusehen, war aus dem Muhen herauszuhören. Ganz klar. Da gab es keinen Zweifel.
Sara und Mickey hatten sich in ihrer Abwesenheit um alles gekümmert. Er vermutete, dass seine Tochter die Tiere gezwungen hatte, das neue Album dieser Billie Eilish, dieser voll und ganz unmusikalischen, ahnungslosen jungen Sängerin, zu hören. Arme Viecher! Seine Sorge, dass die musikalische Tierquälerei sich negativ auf die Qualität der Milch ausgewirkt haben könnte, erwies sich jedoch als unbegründet. Im Gegenteil: Sie schmeckte vorzüglich. Er war sich sicher, dass die Kühe sich ganz besonders viel Mühe gaben, um ihm eine außerordentlich schmackhafte Willkommensmilch zu schenken.
In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr hatte er es nicht gewagt, zur Alm hochzuwandern. Nein, mit dem Umbau der Alm hatte er schon vor der Abreise nichts zu tun haben wollen. Nein, die Alm, das war Saras und Mickeys Projekt. Sie hatten ihr Studium in Wien unterbrochen. Nicht abgebrochen, wie sie ihm hoch und heilig versprochen hatten. Seitdem hielt er sich da raus. So war es am besten. Würde er sich einmischen, würde es Streit geben. Nur ein bisschen einmischen, das konnte er nicht. Nein, nein, nein, die Alm hatte er ihnen überlassen und das war die richtige Entscheidung gewesen. Hatte er gedacht.
Wochenlang jedoch hatte Grauner schlecht geschlafen. Erst hatte er es auf die Reise geschoben. Sein Hirn kam nicht zur Ruhe, weil es alles Schritt für Schritt verarbeiten musste. Das ganz vorzügliche Abendessen auf dem Eiffelturm, mit den glitzernden Lichtern der Stadt unter ihnen. Das unvergessliche Konzert in Manaus. Der junge portugiesische Tenor hatte den Pagliacci so hinreißend gesungen, besser hatte es selbst Enrico Caruso nicht hinbekommen. Die Pinguinbabys in der Pinguinstation im Süden Patagoniens. Die Weingüter in Südafrika mit Meerblick. Der Nachmittagstee am Fuße des Fuji. Eindrücke, so viele Eindrücke! Wahrscheinlich würde er nie wieder richtig schlafen können, hatte er gedacht.
Erst in der vergangenen Nacht hatte er realisiert, dass es nicht allein die Erinnerungen an die Reise waren, die ihm den Schlaf raubten. Immer wieder waren seine Gedanken zu seiner Alm gewandert. Seine Alm, die nun Calm Alm hieß und ein Rückzugsort für ausgelaugte Stadtmenschen werden sollte. Ein kleines Hideaway-Resort, das war die Business-Idee seiner Tochter und ihres Freundes. Zu der er sich hatte überreden lassen. Die ihn all seine Ersparnisse kostete – und noch dazu einen ordentlichen Schuldenberg produzierte.
Also hatte er sich an diesem Morgen nach dem Melken die Schneeschuhe angeschnallt und war losgegangen, aus dem Dorf hinaus, über die verschneiten Wiesen und das zugefrorene Bächlein, in den Wald hinein, bis zu den höher gelegenen Gefilden, wo kein Baum mehr wuchs, wo die großen Findlinge herumlagen, die vor Jahrtausenden von den Felsen abgebrochen und hinabgekullert waren.
Er hatte ein paar Mal gerastet. Nicht etwa, weil er müde gewesen wäre. Eher, weil er sich ein bisschen davor gefürchtet hatte, sie zu sehen. Seine Alm, die nicht mehr seine war. Er hatte sich fest vorgenommen, gut zu finden, was da entstanden war. Er hatte sich fest vorgenommen, wie schon so oft in seiner rumpeligen Karriere als Vater, sich an den weisen Spruch seines geliebten Gustav Mahler zu halten. Der gesagt hatte, dass er die Jungen zwar nicht verstehe, aber sie recht hätten, weil sie eben jung seien.
»Es ist, das ist … was ist … schön! Schön? Ist es … ach …«
Grauner spürte eine Vibration, er stand noch ein paar Sekunden wie versteinert da, bis er realisierte, was sich da in seiner Hosentasche bemerkbar machte. Das Handy.
»Es ist schön, es ist …«, stammelte er weiter, während er das Handy aus der Tasche kramte.
»Es ist …«
Er tippte blind aufs Handy, ohne den Blick von der neuen Alm abzuwenden.
»Es ist schön, es ist … ist es nicht … es ist nicht, nein …«
Er hielt sich das Gerät ans Ohr, hörte die Stimme des Ispettore.
»Grauner, hör zu …«
»Es ist schrecklich, so schrecklich!«
Kurz herrschte Stille zwischen den beiden, nur der Wind rauschte, Grauners Atem bildete Wölkchen.
»Du hast es also schon in den Nachrichten gehört?«
»Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Furchtbar.«
»Ja, schrecklich, furchtbar, traurig …«
»Ja, traurig, das trifft’s.«
Grauner drehte sich um, machte kehrt. Fragte sich, was der Ispettore denn nun von ihm wollte.
»Tragisch«, sagte Saltapepe.
»Hm«, machte Grauner, nun etwas verwirrt.
Er stapfte voran. Vielleicht wäre es besser, nie mehr zurückzukehren.
»Aber jetzt halt dich fest, Grauner«, sagte der Kollege am anderen Ende der Leitung.
Es gab nichts, woran sich der Commissario festhalten konnte, um ihn herum war nur der Schnee, vor ihm die Spuren seiner Schneeschuhe, denen er folgte.
»Es war kein Unfall, es war Mord.«
»W…was?«
3
Der Feuerwehrmann, der am Zaun stand, winkte Grauner durch, nachdem der ihm das Tesserino, das ihn als Commissario auswies, aus dem geöffneten Seitenfenster des Panda hingehalten hatte. Als er anfuhr, stellte sich der Mann stramm hin und salutierte, was Grauner komisch fand. Entweder war der Kollege ein Witzbold oder ein bisschen angetrunken. Oder beides. Er tippte auf beides.
Er stellte das Auto neben einem Übertragungswagen der Rai ab, stieg aus. Eiskalte Luft. Hier in St. Christina war das Tal recht eng, links von ihm krallten sich mit Weihnachtsgirlanden geschmückte Häuser und Hotels an den Nordhang, auf der anderen Seite zogen sich Stahlseile über die schneebedeckten Bäume hinweg in die Höhe. Eine Gondel kam von oben herab. Über allem thronte ein mächtiger Dolomitengipfel. Der ikonische Langkofel.
Die hoch stehende Sonne strahlte vom blauen Himmel. Keine Wolke war zu sehen. Nur die Kondensstreifen zweier Flugzeuge. Eines flog nach Süden, eines nach Westen. Eine glitzernde weiße Schneise zog sich, leicht gebogen, durch das Walddickicht bis zum Fuße des Tales. An ihrem Ende war ein Stahlgerüst aufgebaut, das sich vor dem Commissario auftürmte. Die Tribünen vor dem Ziel.
Grauner ging den Stahlkoloss entlang, er musste an die letzte Station der Weltreise mit Alba denken. Das Theater des Dionysos in Athen am Südhang der Akropolis. Das wohl älteste der Welt. Er hatte tatsächlich Gänsehaut bekommen, als er auf einem der obersten Plätze gesessen und zur ebenerdigen Orchestra hinuntergeschaut hatte.
»Allzu tiefes Schweigen macht mich so bedenklich wie zu lauter Schrei«, hatte Alba von dort zu ihm hochgebrüllt.
Sie hatte sich während ihrer drei Tage in Athen den Spaß erlaubt, ihm mit Zitaten aus Antigone von Sophokles den letzten Nerv zu rauben.
Grauner: »Alba! Jetzt ist aber mal gut. Schau, wollen wir nicht lieber hier in diesem schattigen Café noch eine Limonade trinken, bevor wir schon wieder ein paar Statuen anschauen gehen?«
Alba: »Auch darin hat er es herrlich, Johannophokles Graunerius, mein Tyrann, frei darf er tun und sagen, was er will.«
Das Stahlkonstrukt, um das Commissarius Johannophokles Graunerius nun herumwanderte, wirkte wie ein rudimentärer Nachbau eines alten griechischen Theaters. Der Boden war matschig und mit leeren Plastikbechern übersät. Zwei Gemeindemitarbeiter kehrten sie mit einem Besen auf, an einem weihnachtlich verzierten Bierstand lehnte eine etwas verloren wirkende Männergruppe. Um sie herum standen Kuhglocken, beinahe so groß wie Kirchenglocken. Grauner runzelte die Stirn, keine Kuh war groß und stark genug, um so eine Glocke tragen zu können.
Dann fiel ihm ein, dass er diese Männer, die alle Lederhosen trugen, schon ein paar Mal gesehen hatte. Im Fernsehen.
Manchmal fläzte sich Grauner wochenends nach dem Melken auf die Ofenbank und schaltete den Fernseher an. Oft war er so müde, dass ihm die Kraft fehlte, eine der Derrick-VHS-Kassetten aus dem Schrank zu holen, sich für eine der Folgen zu entscheiden, die er eh alle auswendig kannte.
Dann zappte er herum – im Winter blieb er meist beim Skisport hängen. Beim Skispringen schlief er sofort ein. Noch bevor er die Frage zu Ende denken konnte, warum Menschen so etwas machten. Sich von einer Schanze hinunterzustürzen. Beim Biathlon blieb er länger wach. Auch beim Slalom, die technischen Disziplinen interessierten ihn mehr als die Abfahrt. Als Jugendlicher hatte er Gustav Thöni verehrt, der scheinbar mühelos durch die Tore getanzt war. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder diese Männer mit den riesigen Glocken unter den Fans entdeckt. Die Kamera hielt drauf, wenn sie lärmten, die Journalisten interviewten sie. Es war alles ein großes Spektakel.
Nun? Lag der Zirkus verlassen da. Die Kuhglockenmänner wirkten bedrückt. Grauner wandte sich von ihnen ab, schaute auf die große Leinwand neben der Zieleinfahrt. Sie zeigte einen Pistenabschnitt weiter oben am Berg. Auf der einen Seite ein Stück Wald. Auf der anderen war ein Teil einer Almhütte zu sehen. Blaue Farblinien im Eis. Und ein mit rot-weißem Flatterband abgesperrtes Rechteck. Es markierte den Tatort. Männer in weißen Schutzanzügen liefen herum. Mitarbeiter der Spurensicherung.
Die leeren Ränge des eigens für den Weltcup aufgestellten Stadiongerüsts wirkten gespenstisch. Die Stille ebenso. Vor wenigen Stunden noch mussten hier die Massen getobt haben. Ein Sporttheater. Die Abfahrer waren die Gladiatoren der Neuzeit. Nun war einer tot. Gestürzt. Aber nicht einfach so. Er war ermordet worden.
»Es ist verrückt, einfach verrückt.«
Grauner fuhr herum. Er hatte Max Weiherer, den Chef der Scientifica, nicht kommen hören.
»Was ist verrückt?«, fragte er zurück und hoffte, der Kollege hatte nicht bemerkt, wie sehr er ihn erschreckt hatte.
»Dass man mir derart in meine Arbeit hineinpfuscht.«
Grauner kannte Weiherer nun bereits seit vielen Jahren. Er konnte sich an keinen einzigen Fall erinnern, bei dem sich der Spurensicherer nicht beschwert hätte. Es war nun einmal das leidvolle Schicksal von Spurensicherern, dass Ermittler ihnen in ihre Arbeit hineinpfuschten.