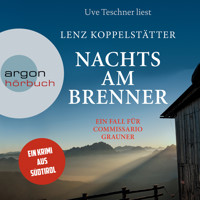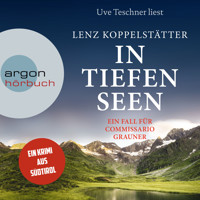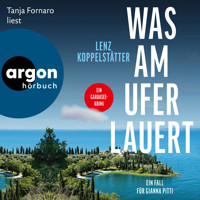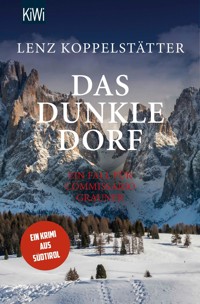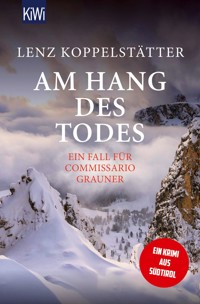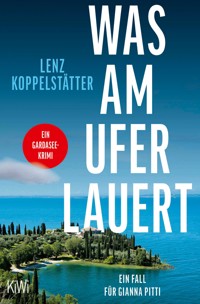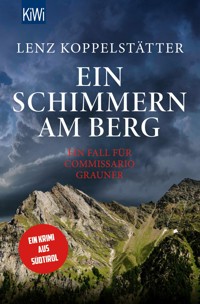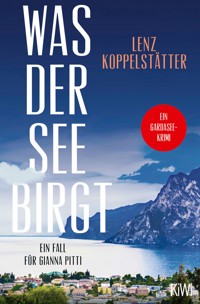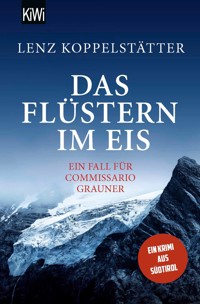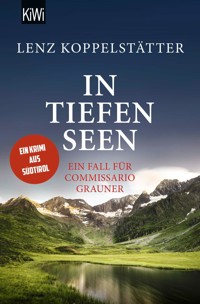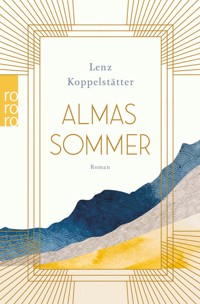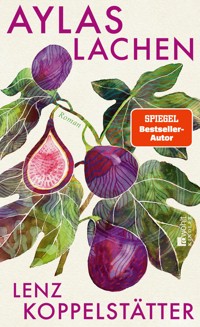
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende deutsch-türkische Familiengeschichte von Bestsellerautor Lenz Koppelstätter. Wenn Ayla an ihren Großvater Mesut denkt, dann träumt sie sich an die Bank unter dem Feigenbaum in seinem Garten zurück, auf der er ihr die abenteuerlichsten Geschichten erzählte. Sie erinnert sich an die flirrenden Sommer ihrer Kindheit voller Licht, Hitze und Staub, die sie mit ihrer Familie in Anatolien verbrachte, woher ihre Mutter Hava stammt. Hava hat ihre Heimat als junge Frau verlassen, aber in Deutschland, am Bodensee, ist sie nicht glücklich geworden, genauso wenig wie in ihrer Ehe. Den Mann, den sie nicht heiraten durfte, hat sie nie vergessen – und ihrem Vater nie verziehen. Und so machen sich Ayla und ihr Bruder Yasin mit ihrer Mutter in einem alten Mercedes auf den Weg nach Anatolien, damit Hava ihre große Liebe wiedersehen kann. Eine Reise beginnt, die in die Vergangenheit führt, zu dem kleinen Dorf in den Bergen, in dem Bauer Mesut von der großen, weiten Welt träumte – und seine Tochter von der Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Aylas Lachen
Roman
Über dieses Buch
Aufgewachsen in Deutschland, kennt Ayla die anatolische Heimat ihrer Mutter nur aus den Sommerferien. Flirrende Wochen voller Licht, Hitze und Staub. Und ihr lustiger Großvater Mesut, der ihr im Schatten eines Feigenbaums die abenteuerlichsten Geschichten erzählte.
Aylas Mutter Hava hat die Türkei als junge Frau verlassen, aber in Deutschland, am Bodensee, ist sie nicht glücklich geworden, genauso wenig wie in ihrer Ehe. Den Mann, den sie nicht heiraten durfte, hat sie nie vergessen – und ihrem Vater nie verziehen.
Und so macht sich Ayla Jahre später mit ihrer Mutter in einem alten Mercedes auf den Weg nach Anatolien, damit Hava ihre große Liebe wiedersehen kann. Eine Reise, die in die Vergangenheit führt, zu dem kleinen Dorf in den Bergen, in dem Bauer Mesut von der weiten Welt träumte – und seine Tochter von der Freiheit.
Ein bewegender Familienroman über drei Generationen – und zwischen zwei Kulturen.
Personen, Handlungen und Ereignisse dieses Romans sind frei erfunden.
Vita
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist Spiegel-Bestsellerautor, er schreibt Kriminalreihen, Biografien, Sachbücher. Als Reporter war er, vor allem für Geo Saison und Geo Special, in der ganzen Welt unterwegs; nach wie vor publiziert er Texte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Salon. Bei Rowohlt Kindler erschien zuletzt der Roman «Almas Sommer». «Aylas Lachen» ist inspiriert von zahlreichen Erinnerungen und Erzählungen seiner Frau, die in Anatolien geboren und teils dort, teils in Deutschland aufgewachsen ist. Mit ihr und den beiden gemeinsamen Kindern lebte Koppelstätter während der Entstehung des Buches in Istanbul und bereiste weite Teile der Türkei.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung ©Sally-Ann Langley 2025, www.slangleyart.com
ISBN 978-3-644-02118-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ilay und Yade
Prolog
«TRÄUM SCHÖN!»
Ende der 1980er
«Lach nicht vor fremden Menschen», befahl Großvater Mesut seiner Enkelin Ayla, wenn sie gemeinsam durch die Straßen von Burdur spazierten.
Zu Hause, in Großvaters Garten im kleinen Dorf in den anatolischen Bergen, lachten die beiden viel miteinander.
Am liebsten war es Ayla, wenn Großvater sie auf der morschen Holzbank im Schatten des Feigenbaumes auf den Schoß nahm und ihr Geschichten erzählte. Geschichten von den vielen Reisen, die er niemals unternommen, und den Abenteuern, die er niemals erlebt hatte. Und wenn er sie dann ohne Vorwarnung kitzelte.
Großvater Mesut erzählte von den Tagen, als die Soldaten der Entente die Halbinsel Gallipoli bei der Meerenge der Dardanellen einnehmen wollten. Als er selbst mit Mustafa Kemal und seinen Männern säbelrasselnd auf den sandigen Steinhügeln stand und hinter den Dornbüschen versteckt auf die Feinde wartete.
Der Rauch der Lagerfeuer hing über den Zelten, fraß sich in den Stoff der schmutzigen Uniformen.
«Eure Mütter haben euch nur für diesen Tag geboren», rief Mustafa Kemal – den sie damals gazi riefen, heiligster aller Krieger! – seinen Männern zu.
Die Flammenzungen loderten so hoch in den dämmernden Himmel, dass die Soldaten manchen Funken mit einer Sternschnuppe verwechselten. Oder verwechseln wollten.
Die Mutlosen unter ihnen wünschten sich beim Anblick der Leuchtkörper, dass sie die anstehende Schlacht möglichst unversehrt überleben mochten, es vielleicht schafften, sich unbemerkt zu einem der Leichenberge zu legen. Scheinbar totenstarr abwartend, bis das Gemetzel ein Ende fand. Sich dann selbst eine Verwundung zuführend, nicht zu harmlos, nicht zu schrecklich. Eine abgehackte Hand vielleicht, ein Schuss in einen der Unterschenkel, um in ein Lazarett gebracht zu werden und nach Hause zu dürfen. Um die eigenen Kinder wiederzusehen.
«Feiglinge, Hasenfüße», schimpfte Großvater Mesut unterm Feigenbaum und erzählte weiter.
Nur Angsthasen hielten die Feuerfunken für Sternschnuppen. Die Mutigeren, und er selbst hatte natürlich zu den allermutigsten von Kemals Kameraden gehört, wünschten sich einen heroischen Tod auf dem Schlachtfeld. Nicht ohne, ehe sie von einer Klinge oder einer Kugel getroffen zu Boden sanken, mindestens ein halbes Dutzend Feinde abgemurkst zu haben.
«Ich befehle euch nicht den Angriff», schrie Mustafa Kemal, den sie später als Atatürk, den Landesvater, verehrten, «ich befehle euch zu sterben.»
Alle Munition war längst verschossen, Kemals mutige Männer pflanzten die Bajonette auf die Gewehrspitzen und drängten dem Feind tollkühn schreiend entgegen.
Großvater Mesut erzählte davon, wie er im Gestrüpp mit seinem Kilidsch zwei, nein drei Dutzend Australiern den Kopf abgeschlagen hatte. Wie der Geruch des wilden Thymians, der in den Felsen rankte, vom Gestank der Verwesung übertüncht wurde. Wie die Schlangen an der steinigen Küste über die Leichen glitten. Dass ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Achtundvierzig Stunden. Aus Angst, das Nervenfieber würde den Kugeln und Säbeln zuvorkommen.
Er drückte Ayla fest an sich, wenn sie ihn mit großen Augen anschaute und gleichzeitig von ihm forderte, nicht aufzuhören, immer weiterzuerzählen. Nein, sie fürchte sich nicht!
Großvater erzählte also, dass ihm Mustafa Kemal höchstpersönlich zu seiner Glanzleistung gratuliert habe. Dass Winston Churchill, damals Erster Lord der britischen Admiralität, wütend seinen Namen durch die Hallen des Buckingham-Palastes brüllte, nachdem er König George dem Fünften das Rückzugsgesuch vorgelegt hatte.
«Mesut, gottverdammter!», ja das habe Churchill, der spätere Vater der Briten, geschrien.
Dann verfinsterte sich Großvaters Gesicht – und Ayla ahnte es schon: Jetzt würde gleich die Kitzelattacke starten. Und sie lachte schon, sie konnte nicht anders, bevor es losging. Gackerte beinahe wie Großvaters Hühner, die auf der ausgetrockneten Wiese herumwackelten. Und er lachte mit ihr, tief grollend wie der Donner eines anatolischen Sommergewitters.
Jedes Jahr verbrachte Ayla mit ihrer Familie den Sommer bei ihrem Großvater in der Türkei. Und jedes Mal erzählte sie ihrer Mutter während der langen Fahrten zurück nach Deutschland von Mesuts Abenteuern. So auch dieses Mal. Atatürk! Die Australier in Gallipoli! Und dass die Köpfe dieser Australier wohl immer noch irgendwo tief im Sand begraben sein mussten. Und ob sie nicht nächsten Sommer einen Abstecher dahin machen könnten und ob Vater, der schweigend in Richtung bulgarischer Grenze fuhr, das Schmiergeld für den Grenzbeamten bereits hinter die Sonnenklappe geklemmt, ihr nicht eine größere Strandschaufel kaufen könne. Nicht so eine aus Plastik, die sie ja bereits hatte, sondern eine richtige, eine aus Metall – damit müsste es doch zu schaffen sein, die zwei Dutzend Australierköpfe auszugraben.
«Ayla!» Ihre Mutter drehte sich zu ihr um. «Glaub doch nicht alles, was Großvater Mesut dir erzählt!»
Er sei 1915 sicher kein Soldat des großen Kemal Atatürk gewesen. Er habe auch sicher niemandem den Kopf abgehackt. Erstens stelle Großvater sich ja schon blöd an, wenn es die Hühner zu köpfen galt. Zweitens sei er damals noch gar nicht geboren gewesen. Drittens seien diese Köpfe, wären sie tatsächlich von irgendjemandem abgehackt und begraben worden, längst in sich zusammengefault und die Schädelknochen über die Jahre vom Sand zerrieben worden.
Vater brummte.
Hava schaute wieder nach vorne, da ihr bei der Hitze im Auto immer schlecht wurde.
«Dann sind die Knochen jetzt wohl Muscheln», antwortete Ayla trotzig. Sie hatte längst beschlossen, Großvater Mesut immer zu glauben, ganz egal, was ihre Mutter sagte. «Australiertotenkopfmuscheln!»
Schon auf dem Heimweg nach Deutschland zählte Ayla die Tage, bis sie im Sommer darauf wieder in die Berge Anatoliens zurückkehren würden. Dreihundertdreißig waren es. Nur an Schaltjahren, da waren es dreihunderteinunddreißig.
Sie dachte auch an die Abschiedsworte, die Großvater ihr jedes Mal aufs Neue mit auf die Reise gab: «Ayla, das Leben ist ein Kinderspiel, wenn du es als Abenteuer begreifst, als schönen Traum, in dem du selbst bestimmst, was wahr ist und was geflunkert.»
Sie schaute zum Fenster hinaus, die trockenen Hügel nahe Edirne, im Länderdreieck aus Türkei, Bulgarien, Griechenland, zogen an ihnen vorbei, die Sonnenblumen, die Weizenfelder. Manchmal überholten sie ein Kleinmotorrad oder einen Bauern, der sich auf einem Karren von seinem Esel ziehen ließ. In all diesen Ländern brannte die Sonne unaufhörlich vom Himmel, brachte die sandigen Farben zum Flimmern. Ja, so musste es gewesen sein, als Großvater Mesut in der großen Wüste Afrikas halb verdurstet auf einen Beduinenstamm gestoßen war.
Wenn Aylas kleiner Bruder Yasin auf der Rückbank neben ihr einschlief und Vater den Mercedes E-Klasse aus Versehen in ein Schlagloch lenkte, schlug die Schläfe des Jungen gegen die Tür. Dann stöhnte Yasin im Schlaf auf.
Wenn sich ein Schlagloch an das nächste reihte, setzte sich Ayla dicht neben ihren Bruder und legte ihre Hand zwischen seinen Kopf und die Autotür. Damit die Stöße ihn nicht weckten, damit ihre Hand sie dämpfte.
Wenn es sein musste, hielt sie ihre Hand stundenlang so. Auch noch, wenn ihre Fingerknöchel bereits rot anliefen. Auch noch, wenn sie irgendwann spürte, wie sich der verdrehte Oberarm verkrampfte. Ein stechender Schmerz. Dann Taubheit.
«Mama, warum leben wir in Deutschland?», hatte Ayla einmal gefragt, als sie beinahe schon wieder zu Hause waren. Den See entlangfuhren, in dem sich der Halbmond spiegelte. Ihre Mutter hatte nicht geantwortet.
«Baba?»
Ihr Vater hatte nur gebrummt. Wie immer.
Sie fragte nicht weiter. Und nie wieder. Aber irgendwie hatte sie damals schon gespürt, dass nicht nur das Leben ihres Großvaters Mesut nicht so verlaufen war, wie er es sich erträumt hatte. Sondern dass auch ihre Mutter Hava tief in sich drin unglücklich war.
Erster Teil
Großvaters Welt
1945–1969
Der schöne Mesut lebte immer schon in seinem kleinen Dorf im Hochland Zentralanatoliens. Er war von recht großer Statur, hatte eine ungewohnt helle Haut, eine kantige Gesichtsform, die blauen Augen leuchteten. Der Schnauzbart war grazil geschwungen und an den schmalen Enden kunstvoll nach oben gezwirbelt. Von der Sonne beschienen, schimmerte Mesuts Haarpracht beinahe blond. Er trug meist eine dunkelblaue Schiebermütze, einen dunkelgrauen Dreireiher aus Flanellstoff, eine dazu passende Hose und ein weißes Hemd, das, ja, durchaus ein paar Flecken aufwies, aber deutlich weniger Flecken als die Hemden all der anderen Männer im Dorf.
Mesuts schlanke Beine steckten in Reiterstiefeln, obwohl er noch nie auf einem Pferd gesessen hatte. Nur auf Eseln. Und einmal, als Mutprobe, ein paar Sekunden lang auf dem knochigen Rücken eines Büffels, dem das gar nicht gefallen hatte.
Die Soldatenreiterstiefel, Schuhwerk der Kavallerie, hatte der junge Mesut von einem greisen Händler auf dem Markt von Isparta erhalten. Für eine Kiste voller Zuckerrüben. Eine ganze Kiste voll! Aber der Tausch hatte sich trotzdem gelohnt, weil der alte Veteran die Rüben längst gegessen hatte, Mesut die Stiefel aber immer noch trug. Jeden Tag. Selbst im Hochsommer, wenn er schwitzte wie ein übergewichtiges Wiesel und der Schweiß zwischen den in den Stiefeln steckenden Zehen sickerte.
Burdur lag rund tausend Meter über dem Meer. An einem großen Salzsee, der jedoch Jahr für Jahr ein klein wenig schrumpfte, an dem nichts wuchs, nichts lebte, weil das Salz alles pflanzliche und tierische Leben zerfraß.
Am hintersten Ufer des Sees und dann noch weiter die Ebene in Richtung der Berge hinein, lag irgendwann, irgendwo Mesuts Dorf. Seine Welt. Von Burdur aus brauchte man mit einem Eselskarren etwa zwei Stunden bis dahin. Erreichte ein Ankömmling samt Esel und Karren die ersten Häuser, so lief ihm sofort eine Schar Kinder entgegen. Um dem erschöpften Tier Wasser zu geben und es mit Grasbüscheln zu füttern.
Nahe der ersten Häuser führte ein Fluss die Wiesen entlang, an dem die Frauen sich versammelten, um zu waschen. Im Zentrum des Dorfs, an der Hauptstraße, gab es einen Brunnen, daneben lag ein großer Stein mit unentzifferbaren Schriftzeichen. Antik, vermuteten die Männer im Dorf. Auch die Moschee und das Bürgermeisterhaus lagen an der Hauptstraße. Daneben gab es ein Kahve, eine Teestube, vor und in der sich die Männer trafen. Die Frauen hatten da nichts verloren, wollten da auch nichts verloren haben, wollten noch nicht einmal vorbeilaufen, die Blicke nicht spüren, das Gemurmel nicht hören. Wenn die Männer nach Hause kommen sollten, wurden die Kinder geschickt, um sie zu holen.
Erdem, der Bürgermeister, hatte drei Mitarbeiter – und er hatte Yavuz. Yavuz war so eine Art Dorfwärter. Gab es Streit, rief man ihn. Zudem patrouillierte er mit einer Schrotflinte durch die Straßen. Hauptsächlich um streunende Hunde, die Anzeichen von Tollwut zeigten, zu erschießen.
In einem der naheliegenden Seitenwege befand sich der kleine Laden des Eisenwarenhändlers Tunçay, der hauptsächlich gebrauchtes Werkzeug verkaufte. Nicht weit davon stand die Werkstatt des Schreinermeisters Ismet, der auch sonst ganz geschickt bei Handwerksarbeiten war. Auch der Laden von Taner, dem Barbier. Die Mühle von Osman, dem Müller, lag abseits, in Richtung des Sees. Sie hatte früher einem Armenier gehört, doch die Armenier waren vertrieben worden, was alle zu vergessen versuchten. Es gab auch einen Sensenschleifer, Ümit, der zudem Pfannen mit Zinn beschichtete. Einen Arzt gab es nicht, nur einen Zuckerbäcker, Cengiz, der in Notfällen auch als Zahnarzt fungierte. Der auch, weil er sich recht geschickt anstellte, manchem im Dorf zumindest die nötigen Spritzen setzen durfte.
Mesut und seine Familie waren, wie alle anderen, Bauern. Sie besaßen Felder, die bis zu den felsigen, glatten, rutschigen, mancherorts moosbewachsenen, mancherorts mit Disteln überwucherten Bergrücken reichten. Das Land wurde mit der Hilfe von Tagelöhnern und Ziegenhütern bewirtschaftet, die aus den Bergen heruntergekommen waren, weil sich das Ziegenhüten nicht mehr lohnte. Bei den Felsen ließen sich manchmal wilde Tiere blicken. Wildschweine, ab und an auch ein Luchs. In den Höhlen und Spalten nisteten Störche. Sonst? Gab es nichts. Nur Staub, so viel Staub.
Die Sommer in Mesuts Welt waren alle ausnahmslos heiß und trocken, und manchmal schien der Wind sich einen Spaß daraus zu machen, nachmittags heftig aus allen Richtungen gleichzeitig zu wehen.
Im Winter war es windstill, die klirrende Kälte trotzdem unerträglich. Selbst die Sonnenstrahlen schienen von Dezember bis März schlechter Laune zu sein und eisig und schadenfroh auf die Bewohner des Dorfes hinabzustechen. Die Kälte drang in den Stoff der Kleider, schien sich darin zu verfangen, sich festzukrallen. Es war wie verhext, sie war daraus monatelang nicht mehr herauszubekommen, selbst aus Soldatenreiterstiefeln nicht – beinahe wie böse, aus rauchlosen Feuern entsprungene Dschinns, die in manchen Menschen hausten.
Wenn der Regen sommers wie winters ausblieb, färbte sich das Gras gelb und die Stoppeln wurden hart wie Zahnstocher.
Regnete es doch ab und an, dann so, als hätten die in den Wolken sitzenden Erzengel alle Wasserschleusen geöffnet. Fluss und Brunnen liefen über. Die Wiesen wurden zu Matschmooren und die Hauptstraße, die durch das Dorf in noch kleinere, abgelegenere, noch höher in den Bergen liegende Ziegenhirtenweiler führte, zu einem reißenden Gewässer.
Die meisten der Häuser in Mesuts Dorf hatten zwei Räume: eine Küche mit offenem Kamin und ein zweites Zimmer, in dem tagsüber gegessen und nachts geschlafen wurde. Auf dem Boden lagen mit Schafswolle gefüllte Matten; wenn niemand darauf hockte oder lag, wurden sie in Wandschränken verstaut. Öllampen spendeten Licht.
In vielen der Häuser lebten Großfamilien, die oftmals generationsübergreifend mehr als ein Dutzend Seelen zählten. Sobald es die Temperaturen zuließen, fand das Leben draußen statt.
Die Mauern der Häuser bestanden aus einem Lehmgemisch, mit Schilf vom Fluss untermischt. Die Dächer waren aus Torf und ebenso aus Schilf. Das Gebälk, die Türen und Fensterrahmen aus Birkenholz aus einem Hain zwischen den Feldern, der dereinst von einigen Urahnen gepflanzt worden war. Dort, so erzählten es die Alten den Kindern, hausten die Dschinn, die darauf warteten, in einen von ihnen zu kriechen, sich zwischen Herz und Leber einzunisten.
Auf den Wiesen vor den Häusern blühte Löwenzahn und wucherten Disteln. Da standen vereinzelt auch Aprikosenbäume, Mandelbäume, Maulbeerbäume, Mirabellenbäume und Kastanienbäume.
In jedem Garten befanden sich jeweils auch ein Plumpsklo – und ein Stall für die Büffel und Kühe, die Hühner, die Truthähne. Manche der Dorfbewohner, die nicht besonders geruchsempfindlich waren, hatten Klo und Stall nahe der Hausmauer errichtet, damit die Wärme des Viehs und der Mist die Zimmer mitwärmten. Die geruchsempfindlicheren Dorfbewohner hatten beides weit weg platziert, an den Lehmmauern, die an die Nachbargrundstücke angrenzten.
Die Büffel und Kühe? Waren gutmütige und brave Gesellen. Hahn und Hühner? Mal so, mal so. Schon als kleiner Junge hatte Mesut vermutet, ihr Protest – lauthals gackernd im Lehmhaus herumlaufend, herumflatternd – richtete sich dagegen, dass sie nicht mit im Haus leben durften. Zumindest offiziell nicht, inoffiziell taten sie es eh. Eines der Hühner schlief beinahe jede Nacht auf seinem Bauch.
Um das gesamte Dorf herum hatten die Bewohner Gärten angelegt. Mit Beeten, in denen Tomaten, Gurken, Bohnen, Auberginen und Zucchini wuchsen. Auch Reben standen da, die köstliche, süße Tafeltrauben trugen.
Hinter dem Birkenhain lagen schließlich die Felder. Die Bauern bauten Kichererbsen, Weizen, Roggen, Mais und Mohn an. Vor allem Mohn. Sehr viel Mohn. Von Jahr zu Jahr mehr. Das borstige Hahnenfußgewächs mit den zartroten Blütenblättern war mit so manchem Schicksal im Dorf verbunden. Auch mit Mesuts.
Mohnsamen gab es zu allem und jederzeit, als Aufstrich, Öl oder Blätterteigfüllung. Doch die von Osmans Mühle am Waldrand zerriebenen Samen waren das eine, die Milch der Knospen etwas ganz anderes – viel Kostbareres. Im Mai, wenn die Knospen ein saftiges Dunkelgrün trugen, gingen die Männer mit ihren Hilfsarbeitern im Morgengrauen auf die vom Tau überzogenen Felder.
Sie schlitzten die Knospen mit kleinen Messern auf, ein süßlicher Duft entströmte, eine weiße, harzige Flüssigkeit quoll hervor. Gut zweihundert Milliliter Mohnmilch gab jede Knospe her. Die Milch wurde fest, zu einem kaugummiartigen Gemisch, und nach zwei Stunden zu zuerst braunen, dann schwarzen Klumpen. Die Klumpen wurden von Männern, die in großen Autos und mit finsteren Mienen in die Dörfer kamen, abgeholt. Männer von der Regierung, hieß es. Die Klumpen kämen nach Afyonkarahisar, einer Stadt, zwei Eselskarrentage weiter nördlich, hinter den Bergen. Dort stünden Fabriken, die daraus Morphium für die Pharmaindustrie herstellten. Die Bauern stellten keine Fragen. Sie bekamen gutes Geld.
Nur hin und wieder versteckte jemand einen Klumpen, verkaufte ihn – heimlich, unter der Hand – auf dem Markt, wo auch der Aufstrich und das Öl feilgeboten wurden. An irgendwelche noch finsterere Gestalten, die noch mehr boten als die Staatsgesandten. Die, so hieß es, die Klumpen an die Küste schmuggelten. Nach Antalya, Izmir, Istanbul. Oder nach Europa. Sogar nach Amerika. Die Amerikaner, so hieß es, waren ganz verrückt nach dem Opium aus den Mohndörfern in den anatolischen Bergen.
Was manche Bauern für sich selbst zurückhielten, lagerten sie wiederum in tiefen Erdlöchern hinter den Häusern. Manche der Männer in Mesuts Dorf, die gerne ein paar Stunden zu viel in der Teestube verbrachten, sich nach dem letzten Ruf des Muezzins dort noch beim Okey-Spielen vergnügten, reichten zu mitternächtlicher Stunde eine Pfeife mit den erhitzten braunen Mohnmilchklumpen herum. Einer holte stets eine Saz hervor, spielte beinahe vergessene Melodien.
Je öfter die Männer an der Pfeife zogen, je mehr Rakı sie tranken, je tiefer die Nacht – desto waghalsiger wurden die Okey-Einsätze. Obwohl das laut Koran eigentlich haram war – verboten. Deshalb spielten sie am frühen Abend verstohlen meist nur um ein paar wenige Kuruş. Bei nahendem Sonnenaufgang, kurz bevor der Muezzin schon wieder zum Aufstehen rief und sich die Übriggebliebenen – nur ein letztes Spiel noch! – langsam zur Heimkehr aufmachten, soll der Legende nach einmal ein fußballfeldgroßes Zuckerrübenfeld von einem opiumrauchenden Teestubenhocker an Mesut übergegangen sein, der damals noch ein ganz junger Bursche gewesen war. Junggeselle – und am Beginn seiner eindrucksvollen Karriere als sehr ausdauernder nächtlicher Teestubengast.
Gerade erst erwachsen geworden, hatte Mesut von seinem kranken und arbeitsunfähigen Vater die Familienländereien übernommen. Er hatte, auf welchem Weg auch immer, ein fußballfeldgroßes Ackerstück dazuerwirtschaftet.
«Bau Mohn an, Mesut, viel Mohn!», rieten ihm die anderen Bauern im Dorf.
Doch der schöne Mesut machte sich nichts aus dem Hahnenfußgewächs. Er beließ es bei den Rüben, beim Weizen. Bei so etwas konnte er ein sturer Bock sein.
«Nimm mal einen Zug von der Pfeife, Mesut, jetzt mach schon!», drängten ihn die Männer beim mitternächtlichen Okey-Spiel. Er lehnte ab. Immer und immer wieder.
Nur einmal hatte Mesut ein paar Züge von dem Zeug probiert. Es war ein früher Morgen nach einer seiner ersten durchzechten Nächte in der Teestube gewesen.
Als er tags darauf am späten Nachmittag aus Träumen erwachte, die von Wildschweinen mit Drachenköpfen gehandelt hatten, die an der Küste der Dardanellen von australischen Soldaten auf ihn gehetzt worden waren, schmerzte Mesuts Kopf so sehr, als habe ihn jemand, ein Australier wohl, mit einem Beil entzweigehackt.
Seine trockene Zunge hatte am trockenen Gaumen geklebt, er musste sich mit den Fingern in den Mund fahren, mit einem festen Ruck an der Zunge ziehen, die sich nur unter großen Schmerzen löste.
Drei Tage lang dröhnte ihm der Schädel. Vier Tage lang schmerzten Gaumen und Zunge. Fünf Wochen lang mied Mesut die Teestube vollends, sechs weitere Wochen des Nachts, siebzehn Wochen lang ging er zwar wieder hin, trank jedoch noch nicht einmal seinen geliebten Rakı. Stattdessen Ayran.
«Ich baue doch nichts an, was mir den Kopf zerbricht», sagte sich Mesut von da an. Er blieb lieber bei seinen eineinhalb Schachteln Maltepe. Und spielte Okey. Ohne Opium. Nur mit Rakı intus – was manch einen der anderen Okey-Spieler durchaus verstimmte.
Doch die Wogen glätteten sich alsbald, es wurde entschieden: Jeder durfte sich benebeln, wie er wollte und womit er wollte, und es wurde weitergespielt und weitergeschimpft, über das, worüber man sonst auch stets schimpfte. Meistens über die Griechen, die wildgewordenen Truthähne, die stechende Wintersonne, den Wind und den Staub.
Mesut schimpfte kräftig mit. Am meisten schimpfte er, wenn wieder einmal eines der Großereignisse anstand.
Die fand er am schlimmsten. Zuckerfest, Opferfest. Aber vor allem Begräbnisse, Beschneidungen, Hochzeiten. Mesut zechte damals, mit scheinbar unversiegbarer, jugendlicher Freude und Ausgelassenheit, beinahe jeden Abend in der Teestube. Er war es, der stets als Erster wippend in die Knie ging, mit den Fingern schnippte, dann die Arme ausbreitete, sich beim Zeybek tanzend zujubeln ließ. Wie er das genoss!
Bei Großereignissen jedoch stand nicht er im Mittelpunkt, sondern die Toten, die Beschnittenen, die Bräute. Das konnte Mesut gar nicht leiden. Außerdem – und das störte ihn beinahe noch mehr – versuchten sich bei diesen Anlässen auch jene biederen Dorfgestalten zu amüsieren, die sonst fleißig auf den Feldern arbeiteten und abends früh auf ihren Schlafmatten lagen, die Teestube zur nächtlichen Stunde mieden. Jene, die über die Rakı-Nasen, Opiumraucher, Okey-Zocker die Nasen rümpften. Jene sonst so pflichtbewussten Amateurtrinker, die nun, da sie einmal, ausnahmsweise über die Stränge zu schlagen gedachten, nicht kapierten, wann es genug war. Die nicht bemerkten, wann sich der Abgrund in ihnen auftat.
Am allerschrecklichsten, so empfand es Mesut, waren die drei Tage andauernden Hochzeiten, auch wenn er zähneknirschend verstand, dass nun mal jeder und jede verheiratet werden musste. Ob der oder die nun wollte oder nicht. Weil sonst ja alles in sich zusammenbrach. Das ganze Gefüge. Das bisschen Ordnung, das es brauchte, damit im Dorf alles seiner Wege ging.
Mit Ende zwanzig traf es schließlich auch Mesut. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Das Hirtenmädchen aus den Bergen, das auf den Feldern des Nachbarsbauern bei der Rübenernte aushalf, hatte ihm auf den ersten Blick den Kopf verdreht.
Sie starrte ihn aus schwarzen Augen an, trug schwarzes Haar, das unter dem verrutschten Kopftuch hervorschaute. Mesut, der sich sonst möglichst selten auf den Feldern herumtrieb, der seine Arbeiter einfach machen ließ, war nun von früh bis spät dort. Wenn sich ihre Blicke trafen, von Tag zu Tag immer öfter, formte sie die Lippen zu einem frechen Lächeln; und da war ihm klar, dass sie das Mädchen war, auf das er gewartet hatte. Und die, schlau wie sie war, ihm durchaus ihre Zuneigung gestand, ihn aber noch zwei Sommer hinhielt.
Er liebte es, alsbald mit ihr abends noch in den Feldern zu liegen, der feuerroten Sonne hinter den Bergen beim Verschwinden zuzusehen, ihr seine Geschichten zu erzählen. Sich ihre anzuhören. Er erzählte ihr von seinem früheren Leben als Sternenräuber auf einer fassgroßen Insel mitten im Marmarameer. Sie erzählte ihm von ihrem zukünftigen Leben als Sultanin auf einer fernen Sternschnuppe, die in Richtung Erde schwebte. Er liebte es, im Dunkeln schließlich, ihre Hand zu ertasten, sie zu drücken, sie mit diesem Drücken, wenn es irgendwo raschelte, wenn irgendwo ein Goldschakal oder eine tollwütige Wildkatze jaulte, wissen zu lassen, er würde sie bis aufs Blut verteidigen.
Nach siebenundzwanzig Monden küsste sie ihn. Ihr Name war Efsane, die Sagenumwobene.
Mesuts kranker und alter Vater und seine ebenso alte, jedoch noch rüstige Mutter waren einverstanden, dass ihr Sohn das Hirtenmädchen auserwählte. Sie waren klug genug, zu wissen, dass eine verwehrte Liebe das Unglück aller heraufbeschwor. Solch eine Ansicht war äußerst selten im Dorf.
Die Eltern des Mädchens stimmten der Ehe ebenfalls zu. Ein Schwiegersohn wie Mesut kam für die Ziegenhüter aus den Bergen einem Hauptgewinn gleich. Der große, schöne Auserwählte mit den leuchtend blauen Augen, den in der Sonne blond schimmernden Haaren und den beinahe fleckenlosen weißen Hemden hatte zwar nicht viel Geld – viel Geld hatte damals niemand im anatolischen Hochland –, aber da waren dieser anschauliche Ackergrund, die acht Büffel, sechs Kühe, rund ein Dutzend Hühner, drei Esel, zwei Schafe. Und es gab da auch noch zwei Dutzend Ziegen. In den Bergen. Das traf sich doch ganz wunderbar, das passte perfekt. Die würde er von nun an wohl ihnen zur Obhut geben. Und vielleicht noch etwas dazu. Decken oder gar einen Holzschrank.
Efsane versicherte Mesut, ihn nicht um der Äcker willen heiraten zu wollen. Auch nicht wegen der Ziegen und der anderen Viecher. Er zweifelte keine Sekunde daran, dass sie die Wahrheit sprach. Und nachdem Mesuts Familie bei Efsanes Verwandten offiziell mit kostbaren Süßspeisen – Halva, Lokum, weißem Nougat –, wie es die Tradition verlangte, vorstellig geworden war, stand dem Vorhaben nichts mehr im Wege.
Die eigene Hochzeit, erzählte Mesut später, sei die einzige der unzählig erlebten gewesen, die er von der ersten Sekunde bis zur letzten genossen hatte. Seine Angetraute glaubte ihm kein Wort. Da sie im mohnroten Kleid und mohnroten Kopftuch noch ein bisschen bezaubernder strahlte als er. Da das Dorf sie doch ein kleines bisschen mehr bewundert hatte als ihn. Und Mesut, eitel wie er war, hatte das sicher bemerkt, es sich aber, so viel Contenance besaß er, nicht anmerken lassen.
Nach der Hochzeit beschloss der frisch Getraute zwei Dinge. Mesut wollte ein guter Ehemann sein, deshalb versuchte er, dem Rakı zu entsagen und überhaupt weniger in der Teestube in der Dorfmitte rumzuhängen. Besonders nachts. Er schaffte es. Sechs Monate lang. Dann einigte sich sein gutes Gewissen mit dem schlechten zu einem Kompromiss. Teestubenbesuche tagsüber? Nur noch drei Mal pro Woche. Zu später Stunde? Nur noch einmal im Monat. Rakı? Nur noch so viel, dass er, ohne Kurven zu schlagen, nach Hause gehen konnte. Also höchstens fünf am Stück.
Zweitens nahm sich Mesut vor, für seine zukünftige Familie ein eigenes Lehmhaus zu bauen. Weil das seiner Eltern ihm für sie allesamt nun doch zu klein erschien. Und weil Mesut nicht nur ein schöner und eitler, sondern auch ein stolzer junger Mann war, beinahe so stolz wie manche der Frauen, die sich am Fluss trafen, sollte sein neues Haus das schönste im Dorf werden. Und das größte. Beinahe so groß wie die Häuser in den Städten an der fernen Mittelmeerküste.
«Fünf Kinder sollen wir haben, Efsane», bestimmte Mesut, «mehr nicht.»
Fünf war gut. Fünf war wenig. Wenig war modern. Mesut wollte modern sein. Er selbst hatte elf Geschwister, davon lebten noch vier. Ein Bruder war bei Holzarbeiten im nahen Birkenhain verblutet, einen hatte der Blitz erschlagen, einer war auf dem Viehmarkt in Burdur einem wildgewordenen Ochsen zu nahe gekommen, zwei Schwestern waren kurz nach der Geburt gestorben.
Fünf Kinder. Moderne Kleinfamilie. Ja, so sollte es sein. Wobei Mesut sich natürlich eher Söhne als Töchter wünschte. Stammhalter!
Ja, er wollte für seine zukünftigen Söhne das schönste und größte Haus im Dorf bauen. Ein Haus mit einer Küche, einem Weizenlager, fünf weiteren Zimmern und einer Holzveranda, die alles miteinander verband.
Einmal hatte er sogar an zwei Küchen gedacht. Es wäre das einzige Haus im ganzen Dorf mit zwei Küchen gewesen. Wahrscheinlich gab es noch nicht einmal in Burdur ein Haus mit mehr als einer Küche. Dann aber, nach drei schlaflosen Nächten, hatte er die Idee verworfen. Zwei Küchen. Er war größenwahnsinnig, das war ihm stets bewusst gewesen, aber das war dann doch zu viel. Verrückt.
Efsane liebte Mesut sehr. Manchmal, so glaubte er, fast so sehr, wie er sie liebte. Er spürte: Sie liebte ihn mit allen seinen Fehlern. Niemand kannte ihn so gut wie sie, niemand außer ihr verstand, dass er im Herzen ein Träumer war. Er träumte so gerne mit ihr zusammen. Manchmal träumten sie davon, ans Meer zu fahren, ein Boot zu stehlen, bis zum ewigen Eis zu segeln, mit einem Pinguinmännchen und einem Pinguinweibchen zurückzukehren. Ihnen Kunststücke beizubringen. Als Zirkusleute durch die Welt zu streunen.
Manchmal sagte sie ihm aber auch, dass er ihr ziemlich auf die Nerven ging. Als ihr Lehmhaus ein Jahr nach der Hochzeit immer noch nicht fertig war, das große Dach wollte einfach nicht halten, sagte sie es ihm fast täglich. Efsane war eine Frau der Tat, Mesut war ein Mann der vielen Worte. Einige Monate lang hatte er tatkräftig am Haus gebaut, dann hatte er die Lust daran verloren.
Ihr, das hatte er verstanden, war egal, wie das Haus aussehen würde. Es musste nicht das schönste werden oder das größte. Sie wollte einfach nur, dass es nicht durch den Torf und das Stroh tropfte, denn sie bauten nun schon so lange daran. Und ihr Bauch war nun schon dick, so als würde sie eine Wassermelone unter ihrem weiten Umhang mit sich herumschleppen.
«Canım!», sagte Efsane zu Mesut. Mein Leben! So nannte sie ihn nur, wenn sie wieder einmal besonders wütend auf ihn war. «Wo sind die Feldarbeiter, die uns heute beim Hausbau helfen sollten?»
Wieder einmal stand an der Baustelle alles still.
«Du hattest mir versprochen, dass sie für ein paar Tage kommen.»
«Gülüm!», antwortete er. Meine Rose! Immer, wenn es galt, sie zu beschwichtigen, liebkoste er sie mit diesen Worten. Es funktionierte nie, aber sie rutschten ihm trotzdem wie automatisch über die Lippen.
Er gestand ihr, dass er zum Zeitpunkt des Versprechens, das er so sehr willens gewesen war einzuhalten, noch nicht wissen konnte, was ihm am Abend zuvor die anderen Männer im Dorf erzählt hatten. Nämlich, dass der Sohn von einem von ihnen am frühen Vormittag am Birkenhain, dort, wo die Straße aus dem Dorf hinausführte, einen Ring gefunden habe. Einen goldenen!
Der Ring musste tausend Jahre alt sein. Mindestens. Das hatte Tunçay gesagt, der Eisenwarenhändler, dessen Urgroßvater ja Schmied gewesen war. Hufeisenschmied zwar, aber bitte, vom Fach.
Und Ismet, der Schreinermeister, der habe als Kind doch stets diese alten Geschichtsbände gelesen, über die dummen Griechen und die lauten Römer und die hinterlistigen Eunuchen und die blutrünstigen Hunnen – und der hatte doch immer schon geahnt, dass sich eine der Seidennebenstraßen direkt hier durchs Dorf langgezogen haben musste. Bis nach Indien, wo – was Mesut zumindest hoffte – sich das Ende der Welt befand. Weil so ein Ende der Welt viel spannender und aufregender war als eine langweilige Kugel.
«König Attila, der blutrünstigste der Hunnen, hat womöglich diesen Weg genommen, auch Alexander der Große», sagte Mesut, «das vermutet Schreinermeister Ismet.» Seine Augen leuchteten spitzbübisch. «Ach, was heißt womöglich, was vermuten, Efsane, du blühende Rose», jauchzte Mesut weiter, «sicher war er sich! Wie sollte es denn auch sonst gewesen sein? Das erklärt auch den antiken Stein am Brunnen.»
Er tat nicht länger nur so, Mesut glaubte nun tatsächlich fest daran: Warum sollte am Birkenhainrand denn sonst so ein tausend Jahre alter Ring liegen, wenn der nicht von den Hunnen oder den Makedoniern als Teil eines großen Raubschatzes vergraben worden war, die nach einem ihrer Raubzüge im Westen auf dem Rückzug waren.
«Canım!», ertönte ihre ernste Stimme, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholte.
«Ja, Rosensträußchen?»
«Wo sind unsere Feldarbeiter?»
Mesut wäre so gerne wieder in seine Phantasiewelt abgetaucht, er hätte so gerne noch ein klein wenig ausgeholt, stattdessen erklärte er seiner geliebten Efsane, dass er die Männer tatsächlich zum Hain geschickt habe. Mit Spaten und Schaufeln. Um nach dem Schatz zu suchen. Der würde sie beide schließlich noch glücklicher machen, als sie eh schon waren. Er konnte es gar nicht erwarten, wie es sich anfühlen würde, noch glücklicher zu sein. Wie aufregend.
«Canım!, genug jetzt!»
Efsane verzog das Gesicht – und war auch so immer noch wunderschön. Diese schwarzen Augen, das schwarze Haar. So verzaubernd schön war sie, dass Mesut Attila und Alexander, oder wen auch immer, zum Schwertkampf herausgefordert hätte, um deren Schatz zu erlangen. Und ihr den wertvollsten der darin befindlichen Ringe zu schenken.
«Mein Rosengarten, was ist?»
«Das Haus! Und der Bauch! Alles zieht, das Baby, es zappelt, es zerrt. Der Bauch wird bald leer sein, unser Kind da, aber unser Heim noch nicht!»
«Mein Sohn!», schrie er. «Mach dir keine Sorgen, mein Röschen, mein Melonenbäuchlein, m… mein … «, stammelte er.
«Canım!», flehte sie.
Als es endlich tatsächlich so weit war, in einer schwülen Sommernacht, nicht die Sache mit dem Haus, sondern die mit dem Melonenbauch, als die Wehen einsetzten, da schrie Efsane die Schmerzen durch das Loch in der Torfdecke zum Himmel hinauf, in dem die Sterne silbern glitzerten.
Als das Ziehen im Unterleib nicht mehr aufhören wollte, machte sich Mesut mit dem angerosteten Murat seines Nachbarn Tarkan, einem der ersten drei Autos im Dorf, angetrieben von einem Fiat-124-Ottomotor, auf den Weg in die Stadt. Mit der Hebamme in Burdur hatte er vor einem halben Jahr vereinbart, dass sie im Notfall zu Hilfe kommen sollte. Weil die Hebamme im Dorf bereits alt und gebrechlich und vergesslich war. Kaum noch einsatzfähig.
Als die Fruchtblase platzte und das Fruchtwasser in den staubigen Teppiche sickerte, war Mesut immer noch nicht zu Hause. Er stand am Straßenrand auf halbem Weg zwischen Burdur und seinem Bergdorf, schaute in den silbern blinkenden Sternenhimmel hinauf und verfluchte alle Völker der Erde und seinen Nachbarn Tarkan insbesondere, während die Hebamme verzweifelt versuchte, den geplatzten Reifen zu flicken. Von geplatzten Reifen nämlich hatte er genauso wenig Ahnung wie von geplatzten Fruchtblasen.
Als sie nach etlichen Stunden, die sich für Mesut wie Jahrhunderte angefühlt hatten, zurück waren, im Familienlehmhaus mit dem halb fertigen Dach, schaute auf dem nassen Teppich der kleine, mit nassen schwarzen Haaren bedeckte Kopf des Mädchens, das sie später Hava nennen würden, bereits aus Efsanes Unterleib hervor.
Die Hebamme war damit beschäftigt, Efsane und das Neugeborene zu versorgen. Nachbar Tarkan kümmerte sich indes um den furiosen Mesut, der sich dem Selbstmitleid hingegeben hatte. Darüber, dass sein Erstgeborenes ein Mädchen war. Darüber, dass, wenn es so weiterging mit seinem Pech, wohl auch bei den nächsten vier geplanten Kindern einige Mädchen darunter sein würden, zwei ganz sicher, zwei mindestens. Vielleicht drei oder alle fünf sogar.
Er lief, sich die langen, verschwitzten Haare raufend, die im Laufe dieser Schicksalsnacht grauer und deutlich weniger worden waren, um das Haus herum und verfluchte sämtliche Propheten, die ihm einfielen, die islamischen, die christlichen und ein paar, die er an Ort und Stelle erfand. Weil sie sich offensichtlich gegen ihn verschworen hatten.
Erst nach vier Wochen war die Wut verflogen – und Mesut schaute sich das kleine Geschöpf einmal genauer an. Ihr Gesicht, ihre kleinen, wurstigen Fingerchen, ihr Bäuchlein, ihre Waden, ihre hinter den schlitzförmigen Lidern hervorfunkelnden Äuglein. Schwarz, wie die der Mutter!
Mesut beschloss, Hava zu lieben. Mehr als alles andere in der Welt. Ihr zu unendlichem Glück zu verhelfen. Auch wenn er damals noch nicht wissen konnte, dass seine und ihre Vorstellungen von Glück irgendwann sehr weit auseinanderliegen würden.
Das Flüstern
Anfang der 1970er
Die ersten Frauen kamen mit den frühen Sonnenstrahlen an den Fluss. Sie setzten sich dorthin, wo der anbrechende Tag die Wiese langsam erwärmte. Sie hoben ihre schweren Weidenkörbe von den Schultern ins Gras, rasteten ein wenig, dann begannen sie mit der Arbeit, die sich über mehrere Stunden hinziehen würde. Die Frauen wuschen die Wäsche mit bloßen Händen, die das Wasser bald aufweichte. Ab und an setzten sie sich neben die Rinder, die es sich unter den nahen Mandelbäumen gemütlich gemacht hatten. Im Schatten war die brütende Hitze erträglicher.
An heißen Tagen versammelten sich auch die Katzen und Hunde des Dorfes an der Wasserstelle, weil dort die Erde feucht und kühl war.
«Katze müsste man sein», sagte immer irgendeine der Frauen.
«Oder zumindest ein Rindviech», sagte eine zweite.
Und schließlich lachten sie alle zusammen. Und dieses gemeinsame Lachen, das hatte Hava als dreizehn-, vierzehnjähriges Mädchen schon gespürt, aber natürlich erst viel später wirklich verstanden, war einer jener kleinen Glücksmomente im Leben, die man Tag für Tag genießen musste. Denn auf das ganz große Glück, auch das hatte Hava irgendwann gelernt, lohnte es sich nicht zu hoffen.
«Irgendwann werden sie geschlachtet, unsere Rinder, aber zumindest müssen sie vorher nicht schrubben und kochen», sagte wieder eine. Und wieder lachten alle.
Draußen vor dem Dorf, da trauten sich die Frauen über Dinge zu sprechen, die drinnen, zwischen den Lehmhäusern, nahe der Teestube und der Moschee und dem Amtssitz des Bürgermeisters niemals gesagt werden durften. Weil die Häuser und die Moschee und der Amtssitz Ohren hatten. Männerohren. Weil die Männer nicht wollten, dass die Frauen tratschten. Zumindest offiziell nicht.
In Wahrheit war es natürlich anders. In Wahrheit war immer alles anders, wie wohl überall auf der Welt, dachte Hava, obwohl sie von der Welt noch nichts gesehen hatte. In Wahrheit warteten die Männer nur darauf, dass die Frauen ihnen abends davon erzählten, was sie am Wasser Neues erfahren hatten. Und die Frauen fragten die Männer, was auf den Feldern und in der Teestube berichtet wurde.
Nicht alle Frauen wuschen am gleichen Tag. Dafür hätte der Platz niemals gereicht. Und das wäre auch aus einem anderen Grund ungünstig gewesen: Weil es sich dann schlecht hätte tratschen lassen. Weil stets nur über die Männer und Söhne und Töchter der Frauen getratscht wurde, die am entsprechenden Tag nicht da waren. Um des lieben Friedens willen. Sonst wären sie ja jede Woche und nicht nur alle paar Monate übereinander hergefallen. Wie die Katzen, die manchmal nachts, meist gegen Mitternacht, außerirdisch jaulend übereinander herfielen.
Die Frauen am Fluss tratschten über die Männer und Söhne und Töchter jener Frauen, die gerade nicht da waren – und wenn der Muezzin mittags rief, dann grinsten sie und tratschten sogar über ihn. Und zwar darüber, dass der neue, junge Muezzin, der vor nun schon vor zwei Monaten von Antalya ins Dorf beordert worden war, seine Aufgaben in der Moschee zwar zur Zufriedenheit aller bewerkstelligte, dass sein fünfmaliger Ruf zum Gebet allerdings kaum vom Krächzen eines jungen Hahns kurz vor dem Stimmbruch zu unterscheiden war.
Ihm fehlte das engelsgleiche Timbre seines Vorgängers, der ehemalige Muezzin, der im Winter an einer Lungenentzündung verendet war. So wunderbar hatte er gerufen, dass die Frauen Wäsche und Wasserkrüge hatten liegen lassen, die Augen schlossen und sich von der himmlischen Stimme in Tagträume führen ließen, in längst vergangene Zeiten, als sie noch jung und schön waren wie ihre Töchter, die nun mit ihnen an den Fluss kamen. Als sie noch naiv daran glaubten, irgendwann würde ein junger Sultan sie besuchen, ihnen den Hof machen, um ihre Hand anhalten.
Am späteren Nachmittag trotteten die Hunde den Frauen hinterher ins Dorf zurück. Die Katzen warteten unterdessen am Fluss, bis alle weg waren, verstreuten sich dann stolzierend, wie nur sie es konnten, in alle Richtungen. Nur die Rinder blieben an den Mandelbäumen liegen oder grasten nicht weit davon.
Die Frauen gingen keuchend und gebeugt, die nasse Wäsche in Weidenkörben. Am Brunnen füllten sie noch die Tonkrüge mit Wasser, das sie fürs Kochen benutzten. Auch zum Baden. Einmal pro Woche. Heißes Wasser in einem Bottich. Zuerst badeten die Väter, dann die Mütter, dann, wenn das Wasser bereits von der Kernseife und dem abgeriebenen Schmutz trübe war, die Kinder. Nachts brannte die rote Haut vom Abschrubben mit dem Waschhandschuh aus roher Ziegenfellfaser, anfangs schmerzhaft, doch bald recht angenehm.
Schon die vierjährigen Mädchen mussten mit anpacken. Den Stoff am Stein schrubben, bis die Fingerkuppen bluteten, sich das Blut mit der Seife vermischte, mit den zierlichen Ärmchen tief in den Fluss greifen, die vom Wasser schweren Kleider herausholen.
Im Sommer war das kühle Nass Erfrischung. Manchmal, wenn die Mütter guter Dinge waren, durften die Mädchen in ihren Leinenkleidern sogar in den Fluss springen, darin herumplantschen. Im Winter war das Waschen der Kleider eine Tortur. Die einmal ins kalte Wasser getauchten Ärmchen färbten sich blau, wollten dann nicht mehr aufhören zu zittern, ebenso die blauen Lippen. Im Winter hatte es auch keinen Sinn, die nassen Kleider auf die Wiese zu legen. Im Winter waren die Wiesen kalt, alles war kalt. Manchmal lag sogar Schnee. Da mussten die vollgesogenen Kleider in den Körben wieder nach Hause getragen werden. Doppelt so schwer.
Im Winter lagen die Mädchen nachts wach, weil ihnen nicht nur die blutenden, aufgerissenen Fingerspitzen weh taten, sondern auch die Schultern. Die meisten der Mütter waren streng. Havas Mutter war es nicht. Wenn Efsane sah, dass ihre Tochter fror, dass sie die Kleider nur mit Fingerspitzen ins eisige Wasser tauchte, dann schimpfte sie nicht, sondern nahm Hava in den Arm, sang ihr leise eins ihrer liebsten Lieder vor, das vom Leben in einem Tal voller Schokoladenhäuser, wilder Pferde und Regenbögen handelte.
Schließlich wickelte sie Hava in eine Schafswolljacke ein, die sie erst ganz zum Schluss wusch. Den tadelnden Blick der anderen Mutter, deren Kinder weinend die Ärmchen ins kalte Nasse tauchten, schien sie einfach zu ignorieren – und setzte Hava an einen der Mandelbäume, drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Hava hatte mittlerweile zwei Schwestern, Sibel und Cemile, und auch zwei Brüder, Ilyas und Ibrahim. Sie lebten mit Vater und Mutter allesamt in der Küche und einem weiteren Raum, der gleichzeitig Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer war, im schönsten und größten Lehmhaus des Dorfes. An dessen Wänden hingen Teppiche, die Mesut von einem Händler in Burdur bekommen hatte. Für ein paar Säcke voller Kartoffeln. Auch eine rostige Büchse hing da, von der Mesut sagte, dass sie immer noch geladen sei – und dass er sie von einem sibirischen Jäger geschenkt bekommen habe.
Die anderen Zimmer? Blieben leer. Sie zu benutzen, kam weder in Frage noch jemals jemandem in den Sinn. Wozu denn auch?
Ein Raum zum Essen, einer zum Leben und zum Schlafen, für alle – mehr brauchte es nicht. Mehr hatte niemand. Mesut hatte die weiteren Türrahmen mit Birkenharz zugeklebt und irgendwann wohl beinahe vergessen, dass sie existierten. Sie waren für später gedacht. Ein Später, das niemals kam, da die fünf Kinder, als sie erwachsen wurden, heirateten, selbst Nachwuchs bekamen, allesamt nicht in dem Dorf in den Bergen leben wollten. Aber das konnte damals noch niemand wissen.
In der Dämmerung, wenn sich alle wieder in den Häusern einfanden, Mutter, Töchter, Söhne, Vater, beim gemeinsamen Abendmahl, Yufka, immer wieder das hauchzart gebackene Fladenbrot, gefüllt mit Ziegenkäse und Walnüssen, erzählte Efsane von den Gesprächen am Wasser, Mesut von denen auf dem Feld oder in der Teestube. Meistens von denen in der Teestube, obwohl er sagte, er habe das alles vom Feld erfahren. Dann dozierte er noch ein bisschen über die Weltpolitik, was stets darauf hinauslief, dass man Atatürk doch unendlich dankbar sein solle, da es ohne ihn keine Republik gäbe, dass die türkische Riviera samt Burdur und Umgebung ohne ihn womöglich den Italienern als Protektorat zugefallen wäre.
«Stellt euch nur vor, Kinder, dann wären wir Italiener», schimpfte Vater.
«Italiener», seufzte Efsane, manchmal eine Spur zu schmachtend.
«Das wäre beinahe so schlimm wie Griechen», schimpfte Mesut weiter, «dann müssten wir Spaghetti essen.»
«Immerhin haben uns die Italiener die Inseln nicht weggenommen», sagte Efsane dann allenthalben.
Darüber, dass der große Atatürk die Inseln nach dem Krieg abtreten musste, keiner konnte sagen, welches Zugeständnis sie gewesen waren, wurde nie gesprochen. Nein, darüber redete man nicht. Er wird schon Gründe gehabt haben.
Meistens schimpfte Mesut auch mit Hava. Immer nur mit Hava. Vielleicht weil sie die Älteste war, vermutete sie. Eher wohl, weil sie sich so ähnlich waren, auch wenn sie das beide nicht erkannten. Ähnlich stur. Ähnlich stolz. Ähnlich dem Schönen zugetan. Er schimpfte darüber, dass sie wieder einmal, ohne die Schuluniform gegen andere Kleidung einzutauschen, zum Fluss geeilt war. Ohne das Kopftuch aufzusetzen, das in der Klasse verboten war, außerhalb der Schule jedoch jedes Mädchen ab neun, zehn, elf Jahren trug.
Weiß. Oder mit Blumenmuster. Mit gehäkelten Spitzen an den Rändern und manchmal feinen Glasperlen daran. Die Mädchen trugen das Kopftuch mit Stolz. Sie eiferten ihren Müttern nach, die auch eines trugen. Sie, die Mütter, waren zwar Republikanerinnen, wie ihre Männer, aber doch nicht so fanatisch! Die Männer mussten immer übertreiben. Bei allem. Die Frauen übertrieben nicht. Sie suchten und fanden den Kompromiss, mit dem sie gut leben konnten. Sie trugen Kopftuch, aber locker, stets so, dass die Haare durchaus ein wenig in die Stirn fielen.
Auch Hava trug das Tuch gerne. Doch gleich nach der Schule vergaß sie es hin und wieder. Da war doch keine Zeit, es zu holen! Gleich nach Unterrichtsschluss lief Hava los, zum Dorf hinaus. Sie warf am großen Haus, in dem ihre Familie lebte, den Lederranzen mit den Büchern über die Lehmmauer, dann eilte sie die staubige Straße weiter. Weil sie die Stunden draußen am Fluss so sehr mochte, selbst im Winter.
«Das bekommst auch nur du hin, Hava! Da gehst du zum Kleiderwaschen und kommst dreckig zurück», schrie Vater, wenn sie abends nach Hause kam.
Die Kinder schnellten davon, obwohl er sie nie schlug. Kein einziges Mal. Hava konnte nicht sagen, warum. Ob er es falsch fand. Oder ob er zu stolz war, ihnen hinterherzueilen.
Wenn er noch wütender war als normalerweise, dann schrie er nicht, dann schwieg er – was das Schlimmste war. Er konnte tagelang schweigen. Er konnte schweigen, dass es schmerzte, mehr als Schläge es hätten tun können.
Schläge gab es in der Schule. Die Lehrer schlugen ständig zu, wenn auch bei den Mädchen nicht so oft wie bei den Jungen. Meistens mit einem dicken Holzlineal und gleich montags früh, wenn die neue Woche begann. Noch bevor die rote Flagge mit dem weißen Halbmond und dem Stern gehisst wurde, noch bevor die Hymne gesungen wurde, hatten die Kinder allesamt in Reih und Glied dazustehen, den Blick auf das Antlitz Atatürks gerichtet, das golden gerahmt neben dem Schuleingang hing. Sie mussten die Hände nach vorne halten.
Dann ging der Lehrer die Reihe entlang, kontrollierte. Die Fingernägel. Die Haare. Mädchen hatten sie in einem Zopfgeflecht streng nach hinten zu binden. Die der Jungen durften die fünf Zentimeter nicht überschreiten. Im Zweifel wurde mit dem Lineal, das auch zum Schlagen diente, nachgemessen. Die Schuluniform hatte sauber zu sein. Bei den Mädchen das schwarze Kleid mit dem weißen Kragen, die schwarzen Strümpfe. Bei den Jungen schwarze Jacken, weißes Hemd.
Die Wahl des Schuhwerks war frei. Manche Familien konnten sich nur Plastikschuhe leisten. Die Kinder trugen sie sommers wie winters. Rissen sie, wurden sie geklebt, solange es nur irgendwie ging. Hava trug Lederschuhe. Sie war, als die Älteste der Geschwister, in der vorteilhaften Situation, ab und an ein neues Paar vom Markt zu bekommen.
Sibel, die Zweitälteste, bekam in regelmäßigen Abständen Havas abgetragenes Paar, egal ob sie schon hineingewachsen war oder nicht. Cemile bekam jenes von Sibel, Ilyas jenes von Cemile, Ibrahim jenes von Ilyas. Nur manchmal, wenn das Schuhwerk über die Jahre schon so löchrig war, dass es ihm, dem Jüngsten, von den Füßen fiel, bekam auch er ein neues Paar, das Vater später auf dem Markt erneut verkaufte.
Waren die Schuhe den Kindern zu groß, steckten sie Kartonstücke hinein. Waren die Schuhe zu klein, gab es nichts, was man machen konnte. Außer die Zehen einzuziehen und den Schmerz zu ertragen.
Die rund sechzig Kinder des Dorfes waren in drei Klassen aufgeteilt. Eine für die jüngeren, eine für die mittleren, eine für die großen. Acht Jahre Schule, Grundstufe und Mittelstufe. Es gab Unterricht in Mathematik, Türkisch, Biologie, Sachkunde, Geografie, Heimatkunde. Und Sport – im Schulgarten. Religionsunterricht gab es auch. Manchmal. Es war eine ewige Diskussion, ob das nun erlaubt war. Oder nicht. Klar war, der Imam hatte, ebenso wie die Kopftücher, in der Schule nichts verloren. So hatte es Atatürk gewollt, ganz sicher!
Es gab nur Lehrer. Keine Lehrerinnen. In Burdur, so munkelte man im Dorf, soll es wohl die eine oder andere gegeben haben. Aber hier? Nein, den Landleuten, die von den Stadtleuten abschätzig Yörük genannt wurden, Halbnomaden, mochte man das wohl nicht zumuten. Manchmal wechselte der Herr Lehrer mehrmals im Jahr. Weil Lehrer Mangelware waren. Vor allem solche, die sich dazu bereit erklärten, in abgelegenen Schulen in den Bergen zu unterrichten. Die meisten waren sich zu fein dafür, empfanden sich als zu wichtig. Mochte sein, dass Atatürk das Wissen bis zu den letzten Gebirgsanatoliern bringen wollte, aber sie selbst waren doch dazu da, Stadtkindern etwas beizubringen, nicht zukünftigen Ziegenhütern. Viele der Lehrer in Havas Dorf waren demzufolge Strafversetzte, andere Pensionäre, denen für das Extrajahr in den Bergen nochmal ein Extragehalt versprochen wurde.
Strammstehen. Ruhender Blick. Bloß nicht lachen. Hoffen, dass der Herr Lehrer weiterging. Nicht allzu genau hinschaute. Manche der Jungen sangen die Hymne stets unter Tränen, mit vor Schmerzen zusammengebissenen Zähnen. Manchmal war der Dreck von der Feldarbeit einfach nicht unter den Fingernägeln hervorzubekommen. Da konnten ihre Mütter am Bottich im Hof schrubben, soviel sie wollten, so lange, bis die Kuppen bluteten. Da war nichts zu machen, da zitterten die Finger bereits, wenn der Herr Lehrer näher kam. Da war ihr Singen mit vor Schmerz zusammengebissenen Zähnen kaum zu hören.
Hava sang stets falsch, sie traf keinen Ton, doch sie sang laut, weil sie es so sehr liebte.
Getrost, der Morgenstern brach an,
im neuen Licht weht unsre Fahn’.
Ja, du sollst wehen,
solange ein letztes Heim noch steht,
ein Herd raucht in unserem Vaterland.
Du unser Stern, du ewig strahlender Glanz,
du bist unser, dein sind wir ganz.
Nicht wend’ dein Antlitz von uns,
oh Halbmond, ewig sieggewohnt.
Scheine uns freundlich
Und schenke Frieden uns und Glück,
dem Heldenvolk, das dir sein Blut geweiht.
Wahre die Freiheit uns, für die wir glüh’n,
höchstes Gut dem Volk, das sich einst selbst befreit.
Manchmal griffen die Lehrer nicht zum Lineal, sondern schlugen mit der offenen Hand zu. Meistens die Jungen im Hof, wenn die wieder einmal den ranzigen Lederball über die Lehmmauer geschossen hatten. Rüber zum Haus des Bürgermeisters. Da glühten danach ihre Wangen noch mehr als während der Fußballpartie. Und sie leuchteten noch roter als zuvor.
Die Mädchen durften nie Fußball spielen. Sie mussten währenddessen am Rande des Hofes Purzelbäume üben. Hava weigerte sich. Sie sagte, nein, das könne sie nicht. Sie schwor sich, nie im Leben einen Purzelbaum zu schlagen. Sie war