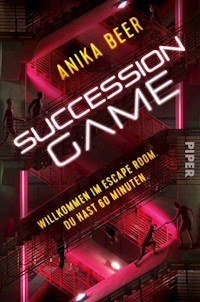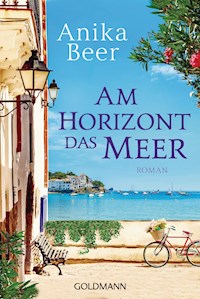
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit sie denken kann, träumt Sofia vom Meer. Von einer wilden Küste mit tosender Brandung. Woher diese Bilder kommen, weiß sie nicht, und ihre Großmutter Emilie weicht ihren Fragen nach der Vergangenheit immer wieder aus. Erst nach Emilies Tod findet Sofia eine Kiste mit Briefen aus einem Fischerdorf an der Costa Brava. Offenbar hat Sofia dort als kleines Mädchen einen Sommer verbracht. Fest entschlossen, das Meer aus ihren Träumen zu finden, macht sie sich auf den Weg nach Spanien – und auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit …
Ein Roman wie der Ozean: mal sanft, mal sturmgepeitscht und dabei voller Kraft und Tiefe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Seit sie denken kann, träumt Sofia vom Meer. Von einer wilden Küste mit tosender Brandung. Woher diese Bilder kommen, weiß sie nicht, und ihre Großmutter Emilie weicht ihren Fragen nach der Vergangenheit immer wieder aus. Erst nach Emilies Tod findet Sofia eine Kiste mit Briefen aus einem Fischerdorf an der Costa Brava. Offenbar hat Sofia dort als kleines Mädchen einen Sommer verbracht. Fest entschlossen, das Meer ihrer Träume zu finden, macht sie sich auf den Weg nach Spanien – und auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit …
Autorin
Anika Beer wuchs umgeben von Geschichten auf: Mit drei Jahren lernte sie lesen, mit acht fing sie an, eigene Erzählungen zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Romane für Jugendliche und Erwachsene veröffentlicht. Sie lebt mit ihrer Familie in Bielefeld und reist so oft wie möglich ans Meer.
Weitere Infos über die Autorin finden Sie auf ihrer Homepage www.anikabeer.de oder bei Instagram unter @anika.beer.autorin.
Anika Beer
Am Horizont das Meer
Roman
Nachweis der zitierten Gedichte:Ramón Sampedro, Cartas desde el infierno (Briefe aus der Hölle), Übersetzung: Anika Beer.Rainer Maria Rilke, Die Gedichte, Lied vom Meer, Insel Verlag, Frankfurt am Main 2006.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Originalausgabe Juni 2020Copyright © 2020 by Anika BeerCopyright © dieser Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenDieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 HannoverUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: Stadt und Meer: Valery Bareta/Alamy Stock PhotoFahrrad, Pflanzen an der Mauer: FinePic®, MünchenHäuser: Smartshots International/getty imagesRedaktion: Ilse WagnerLS · Herstellung: kwSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-23465-2V002www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Oma, der ich dieses Buch so gern vorgelesen hätte.
Aufs Meer hinaus, aufs Meer hinaus,und schwerelos schwebend über tiefem Grund,wo Träume sich zu Wahrheit wandeln,vereinen sich zwei mit starkem Willen,eine tiefe Sehnsucht zu erfüllen.Ramón Sampedro, Briefe aus der Hölle
8. Juli 1995, Rocavella, L’Alt Emporda, Spanien
Es war ein klarer, stiller Morgen an der wilden Küste.
Die Ruhe nach dem heftigen Unwetter der vergangenen Nacht hing noch über dem Dorf, und eine blanke, sanfte Sonne funkelte in den Pfützen, die der Sturm in den Straßen zurückgelassen hatte. Von der sengenden Sommerhitze, die der Tag erwarten ließ, war um diese Zeit nur eine Ahnung zu spüren. Selbst der Wind, der die ganze Nacht über wie wild an den Fensterläden gerüttelt hatte, war in einen erschöpften Schlaf gefallen und schnaufte nur von Zeit zu Zeit leise vor sich hin.
Luz und Cian, die Kinder des Dorfapothekers, hatten sich früh aus dem Haus geschlichen, um vor allen anderen am Strand zu sein, solange das Dorf noch schlief und die Welt ihnen allein gehörte. Cian wollte Schätze im Treibholz suchen, hatte er gesagt, und dann waren sie durch Luz’ Fenster nach draußen und am Blumenspalier hinunter auf die Straße geklettert. Es war jener strahlende Sommer 1995, in dem sie am liebsten Piraten sein wollten, mit Augenklappen und Enterhaken an Angelschnüren, mit Piratenkopftüchern und Holzsäbeln aus zersägten Besenstielen. Kein Wunder also, dass Luz sofort Feuer und Flamme für den Plan ihres großen Bruders war.
Die Sonne war gerade erst über den Horizont gekrochen und ließ das Meer weiß-golden glitzern, als sie die kleine Bucht unterhalb des Leuchtturms erreichten. Der rötliche Sand im Schatten der schroffen Küstenfelsen war dunkel vor Nässe, und es roch nach Wind, Salz und den Algen, die am oberen Rand des Strandes eine schwarze Wellenlinie zeichneten, als wolle die See ihnen zeigen, wie beeindruckend weit sie in der Nacht ins Land vorgedrungen war.
Wie Cian vorausgesagt hatte, war die Bucht übersät mit dem Unrat, den das Meer in der Nacht ausgespien hatte. Holztrümmer, Flaschen und verblichene Plastiktüten, alte Schuhe, Getränkedosen und zerbrochene Angelruten. Die Überreste eines Lenkdrachen und dazwischen Muscheln, bunte Kiesel, Kronkorken und Scherben, die die Wellen rund und glatt geschliffen hatten. So stapften die Kinder mit nackten Füßen durch den nassen Sand, die Augen auf den Boden gerichtet, damit ihnen kein Funkeln, kein noch so schwaches Schimmern entging. Mit den Zehen schoben sie pockenbedecktes Holz zur Seite und hoben mit spitzen Fingern Papier und verklumpte Algen auf. Schon bald waren sie so vertieft in ihre Arbeit, dass sie gar nicht bemerkten, wie die Zeit verging – bis Cian auf halber Strecke zwischen dem Leuchtturmfelsen und der Brandungslinie eine schier unglaubliche Entdeckung machte.
»Luz!«, rief er, und seine Stimme überschlug sich vor Aufregung. »Komm, das musst du sehen! Schnell!«
Luz, die am anderen Ende des Strandes gesucht hatte, zögerte nicht eine Sekunde. Sie ließ ihren Sammelkorb fallen und rannte, so schnell ihre kurzen Beine sie trugen, quer durch die Bucht, wo Cian neben einem merkwürdigen, unförmigen Haufen auf sie wartete.
Es war ein Mädchen. Ein echtes, blasses Mädchen mit klatschnassem Haar, das ihr verfilzt am Kopf und in der Stirn klebte. Sie war nackt bis auf ein paar unkenntliche Stofffetzen und die algenverklebten Reste eines Fischernetzes, die sich hoffnungslos um sie herum verknotet hatten. Ihre Augen waren geschlossen, und ihre Haut war so bleich, dass sie fast blau schien.
»Da staunst du, was?«, flüsterte Cian, die Stimme heiser vor Aufregung. »Das ist eine Meerjungfrau!«
Ehrfürchtig starrte Luz auf das Mädchen. »Sie hat aber gar keinen Fischschwanz«, gab sie zu bedenken und knabberte aufgeregt an ihren Fingernägeln.
»Natürlich nicht, Dummchen.« Cian hockte sich neben das Mädchen und musterte sie genauer. »Das war die böse Seehexe. Sie hat ihren Fischschwanz in zwei Beine verhext. Ist doch klar.«
Darauf wusste Luz nichts zu sagen. Sie hatte davon noch nie gehört. Aber Cian war ja schon zehn, ganze drei Jahre älter als sie, der würde es wissen. Nervös beobachtete Luz, wie er die Hand nach dem Mädchen ausstreckte. »Fass sie besser nicht an!«, flüsterte sie.
»Ich muss doch sehen, ob sie noch lebt!«
Doch als Cians Fingerspitzen die weiße Haut streiften, zuckte er zurück. »Kalt wie ein Fisch.«
Luz schauderte.
Cian aber rückte noch ein Stück näher an die kleine Meerjungfrau heran und beugte sich über sie, bis er fast auf sie fiel.
»Cian!«, zischte Luz ängstlich. Doch da drückte Cian schon sein Ohr auf die schmale Brust unter dem modrig-feuchten Fischernetz. Mit blitzenden Augen sah er zu seiner Schwester hoch. »Sie lebt noch!«
In Luz’ Brust zog und kribbelte eine Mischung aus Angst, Neugier und Hilflosigkeit, in der kleine Blasen wunderbarer Aufregung platzten. Eine echte Meerjungfrau! Ermutigt von Cians Erfolg hockte sie sich nun ebenfalls hin und streichelte über die Arme und Schultern des Mädchens. Sie war wirklich eiskalt. Mitleid stieg in Luz auf. »Hab keine Angst«, murmelte sie. »Wir retten dich. Stimmt’s nicht, Cian?« Sie sah ihren Bruder hoffnungsvoll an.
Aber Cian sagte nichts darauf. Er starrte nur wie gebannt auf seine Hand, unter der sich, wie zur Antwort, die schmale Brust nun deutlich sichtbar hob und senkte.
Und als Luz ebenfalls wieder auf das Mädchen blickte, erkannte sie, dass die Meerjungfrau aufgewacht war und ihre Retter aus großen Augen ansah.
Es war, als ob für einen Moment die Zeit stillstünde. Luz und Cian sahen sich an und dann wieder auf die Meerjungfrau, deren strahlend blaue Iriden unnatürlich riesig wirkten in dem bleichen, schmalen Gesicht. Und als das Meermädchen mit ungelenken Bewegungen versuchte, sich aufzurichten, da zuckten die Kinder zurück wie vor einem tot geglaubten Fisch, der plötzlich wieder zu zappeln anfängt.
Aber dann begann das Mädchen zu husten, zu keuchen und Salzwasser auszuspucken – ein Geräusch, das so mitleiderregend klang, dass sie sich beide plötzlich ziemlich dumm vorkamen, vor so einem schwachen, ausgezehrten Wesen zu erschrecken.
»He, schsch«, machte Cian, als wolle er ein Kätzchen beruhigen, das er aus der Regentonne gerettet hatte. »Tranquiŀla, tranquiŀla …«
Die Meerjungfrau hatte sich derweil wieder auf den Boden sinken lassen und sich eng zusammengerollt, die Wange in den nassen Sand geschmiegt. Sie zitterte am ganzen Körper, ob vor Furcht oder vor Kälte war nicht zu unterscheiden.
»Keine Angst«, flüsterte Luz, weil sie befürchtete, ein lautes Wort könne einen erneuten Schreck und damit einen neuen Hustenanfall auslösen. »Wir tun dir nichts. Wir wollen dir bloß helfen.«
Die Meeresaugen schauten verständnislos zu ihnen hinauf.
»Ich bin Cian«, sagte Cian und deutete auf sich, »und das ist Luz. Und wie heißt du?«
Aber das Mädchen antwortete nicht. Stattdessen sanken die Lider über die wasserblauen Augen, als wolle sie erneut ohnmächtig werden.
Die Kinder sahen sich erschrocken an.
»Was machen wir denn jetzt, Cian?«, flüsterte Luz – undeutlich, weil sie vor Aufregung schon wieder die Finger im Mund hatte. »Sollen wir mamà holen?«
Cian schüttelte energisch den Kopf. »Das dauert viel zu lange! Vielleicht ist sie tot, bis wir zurück sind!« Er legte die Stirn in Falten und dachte angestrengt nach. Dann sprang er auf die Füße. »Ich weiß! Wir holen Davíd! Komm, Luz!«
»Aber …!«, stieß Luz entsetzt hervor. Vor dem grimmigen alten Leuchtturmwärter hatte sie einen gehörigen Respekt. Und hatte nicht auch papà verboten, dass sie den Strand verließen und zum Leuchtturm hinaufkletterten? Doch Cian war bereits unterwegs und sah sich nicht einmal nach ihr um.
»Cian! Warte!«, heulte Luz und rannte hinter ihrem Bruder her, so schnell sie konnte. Allein zurückzubleiben mit dem reglosen Mädchen, das jederzeit einfach aufhören konnte zu atmen, das erschien ihr noch sehr viel Furcht einflößender, als dem Leuchtturmwärter zu begegnen.
Und so stoben die beiden durch die Brandung davon, während am Horizont langsam die Sonne in den leuchtenden Sommerhimmel hinaufstieg und Sand und Salz auf der Haut des Meermädchens zu krümeligem Staub trockneten.
Erster Teil: Sofia
1.
Rauschend umspült die Brandung meine Knöchel. Sie plätschert und glitzert an meinen Zehen, die mit jeder Welle tiefer in den nassen Sand sinken. Kitzelnd entfliehen die Kiesel dem Druck meiner nackten Sohlen. Das Wasser leuchtet unter den Strahlen der Nachmittagssonne himmelblau und türkis. Ein vertrautes Meer. Ein vertrauter, wilder Horizont, ein überwältigendes Gefühl von Heimkehr, und doch …
Wo ein Flüstern in jeder schäumenden Welle sein sollte, eine Melodie im Säuseln des Windes, der über die gekräuselte Oberfläche streift, höre ich nichts.
Salz auf meiner Haut. Gischt und Möwenschreie. So nah. So unerreichbar.
Und das Meer schweigt mich an.
»Entschuldigen Sie bitte. Ich suche den Weg zum Strand.«
Die Worte drangen so unerwartet durch die Stille, dass Sofia sich im ersten Moment nicht einmal darüber wunderte.
Wasser. Wellenrauschen. Wind.
Ein Strand?
Erst nach und nach dämmerte ihr, dass ihre Gedanken sehr weit fort gewandert sein mussten und dass es wohl keinen logischen Zusammenhang zwischen der Frage, dem Rauschen in ihren Ohren und der nüchternen Kühle des Bibliotheksschalters unter ihren aufgestützten Ellbogen gab.
»Ist alles in Ordnung bei Ihnen?« Das junge Mädchen auf der anderen Seite des Tresens krauste besorgt die sonnenverbrannte Nase. Erstsemester, vermutlich. Höchstens drittes. Sie hatte Sommersprossen. Dicht an dicht wie Sandkiesel auf der hellen Haut.
»Oh, nein, schon gut. Ich war nur in Gedanken.« Auch Sofia zwang rasch ein Lächeln in ihre Mundwinkel; weiter kam es nicht, sondern blieb dort stecken wie mit Nadeln angeheftet. »Was war die Frage, bitte?«
»Ich suche ein Buch. Es soll an diesem Standort sein.« Das Sommersprossenmädchen legte einen Zettel auf den Tresen der Ausleihe. FB 21 TT400 C191(2) stand darauf. China Study: Die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise, Campbell 2011.
Standort – nicht Strand. Ach so.
Sofia schüttelte den Kopf und zugleich die letzten Überbleibsel von Salzwind und Meeresrauschen von ihrer Haut. Das Stecknadellächeln verursachte ihr einen Krampf in der linken Wange. »Tut mir leid, da sind Sie hier falsch. Hier finden Sie nur Bücher über Literaturwissenschaft und Linguistik. Die Ernährungs- und Haushaltswissenschaften sind auf der anderen Seite des Gebäudes, Bereich E-1, einmal quer durch die Halle.« Sie warf einen Blick auf die Uhr hinter ihr an der Wand und erschrak. Acht Minuten nach fünf.
Völlig die Zeit verträumt.
Um Viertel nach fünf wollte sie Oliver abholen. Daraus wurde nun wohl nichts. Der Feierabend fing gut an. Sie wandte sich wieder an die Studentin, bemüht, sich die plötzliche Eile nicht anmerken zu lassen. »Die Kollegen sind wahrscheinlich schon alle weg, aber versuchen Sie mal Ihr Glück.«
Die junge Frau errötete bis unter die Haarwurzeln. »Oh. Danke. Es ist auch nicht so wichtig, ich wollte es nur aus Interesse ausleihen. Also …« Ihre Augen huschten kurz zu Sofias Namensschild. »… Frau Bensiek, danke noch mal. Einen schönen Sommerabend wünsche ich.« Ihre Absätze klapperten etwas zu laut auf dem Linoleum, als sie an den Regalen entlang aus der Bibliothek floh.
Sofia sah ihr nach und seufzte leise. Wie lange war es her, dass sie rein aus Interesse ein Buch mitgenommen hatte? Seit ihrem Magisterabschluss jedenfalls nicht mehr, und der lag immerhin schon sechs Jahre und einen opulent gefeierten dreißigsten Geburtstag zurück. Sogar den einunddreißigsten, genau genommen – nicht ganz so opulent. Sie sah noch einmal zur Uhr und wusste nicht, ob sie der jungen Fremden wünschen sollte, dass sie in E-1 noch jemanden antraf. In ihren Ohren pochte die Stille, die die helle Stimme und die verklingenden Schritte zurückgelassen hatten. Fast glaubte Sofia, das Rauschen ihres eigenen Blutes zu hören, das an und ab schwoll wie Wogen, die an einen Strand brandeten.
Nun lass doch mal das Meer.
Der Lesesaal lag jetzt verlassen da. Bei der Hitze hielt es niemanden länger als nötig hier drin. Nur ein paar Staubflocken flüchteten über den glatten Boden, als Sofia ihren Platz hinter dem Schalter verließ und eilig die Handtasche aus dem Spind zog. Vor dem Spiegel auf der Innenseite der Tür zupfte sie noch rasch die kurzen, schon sommergoldenen Locken in Form und zog den Lidstrich nach, tauschte die bequemen Arbeitssneaker gegen die eleganteren Sandalen. Ein letztes Mal drehte sie sich prüfend hin und her, schnippte einen Fussel vom schwarzen Bleistiftrock und strich den Kragen der geblümten Sommerbluse glatt. Okay. Seriös genug für eine Hausbesichtigung. Ein Blick aufs Handy zeigte drei unbeantwortete Anrufe einer unbekannten Festnetznummer. Sofia wischte sie unbesehen zur Seite.
Später.
Der Schlüssel knirschte im Schloss, als sie die schwere Stahltür der Bibliothek hinter sich zusperrte.
Draußen auf dem Parkplatz stand die Hitze wie eine Wand. Kein Lüftchen regte sich. Die Nachmittagssonne ließ den Asphalt flirren und alle Bewegungen wie in Zeitlupe ablaufen.
Sofia warf ihre Handtasche auf den Rücksitz und drehte die Klimaanlage hoch. Zwanzig nach fünf. Um sechs waren sie mit der Dame des Bauträgerunternehmens in der Südstadt verabredet. Unmöglich zu schaffen, nicht im Feierabendverkehr und mit dem Umweg über die Fachhochschule. Fast unmöglich.
Sofia klemmte das Handy in die Freisprecheinrichtung und wählte die Nummer der Maklerin.
Dann trat sie aufs Gaspedal.
Schon als sie auf die Zufahrtsstraße zur Fachhochschule für Bauwesen und Architektur einbog, konnte Sofia die Ungeduld in Olivers Gesicht und seiner Haltung erkennen. Auf Außenstehende wirkte er vermutlich ganz entspannt – ein sportlicher Mittdreißiger in Shirt und gut sitzender Jeans, der an der Bushaltestelle vor den Parkhäusern wartete. Die Ledertasche, die Sofia ihm zur Promotion und dem Antritt seiner Dozentenstelle geschenkt hatte, trug er lässig über einer Schulter. Hin und wieder grüßte er vorübereilende Studenten mit einem Lächeln. Doch Sofia sah den nervösen Mittelfinger, der unablässig gegen die Seitennaht seiner Hose klopfte, und sie kannte diese Art, den Blick in den Himmel zu richten, um nicht auf die Straße zu starren, auf der sie irgendwann herangefahren kommen musste.
Sie klemmte sich hinter den Bus, der gerade die Haltestelle anfuhr, und blieb mit eingeschaltetem Blinker neben Oliver stehen.
»Hey, Liebling.«
»Na endlich.« Sein Begrüßungskuss fiel flüchtig aus.
»Tut mir leid. Ich musste noch einer Ersti-Studentin helfen.« Sofia warf einen Blick über die Schulter und scherte aus, ehe der Bus losfuhr. Hinter ihr hupte jemand.
Oliver seufzte und starrte auf den Verkehr, der im Schneckentempo vor ihnen dahinkroch. »Zu solchen Terminen ist man einfach pünktlich. Du weißt, wie ich über Unzuverlässigkeit denke.«
Sofia verdrehte die Augen. »Es sind zehn Minuten, Oliver. Zehn. Außerdem habe ich schon mit Frau Lund gesprochen.«
Oliver hob die Brauen. »Das ist ja wohl auch das Mindeste. Und?«
Nun musste Sofia fast lachen. »Sie war ziemlich erleichtert. Sie ist nämlich selbst spät dran.« Sie tätschelte liebevoll Olivers Oberschenkel. »Und jetzt entspann dich mal. So was passiert eben. Das ist normal und menschlich. Und draußen auf der Bundesstraße fließt es besser. War zumindest eben noch so.«
Darauf sagte Oliver nichts, aber er entspannte sich tatsächlich ein wenig, obwohl er immer noch mit gerunzelter Stirn nach draußen sah. »Welche neue Zeit habt ihr ausgemacht?«
Sofia zuckte die Schultern und lächelte. »Gar keine. Wir sind da, wenn wir da sind. War ihr Vorschlag.«
»Nicht dein Ernst.« Oliver stöhnte resigniert. Dann lehnte er sich zurück gegen die Kopfstütze und schloss die Augen. »Na gut. Dann macht ihr das halt auf eure fancy-pancy Verpflichtungslose-Vorstadtweiber-Tour. Ich bin raus.« Trotz seines resignierten Tonfalls zuckte jetzt tatsächlich ein Lächeln um seine Mundwinkel.
Diesmal musste Sofia wirklich lachen. »Böser Mann.« Sie gab ihm einen Klaps aufs Knie, froh, dass er seinen Ärger zum größten Teil überwunden zu haben schien. »Am besten begrüßt du die Dame gleich ganz genau so. Ich bin sehr gespannt, wie sie das findet.«
Frau Lunds schwarzer BMW X5 parkte gerade vor der Einfahrt des Hauses ein, als Sofia am Straßenrand auf der anderen Seite den Motor abstellte. Der Sonnenhof 17 war eine noch recht nackt wirkende Doppelhaushälfte mit nur halb gedecktem Dach, gelegen am Rand einer Neubausiedlung im grünen Gürtel der Stadt, mit frisch gepflanzten Bäumen und Hecken hier und da. Vieles hier schien roh, unfertig, etliche Grundstücke waren noch leer oder gerade in der Bebauung begriffen.
Oliver liebte es, das sah Sofia sofort. Ein leeres Grundstück war für ihn eine Projektionsfläche unendlicher Ideen, und wenn etwas seine Augen zum Leuchten bringen konnte, dann ein leidenschaftliches Gespräch darüber, wie Häuser wuchsen und atmeten. Als sie ausstiegen und der Maklerin entgegengingen, griff Sofia nach seiner Hand. Oliver drückte sanft ihre Finger, und sie spürte, wie seine Begeisterung auf ihrer Haut kribbelte. Ja doch, dachte sie und sah sich noch einmal um, sie könnte sich hier vermutlich wohlfühlen, nach einer Weile. Bis zur Arbeit wäre es auch nicht zu weit.
»Hallo, Frau Bensiek. Doktor Brenker.« Frau Lund schüttelte ihnen beiden die Hand. Sie war eine taffe Frau um die vierzig, im Nadelstreifen-Hosenanzug, mit feuerrot gefärbter Hochsteckfrisur und passendem Lippenstift. »Schön, dass es trotz aller Widrigkeiten geklappt hat. Wollen wir?«
Sie führte Sofia und Oliver die mit Bauschotter bedeckte Einfahrt hinauf. »Die Tür ist noch ein Provisorium«, sagte sie, als sie aufschloss. »Wie auch vieles andere. Sie würden im Fall eines Kaufes die finalen Entscheidungen natürlich selbst treffen.«
»Na großartig.« Oliver lächelte sein charmantestes Lächeln. »Ich liebe es, Bauherren reinzureden.«
Frau Lund lachte hell. »Das glaube ich gern. Ich habe auf Ihrem Profilbogen gelesen, dass Sie in Architektur promoviert haben. Wenn ich so neugierig sein darf: Wollten Sie Ihr Eigenheim denn nicht selbst entwerfen?«
Auch Oliver lachte jetzt. »Ach, Frau Lund, das habe ich doch längst. Ich kann es mir nur nicht leisten.«
Sofia hörte mit halbem Ohr zu, wie Oliver weiter mit der Maklerin Small Talk führte. Von dem Traumhaus erzählte, das er seiner Liebsten – ihr – für einen unbestimmt fernen Tag in der Zukunft versprochen hatte. Dass sie jetzt erst mal etwas nicht ganz so Individuelles, aber dafür Praktisches suchten. Etwas, wo sie sich für die nächsten Jahre zu Hause fühlen konnten.
Sofia wanderte zwei Schritte hinter den beiden, besah sich die kahlen Wände und nackten Kabel, spähte in alle Zimmer und versuchte sich vorzustellen, wie sie sich hier einrichten könnten. Für Oliver, das wusste sie schon jetzt, war es perfekt. Für sie … Sofia blieb mitten in einem Raum stehen, der wohl einmal ein Wohnzimmer werden konnte. Nun ja. Sie hatte vor Jahren schon entschieden, dass er ihr Zuhause war. Und dieses Haus war in all seiner Nüchternheit und Charakterlosigkeit bestimmt nicht der schlechteste Platz, um dort mit ihm zu leben.
»Sofia?« Olivers Stimme schreckte sie auf. »Ach, hier steckst du. Wir sind schon oben.«
Sofia drehte sich um und lächelte. »Entschuldige. Ich war in Gedanken.«
»Wo auch sonst.« Oliver schüttelte den Kopf, resigniert und liebevoll zugleich. Dann streckte er die Hand aus. »Komm mal mit rauf. Ich will dir was zeigen.«
»Na, da bin ich gespannt.«
Sie folgte Oliver die Betonstufen hinauf ins Zwischengeschoss, das nur ein Zimmer und ein winziges Bad hatte. Oliver führte Sofia zum Fenster und deutete nach draußen. »Schau mal. Wir haben das Meer direkt vor der Tür.«
Etwas in Sofia erstarrte für Sekundenbruchteile, obwohl sie natürlich wusste, dass das schlicht unmöglich war. Sie waren mitten im Inland, das nächste Meer war mehr als zwei Stunden Autofahrt entfernt.
An einem Bauzaun auf dem Grundstück gegenüber hing ein Plakat mit Werbung einer Fluggesellschaft. Schneeweißer Sand und Palmen. Ein traumhaftes, tiefblaues Meer.
»Na, was meinst du?« Oliver lächelte und legte den Arm um ihre Hüfte. »Ist das ein Zeichen? Meine schöne Meerjungfrau?«, murmelte er in ihr Haar.
Sekunden vergingen, in denen Sofia nur dastand und auf das Meer auf dem Plakat starrte. Die Sonne brannte durch das Fenster auf ihren Wangen. Kein Rauschen. Kein Wind. Das Meer schien in diesem Augenblick ferner denn je.
»Na ja, es … ist nicht das Richtige«, sagte sie schließlich und hob die Schultern, ein bisschen zu abwehrend vielleicht. Nicht wild genug.
Olivers Griff um ihre Hüfte lockerte sich. »Hm«, machte er, und Sofia hörte die Enttäuschung in seiner Stimme.
»Das hat aber nichts mit dem Haus zu tun«, versicherte sie rasch. »Also, mir gefällt es. Dir doch auch.«
»Schon klar.« Oliver seufzte, weil er es natürlich besser wusste, oder zumindest ebenso gut wie sie, dass Momente wie dieser ganz und gar nicht mit einem Schulterzucken abzutun waren. Eine kleine Pause, ein etwas gequältes Lächeln, und dann: »Es ist immer das Falsche. Ich weiß.«
»Hör mal, ich weiß, dass …«
In diesem Moment vibrierte das Handy in Sofias Tasche. Schon wieder diese unbekannte Nummer.
»Wer ist das?«, fragte Oliver, als sie zögerte, den Anruf anzunehmen.
»Keine Ahnung.« Ihr war gerade wirklich nicht danach, mit einem Fremden zu reden.
Oliver hob eine Braue, wie er es immer tat, wenn er der Meinung war, dass sie die Dinge unnötig verkomplizierte. »Geh ran, dann weißt du’s?«
Sofia zögerte. Es klang so einfach. Was Oliver sagte, klang immer einfach. Aber …
Oliver seufzte, nur ein bisschen ungeduldig. »Es ist vielleicht wichtig?«
Sofia riss sich zusammen. Dann tippte sie auf den grünen Knopf. »Hallo?«
Ein Räuspern am anderen Ende. Eine fremde Frauenstimme. »Selma Tiemann von der Polizei Einhöven, guten Tag. Spreche ich mit Sofia Bensiek?«
Sofia warf einen Blick zu Oliver. »Ja, die bin ich … was gibt es denn?«
Noch ein Räuspern. »Entschuldigen Sie die Störung, Frau Bensiek. Gut, dass ich Sie erreiche. Haben Sie einen Moment Ruhe?«
Ein nervöses Ziehen regte sich in Sofias Brust und zugleich der irrationale Impuls, das Handy aus dem Fenster zu werfen. »Natürlich«, sagte sie trotzdem, »wenn es nicht zu lang dauert?«
Die Frau am anderen Ende räusperte sich ein drittes Mal. »Frau Bensiek … ich habe leider eine traurige Nachricht für Sie. Ihre Großmutter, Emilie Bensiek, ist in der vergangenen Nacht zum dritten Juli verstorben. Es tut mir sehr leid.«
Eine sachte Windbö strich durch die Bäume und Hecken draußen. Sofia starrte aus dem Fenster auf das Bild von dem falschen Meer, hörte die Worte und begriff sie nicht.
»Wie bitte?«, fragte sie und konnte sich selbst nicht hören.
Die Polizistin erzählte noch einiges mehr, von der Vermieterin, die Emilie Bensiek gefunden hatte, von Ärzten – natürlicher Tod, sanft eingeschlafen – , Notaren und Bestattern.
Es ist immer das Falsche, sagte Oliver sehr viel lauter in Sofias Kopf.
Sie bemerkte kaum, wie Oliver ihr das Telefon aus den Händen nahm. Während er leise und ruhig mit der Polizistin sprach, starrte Sofia auf ihre leeren Finger. Nur verschwommen bekam sie mit, wie Oliver schließlich auflegte. Er sagte nichts, zog sie einfach an sich und hielt sie fest. Sehr fest.
Aber …
In der Leere flackerten Ahnungen von Empfindungen auf. Kleine Funken nur, die verglommen, lang bevor sie die Chance bekamen, an die Oberfläche von Sofias Bewusstsein zu dringen. Was blieb, war ein einsamer Gedanke, scheppernd und misstönend in der geisterhaften Stille in ihrem Kopf.
Ich kann sie nicht nach dem Meer fragen.
Nie wieder.
2.
»In der mondhellen Nacht saß die kleine Meerjungfrau am Wasser und starrte in die klaren Tiefen. Da schien es ihr, als sähe sie des Vaters perlmuttschimmerndes Schloss, und auf den Zinnen des Schlosses stünde die alte Großmutter mit der Silberkrone auf dem Kopf und den zwölf Austern an ihrem Schwanz und schaute zu ihr hinauf.«
Vergangenes soll man ruhen lassen, hatte Oma Emilie immer gesagt. Vergangenes soll man ruhen lassen – wie ein Stoßgebet zu jeder sich bietenden Gelegenheit, vor allem aber, wann immer der kleinen Sofia auch nur der leiseste Ton einer Frage über die Lippen kam. Über ihre Eltern. Über das Meer.
Als Kind hatte sie viel gefragt. Geradezu unermüdlich war sie gewesen.
»Wann kann ich wieder ans Meer?«
»Können wir meinen Kompass holen?«
»Wo sind Mama und Papa? Warum können wir nicht zu ihnen?«
»Darf ich Cian und Luz sehen – und Davíd?«
»Bitte, können wir nicht zurückfahren?«
Aber die Antwort, egal, welche Frage sie stellte, war immer die gleiche: Vergangenes soll man ruhen lassen.
Sofia konnte nicht sagen, wann oder wie es schließlich dazu kam, dass sie sich fügte. Warum sie aufgab – nach dem tausendsten oder vielleicht auch zweitausendsten Versuch, ihrer Großmutter mehr als beharrliches Schweigen zu entlocken. Vielleicht waren es die zwei Tränen im linken Augenwinkel, die Oma Emilie jedes Mal energisch wegblinzelte, wenn die Sprache auf das Thema kam. Es musste einen Grund geben, weshalb sie nicht antworten konnte und weshalb sie nicht ins Meer zurückkehrten, wo ihre Heimat war. Sofia wollte ihre Oma nicht unglücklich machen. Also schwiegen sie schließlich beide.
Nur ein einziges Mal, viele Jahre später, hatte sie ein letztes Mal gewagt, Emilie auf das anzusprechen, was in ihrem Herzen fehlte. Ein insgeheim längst hoffnungsloser Versuch, an dem Tag, an dem sie das Haus ihrer Kindheit verließ, um mit Oliver in eine Wohnung in der nahen Großstadt zu ziehen.
»Welches Meer war es, Oma? Wo komme ich her?«
Oma Emilie hatte sie schweigend angesehen, mit Augen, die dunkel waren vor Kummer.
»Vergangenes soll man ruhen lassen«, antwortete sie schließlich mit mehr Nachdruck als je zuvor. Und Sofia begriff, wenn sie diese Frau, die ihre einzige Familie war, nicht in erbittertem Streit verlassen wollte, durfte sie nie wieder nach ihrer Vergangenheit fragen.
Seit diesem Tag waren weitere sieben Jahre vergangen, und von Sofias Suche nach der Wahrheit war schließlich nicht viel mehr geblieben als diese eine, quälende Frage: Hatte sie das Meer, ihr Meer, überhaupt jemals gesehen?
Und was war mit ihren Eltern geschehen?
»Warum fährst du nicht ans Meer und findest es heraus?«, hatte Oliver gefragt, eines dunklen Wintermorgens im ersten Jahr ihrer Beziehung, als er Sofia mit nach innen gekehrtem Blick auf dem Sofa sitzend vorgefunden hatte. »Wenn du erst dort bist, fällt es dir vielleicht wieder ein.«
Aber Sofia hatte nur den Kopf geschüttelt.
»Weil es immer das falsche Meer ist.« Das hatte sie ihm zur Antwort gegeben. Danach hatten sie das Thema nie wieder angesprochen. Oliver nicht, Sofia nicht, und auch ihre Großmutter nicht.
Und jetzt war es dafür endgültig zu spät.
*
Eine ganze Weile lag Sofia reglos in Olivers Armen und wartete darauf, dass die Tränen kommen würden. Dass die Trauer sie überwältigte und sie endlich etwas empfand.
Auch Oliver blieb stumm. Sanft strich seine vertraute Hand ihren Rücken auf und ab.
»Doktor Brenker? Frau Bensiek?«, drang in diesem Moment Frau Lunds Stimme durch das Treppenhaus zu ihnen herunter. »Möchten Sie jetzt vielleicht noch das Obergeschoss sehen?«
»Ich muss hier raus«, murmelte Sofia an Olivers Brust. Jetzt mit der Maklerin sprechen und sich durch noch mehr kahle Zimmer führen lassen zu müssen, schien ihr einfach unerträglich. Und weinen konnte sie vor dieser fremden Frau auch nicht.
Oliver löste die Umarmung, fasste Sofia sanft bei den Schultern und sah ihr in die Augen. »Ich rede mit ihr. Ich sage ihr, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, für alles. Willst du schon mal nach draußen gehen?«
Sofia nickte erleichtert. »Danke«, flüsterte sie und gab ihm einen Kuss. Dann wankte sie die Treppe hinunter.
Draußen war es unverändert heiß, doch Sofia schien es, als könne sie dort zumindest ein wenig leichter atmen.
Zumindest, bis es ihr wieder einfiel.
Sie ist tot. Oma Emilie ist tot.
Für immer weg.
Sofia wusste selbst nicht, was sie antrieb, als sie sich im nächsten Moment ins Auto setzte und den Motor startete, die Augen halb blind vor Tränen.
Sie fuhr einfach los.
8. Juli 1995, Rocavella, L’Alt Emporda, Spanien
Davíd, der Wärter des verwitterten Leuchtturms von Rocavella, war alt, bärtig und mochte Kinder nicht besonders. Tatsächlich mochte er Menschen im Allgemeinen nicht besonders, aber gegen Kinder und ihre niemals endende Ruhelosigkeit pflegte er eine spezielle Antipathie. Und hätte jemand Davíd gesagt, als er seine rheumatischen Knochen an jenem Sommermorgen aus dem Bett in der Leuchtturmwärter-Stube quälte, wie nahe ihm in diesem Moment ein kleines Wunder war – ja, hätte dieser Jemand ihm vielleicht sogar gesagt, dass nur wenige Stunden später ein bleiches, halb erfrorenes Mädchen in ebendiesem Bett liegen würde, das geradewegs aus dem Meer zu ihm gekommen war – , er hätte ganz bestimmt gelacht. Laut und rau hätte er gelacht und die verrückte Landratte zum Teufel geschickt.
»Überlass das Seemannsgarn den Seemännern!«, hätte er gebellt.
Doch als nicht lang nach Sonnenaufgang der Türklopfer seinen Turm erzittern ließ und die Apothekerskinder auf seiner Schwelle standen, nass und voller Sand und Algen, während das Morgenlicht ihre wilden Haare in leuchtende Heiligenscheine verwandelte, da war er so verblüfft, dass ihm gar nicht erst einfiel, sie wegzuscheuchen. Und ihr aufgeregtes Geplapper, aus dem Davíd nicht viel mehr heraushören konnte als »Meerjungfrau, Meerjungfrau!«, und ein ganz klein wenig vielleicht auch die Tränen in Luz’ großen Bernsteinaugen hatten an diesem Morgen selbst den grimmigen alten Seebären neugierig gemacht, wer oder was da wohl an seinem Strand angespült worden war.
So stapfte er hinter den Kindern den schmalen Pfad über den Leuchtturmfelsen hinab, ohne sich von ihrer Ungeduld allzu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Als sie schließlich den Strand erreichten, waren ihre Schatten bereits merklich kürzer geworden. Und dort, wo die letzten Ausläufer der Wellen gerade noch an ihren Füßen leckten, lag sie: die kleine Meerjungfrau.
Davíd hatte in seinem Leben schon viel gesehen: auf See, an Land, am Grund seines Cremat-Glases im Winter. Seeungeheuer, Klabautermänner, Sirenen – er hatte die Geschichten über solcherlei Wesen so oft erzählt, dass er selbst schon längst nicht mehr wusste, was er wirklich gesehen und was erfunden hatte. Doch als er das bleiche, magere Mädchen im nassen Sand liegen sah, nackt bis auf ein Fischernetz und ganz und gar schutzlos, da regte sich in seinem vernarbten Herzen ein Funke, der nichts mit Beinen oder Fischschwanz zu tun hatte, und er beschleunigte seine Schritte und eilte zu ihr, so schnell seine vom Rheuma schmerzenden Knochen es zuließen.
Das Mädchen war wach. Aus tränenverhangenen Augen starrte sie die drei Neuankömmlinge an, war aber offensichtlich viel zu schwach, um sich auch nur einen Fingerbreit zu rühren.
»Komm, komm«, murmelte Davíd, kniete sich zu ihr in den Sand und strich ihr mit seinen schwieligen Händen das nasse Goldhaar aus der Stirn. »Tranquiŀla.«
Und das Mädchen, so sonderbar es auch schien, beruhigte sich beim Klang seiner Stimme. Die Panik in ihren Augen schwand, und obwohl es nicht so aussah, als würde sie verstehen, was er sagte, schien sie doch zu spüren, dass dieser raubeinige Alte ihr helfen wollte. Also nahm Davíd sie kurzerhand mitsamt dem Netz auf seine Arme und trug sie ohne ein weiteres Wort zurück zum Leuchtturm.
Die Apothekerskinder, die offenbar jede Scheu vor dem bärbeißigen Leuchtturmwärter verloren hatten, blieben ihm dabei dicht auf den Fersen. Davíd ließ sie. Sie hatten das Mädchen gefunden – nicht einmal er brachte es fertig, ihnen jetzt die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Sollten die Rotznasen sich ruhig nützlich machen.
Im Leuchtturm angekommen, schnitten sie die Meerjungfrau aus dem aufgequollenen Fischernetz heraus, wuschen mit einem warmen Lappen das Salz von ihrer Haut, steckten sie unter die Bettdecke und flößten ihr Fischsuppe und Tee mit Rum ein. Die Kinder gingen Davíd dabei mit leuchtenden Augen und glühenden Wangen zur Hand, und ihre Plappermäuler standen nicht einen Moment still.
Das Mädchen hingegen ließ alles stumm mit sich geschehen. Kein einziges Wort kam ihr über die Lippen, und in ihren wasserblauen Augen lagen nur Fragen, keine Antworten. Schließlich schlief sie mit einem erleichterten Seufzer einfach ein – und das musste ihren drei ungleichen Rettern für den Moment Lohn genug sein.