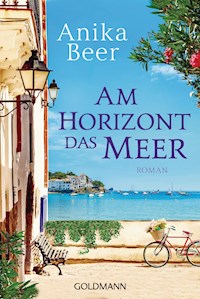8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
London, 1873. Cedric Edwards ist Konzertpianist, Klavierlehrer an der Royal Academy of Music – und sterbenskrank. Eine noch weitgehend unbekannte und unheilbare Krankheit droht sein Leben auf wenig verbleibende Jahre zu verkürzen. Doch nachdem ein Jahr zuvor bereits seine Frau verstarb, ist Cedric fest entschlossen, alles zu tun, damit seine Kinder nicht auch noch ihn verlieren. Als ihm seine Ärztin eine ungewöhnliche Therapie vorschlägt, die ihn nicht nur heilen, sondern sogar unsterblich machen soll, kann er daher nicht anders, als zuzustimmen – ohne zu ahnen, dass er sich damit mehr Blut und Dunkelheit ins Haus holt, als er sich je hätte ausmalen können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Requiem für einen blutroten Stern
ANIKA BEER
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Christin Thomas – Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-618-9
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie eleison
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
III. Graduale: Requiem aeternam
IV. Tractus: Bußpsalmgesang
V. Sequenz: Dies irae
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
VI. Offertorium
VII. Sanctus
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
VIII. Agnus Dei
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
IX. Communio: Lux aeterna
Danksagung
Drachenpost
Für Erik
Natürlich ist das auch Sids Geschichte.
I. Introitus: Requiem aeternam
Die Schatten werden länger. Um ihnen zu entkommen, werden wir unser eigenes Licht brauchen. Oder unsere eigene Dunkelheit.
April 1999
In den verlassenen Industrievierteln, Detroit, Michigan
Es wird Morgen über dem alten Fabrikgelände. Die ersten Sonnenstrahlen tasten sich über den gesprungenen Asphalt, erhellen Mauerschutt und Kletterpflanzen und sickern durch die Löcher im Dach der ehemaligen Großdruckerei. In der Ferne erwacht mit gedämpftem Rauschen die Stadt.
Durch eines der geborstenen Fenster schießt ein Mauersegler auf dem Weg zu seinem Nest. Fast drei Wochen hat das Vogelpaar oben am Schornstein gebrütet. An diesem Morgen dringt endlich mehrstimmiges Zirpen hinunter in die Halle. Dorthin, wo zwei Särge aus Kirschholz nebeneinanderstehen und darauf warten, dass ihre Bewohner endlich zur Ruhe kommen.
Dieses Leben, denkt Cedric und beobachtet die winzigen Schnäbel, die sich dem Muttervogel entgegenrecken. Es beginnt einfach immer wieder neu. Bemerkenswert, dass er nach mehr als hundertfünfzig Jahren immer noch darüber staunen kann.
Eine Bewegung zwischen seinen Fingern erregt seine Aufmerksamkeit – ein Zucken nur, aber Cedric ist sofort in Alarmbereitschaft. Sein Blick springt zurück zu dem Sarg, neben dem er sitzt. Jene viel zu große Kiste, in die das Vampirkind, das ihm anvertraut wurde, erst noch hineinwachsen muss. Ist es doch noch nicht vorbei für heute, hat der Körper des Jungen nach den zähen Stunden der vergangenen Nacht immer noch keine Ruhe gefunden?
Aber Sid hat nur versucht sich umzudrehen, ohne dabei Cedrics Hand loszulassen.
Cedric atmet bewusst langsam aus. »Warum schläfst du nicht?«
Sid antwortet nicht sofort. Die dunklen Augen unter dem Zottelhaar sind groß und verängstigt, als horche er noch immer in sich hinein; als traue er seinem Körper nicht, dass der nun wirklich für ein paar Stunden nicht gegen die viel zu starken Vampirkräfte ankämpfen wird.
»Erzählen Sie mir eine Geschichte, Doc?«
Doc. Wie immer schleicht sich ein Lächeln auf Cedrics Lippen, das sich mehr wie ein Seufzen anfühlt. Sid lässt sich nicht davon abbringen, ihn so zu nennen, und auch nach drei gemeinsamen Jahren in diesem Versteck weiß er nicht recht, was er dabei fühlen soll. Aber wenn es dem Jungen hilft zu glauben, dass er eines Tages einen ausgewachsenen, gesunden Körper haben kann, ist das zweitrangig. »Sicher. Was möchtest du hören?«
Die Antwort kommt prompt. »Wie Sie zum Vampir geworden sind.«
Cedric runzelt die Stirn. »Danach fragst du immer.«
»Aber Sie erzählen es nie.«
Damit hat er recht. Und Cedric hat seine Gründe dafür. Vor allem, warum er ausgerechnet Sid gegenüber damit zögert.
»Es ist eine lange Geschichte. Du könntest niemals wach bleiben, bis ich sie zu Ende erzählt hätte. Und du sollst es auch nicht versuchen«, fügt er streng hinzu.
Das rebellische Funkeln in Sids Augen verschwindet. »Okay, aber … dann könnten Sie ja einfach morgen weitererzählen. Wir sehen uns doch morgen wieder, oder? Und übermorgen auch. Und …« Sid verstummt, doch Cedric hat die plötzliche Angst in seiner Stimme schon gehört. Angst vor dem, was es bedeuten würde, wenn Cedric auf diese Frage mit Nein antwortete.
Behutsam drückt er die kleine Hand. »Natürlich, Sid. Natürlich sehen wir uns wieder.«
Sid entspannt sich ein wenig. Es ist jetzt still in der Druckerei. Nur die frisch geschlüpften Mauersegler schreien immer noch nach Futter.
»Hatten Sie schon mal Kinder, Doc? Als Sie noch ein Mensch waren, meine ich?«
Die Frage trifft ihn unerwartet. Cedric weicht Sids Blick aus und fühlt sein Herz ungewohnt heftig in seiner Brust schlagen. Dieser Junge hat ein Talent, an Dingen zu rühren, an die er lieber so selten wie möglich denken möchte. Bestenfalls nie. Kann man sich selbst Absolution erteilen? Er glaubt nicht daran.
»Doc?« Sid wirkt jetzt immerhin weniger ängstlich als zuvor. Die vergangenen Monate und Jahre haben gezeigt, dass es ihm hilft, sich auf Geschichten zu konzentrieren, die nicht seine eigenen sind. Deshalb weiß er inzwischen mehr über Cedric als irgendjemand sonst. Doch die anderen Geschichten gehen Cedric allmählich aus. Wenn er sich heute darauf einlässt, wo wird ihn das hinführen? Es ist schwer vorauszusehen.
»Ja.« Das Zögern schnürt ihm beinahe die Luft ab. »Zwei Töchter. Und einen Sohn.«
Sids Gesicht hellt sich sichtbar auf. »Ehrlich? Wie hießen sie?«
Cedric atmet tief ein und sehr langsam wieder aus. »Lass mich von vorn anfangen, Sid, in Ordnung? Es ist wirklich eine lange Geschichte.«
II. Kyrie eleison
Es heißt, man lernt sein Glück erst zu schätzen, nachdem man es
verloren hat. Das ist ebenso abgegriffen wie wahr.
Bei mir war es allerdings umgekehrt.
November 1873
Kapitel Eins
»Pathétique«; Piano Sonata No. 8, Op.13; Ludwig van Beethoven
Havencourt Stadtresidenz, 23 Oxford Street, West End, London
Stopp! Fehler!«
Der weiche Klang des Flügels verstummte. Aus großen Rehaugen sah Miss Elaine Rimbaur of Havencourt zu Cedric auf. Das Nachmittagslicht, vielfarbig gebrochen durch die Buntglasfenster im Salon von Havencourt House, leuchtete auf ihren braunen Locken wie ein Heiligenschein. »Bitte um Verzeihung, Maestro. Können Sie mir das näher erklären?«
Cedric ließ den Taktstock gegen die Seitennaht seiner Hose schlagen. »Sie können nicht einfach spielen, wie es Ihnen passt, Miss. Glauben Sie, ein Komponist wie Beethoven hätte sich nicht bei jeder Note etwas gedacht? Was hätte er wohl gesagt, wenn er gehört hätte, wie Sie ständig nach Lust und Laune gleich zwei oder drei davon auslassen oder dazuerfinden? Pathétique bedeutet Leidenschaft, nicht Ignoranz. Noch mal von vorn. Nein, warten Sie.« Ein grimmiges Lächeln zuckte in seinen Mundwinkeln. »Spielen Sie im zweiten Satz ab Zeile drei, das modulierte Thema bis zur Coda. Con brio, freudestrahlend, auf, auf, Miss!«
Elaines Unschuldsmiene verrutschte sichtlich. Sie beugte sich vor und blätterte fahrig durch die Seiten, ehe sie sich mit glühenden Wangen wieder zu ihm umwandte. »Das ist unfair, Cedric. Ich finde diese Stelle nicht.«
Cedric atmete angestrengt durch und schob sich die schwarzen Strähnen aus den Augen, die sich schon wieder aus dem Schleifenband gelöst hatten. »Natürlich nicht. Weil nichts davon in dieser Partitur steht. Und hättest du dir in den letzten Wochen die Mühe gemacht, endlich Noten lesen zu lernen, statt dich nur auf dein formidables Gehör zu verlassen, wüsstest du das auch.« Mit einem scharfen Klacken legte er den Taktstock auf dem Rahmen des Flügels ab. »Ich habe genug. Wir setzen den Unterricht fort, wenn du vorhast, ihn ernst zu nehmen.« Er begann, die Notenblätter einzusammeln und in seiner Tasche zu verstauen.
Elaine erhob sich mit hastigem Kleiderrascheln und sah Hilfe suchend zu ihrem Bruder, der im Lehnstuhl am Fenster saß, eine Meerschaumpfeife paffte und die Szene mit unübersehbarer Belustigung verfolgte. »Das kann nicht dein Ernst sein. Rob, sag ihm, dass er das nicht darf. Wir haben ihn doch schon für die nächsten Monate bezahlt!«
Cedric warf ihr einen finsteren Blick zu. »Auf diesem Niveau unterhalten wir uns jetzt also. Ohne mich.« Er klemmte seine Tasche unter den Arm und verließ den Salon, ohne sich noch einmal umzusehen.
»Cedric!« Elaine klang nun ernsthaft verzweifelt, weil sie nicht schnell genug aus der Rolle herausfand, die sie an diesem Tag für den Klavierunterricht eingenommen hatte – und auch ein wenig verletzt, weil er darauf keine Rücksicht nahm. Natürlich kannte er sie eigentlich besser. Das war ja das Schlimme daran. Die Tür zum Salon fiel geräuschvoll hinter Cedric ins Schloss.
Erst auf der Straße blieb er stehen, legte den Kopf in den Nacken und sah in den Himmel. Es war viel weniger sonnig hier draußen, als es das Lichtspiel der Buntglasfenster im Salon ihn hatte glauben machen wollen. Der Novembernebel zog bereits schwer von der Themse herüber. Jenseits der feuerfarbenen Ahornblätter am Hanover Square ragten Fabrikschlote düster in den beginnenden Abend und trieben ihre Rußschwaden über die Londoner Innenstadt.
Hinter Cedric ging erneut die Haustür. Er seufzte leise. Natürlich hatte er nicht damit gerechnet, dass Robert ihn einfach ziehen lassen würde. Der junge Baron of Havencourt hatte an dem Auftritt gerade sicher seinen Spaß gehabt. Aber mit einem hatte Elaine recht: Dass Cedric seinen Lohn für die nächsten Klavierstunden, inklusive des heutigen Desasters, bereits erhalten hatte. Freundschaft war eine Sache. Geld eine andere. Und zwar selbst dann, wenn diese Freundschaft bis in ihre Kindertage zurückreichte, als Cedrics Vater Robs Klavierlehrer gewesen war und sie beide gemeinsam unterrichtet hatte. Gerade weil es schon immer dieses Machtgefälle gegeben hatte, war es Cedric wichtig, dass Geld nie zu einem Argument zwischen ihnen wurde.
»Willst du das Honorar zurück?«, fragte er, als Rob neben ihm stehen blieb, in der einen Hand noch immer die Pfeife, die andere locker unter dem zurückgeschlagenen Sakko in die Hosentasche gesteckt. Cedric wusste nie, ob Rob sein Bild des kultivierten jungen Upperclass-Gentleman besonders gewissenhaft pflegte oder es doch eher zu karikieren versuchte. Vielleicht etwas von beidem.
»Natürlich nicht.« Rob nahm einen Zug von seiner Pfeife, fuhr sich durch die dunkelbraunen Locken und sah dem Rauch hinterher, wie er durch die nasse Luft davontrieb. »Ich hätte mir für deine Performance heute allerdings etwas mehr Contenance gewünscht, mein Freund.«
»Es ist eine Farce.« Cedric rieb sich erschöpft über die Augen. »Hör zu, ich verstehe, dass eure Familie Elaine am Konservatorium sehen möchte, und ich bin dir dankbar, dass du auf der Suche nach einem Lehrer an mich gedacht hast. Aber wozu plötzlich dieses Theater?«
Robert grinste sein jungenhaftes Grinsen. »Weil es ihr gefällt, wenn du dein strenges Gesicht machst. Und weil es mir gefällt zu sehen, wie du dich ihr annäherst.«
»Ich nähere mich ihr nicht an«, erklärte Cedric ärgerlich. »Ich bin verheiratet.«
Rob hob eine Braue. »Du warst verheiratet.«
Ein dumpfer Schmerz regte sich bei den so leicht dahingeworfenen Worten in Cedrics Brust. Er überging es. Diesmal. »Und ich bin es wieder.«
Rob zuckte die Schultern. »Mit einer Frau, die du nicht ausstehen kannst. Was spricht also dagegen, euch beide davon zu befreien? Eine Ehe mehr oder weniger macht doch wirklich keinen Unterschied.«
Das machte Cedric für einen Moment wirklich sprachlos. »Ich denke, wir beenden diese Unterhaltung besser«, brachte er nach einigen mühevollen Atemzügen hervor. »Wir sehen uns am Freitag.«
»Warte.« Robert legte ihm die Hand auf die Schulter, ehe er sich ganz abwenden konnte. Auf seinen Zügen lag aufrichtige Reue. »Ich bin zu weit gegangen. Bitte verzeih.«
Cedric furchte die Stirn, aber er sagte nichts. Robert redete schneller, als er dachte, das war schon immer so gewesen. Als ältester Sohn aus reichem Hause hatte er schließlich nie ernsthafte Konsequenzen für sein Handeln erfahren und deshalb auch nicht gelernt, sich zurückzunehmen. Auf der anderen Seite saß Cedric selbst zweifelsohne im Glashaus, was schonungslose Direktheit betraf. Ihre Freundschaft beruhte auf vielen Werten – übermäßiges Taktgefühl war keiner davon. Einen verbalen Tiefschlag wie diesen einfach wegzustecken, erforderte dennoch mehr Versöhnlichkeit, als er in diesem Moment in sich hatte.
»Bitte, Cedward. Lass uns so nicht auseinandergehen. Komm wieder mit rein und trink einen Portwein mit mir. Ich habe gestern erst eine neue Lieferung erhalten, einfach wunderbar, sage ich dir.«
Endlich entschied sich Cedric, den Kopf zu schütteln. »Danke, heute nicht. Ich werde es dir nicht nachtragen, keine Sorge. Und Elaine auch nicht. Aber meine Familie erwartet mich zum Tee, und ich möchte vorher noch bei der Post vorbeischauen. Dr Shaw hatte …« Er räusperte sich, weil seine Stimme unwillkürlich belegt klang. »Er hatte mir ein neues Buch bestellt. Über Schwindsucht.«
Darauf erwiderte Robert eine Weile nichts. Er sah Cedric nur sehr nachdenklich an, und Cedric fragte sich, ob sein ältester und bester Freund seine monatelangen Lügen trotz aller Mühen wohl inzwischen durchschaute. Ob er ahnte, dass es Cedric längst nicht mehr darum ging, die Trauer um seine verstorbene Frau zu verarbeiten, indem er weiterhin regelmäßig die Arztpraxis aufsuchte und alles über die Krankheit lernte, die Adele getötet hatte. Falls dem so war, entschied sich Rob allerdings auch heute dagegen, es anzusprechen.
»Komm zurück ins Leben, mein Freund«, sagte er schließlich bloß und klopfte Cedric auf die Schulter. »Elaine und ich erwarten dich Freitag zum Tee. Einen guten Tag dann noch.«
Die Tür schloss sich mit einem hohlen Laut hinter ihm. Und oben im ersten Stock fiel ein dicker Vorhang zurück an seinen Platz.
Cedric blieb noch einen Moment stehen und sah zum Fenster hinauf. Zu allem Überfluss begann es nun auch noch zu regnen. Warum nur war er nicht überrascht?
Er zog seine Taschenuhr aus der Westentasche und ließ den Deckel aufspringen. Sieben Minuten nach vier. Gerade genug Zeit, um bis nach Camden Town zum Postbüro zu laufen und von dort zurück ins West End, um pünktlich zum Tee daheim zu sein. Der Doktor hatte ihm immerhin zu viel Bewegung an frischer Luft geraten. Bei dem Gedanken entwischte Cedric tatsächlich ein zynisches Lachen, dem ein unangenehmer Husten folgte. Frische Luft. Ausgerechnet hier.
Wie mechanisch strich er mit dem Daumen über den Schriftzug, der in die Innenseite des Uhrendeckels geprägt war. In Liebe. Adele.
Noch ein Husten. Einatmen, ausatmen. Bis sich das Brennen und Stechen in seiner Kehle wenigstens etwas gelegt hatte.
Cedric schloss den Uhrendeckel und rang sich einen letzten tiefen Atemzug ab, ehe er sich auf den Weg machte.
»Komm zurück ins Leben, mein Freund.«
Leichter gesagt als getan.
Kapitel Zwei
Allegretto für vier Hände in C-Dur; Joseph Schuster
11 Hanover Street, West End, London
Sein Haus empfing Cedric mit Licht und Musik, als er später an diesem Nachmittag die Vordertür hinter sich ins Schloss zog. Oder zumindest mit etwas, das Musik hätte sein können, wäre sie nicht von hüpfenden Disharmonien und wechselweise schimpfenden und kichernden Kinderstimmen unterbrochen worden. Er war weniger pünktlich daheim, als er sich vorgenommen hatte, und die Herbstkälte war auf dem Heimweg bis in seine Knochen vorgedrungen. Aber mehr noch als die Wärme des Kohleofens in der Diele oder der Geruch nach Yorkshire Pudding, Bohnen und brauner Soße vertrieb das Lachen seiner Töchter das klamme Gefühl von seiner Haut und aus seinen Gedanken.
»Willkommen zu Hause, Mr Edwards.« Martha, das Dienstmädchen, kam aus der Stube geeilt, als sie die Haustür gehen hörte.
»Guten Abend, Martha.« Er reichte ihr seinen feuchten Mantel und das versiegelte Paket, das tatsächlich bei der Post auf ihn gewartet hatte. »Was soll das sein, das die Mädchen da verbrechen?«
Martha knickste. »Schusters Allegretto«, antwortete sie artig, doch Cedric sah das Lachen in ihren Augenwinkeln. Martha war bei den Edwards beschäftigt, seit Cedric und Adele geheiratet und das Haus in der Hanover Street bezogen hatten. Sie war definitiv Teil der Familie, ihre passive musikalische Bildung war inzwischen in der Tat bemerkenswert, und sie hatte den Haushalt auf ihre eigene Weise fest im Griff. Ganz davon abgesehen, dass sie natürlich über alles Bescheid wusste, was den Tag über im Haus geschah – und Cedric niemals unvorgewarnt in gewisse Begegnungen laufen ließ.
»Ihre Mutter ist zu Besuch«, berichtete sie jetzt in tadellos respektvollem Ton. »Sie bleibt nicht zum Tee, aber sie wollte noch auf Sie warten, ehe sie aufbricht.«
Wie üblich bei dieser Nachricht versteifte Cedric sich sofort. Das Verhältnis zu seiner Mutter war … schwierig, um es milde auszudrücken, und es schien mit jedem Jahr schwieriger zu werden. Besonders kompliziert war es allerdings, seit er auf ihr Drängen hin nur wenige Monate nach Adeles Tod eine neue Frau geheiratet hatte: Ruth Pia Elise Winterfield, inzwischen Edwards, Tochter eines Leinenfabrikanten, der sogar den spanischen Hof belieferte. Auch ihre Stimme hörte Cedric aus dem Musikzimmer dringen. Verzweifelt. Mahnend. Resigniert.
Cedric seufzte leise. Besuche seiner Mutter waren auch deshalb so kräftezehrend, weil Ruth sich dann offenbar verpflichtet sah, ihrer Schwiegermutter zu beweisen, dass sie das Haus und die Familie unter Kontrolle hatte. Sie hatte an diesen Tagen auch weniger Geduld mit den Kindern. Und die Kinder mit ihr.
»Danke«, sagte er zu Martha. »Ich fürchte, ich werde ein ernstes Wort mit den Mädchen reden müssen. Wünsch mir Glück, dass ich vor dem Essen damit fertig bin.«
Martha verzog keine Miene, während sie seinen Mantel aufhängte und das Paket auf der Hutablage verstaute. »Ich stelle den Pudding im Ofen warm, Mr Edwards.« Damit verschwand sie auch schon in die Küche.
Cedric fuhr sich notdürftig durch die noch nebelfeuchten Haare, obwohl er wusste, dass er damit nichts richtete, sondern lediglich zerstörte, was immer von dem Zopf geblieben war, mit dem er die schwarzen Locken am Morgen gebändigt hatte. Dann öffnete er die Tür zum Musikzimmer, wo gerade wieder einmal die ersten Töne von Joseph Schusters Allegretto für vier Hände erklangen.
Seine Töchter saßen nebeneinander auf der breiten Klavierbank. Ericas schmales Gesicht war angestrengt konzentriert, wie immer, wenn sie Klavier spielte. Ada indes gab sich sichtlich wenig Mühe, die Basslinie des Stücks im Tempo ihrer Schwester zu halten, und hatte ihr bereits vorwitzig in die Akkorde gegriffen, ehe sie auch nur den sechsten Takt erreichten.
»Ada!«, heulte Erica protestierend auf. »Lass das, ich kann so nicht spielen! Frau Mutter, sie …«
»Ada, Liebes!« Ruth, die neben dem Flügel stand, hob ebenfalls die Stimme, in einem vergeblichen Versuch, streng zu klingen. Immer wieder huschte ihr Blick zum Sessel am Fenster, in dem – wie von Martha angekündigt – Cedrics Mutter saß. Gewohnt aufrecht und wortkarg, mit perfekt frisierten eisengrauen Locken, ihre ganze Haltung ein Urteil in sich. Das ist Adeles Sessel, dachte Cedric. Niemand sollte so darin sitzen.
»Bitte nimm das Üben ernst.« Ruths Stimme fiel wieder ab, als hätte sie nicht genug Kraft, um mehr als zwei laute Worte zu sprechen. Vermutlich dauerte dieser Kampf schon eine ganze Weile. »Ihr wolltet eurer Großmutter doch zeigen, wie ihr euch verbessert habt.«
An diesem Punkt hielt Cedric es für ratsam, sich bemerkbar zu machen. Er klopfte vernehmlich an den Türrahmen und räusperte sich. »Guten Abend, die Damen.«
Alle vier drehten sich augenblicklich zu ihm um.
»Papa!« Ada, die eben hatte anfangen wollen zu schmollen, bekam leuchtende Augen. »Du bist schon zurück!«
Schon? Cedric lächelte müde. Es fühlt sich an, als wäre ich Wochen von hier fort gewesen.
»Wo liegt das Problem?« Er trat an den Flügel heran, ignorierte den stechenden Blick seiner Mutter, der sich sofort auf ihn richtete, und widmete auch seiner Frau ein Lächeln, obwohl es etwas angestrengt geriet. »Danke, Mrs Edwards. Sie können das von hier an mir überlassen.«
Ruth presste einen Moment die Lippen zusammen. Erneut huschte ihr Blick zu Cedrics Mutter, weiter zu den Kindern, und kehrte schließlich zu ihm zurück. Der Widerstreit zwischen der Erschöpfung, der sie gern nachgeben wollte, und dem dringenden Wunsch, die Situation doch noch selbst in den Griff zu bekommen, war ihr deutlich am Gesicht abzulesen. Die Erschöpfung gewann. Der Preis war ein Gefühl der Demütigung, das Cedric leider sehr gut verstand.
»Danke. Ich gehe Martha in der Küche zur Hand.« Das Tempo, mit dem Ruth den Raum verließ, glich einer Flucht. Die Tür fiel etwas zu laut hinter ihr ins Schloss. Beklemmende Stille blieb zurück.
»Siezt du sie etwa immer noch?«
Betont langsam wandte Cedric sich zu seiner Mutter um, die genauso unbeugsam in Adeles Sessel saß wie zuvor. »Und hast du nichts Besseres zu tun, als dazusitzen und allen im Haus das Gefühl zu geben, versagt zu haben?« Er furchte ärgerlich die Stirn und legte eine Hand auf Ericas Schulter, weil er wusste, dass solche Situationen sie sehr mitnahmen. Ada verwand solche Dinge leichter, trotzdem war auch sie jetzt ungewöhnlich still. Genau deshalb hasste Cedric es, diese Art Gespräche vor den Kindern zu führen. Seiner Mutter, das wusste er leider, war das allerdings egal. Die harten Linien in ihren Mundwinkeln vertieften sich. Bittere Belustigung war schon immer ihre schärfste Waffe gewesen.
»An dir zu versagen ist nun wirklich keine Schande. Das habe ich selbst schon hinter mir. Auch wenn ich Ruth gewünscht hätte, dass du zu ihr gnädiger bist und ihr gelingt, was ich nicht konnte. Eine fromme Hoffnung ohne Zukunft, wie es scheint.« Sie schnaubte leise und faltete die Hände im Schoß ihres smaragdgrünen Kleides. »Sieh dich doch an. Kommst hier zu einer Unzeit herein wie ein Landstreicher und hältst es nicht einmal für nötig, deine Mutter zu begrüßen. Denkst du nicht, deine Familie hat etwas mehr Respekt verdient?«
Erica sprang auf. Sie hatte schon immer einen feinen Sinn für Gerechtigkeit gehabt – und sehr viel Mut für eine Achtjährige. »Papa ist kein Landstreicher!«
Cedric drückte sanft ihre Schulter, obwohl er sich selbst nur schwer davon abhalten konnte, seine Mutter grob anzufahren. »Schon gut, Erica. Selbst wenn es so wäre, wäre das nicht halb so schlimm, wie deine Großmutter es uns weismachen will. Landstreicher sind ja nicht von Natur aus schlechte Leute.«
Seine Mutter lachte kurz und trocken auf. »Sag das noch mal, wenn du auf der Straße sitzt.«
Cedric schloss die Augen und zählte bis fünf. Es brachte doch nichts. Es brachte einfach nichts. »Was willst du, Mutter? Martha sagte, du hast auf mich gewartet. Wie ich dich kenne, tust du das nicht ohne Grund.«
Seine Mutter verengte leicht die Augen. »Ob du es glaubst oder nicht, Cedric, ich wollte meinen Sohn sehen – da er sich freiwillig ja nie bei mir blicken lässt.«
Cedric sagte nichts darauf. Die Enttäuschung war gut platziert, und sie wirkte: Ein altbekanntes Gefühl von Schuld stieg in ihm auf, gegen das er sich nicht wehren konnte. Es stimmte, er besuchte sie so gut wie nie, und das schon seit der Heirat mit Adele. Es war außerdem schwer, seiner Mutter vorzuwerfen, dass sie sich für ihren einzigen Sohn und dessen Sprösslinge ein Leben wünschte, das nach den gesellschaftlichen Normen, mit denen sie aufgewachsen war, als gut und sicher bezeichnet werden konnte. Nur waren diese Normen einfach nicht, woran Cedric glaubte, und schon gar nicht passten sie zu dem Leben, das er sich mit Adele aufgebaut hatte. Er wollte nicht ausgeschlossen werden von der Kindererziehung und der Gestaltung ihres Heims, weil das keine Männersache war. Adele wiederum hatte es sich auch als Mutter und Ehefrau nicht nehmen lassen wollen, weiter als Goldschmiedin zu arbeiten und Literatur zu studieren. Und das war nur der Anfang einer langen Liste von Dingen, die sie anders gehandhabt hatten als andere junge Ehepaare. Sie waren eigenbrötlerisch gewesen im Blick der Öffentlichkeit, verschroben und dabei ausgesprochen glücklich, und Cedric war es leid, das immer wieder rechtfertigen und diskutieren zu müssen. Umso mehr – und schmerzlicher –, seit Adele nicht mehr da war. Seine Mutter und er konnten sich nicht einig werden. Es war ebenso bitter wie unmöglich.
»Also gut«, sagte er beherrscht. »Du hast mich gesehen, ich lebe noch. Jetzt würde ich gern mit meinen Töchtern Klavier spielen. Allein. Bitte geh.«
Die Augen seiner Mutter weiteten sich, als könne sie nicht glauben, was er gerade gesagt hatte. Aber diesen Blick bekam Cedric oft von ihr, und natürlich glaubte sie es. Weil das schlicht die Art war, wie sie seit Jahren miteinander sprachen.
»Sei wenigstens anständig zu der Frau, die du geheiratet hast. Es geht nicht an, dass du sie nach einem Jahr Ehe immer noch wie eine Fremde behandelst.« Sie erhob sich steif. »Ruth ist dir eine gute Gattin. Sie bewahrt dich vor dem endgültigen Verfall, Cedric. Fang endlich an, dankbar dafür zu sein, was dir geschenkt wurde.« Sie wandte sich an Erica und Ada. »Mädchen? Werdet nicht wie euer Vater, ich rate es euch im Guten.« Und ohne noch eine Antwort abzuwarten, rauschte sie aus dem Zimmer.
Cedric sah ihr wortlos nach. Er war sich bewusst, dass Ada und Erica ihn verunsichert und eingeschüchtert ansahen, und dass es jetzt in seiner Verantwortung lag, sie irgendwie zu Normalität und Alltag zurückzuführen. Doch das musste warten, bis sein Puls sich beruhigt hatte und ihm das Lächeln wieder leichterfiel.
Musik. Musik wird helfen. Sie hilft immer.
»Also.« Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und beugte sich über die Köpfe seiner Töchter hinweg zur Partitur. »Jetzt zu euch. Was haben wir hier für ein Problem?«
»Ada spielt immer falsch!«, beschwerte sich Erica prompt – und endlich wieder so forsch, wie Cedric es von ihr gewohnt war. Auch sie musste unfassbar erleichtert sein, dass die beklemmende Situation vorbei war. »Mit Absicht!«
Ada zog einen Flunsch. »Aber du spielst zu schnell! Ich kann nicht so schnell. Meine Hände sind zu klein. Papa, sie wartet einfach nicht auf mich, das ist so gemein!«
»Ach, jetzt bin ich auf einmal schuld!« Erica stemmte eine Hand in die Hüfte und richtete die andere anklagend auf ihre Schwester. »Du ärgerst mich schon die ganze Zeit!«
»Weil ich keine Lust habe, wenn du so schnell spielst, wie ich nicht kann!«
»Mädchen! Genug jetzt. Mir fallen noch die Ohren ab.« Cedric musterte Erica streng und hoffte, sie würde nicht merken, wie wohltuend und heilsam er diesen ganz normalen Kinderstreit nach dem gerade überstandenen Zusammenstoß mit seiner Mutter empfand. »Du möchtest also schneller spielen und glaubst deiner Schwester nicht, dass ihre Hände zu klein dafür sind?«
Erica holte tief Luft. »Ja, aber …«
»Also glaubst du dann vielleicht auch, dass du es mit meinen Händen aufnehmen kannst?«
Ericas Augen wurden groß. »Oh. Ich …« Entschlossen reckte sie das spitze Kinn vor. »Jederzeit.«
Ada stieß ein entzücktes Quietschen aus, und Cedric hob eine Braue. »Ach, so ist das? Nun denn. Ada, würdest du für mich den Platz räumen?«
Ada rutschte augenblicklich vom Hocker – nur um umgehend auf Cedrics Schoß zu klettern, kaum dass er Platz genommen hatte. Die feinen hellroten Locken kitzelten seine Wange, und eine Flut von Liebe stieg hinter Cedrics Nasenbein hinauf, um sich kribbelnd hinter seinen Augenlidern zu sammeln.
Es ist gut. Es wird alles gut. Wir schaffen das schon irgendwie.
Er räusperte sich belegt und griff um Ada herum, um seine Hemdsärmel zu den Ellbogen hochzukrempeln. »Nun gut, Miss Erica. Wollen wir dann?«
Erica sagte nichts, vermutlich konnte sie nicht, weil sie
die Lippen so angespannt aufeinandergepresst hatte, die Finger schon auf den Tasten und den Oberkörper vorgebeugt.
Ein Lächeln schlich sich auf Cedrics Gesicht. »Also bereit. Eins-und-zwei-und …«
Sie begannen in moderatem Tempo. Cedric ließ Erica zuerst selbst bestimmen, wie rasch sie sich steigern wollte. Doch schon im zweiten Durchgang begann er ihr ein wenig davonzuziehen; zunächst nur eine Winzigkeit voraus, dann in größeren Schritten, bis ihre Finger förmlich über die Tasten flogen, um ihn wieder ein- und dann zu überholen. Ada auf seinem Schoß jauchzte begeistert, als Cedric den nächsten Durchgang noch ein bisschen schneller spielte, um sie noch mehr anzustacheln – nur um dann kurz vor Schluss die Hände von den Tasten zu nehmen, während Erica die letzten Töne in die Klaviatur hämmerte, als wollte sie sie zertrümmern. »Ich gebe auf! Ich gebe auf!«
Schwer atmend saß seine ältere Tochter neben ihm. »Ehrlich?«
»Ich komme nicht mehr mit. Du hast gewonnen.«
Erica zog misstrauisch die dunklen Brauen zusammen. »Du hast mich doch nicht gewinnen lassen, oder?«
Cedric hob die Hände und lachte. »Niemals, Miss, sehe ich aus, als würde ich das wagen?« Das Lachen verklang. Es hielt sich dieser Tage niemals lange. Das Lächeln blieb, immerhin – selbst wenn er jetzt trotzdem noch eine kleine Moral weitergeben musste. »Aber sieh mal, Erica. Da du sogar für meine großen Hände zu schnell spielst, denkst du nicht, du solltest etwas mehr auf deine Schwester warten? Wenn du dich ein bisschen an sie anpasst, kann sie noch viel von dir lernen. Und du, Ada«, fuhr er fort, ehe sich seine jüngere Tochter triumphierend in die Brust werfen konnte, »du versuchst es in Zukunft bitte mindestens fünfmal ernsthaft, ehe du anfängst, Unfug zu machen. Ich zwinge dich nicht zum Üben, aber wenn Erica mit ihren Stücken vorankommen möchte, ist es nicht in Ordnung, wenn du sie störst.«
Erica schnaufte. Ihre Wangen hatten sich vor Verlegenheit gerötet. »Tut mir leid.«
Auch Adas Mundwinkel sanken nach unten. »Entschuldigung, Papa.«
»Entschuldigt euch nicht bei mir, sondern beieinander. Oder lasst es, und versprecht, dass ihr beim nächsten Mal besser zueinander seid. Hand drauf.«
Einige Sekunden lang drucksten Ada und Erica noch betreten herum. Dann reichten sie sich tatsächlich die Hände.
»Spielst du jetzt was für uns?« Ada drehte sich auf seinem Schoß zu ihm um. Die Verstimmung war so schnell von ihrem Gesicht verschwunden, wie sie gekommen war.
Cedric schmunzelte und strich ihr eine vorwitzige Locke aus der Stirn. »Und was schwebt euch da vor?«
Ein schelmisches Funkeln leuchtete in Adas Augen auf, und Cedric wusste sofort, was sie fordern würde. »Soler!«
»O nein.«
Jetzt leuchtete Adas ganzes Gesicht. »Sonate Nr. 90!«
Cedric schüttelte energisch den Kopf. »Kein Soler in diesem Haus!« Er verabscheute dieses Stück. Zu verspielt und zu viel Schnickschnack für sein Empfinden. Das änderte allerdings nichts daran, dass seine Töchter es liebten.
»Dann Tschaikowsky!«, warf Erica triumphierend ein. »Wenn du Soler nicht willst, musst du Tschaikowsky spielen.«
»Tschaikowsky?! Dieser neumodische Krempel?«
»Papa!« Ada legte ihre kleinen Hände an seine Wangen und sah ihm streng in die Augen. »F-Dur. Jetzt.«
Cedric seufzte ergeben, als sich ein weiteres Lächeln auf seine Lippen stahl. Wenn sie ihm mit Tschaikowsky drohten, was sollte er dann noch tun? Dann doch lieber Soler. Sie hatten es sich außerdem verdient. An diesem Tag noch mehr als sonst. Also legte er die Finger auf die Tasten und spielte, was seine Töchter sich von ihm wünschten.
Kapitel Drei
»Unjust Life«; Ai Kamachi, Tatsuo Nagami; Arr. Jeremy Ng
11 Hanover Street, West End, London
Später am Abend saßen Cedric und seine Frau vor dem Kamin im Salon. Martha hatte ihnen Tee und Gebäck gebracht und sich dann zurückgezogen. Die Mädchen schliefen schon, und das Haus war still bis auf das Knistern der Flammen in den Holzscheiten. Es war ein Ritual, an dem sie festhielten, Cedric und die neue Mrs Edwards – diese zweisame Stunde am Abend, nur für sie beide, obwohl sie sich im Grunde nie etwas zu sagen hatten. Ruth stickte und Cedric las die Tageszeitung, und wie gewöhnlich schwiegen sie sich an.
Allerdings glaubte Cedric an diesem Abend zu erkennen, dass seiner Frau etwas auf der Seele lag, das schwerer wog als die übliche Stille. Sie stickte langsamer als sonst und hatte sich schon dreimal mit einem leisen Schmerzenslaut in den Finger gestochen. Wann immer Cedric zu ihr hinsah, spürte er geradezu körperlich, wie das Unausgesprochene aus ihr herausdrängte. Trotzdem schwieg sie weiter, während die Uhr auf dem Kaminsims die verbleibenden Minuten ihrer Abendstunde herunterzählte.
Cedric machte sich nichts vor. Dass sie nicht miteinander sprachen, war in erster Linie, wenn nicht vollständig, seine Schuld. In den bisherigen Monaten ihrer Ehe hatte er jedenfalls wenig bis nichts dafür getan, ein Klima zu schaffen, in dem sie einander persönliche Dinge anvertrauen konnten. Gründe dafür gab es viele: Weil es viel zu früh für eine neue Ehe war und er Adeles Tod noch nicht annähernd verwunden hatte. Weil er in Wahrheit überhaupt nicht wieder hatte heiraten wollen. Weil er bereute, es trotzdem getan zu haben. Und nicht zuletzt, weil seine Mutter Ruth für ihn ausgesucht hatte und er ihr deshalb unterstellte, dieselben Wertvorstellungen zumindest in Grundzügen zu teilen. Dabei wusste er nicht einmal mit Sicherheit, ob das zutraf.
Ruth gegenüber war all das fraglos ungerecht, nur wusste Cedric auch nicht, wie er es ändern sollte. Er hatte unfassbar falsch eingeschätzt, wie schwer es ihm fallen würde, mit einer Frau zusammenzuleben, die nicht Adele war. Und das Gefühl, nun ohne Ausweg in dieser neuen Ehe gefangen zu sein, machte es noch schwerer, sich seiner eigenen Ungerechtigkeit zu stellen.
Heute allerdings hatte Ruth offenbar ebenso unter dem Zusammenprall im Musikzimmer gelitten wie er. Womöglich war dies also der Tag, endlich einen Schritt auf sie zu zu tun. Anständig zu ihr zu sein. Seine Mutter hatte ja leider bei Weitem nicht mit allem unrecht, was sie ihm vorwarf. Daher faltete Cedric die Zeitung schon weit vor Ablauf ihrer gemeinsamen Stunde zusammen und legte sie auf den Beistelltisch.
Ruth sah überrascht von ihrer Stickerei auf.
»Was haben Sie auf dem Herzen, Mrs Edwards?«
Ruths Lippen zuckten kurz. Dann senkte sie den Blick wieder auf ihre Hände. »Nichts«, erklärte sie mit verräterisch dünner Stimme.
Cedric räusperte sich. Er hätte es an dieser Stelle gut sein lassen können. Es wäre der einfachste Ausweg für sie beide gewesen, aber es fühlte sich nicht richtig an.
»Geht es um den Besuch meiner Mutter? Hat sie Ihnen das Gefühl gegeben, Sie würden etwas falsch machen?«
Einige Herzschläge lang war Ruth sehr still. Cedric sah ihre Finger weiß werden, weil sie die Nadel viel zu fest hielt. »Nein«, sagte sie endlich. »Darum geht es nicht.«
Cedric runzelte die Stirn. »Worum dann? War es die Klavierstunde der Mädchen? Es tut mir leid, dass Sie es heute so schwer mit ihnen hatten. Ich werde noch einmal mit ihnen darüber sprechen.«
Ruths Kopf ruckte in die Höhe. Sie starrte ihn aus ihren hellen Augen an, als könne sie nicht fassen, dass er ausgerechnet das für den Grund ihrer Anspannung hielt. »Natürlich nicht.«
Nein, dachte Cedric, um ehrlich zu sein, hätte ihn das auch gewundert. Bei allem, was sonst schieflief, hatte es nie Grund zu Bedenken gegeben, was das Verhältnis zwischen Ruth und den Kindern betraf.
»Also schön. Dann sagen Sie mir bitte, was los ist.« Allmählich wurde er ungeduldig, und auch das war natürlich schon wieder ungerecht. Doch er fand es wirklich schwer auszuhalten, dass sie nicht mit der Sprache herausrückte. »Reden Sie mit mir, Mrs Edwards.«
Ein wütendes Funkeln trat bei seinen Worten in Ruths Augen – und in diesem Moment erkannte Cedric, dass ihr Geduldsfaden womöglich noch kürzer davor war zu reißen als seiner. »Es geht darum«, fuhr sie auf, »dass ich mich in meinem eigenen Haus nicht willkommen fühle!«
Im ersten Moment wollte Cedric heftig erwidern. Sie ebenfalls wütend anfahren, dass dies immerhin auch nicht ihr Haus war, sondern seines und Adeles und das ihrer Kinder.
Er kam nicht dazu, ehe etwas in ihm klickte. Eine Erkenntnis rastete ein, und die Worte blieben ihm im Hals stecken.
Das war es.
Genau das war Ruths Problem: Dieses Denken, das er offenbar so tief in sich verankert hatte, dass er es selbst dann nicht überwinden konnte, wenn er sich Sekunden zuvor vorgenommen hatte, etwas daran zu ändern.
Es war dieser Moment, in dem Cedric zum ersten Mal wirklich klar wurde, dass ihre Ehe nicht nur ihn mit Ruth in diesem Haus einsperrte. Sondern auch Ruth mit ihm. Er war ihr Problem, weil er sie um ihre Hand gebeten hatte, ohne sie in seinem Leben zu wollen. Er hatte ihr damit die Chance auf ein echtes Zuhause genommen; auf eine Partnerschaft, in der sie sich geliebt und respektiert fühlen konnte, wie sie es verdiente.
Das Begreifen war erschütternd. Die darauffolgende Selbstverachtung ebenso.
»Ich erwarte ein Kind.«
Die Worte fielen seltsam laut in die Stille zwischen ihnen. Cedric hörte sie, ohne sie gleich zu begreifen, wie ein Gesprächsfetzen aus einem Traum, dessen Kontext im Schlaf verloren gegangen war. Doch sein Verstand hatte die Information offenbar schneller verarbeitet, als sein Bewusstsein es konnte.
»Sind Sie sicher?«, hörte er sich mit heiserer Stimme fragen, im selben Moment, in dem das Zittern in seinen Fingern begann. Cedric ballte die Hand zur Faust. Bitte. Nicht auch das noch. Nicht jetzt.
Aber das Zittern kam immer, wenn er es am wenigsten gebrauchen konnte. Stressinduziert, hatte Dr Shaw es genannt.
Ruth legte die freie Hand auf ihren Bauch. Tränen traten ihr in die Augen. »Ich war heute bei einer Hebamme«, flüsterte sie. »Man kann schon einen Herzschlag hören. Und manchmal spüre ich es treten.«
Das Zittern wurde stärker. Cedric versuchte, ruhig zu atmen. Konnte es sein? War es möglich? Er kam seinen ehelichen Pflichten nicht allzu oft nach. Schon bei Adele hatte er das Bedürfnis nach dieser Art von Nähe nur äußerst selten verspürt, obwohl sie sich sonst auf jede erdenkliche Weise nahe gewesen waren. Mit Ruth war es noch schwerer, sich wenigstens hin und wieder dazu zu überwinden, aber er tat es. Vor allem, um Ruths Selbstwertgefühl nicht noch mehr mit Füßen zu treten, als er es ohnehin täglich tat. Es war demnach möglich. Überaus möglich.
»Sie freuen sich also nicht.« Ruths Stimme war rau – und zugleich bitter gefasst, als wäre es genau die Reaktion, mit der sie gerechnet hatte.
Cedric schwieg. Sein Hals war wie zugeschnürt. Nein, er freute sich nicht. Wie hätte er sollen? Allerdings nicht aus dem Grund, den sie vermutete.
Ein heftiges Zucken fuhr seinen Arm hinab. Er bemerkte es gerade rechtzeitig, um die Hand fest um seine Teetasse zu schließen und die Bewegung dafür zu nutzen, sie mit voller Kraft gegen das Kaminsims zu werfen. Das Porzellan zersprang mit hellem Klirren, und Ruth entfuhr ein Schrei.
Mit einem steifen Ruck kam Cedric auf die Füße. »Bitte um Verzeihung«, brachte er schwer atmend hervor. Doch er konnte seiner Frau dabei nicht ins Gesicht sehen. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, hörte er Ruth aufschluchzen, doch er drehte sich nicht noch einmal um. Irgendwann später würde er die Kraft und die Worte finden müssen, sich zu entschuldigen. Sich ihr wenigstens zu erklären, sie aufrichtig um Verzeihung zu bitten, wenn es schon keinen Trost für sie gab. Aber nicht jetzt. Egal was, es konnte nicht jetzt sein. Denn wovor Cedric in diesem Moment floh, war nichts, was diese junge werdende Mutter auch nur ansatzweise erahnen durfte:
Das Bild seiner selbst, wie er sein neugeborenes Kind hielt und es ihm einfach aus den Fingern glitt.
Kurz darauf saß er wieder am Flügel. Allein diesmal, und ohne Licht im Musikzimmer anzuzünden. Cedric starrte in die Dunkelheit und versuchte den tröstlichen Moment heraufzubeschwören, den er hier erst vor wenigen Stunden mit seinen Töchtern geteilt hatte.
Stattdessen sah er Adele, blass und schmal, wie sie im Sessel beim Fenster saß. In eine Decke gewickelt, die Haut fahl und das Haar stumpf. Nur ihre Augen glänzten, und sie lächelte. Er hatte für sie gespielt. Ein Lied, das nur ihr gehörte. Das sie und ihn, was immer geschah, daran erinnern sollte, dass sie zusammengehörten und -bleiben würden.
Für immer. Immer.
Cedrics Finger bewegten sich wie von selbst. Erst zögernd, dann fließender, als würde das Lied sie mit sich ziehen. Fanden die Töne, die er seit damals nicht mehr gewagt hatte anzurühren, weil er wusste, was sie in ihm bewegen mussten. Was sie freilegen würden. Blank und wund und verletzlich, und nicht einmal durch den strömendsten Regen fortzuwaschen.
Jetzt sah er sie wieder. Er sah Adele und Erica und Ada, und er sah sich selbst, wie ihm alles zwischen den Händen zerfiel. Das Zittern lief von Cedrics Schultern die Arme hinab, als die Melodie von Adeles Lied in verzweifeltem Crescendo anschwoll. Die Finger auf den Tasten bebten. Zuckten. Vergriffen sich.
Und dann ein neues Bild. Das ungeborene Baby. Wie es starb. Und dann er selbst.
Der Flügel verstummte, als Cedric den Kopf auf die Tasten legte und weinte.
Als er wieder zur Ruhe kam, zwang er sich auf die Füße und schleppte sich die Treppe hinauf ins Kinderzimmer. Das Mondlicht beleuchtete die Gesichter der friedlich schlafenden Mädchen. Ada war, wie so oft, zu Erica unter die Decke gekrabbelt und hatte sich fest an sie gekuschelt. Eine kleine Ewigkeit stand Cedric neben dem Bett und sah auf die beiden hinunter. Dann legte er sich neben Ada und rollte sich um den kleinen Körper zusammen; vergrub die Nase im weichen Kinderhaar, während seine Hand über sie hinweg nach Ericas Fingern tastete.
Von allem, was ihm auf der Welt geblieben war, dachte Cedric erschöpft, waren diese Kinder das Einzige, was ihm noch Frieden geben konnte. Sie brauchten ihn ebenso sehr, wie er sie brauchte. Auch das neue Baby würde ihn brauchen. Er konnte sie nicht allein lassen. Und er konnte auch Ruth nicht allein lassen, der er bis hierher so ein furchtbarer Partner gewesen war.
Es gab noch so viel gutzumachen.
Es musste einen Weg geben.
Kapitel Vier
Requiem in d-moll; Wolfgang Amadeus Mozart
99 Cambridge Street, Westminster, London
Die Praxis Dr & Dr Shaw lag in einer der derzeit privilegiertesten Gegenden für die Schaffenden der oberen Mittelklasse, unweit des malerischen Regent’s Park, wo die Patientinnen und Patienten den Rat zur Ertüchtigung unter freiem Himmel ohne Umweg in die Tat umsetzen konnten. Es war ein gutes Stück von der Oxford Street bis zur Praxis. Aber Kutschfahrten kosteten Geld, das Cedric nicht übrig hatte. Außerdem bot der Spaziergang die willkommene Gelegenheit, sich vom dichten Nieselregen so gründlich wie möglich durchnässen zu lassen. Äußere Unbequemlichkeiten lenkten ihn einfach immer noch am effektivsten von den inneren ab. Cedric war es lieber, sich nass zu fühlen anstatt krank, das Gewicht eines regengetränkten Mantels war besser als das des Gewissens, weil der Morgen nach dem Streit mit Ruth in gerechtfertigt eisigem Schweigen verstrichen war, und das Tröpfeln in den Zweigen und das Knirschen seiner Sohlen auf Kies und alten Blättern klang friedlicher als Mozarts Requiem in seinem Kopf. Er hatte es auf Adeles Trauerfeier gespielt. Jetzt wohnte es dort und tauchte immer dann auf, wenn die Welt zu ruhig um ihn wurde. Seit jenem Tag hatte Cedric keinen Regenschirm mehr angefasst. Wenn es nach ihm ging, war es unbedingt das kleinere Übel, den Doktoren auf die teure Fußmatte tropfen zu müssen, während er den Türklopfer betätigte.
Man kannte ihn hier. Niemand wunderte sich mehr über ihn. Nicht die Praxisgehilfin Miss Bonnet, die ihm öffnete – »Guten Tag, Mr Edwards!« –, noch der Hausbedienstete Mr Bernard, der ihm den Mantel abnahm und ein Handtuch reichte, ehe er ihn in den Wartebereich führte – »Dr Shaw empfängt Sie sofort, Mr Edwards. Darf ich Tee bringen?« –, und schon gar nicht die Doktoren Shaw persönlich. Vermutlich hätten sie es absonderlicher gefunden, wenn er eines Tages in weniger derangiertem Zustand hier aufgetaucht wäre.
Die Einzige, vor der es Cedric jedes Mal unangenehm war, in keiner angemesseneren Verfassung zu sein, wardie Frau Doktor. Oder vielmehr: Dr med. Justine-Kate Shaw, denn sie hatte ihren Titel mitnichten angeheiratet. Sie war selbst studierte Ärztin mit Spezialisierung auf die Krankheiten der Psyche und nicht nur deshalb eine außergewöhnliche Persönlichkeit, weil sie gebürtige Amerikanerin war. Cedric war sich nicht sicher, wie üblich es in den Vereinigten Staaten war, dass die Ehefrau eines Arztes selbst praktizierte, statt sich um die Organisation des beachtlich wohlhabenden Haushalts und die Erziehung der Kinder zu kümmern. Sehr britisch war es definitiv nicht, aber es war durchaus einer der Gründe gewesen, warum Adele und er sich für diese Praxis entschieden hatten, als ihre Tuberkuloseerkrankung eine engmaschigere ärztliche Betreuung nötig machte. Auch wenn, das musste Cedric zugeben, es eine Weile gedauert hatte, bis er sich an den schroffen Charme gewöhnt hatte, mit dem sie geführt wurde. Als Adele ihm zuerst von einer praktizierenden Ärztin und Psychoanalytikerin in Westminster berichtet hatte, hatte er sich eine schmalknochige Person mit tief sitzender Brille und feingeistigem Auftreten vorgestellt, doch er hätte nicht falscher liegen können. In Wahrheit nämlich war Dr Shaw von stabiler, geradezu vierschrötiger Gestalt. Auch ihre Züge waren harsch, mit breitem Kiefer, hoher Stirn und eng stehenden rauchgrauen Augen unter rotblondem Haar. Vor allem jedoch hatte sie bisweilen eine irritierende Art, ihn anzusehen – abschätzend und irgendwie wertend. Es reizte Cedric jedes Mal zu Widerspruch, dabei wusste er nicht mal, wogegen eigentlich.
Auch heute war ihre Aura spürbar unterkühlt, während sie eine ihrer Patientinnen an Cedric vorbei durch den Vorraum auf die Diele geleitete. Dabei würdigte sie ihn kaum eines Blickes, aber das war auch nicht nötig. Justine-Kate Shaw brauchte nur Sekunden, um einen Raum durch ihre bloße Anwesenheit vollständig einzunehmen. Cedric gab vor, sich ganz seinem Tee zu widmen, und beobachtete das schwerfällige Treiben der Blätter im Herbstwind über dem Regent’s Park. Für gewöhnlich ließ sie ihn damit davonkommen.
Heute hatte er dieses Glück nicht.
»Mr Edwards.« Sie blieb vor ihm stehen, und Cedric hatte keine andere Wahl, als seinen Tee beiseitezustellen und aufzustehen, wenn er nicht unhöflich oder respektlos sein wollte. »Dr Shaw.«
»Das ist bereits ihr zweiter Termin in dieser Woche. Allmählich könnte man meinen, Sie gehörten zum Inventar.« Sie musterte ihn kritisch von oben herab. Auch das war Teil ihrer außergewöhnlichen Erscheinung: Sie war mindestens einen halben Kopf größer als er. Nun war Cedric zwar selbst kein hochgewachsener Mann. Trotzdem musste er auch zu den meisten Herren seines Bekanntenkreises nicht so weit aufblicken wie zu ihr.
Er räusperte sich und gab sich Mühe, nicht zu dem feuchten Fleck hinüberzusehen, den er auf dem staubgrünen Samtbezug des Sessels hinterlassen hatte. »Ihr Mann sagte, Sie würden im Lauf der Woche die Ergebnisse aus Frankreich erhalten. Von diesem Labor für Blutanalyse.« Zumindest war es das, was Dr Harold Shaw ihm einige Wochen zuvor erklärt hatte: Dass seine Frau Verbindungen zu einer noch recht jungen Forschungsgruppe in Paris pflegte, die sich mit der Mikroskopie von Blutbestandteilen beschäftigte und sich davon Therapieansätze für bislang unheilbare Krankheiten versprach. Cedric hatte von Mikroskopie natürlich keine Ahnung, geschweige denn je von so etwas wie Blutbestandteilen gehört, doch als Dr Shaw ihm erzählte, dass es den Forscherinnen und Forschern chronisch an Versuchspersonen mangelte, hatte er nicht gezögert. Übermäßige Skepsis neuen Methoden gegenüber konnte er sich nicht leisten, solange sie auch nur die geringste Chance auf eine Heilung boten. Und sie bezahlten sogar eine kleine Entschädigung dafür, dass sie sein Blut untersuchen durften.
Dr Shaw ließ sich derweil nicht anmerken, ob sie die Ergebnisse bereits mit ihrem Mann besprochen hatte.
»Sie tragen immer noch Trauer«, bemerkte sie stattdessen mit einem Blick auf die schwarze Halsbinde um seinen Hemdkragen. »Nach mehr als einem Jahr.«
Cedric runzelte überrascht die Stirn. Da war etwas in ihren Worten, das sich kribbelnd in seiner Brust zusammenzog und eine flüchtige Wärme hinterließ, wo sonst der dumpfe Schmerz der Trauer saß. Auch ihre Stimme war weicher als sonst. Geradezu sanft.
»Ach, wissen Sie«, murmelte er belegt, »vielleicht trauere ich schon vorgreifend um mich selbst.«
Dr Shaw verengte leicht die Augen, und Cedric hatte plötzlich das Gefühl, ihren Blick tief in seiner Brust zu spüren, wo es zuvor noch gekribbelt hatte. Als würde sie in seiner Seele eine Seite umblättern.
In diesem Moment öffnete sich die zweite Tür auf der anderen Seite des Raums, und Dr Harold Shaw erschien auf der Schwelle. »Ah, Mr Edwards. Kommen Sie herein.«
Das Gefühl verging. Ihr Blick gab ihn frei. »Guten Tag, Mr Edwards«, sagte Dr Shaw, noch immer mit dieser sanften Stimme.
»Guten Tag, Doktor«, antwortete Cedric verwirrt und zwang sich, ihr noch einmal zuzunicken. Dann folgte er seinem Arzt ins Behandlungszimmer.
Im Gegensatz zu seiner Frau war Dr Harold Shaw ein eher gebeugter Mann, wenn auch auf eine recht schroffe, geradezu zerklüftete Art und Weise. Er trug keinen Bart, war aber auch nie glattrasiert, und sein Atem hatte bisher an den meisten Tagen, an denen Cedric ihm begegnet war, nach Branntwein gerochen. Auch heute zeigten seine Bewegungen eine gewisse Schwerfälligkeit, während er durch den abgedunkelten Raum schlurfte, vorbei an den Regalen voller staubschwerer Folianten und in Formalin eingelegter Präparate, von denen Cedric die allermeisten nicht einmal hätte benennen können. Während seiner Termine hatte er gelegentlich versucht, die Beschilderung zu entziffern. Doch die Handschrift darauf war so verblichen und unleserlich, dass er jedes Mal schnell wieder aufgab.
»Nehmen Sie Platz, Mr Edwards.« Der Doktor fiel mehr in den Stuhl hinter seinem ausladenden Teakholzschreibtisch, als dass er sich setzte, und wies mit dem Pfeifenstiel auf den Sessel gegenüber. »Wie geht es Ihnen heute?«
Cedric wusste viele mögliche Antworten auf diese Frage. Trotzdem beließ er es wie so oft bei einem Schulterzucken. »Unverändert, soweit ich das beurteilen kann.«
Dr Shaw klopfte seine Pfeife in einem Aschenbecher aus und sah auf die Akte hinunter, die aufgeschlagen vor ihm lag. »Möchten Sie rauchen?«
Cedric schüttelte den Kopf. »Ich habe es mir abgewöhnt. Man sagt, es sei ungesund.«
Dr Shaw lachte ein bellendes Lachen. »Als ob das in Ihrem Fall noch einen Unterschied machen würde.«
Darauf sagte Cedric nichts. Er spürte nur einmal mehr ein vages Erstaunen darüber, wie wenig ihn diese Unverblümtheit, was seine Lebenserwartung betraf, aus der Bahn warf. »Also haben diese Blutuntersuchungen nichts ergeben?«, fragte er stattdessen und wünschte sich, er hätte seinen Tee nicht draußen auf dem Tisch stehen lassen.
Dr Shaw ließ eine Tabakdose aufschnappen und begann, seine Pfeife neu zu stopfen. »Sie wissen, dass Sie sterben werden, Mr Edwards.«
»Und ich sagte Ihnen, ich kann nicht sterben, Doktor. Meine Familie braucht mich.«
Der Doktor klemmte sich die Pfeife zwischen die Lippen und schnaubte. Es war schwer zu sagen, ob es ein belustigter oder ein gereizter Laut war. »Die Sturheit allein soll schon Menschen am Leben gehalten haben, sagt man. Üblicherweise spricht man dabei allerdings von alten Leuten.« Er entzündete ein Streichholz und hielt es an den Tabak, der knisternd aufglühte.
Cedric zuckte erneut die Schultern, obwohl es sich ein bisschen steif anfühlte. »Wie sollen wir jetzt weiter vorgehen?«
Dr Shaw paffte eine Weile schweigend vor sich hin. Dann ließ er sich mit leisem Ächzen in seinem Stuhl zurücksinken. »Wie lange sind Sie inzwischen bei mir in Behandlung, Mr Edwards?«
»Etwas mehr als acht Monate.« Denn zu diesem Zeitpunkt, an einem ungewöhnlich sonnigen Tag im letzten Winter – um genau zu sein, fünf Monate nach Adeles Tod und nur etwa eine Woche nach der Hochzeit mit Ruth –, hatte Cedric zum ersten Mal die Anzeichen der Krankheit an sich bemerkt. Jener Krankheit, von der er zuerst geglaubt hatte, es sei dieselbe, die Adele über drei Jahre hinweg jeden Tag ein Stück ihres Lebens genommen hatte: die Schwindsucht. Die Symptome hatten auch bei ihm zunächst eindeutig ausgesehen. Dumpfer Husten, manchmal begleitet von ein wenig Blut, plötzlich auftretender Schwindel. Und um ein Haar hätten sie es dabei belassen, hätte Cedric diese naheliegende Diagnose akzeptiert und den Kampf gegen die Krankheit aufgenommen, mit all den Mitteln, die am Ende auch bei Adele versagt hatten. Wäre da nicht jenes Zittern gewesen, das ihn manchmal überfiel, und das einfach nicht zu dem passen wollte, was er bis dahin über den Verlauf von Tuberkulose gelernt hatte. Es begann meist in den Fingern, hin und wieder auch in den Schultern, und endete in einem mehr oder minder heftigen Zucken eines seiner Gliedmaßen oder des Kopfes. Zuerst war es Cedric nicht schwergefallen, die unkontrollierbaren Bewegungen mit alltäglichen Gesten zu überspielen. Und Musikern gestand man zu seinem Glück ohnehin eine recht große Bandbreite an Ticks zu. Aber es wurde beständig schwerer, die schlechten Tage kamen häufiger, also hatte er Dr Shaw nachdrücklich gebeten, ihn noch einmal zu untersuchen. Nach der Ursache der Zuckungen zu forschen – und nach einer Diagnose, die hoffentlich anders lauten würde, als dass er an derselben nahezu unheilbaren Krankheit sterben würde wie zuvor seine Frau.
Am Ende waren sie erfolgreich gewesen. Mit umso niederschmetternderem Ergebnis.
Cedric litt nicht Tuberkulose. Doch was die Ärzte stattdessen gefunden hatten, war keineswegs weniger fatal: Eine erbliche Krankheit, die im Volksmund als Veitstanz bekannt und erst vor Kurzem durch einen amerikanischen Arzt namens George Huntington eingehend untersucht und beschrieben worden war. Ihre Symptome – Zuckungen und Schwindel – zeigten sich meistens erst im vierten Lebensjahrzehnt, wurden mit der Zeit stärker und führten schließlich innerhalb weniger Jahre zum Tod. Und was das Blut in seinem Hustenauswurf betraf … die Landluft in England mochte die klarste und reinste der Welt sein. Die Luft in London war es nicht.
Dr Shaws Räuspern riss Cedric aus seinen Gedanken. »Mr Edwards, ich will Ihnen nichts vormachen. Die moderne konventionelle Medizin kann an dieser Stelle nichts mehr für Sie tun, außer die Symptome zu lindern und Ihnen vielleicht – vielleicht! – etwas mehr Zeit zu verschaffen. Es tut mir leid. Aber!« Er hob die Hand. »Ich möchte Sie an meine Frau überweisen.«
Der reflexartige Widerspruch verstummte, noch ehe er Cedrics Lippen erreichte. Ein Hoffnungsfunke zuckte durch seine Brust, den er sich lieber nicht so schnell erlaubt hätte. »An Ihre Frau? Hat die Blutuntersuchung also doch etwas ergeben?«
Dr Shaw brummte und ließ eine Wolke blauen Dunsts aus Mund und Nasenlöchern quellen. »Ich habe nie gesagt, dass es nicht so wäre. Wie Sie wissen, war meine Frau in den vergangenen Jahren mehrmals auf dem Festland, um dieses Forschungsprojekt mit aufzubauen. Sie kennt die Methoden sehr gut und hat die Befunde, die wir gestern von dort bekommen haben, gegengeprüft. Es sieht so aus, als kämen Sie für eine Behandlung mit den dort eingesetzten Therapieansätzen infrage.« Der Doktor räusperte sich und zog erneut an seiner Pfeife. »Diese Medikamente können die Chorea Huntington zwar voraussichtlich nicht heilen. Meine Frau ist allerdings der Ansicht, wenn Sie bereit wären, etwas zu riskieren und die Konsequenzen selbst zu tragen, könnte das«, er räusperte sich erneut, »Ihre Lebenserwartung beträchtlich erhöhen. Im Optimalfall könnten Sie sogar weitestgehend so weiterleben wie bisher. Zumindest, bis Ihre Töchter erwachsen sind.«
Im ersten Moment fehlten Cedric die Worte. Ada war jetzt sechs und Erica acht. Bis sie erwachsen waren … auf so viele Jahre hatte er seit Monaten nicht hoffen dürfen.
»Was für Risiken?«, fragte er, weil es sich kurzsichtig und leichtfertig angefühlt hätte, es nicht zu tun. Doch er wusste schon jetzt, dass er diese Therapie unmöglich würde ablehnen können.
»Darüber sprechen Sie besser mit meiner Frau. Ihr Fachwissen in diesem Bereich ist sehr viel tiefgreifender als meines.« Dr Shaw legte seine Pfeife beiseite und griff nach einem Glöckchen, das neben dem Pfeifenhalter auf dem Schreibtisch stand. »Sie wartet im Vorraum auf Sie. Sie hat sich den Termin für Sie freigehalten.« Er läutete, und draußen im Vorraum hörte Cedric eine Tür gehen. »Alles Gute, Mr Edwards. Treffen Sie die richtige Entscheidung.«
Vor den Fenstern im Vorraum war der Regen inzwischen stärker und der Himmel noch düsterer geworden. Trotzdem brannte im Vorraum kaum Licht, nur eine einzelne Kerze leuchtete in einem kleinen Windlicht auf dem Tisch, wo zuvor Cedrics Tee gestanden hatte.
Dr Justine-Kate Shaw wartete neben der Tür zu ihrem Behandlungsraum. »Mr Edwards. Kommen Sie.«
Cedric konnte nicht viel gegen das eigentümliche Gefühl der Befangenheit tun, das ihn überkam, als er der Ärztin folgte. Die Vorhänge waren zugezogen, und eine Gaslampe an der Wand verbreitete mattgelbes Licht. Justine-Kate Shaws Sprechzimmer war deutlich aufgeräumter als das ihres Mannes, modern und pragmatisch eingerichtet, mit hohen Regalen, in denen Medizinbücher, Arzneimittelflaschen und wissenschaftliche Gerätschaften hinter Glas verwahrt waren. Etwas unschlüssig blieb Cedric einige Schritte hinter der Schwelle stehen, während sich Dr Shaw in den Stuhl hinter ihrem Schreibtisch sinken ließ. »Nun denn. Willkommen in meiner Sprechstunde, Mr Edwards.«
Cedric gab sich einen Ruck. »Ihr Mann sagte, dass Sie mir möglicherweise helfen können. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich zu allem bereit bin.«
Dr Shaw sah ihn eine Weile bloß an. Schon wieder so abschätzend, und so lange, dass Cedric kurz davor war, etwas gereizt eine erneute Erklärung seiner Lage zu versuchen. Dabei war er sich sicher, dass sie das alles ohnehin längst wusste.
Doch dann begann sie zu sprechen, noch bevor er sich entscheiden konnte, was er wirklich zu ihr sagen – und was sich lieber verkneifen wollte.
»Es ist mir wichtig, dass Sie etwas verstehen, Mr Edwards. In der Tat gibt es eine Sache, die ich für Sie tun könnte. Zuvorderst möchte ich allerdings nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Zulassung zu dieser Behandlung ein bislang überaus seltenes Privileg ist. Nach allem, was wir wissen, besitzen nur sehr wenige Menschen die Blutfaktoren, die eine notwendige Bedingung dafür sind. Ihre Frau, um ein Beispiel zu nennen, wäre dafür nicht infrage gekommen. Das sollten Sie wissen, ehe Sie anfangen, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob eine Therapie wie diese nicht auch sie hätte retten können.«
Cedric fiel es mit einem Mal seltsam schwer zu atmen. Er hätte erwartet, dass die Worte ihn erleichtern würden. Dass sie die Hoffnung anfachen würden, die er im Zimmer des Herrn Doktors gespürt hatte, oder ihn zumindest etwas Licht für die nähere Zukunft sehen ließen. Nichts davon geschah.
»Wollen Sie damit sagen, Sie haben auch das Blut meiner Frau untersuchen lassen? Davon höre ich zum ersten Mal.«
Dr Shaws Miene blieb unbewegt. »Ich untersuche das Blut all meiner Patientinnen, Mr Edwards. Auch das Ihrer Frau. Natürlich nicht ohne ihr Einverständnis. Allerdings rate ich üblicherweise dazu, der Familie nichts davon zu sagen, solange kein positiver Befund vorliegt. Sie wissen, wie es um die allgemeine Akzeptanz für neuartige Praktiken in der Medizin bestellt ist. Indem wir sicherstellen, dass das Wort darüber nur bei begründeter Hoffnung auf Erfolg dieses Sprechzimmer verlässt, ersparen wir uns viele kräftezehrende Diskussionen.«
Cedric verschränkte die Arme und zwang sich innerlich zur Ruhe. Er durfte jetzt nicht mit Dr Shaw streiten. Adele war nicht mehr hier, und was sie mit ihrer Ärztin besprochen hatte, ohne ihn einzuweihen, tat nichts zur Sache, ganz gleich, wie seltsam verletzend sich der Gedanke anfühlte. »Was ist das für eine Therapie?«
Ein schmales Lächeln erschien auf Dr Shaws Lippen. »Mancher würde sagen: ein Pakt mit dem Teufel. Das ist natürlich Unsinn. Wir stecken ja auch deshalb so viel Energie in die Forschung, um mit solchen Mythen aufzuräumen. Ich hoffe, Sie sind kein zu gläubiger Mann.«
Für einen Augenblick war Cedric versucht, bitter zu lachen. »Da können Sie unbesorgt sein. Mein Leben ist auch ohne Religion belastend genug.«
Das Lächeln verschwand aus Dr Shaws Gesicht. »Nun gut. Ich nehme Sie beim Wort. Dann lassen Sie mich zunächst einige Details zum Ablauf erörtern, ehe wir auf die erwartbaren Resultate zu sprechen kommen. Und auf die Risiken.« Sie öffnete eine ihrer Schreibtischschubladen und zog ein ledernes Etui hervor, um es vor sich auf die Tischplatte zu legen.
»Die Therapie besteht aus drei Phasen. Zunächst erhalten Sie über einige Wochen hinweg ein Vorstufenserum, das Ihren Körper auf die eigentliche Therapie vorbereitet. Außerdem hilft es gegen den Husten und auch gegen die Schmerzen, wenn Sie welche haben. Die Länge dieser Phase richtet sich danach, wie gut Ihr Körper auf das Serum anspricht.« Dr Shaw öffnete das Etui. Mehrere Skalpelle in verschiedenen Größen kamen zum Vorschein und reflektierten das Licht der Gaslampe. »Sobald wir mit den Resultaten zufrieden sind, verordne ich Ihnen das finale Medikament. Diese zweite Phase ist die kritischste. Sie wird einige einschneidende Veränderungen in Ihrem Stoffwechsel bewirken, die Ihre verbleibende Lebensspanne eindrucksvoll verlängern können. Zumindest, wenn Ihr Organismus das Medikament annimmt wie erwartet.« Sie musterte Cedric aus leicht verengten Augen. »Ich will Ihnen allerdings auch nicht verschweigen, dass Sie aufgrund dieser Veränderungen Ihre Ernährung auf eine spezielle posttherapeutische Diät werden umstellen müssen. Das nennen wir schließlich Phase drei, und Sie wird den Rest Ihres Lebens andauern.«
Cedric runzelte irritiert die Stirn. »Posttherapeutische Diät? Was soll ich mir darunter vorstellen?«
Dr Shaw schwieg einige zu lange Sekunden. Dann zog sie eines der Skalpelle aus dem Etui und stand auf. »Ich will Ihnen etwas zeigen, Mr Edwards. Wie ich bereits sagte, ist diese Therapie nur für sehr wenige Menschen geeignet. Klinische Versuchsobjekte sind also schwer zu finden – ich weiß, dass dies nicht Ihr Anliegen ist. Ich möchte Ihnen dennoch sagen, dass Sie mit einer positiven Entscheidung dem noch sehr jungen Forschungsfeld der Intersektionalen Hämatoneurologie einen großen Dienst erweisen.« Sie winkte ab, als Cedric erneut den Mund öffnete. »Wie dem auch sei, zu unser beider Glück verfüge ich allerdings selbst über die erforderlichen Merkmale. Daher konnte ich die fraglichen Präparate bereits testen, und eine Demonstration ist an dieser Stelle möglich. Bitte erschrecken Sie nicht.« Mit diesen Worten streifte sie ihren linken Ärmel zurück, ballte die Faust und zog das Skalpell in einem entschlossenen Schnitt über den kräftig gewölbten Muskel. Blut quoll hervor, so dunkel, dass es beinahe schwarz wirkte. Doch noch bevor sich auch nur ein einziger Tropfen von den Rändern lösen und auf die Schreibtischplatte oder die darauf liegenden Unterlagen fallen konnte, schloss sich der Schnitt, um nichts als glatte Haut unter dunklem Nass zurückzulassen.