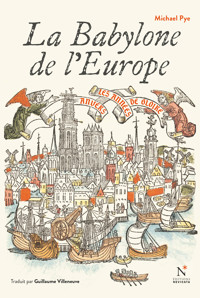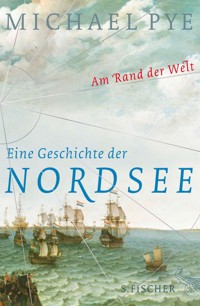
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In ›Am Rand der Welt‹ erzählt Michael Pye anschaulich, farbig und unterhaltsam die reiche Geschichte der Nordsee. Die Nordsee ist das Meer der Wikinger und der Hanse. Aber sie ist noch viel mehr. Bereits im Mittelalter überquerten Heilige und Spione, Philosophen und Piraten, Künstler und Händler die graue See. Michael Pye erzählt uns die spannendsten Geschichten der Nordsee bis hin zum 17. Jahrhundert: der Zeit, in der sie Europa zu dem machte, was es heute ist. Es sind Geschichten über den Wandel einer Region, in der Veränderungen, neue Entdeckungen, revolutionäre neue Vorstellungen, z. B. über die Ehe oder technische Innovationen, über das Wasser getragen wurden. Aber auch der Tod kam über die See, wie im Fall der Ratten, die die Pest in weite Teile Europas trugen. Pye zeigt uns lebendig, was eines der gefährlichsten Gewässer unserer Erde zur Geburt Europas beigetragen hat. »Wie die Nordsee uns zu dem machte, wer wir sind. Ein überwältigendes historisches Abenteuer.« The Daily Telegraph »Ein meisterhafter Geschichtenerzähler.« (Vogue) »Ein außergewöhnliches Buch. Pye macht erstaunliche Entdeckungen. Die Kürze ist hierbei der Fluch des Rezensenten – es ist unmöglich so gute Bücher in 900 Zeichen zusammenzufassen. Und dies trifft auf diesen Schatz absolut zu. Das Resultat ist besonders aufschlussreich. Pye's Kreativität bringt Licht in dieses dunkle Zeitalter.« (The Times) »Außerordentlich unterhaltsam. Es ist Pye's Stärke, dass er sowohl den friesischen Kaufleuten des 17. Jahrhunderts Leben einhaucht als auch den belgischen Beginen und Begarden des späten Mittelalters, und den anderen von ihm noch ausführlicher beschriebenen Themen. Die Wasser der Nordsee mögen grau sein, doch Pye taucht sie in leuchtende Farben.« (Tom Holland, Guardian) »Brillant. Pye ist ein wunderbarer Historiker – er verhilft Geschichte zum Leben wie kein anderer sonst.« (Terry Jones)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael Pye
Am Rand der Welt
Eine Geschichte der Nordsee und die Anfänge Europas
Über dieses Buch
Die Nordsee ist das Meer der Wikinger und der Hanse. Aber sie ist noch viel mehr. Bereits im Mittelalter überquerten Heilige und Spione, Philosophen und Piraten, Künstler und Händler die raue See. Michael Pye erzählt spannende Geschichten rund um das gar nicht so dunkle Nordmeer, vom frühen Mittelalter bis zur Aufklärung im 18.Jahrhundert. Dabei schildert er, wie immer wieder neue Entdeckungen und revolutionäre Ideen über das Wasser getragen wurden: die lange im Schatten gebliebene tausendjährige Geschichte von der Entstehung Europas im Norden des Kontinents, fulminant zum Leben erweckt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael Pye, geboren 1946, studierte Geschichte in Oxford. Für seine Sachbücher und Romane, die in Großbritannien auf der Bestsellerliste vertreten waren, wurde er vielfach ausgezeichnet. Seine Geschichte der Nordsee wurde von der New York Times zu den Notable Books of the Year gezählt. Er war als Journalist, Kolumnist und Reporter in London und New York u.a. für die Sunday Times, die BBC und The Scotsman tätig. Heute lebt er abwechselnd in London und Portugal.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe ist 2014 unter dem Titel The Edge of the World. How the North Sea Made Us What We Are bei Viking/Penguin Books, London, erschienen.
© 2014 Michael Pye
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Karten: Peter Palm, Berlin
Covergestaltung: Sonja Steven, Büro KLASS
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403660-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Erstes Kapitel Die Erfindung des Geldes
Zweites Kapitel Buchhandel
Drittes Kapitel Sich Feinde machen
Viertes Kapitel Siedeln und sesshaft werden
Fünftes Kapitel Mode
Sechstes Kapitel Geschriebenes Recht
Siebtes Kapitel Die Natur überwachen
Achtes Kapitel Wissenschaft und Geld
Neuntes Kapitel Herrschaft der Händler
Zehntes Kapitel Liebe und Kapital
Elftes Kapitel Die Pestgesetze
Zwölftes Kapitel Stadt und Welt
Dank
Bildteil
Abbildungsnachweis
Einleitung
Im Sommer des Jahres 1700 fuhr Cecil Warburton ans Meer – zwei Wochen wollte er an der Ostküste Englands verbringen, in Scarborough, auf halbem Wege zwischen Hull und Newcastle gelegen. Er war überhaupt nicht beeindruckt.
Warburton war ein Gentleman aus dem Norden, Sohn eines Baronet aus Cheshire, und er tat, was Gentlemen in einem Heilbad taten: Er trank fast jeden Tag zweieinhalb Liter des berühmten Heilwassers, das nach Tinte roch und säuerlich schmeckte, und sein ganzer Körper wurde ordentlich durchgespült. Er weigerte sich allerdings, es den übrigen Badegästen gleichzutun und die volle Menge zu trinken, die gut viereinhalb Liter betrug. An seinen Schwager schrieb er: »Ich hatte gehofft, hier etwas zu finden, das meinen Brief ein wenig unterhaltsam machen könnte, aber ich wurde enttäuscht, denn ich sehe nur Angelhaken und trocknende Fische, die hier die einzige Ausstattung ihrer Straßen und Häuser drinnen wie draußen darstellen.« Die Straßen seien übersät mit »Fischabfällen und Kabeljauköpfen … Ich hoffe, der Brief stinkt nicht danach, denn ich habe das Gefühl, dass nichts mehr frei davon ist.«[1]
Er hatte die Stadt ausgewählt, in der die Idee des Seebades geboren wurde und in der bald schon die ersten Umkleidekabinen am Strand auftauchen sollten, einen Ort, in den man kam, um zu flirten und um gesehen zu werden. All die Dinge, die mit der Arbeit am und auf dem Meer zusammenhingen, wollte er nicht sehen. Leute von »Adel, Rang und Stand«, wie es im Reiseführer für 1733 hieß, trafen sich in Scarborough: Earls und Baronets, Ladys und Marquises. Sie tranken und aßen und tranken, denn sie wussten, dass dieses Heilwasser sie reinigen und bei guter Gesundheit halten würde. Sie badeten im kalten Meer, veranstalteten Pferderennen auf den langen weißen Sandstränden und besuchten am Abend einen Ball.[2]
Sie sahen sich lieber das Kurbad an und nicht die Stadt der arbeitenden Leute, auch nicht die Burg, von der aus man nur fünfzig Jahre zuvor noch auf feindliche Schiffe gefeuert hatte, als Holländer und Engländer im Krieg miteinander lagen, nicht die aus gut dreihundert Schiffen bestehende Fischereiflotte und auch nicht den Hafen, den einzigen bei schlechtem Wetter brauchbaren Zufluchtsort zwischen dem River Tyne im Norden und dem River Humber im Süden. Die Stadt erinnerte an das Netz der vielfältigen Verbindungen, die das Meer überspannten: Nahrung, Handel, Krieg, Ankünfte und Invasionen jeglicher Art, darunter auch die von Ideen.
Cecil Warburton hatte, wie Millionen Besucher nach ihm, daran kein Interesse. Er hatte andere Sorgen. In einem Brief an seine Schwester klagte er: »Ich bin immer noch so fett wie zuvor …«[3]
Dieses neue Bild der Küste steht heute zwischen uns und der Geschichte des Meeres.[4] Die Küste wurde zu einem eigenständigen Reiseziel. Sie war nicht mehr nur der Hafen, von dem aus man zu anderen Zielen jenseits des Meeres aufbrach. Und sie wurde zu einem Ort des Spiels und der Freizeit statt der Arbeit und des Krieges. Man konnte sich kaum noch vorstellen, dass es einmal eine Welt gegeben hatte, in deren Mittelpunkt das Meer stand. Über die Jahre hatte man sogar die Küstenlinie fixiert, wie es zuvor nie gewesen war, als kräftige Winde einen Sandsturm entfachen und Sturmfluten tief ins Land vordringen konnten. Aus Stein und später Beton errichtete man Ufermauern, Promenaden, Esplanaden – eine endgültige Grenze zwischen Mensch und Meer. Dahinter konnten Hotels und Villen in völliger Gleichgültigkeit hinaus auf das Meer blicken, dem sie doch eigentlich ihren Reiz verdankten.
Das alles steckte zu Warburtons Zeiten noch in den Anfängen. In Scarborough zahlte die feine Gesellschaft fünf Schilling und trug sich ins Gästebuch ein, um die zwei am Strand erbauten Räume für Getränke und Gesellschaft, zum An- und Auskleiden zu benutzen. Manche kamen mit der Kutsche aus London hierher nach Norden, über York oder, wegen der Sehenswürdigkeiten, über Cambridge, aber nur wenn sie die Landgasthäuser ertragen konnten. Andere zahlten eine Guinee für die Fahrt mit einem der Kohlenschiffe, die von den Docks in Billingsgate leer zum Tyne zurückfuhren und in Scarborough Station machten.
Die Frauen badeten separat unter dem Schutz von Fremdenführern. Ein einheimischer Dichter klagte: »Ein weites Hemd die Nymphe schützt / vor Neugier und vor jedem Blick.« Die Männer konnten sich entweder »zurückziehen und sich in einiger Entfernung von der Badegesellschaft ausziehen … oder mit einem Boot ein wenig hinausfahren« und dann »nackt ins Wasser springen«. Das Meer galt als sicher genug für erfrischende Übungen oder medizinische Bäder. Der anonyme Autor von A Journey from London to Scarborough behauptete sogar: »Die Vorzüge, die unsere Ärzte kalten Bädern ganz allgemein zuschreiben, verstärken sich noch durch den zusätzlichen Salzgehalt des Meerwassers, ein Vorteil, dessen sich in England kein Kurort außer Scarborough rühmen kann.«
Dem Meerwasser schrieb man ähnlich heilende Wirkungen zu wie den Heilquellen. Manche Ärzte zeigten sich sogleich tief besorgt und sahen im Wasser einen Konkurrenten für die von ihnen verschriebenen chemischen Arzneimittel. Offensichtlich bedurfte es einer »genaueren Analyse der Heilwässer«, wie Dr. Simpson 1669 schrieb, einer »chemischen Anatomie«, die zeigte, welche chemischen Arzneistoffe darin enthalten waren. Nur dann könne das Meer die Billigung und Anerkennung der Ärzte finden. Als solche Analysen in den 1730er Jahren vorlagen, wurde das Meerwasser zum Gegenstand bürgerlichen Stolzes und allgemeinen Interesses, und die freundliche Banalität des Seebads bekam etwas Bedeutendes. In Scarborough besuchten nun Gäste wie Einheimische öffentliche Vorträge, in denen genauestens dargelegt wurde, was sie da tranken.[5]
Manche Wässer waren zuvor schon Gegenstand eines anderen Glaubens gewesen: heilige Wässer, heilige Quellen und Brunnen, die Heilige oder andere hoffnungsvolle Amateure gefunden hatten. Die Quelle in Scarborough, so schrieb ein Dr. Wittie 1667, war von einer Mrs Farrow entdeckt worden, die in den 1620er Jahren am Strand entlangwanderte und bemerkte, dass manche Steine durch eine hörbar sprudelnde Quelle am Fuß einer »außerordentlich hohen Klippe« rostrot verfärbt waren. Der Geschmack des Quellwassers gefiel ihr. Sie glaubte, es werde den Menschen guttun.
Die Nachricht verbreitete sich.
Dr. Wittie schrieb ein Büchlein, um sicherzustellen, dass dieses Wasser von Ärzten verschrieben wurde. Er glaubte bereits an den Nutzen von Bädern, denn genau das taten die Engländer in ihren Kurorten: Sie tranken das Wasser, aber sie badeten auch darin – im Unterschied zu den Festlandeuropäern, die das Trinken für ausreichend hielten. Er riet Männern mit einer Vorliebe für Portwein, im Meer zu baden, denn auf diese Weise habe er seine eigene Gicht geheilt, durch »häufiges Baden im kalten Meerwasser, im Sommer …, und danach schwitze ich in einem warmen Bett«. Die Sommermonate seien die besten. Dass man »in deutschen Kurorten im Winter« trank, schockierte Dr. Wittie.
Ihm war allerdings klar, dass »viele die Kurorte nicht aus Notwendigkeit, sondern zum Vergnügen besuchen, um sich eine Weile ihren ernsthaften Beschäftigungen zu entziehen und sich mit ihren Freunden zu trösten«. Aber auch aus dem Vergnügen konnten die Ärzte ein Geschäft machen: ein moderner Berufsstand, der Anspruch auf möglichst weite Teile des Lebens erhob. Das Baden war nun keine bloß vergnügliche Unternehmung mehr. Dr. Robert White schrieb 1775 über »Gebrauch und Missbrauch von Meerwasser« und warnte: »Wer im Vollbesitz seiner Gesundheit und seiner Kräfte ist, sollte sich solchen Freizeitbeschäftigungen nicht allzu intensiv hingeben.« Er könne vielleicht früh am Morgen baden, aber nervösere Fälle sollten bis »kurz vor Mittag« warten, und »niemand sollte länger als eine Minute im Wasser bleiben«. Das Meerwasser sei vielleicht kein so heftiger Schock wie eiskaltes Quellwasser, aber dennoch fühlte Dr. White sich verpflichtet, vor den »fatalen Folgen des Badens für gesunde Menschen« zu warnen. Er berichtete von einem Mann, »etwa vierzig Jahre alt, der ein gesundes und maßvolles Leben geführt hatte und überredet wurde, im Meer zu baden«. Der Mann hielt sich selbst nicht für krank und ging ohne Aderlass, ohne Darmentleerung und ohne ärztliche Anweisung ins Wasser. Die Folgen waren, so erklärte Dr. White, »ein heftiger Schmerz, der durch seinen Kopf schoss, starke Benommenheit und ein tödlicher Schlaganfall«.
Das Meer sei indessen »nützlich« bei Lepra, »von großem Nutzen« bei Epilepsie und ein Mittel gegen Gelbsucht. Es könne den Tripper heilen – wahrscheinlich eine gute Nachricht für die Schürzenjäger unter den Gentlemen, aber wohl kaum ein Trost für die nächste Person, mit der sie schliefen. Dr. White meinte, die Menschen gingen nicht sorgsam genug mit einer »so allgemeinen und beliebten Medizin« um, denn »Magen und Eingeweide werden dadurch in ständiger Erregung gehalten«. Er verzeichnete eine »Neigung, im Meer zu baden, die Menschen jeglichen Standes entwickelt« hätten.
Das galt nicht allein für die Engländer. Die Holländer unternahmen im 17. Jahrhundert Spaziergänge am Strand, in Scheveningen warfen die Jungen die Mädchen alljährlich im Frühjahr ins Wasser, und alle tranken. Ihr mit einem Fürsten vergleichbarer Stadhouder fuhr mit einem Segelwagen über den Sandstrand. Die Seebäder brachten Menschen an die Küste, doch zugleich entwickelte sich an der Küste auch ein anderes Leben. Es gab Strände, für die man keine ärztliche Verordnung brauchte, neuartige Urlaubsorte wie Norderney an der deutschen Nordseeküste, wie Ostende und Boulogne, wie Doberan an der Ostsee, die man allein um des Vergnügens willen besuchte. Jeder konnte nun nach Belieben mit dem Wasser flirten, ihm einen Besuch abstatten und wieder nach Hause zurückfahren. Wellen und Strömungen verwandelten sich in eine Kulisse für sehr städtische Vorstellungen davon, wie man fit und gesund bleiben, gut aussehen und sich amüsieren konnte. Die alten mit dem Meer verbundenen Gewerbe versteckte man, das neue Geschäft hieß Urlaub. Der Hafen von Visby auf der schwedischen Insel Gotland war ein Jahrtausend lang berühmt und geschäftig gewesen, doch im 19. Jahrhundert drohte die Stadt in Stagnation zu verfallen und in Vergessenheit zu geraten, sofern sie keine Badeeinrichtungen schuf, einen Ort, an dem die Badegäste sich umziehen und etwas trinken konnten – zumindest behaupteten das die Befürworter solcher Strandeinrichtungen.[6]
Die Realität versteckte man hinter Umkleidekabinen und Strandattraktionen und später dann hinter Seebrücken, Eselreiten und Bratfischbuden, hinter Schießständen und Bowling Greens (wie in Blackpool), hinter Varietétheatern und heller elektrischer Beleuchtung. Ende des 19. Jahrhunderts schien Baedeker’s Handbuch für Reisende, das ansonsten akribisch jedes Kunstwerk und sämtliche Fahrpreise auflistete, gar nicht zu bemerken, was da fehlte. Der Baedeker für Belgien und Holland wendet sich nach einer Weile Middelburg und der Küstenregion Zeelands zu und beschreibt die Ausflüge, die man von dort aus unternehmen kann.[7] Er verweist auf den Omnibus, der zweimal täglich zu dem »kleinen Seebade Domburg« fährt, zu dessen Badegästen hauptsächlich »Holländer, Belgier, Deutsche« gehören, und erwähnt »in der Umgebung schöne ausgedehnte Parke«. Er nennt den Preis für eine Fahrt im Zweispänner dorthin und für die Vollpension im Badhotel.
Er erwähnt indessen nicht, was in Domburg geschehen war, obwohl manche Bewohner sich noch daran erinnerten. Denn in diesem »kleinen Seebade« hatte die See an einem hübschen Strand ihr Geheimnis preisgegeben: ihre Geschichte.
An den ersten Tagen im Januar 1647 wühlte starker Wind das Meer auf und setzte die Dünen in Bewegung. Der Sand wurde fortgespült und gab im Boden darunter etwas frei, das es dort eigentlich gar nicht geben durfte: Fels. An der Küste bei Domburg gibt es nirgendwo Fels – nur Sand, Torf und Lehm. Also musste jemand die Steinblöcke von weither in das Vorland gebracht haben – aus siebenhundert Kilometer entfernten Steinbrüchen in Nordfrankreich, wie wir heute wissen. Und ihr Transport musste eine gewaltige Aufgabe gewesen sein, denn ein Stein wog zwei Tonnen, und 1647 konnte keine Maschine solch ein Gewicht bewegen. In einem begeisterten Brief nach Amsterdam, der als Einblattdruck veröffentlicht wurde, hieß es: »Vor gut zwei Wochen traten am Strand in der Nähe des Meeres einige große Steine aus weißem Kalkstein zutage.«[8]
Man fand auch etwas, das aussah wie »ein kleines Haus mit Sockeln von Säulen«. Auf den Steinen waren verwitterte Bilder zu erkennen und Gebete an eine Göttin namens Nehalennia, in denen ihr für Erfolge, für das Wohlergehen eines Sohnes, für die sichere Überfahrt mit Waren übers Meer gedankt wurde. Das legte den Gedanken nahe, dass es sich bei dem »kleinen Haus« um einen Tempel handelte. Die versteinerten und versalzten Überreste von Bäumen ließen sich als Hinweise auf einen jener Haine interpretieren, wie sie im Umkreis von Tempeln häufig angelegt worden waren. Der Schreiber des Briefs war sich sicher: Was die See da freigelegt hatte, war »ein Monument von höchstem Alter«.
Unter den Steinen befanden sich auch Altäre bekannter Götter – des Neptun natürlich, für das Meer und die Seeleute, und des Herkules. Doch Nehalennia mit ihren sechsundzwanzig Altären war seit mehr als einem Jahrtausend unbekannt gewesen. Auf den Altären sitzt sie unter einem muschelförmigen Baldachin, der sie zu einer Himmelsgöttin wie Venus oder Juno oder Minerva macht; oder sie steht am Bug eines Schiffs über einer unruhigen See. Gelegentlich ist sie auch auf einem Thron zu sehen, neben sich oft einen Korb mit Äpfeln, und stets schaut ein Hund mit feingeschnittenem Gesicht zu ihr auf. Schiffe waren nicht immer nur Transportmittel; oft besaßen sie im Denken der Menschen vor allem im Norden eine eigenartig tiefe Verbindung zur Fruchtbarkeit. So scheint Nehalennia denn auch die lokale Göttin der guten Ernte, des Glücks auf dem Meer und sogar der guten Verkehrsverbindungen durch Karren und Straßen gewesen zu sein.[9] Für die Menschen in der Umgebung vom Domburg war sie einst alles gewesen, und sie war vollkommen in Vergessenheit geraten.
Das gebildete Europa war begeistert: Etwas Unbekanntes war aus dem Meer hervorgekommen. Die Vergangenheit schien zurückzukehren, weggespült zu werden und erneut zurückzukehren, als wäre auch die Geschichte ein in ständiger Bewegung befindliches Meer. Peter de Buk, ein alter Mann aus Domburg, erinnerte sich, dass 1684, »während des sehr kalten Winters, als das Eis sich am Strand sehr hoch auftürmte«, der unbewegliche Stein sich zu lockern begann, sich verschob und sich schließlich »nach und nach Richtung Meer bewegte«. Die Ballspieler, die den Stein seit Jahren nutzten, so berichtete der Pfarrer des Ortes, mussten sich nach einem anderen Platz umsehen.
Drei Jahre später gab es einen Sturm, der so heftig war, dass man am nächsten Morgen am Strand Leichen fand: alte Leichen, jede in einem Sarg aus mehrere Zentimeter dicken Brettern. Die Särge waren voller Sand, die Schädel sämtlich nach Westen ausgerichtet. Um den Hals trugen die Skelette schmale Schmuckketten, an denen Münzen hingen. Bei einem lag ein Becher auf der Brust, ein anderes hatte einen silbernen Dolch an seiner Seite. Da Christen nicht mit Grabbeigaben bestattet werden durften, mussten die Gräber aus der Zeit vor der Christianisierung der Küstenregion um 700 stammen – oder aus der Zeit anderthalb Jahrhunderte später, als die Christen vor plündernden Wikingern ins Binnenland zurückgewichen waren. Ein paar Tage lang schien die Vergangenheit so fest und solide wie ein Sarg und ebenso unerklärlich wie ein Geist. Dann kehrte das Wasser zurück und versteckte die Toten erneut, bevor jemand herausfinden konnte, wer sie waren.
Im Jahr 1715 lief das Wasser bei einer extremen Ebbe so weit ab, dass die Überreste von Brunnen und die Fundamente von Gebäuden sichtbar wurden. Eine weitere Statue kam zum Vorschein: eine große Siegesgöttin ohne Kopf, mitten in einem mit runden und rechteckigen Steinen gepflasterten Areal, das offenbar ein Tempel gewesen war. Jahrelang lag die gestrandete Siegesgöttin auf dem Sandstrand, bevor man ihren Körper ins Binnenland karrte und in der Kirche des Ortes abstellte. Sie überlebte – inzwischen allerdings grün geworden, da sie nicht mehr im Salzwasser lag, sondern dem Regen ausgesetzt war. Aber sie ging zugrunde, als die Kirche 1848 vom Blitz getroffen und zerstört wurde. Von diesen Überresten des früheren Domburg war nun nicht mehr geblieben als ein paar Bruchstücke und zwei Kubikmeter Schutt, die man im Garten des Stadtschreibers ablud.
Die Toten blieben indessen nicht fern. Der Friedhof wurde 1749 und 1817 erneut freigespült. Zwanzig grobe, wurmstichige, nur von Holzdübeln statt eiserner Nägel zusammengehaltene Särge kamen zum Vorschein, die das schiere Gewicht der alten Dünen im Sand eingeschlossen hatte. An der rechten Schulter sämtlicher Leichen fand man runde Gewandspangen, gelegentlich auch auf der Brust – möglicherweise als Bezahlung für das sichere Geleit einer Meeresgöttin oder als Schatz für ein neues Leben. Eine der Leichen war mit einem Schwert begraben worden. Die Einheimischen wussten inzwischen um den Wert solcher vergrabenen Dinge, durchsuchten heimlich die Särge und konnten nicht mehr genau angeben, wo sie was gefunden hatten. Sie verkauften die Schätze rasch an Sammler in Amsterdam.
Die Küstenlinie veränderte sich auch weiterhin durch Wind und Gezeiten, und so wurde 1832 eine ganz andere Stätte freigelegt, die 1866 zum zweiten und seither letzten Mal gesehen ward: die verwitterten Umrisse eines Hauses und eine Begräbnisstätte, bei der die Särge sternförmig auf dem Sand lagen. So gab es dort nun drei verschiedene Geschichten unter dem unruhigen Wasser. Da war ein römischer Tempel für eine unbekannte Göttin, der an einer Stelle stand, an der Schiffe aufs offene Meer hinausfuhren, und der so aussah, als hätte man ihn sehr plötzlich aufgegeben. Da waren die Überreste einer Siedlung, eine einzige Straße, die an der Küste entlang von Ost nach West führte, mit Hütten für das Lagern und Sortieren von Waren und ausreichend Münzen als Beleg für ein reges Geschäftsleben. Und da waren Gräber, die nichtchristlichen Ursprungs sein mussten, weil sich darin zahlreiche schöne, mit Tiermasken und einem rechtwinklig geschnittenen Silberhalsreif verzierte Bronzen fanden, die wie Objekte der Wikinger aussahen.[10]
In den schriftlichen Quellen finden sich nur wenige Hinweise auf all das Leben, von dem die Münzen und die Altäre zeugen. In den aus römischer Zeit überkommenen Schriften wird Domburg nirgendwo erwähnt, doch damals waren die im Herzen ihres Reiches lebenden Römer zutiefst provinziell und schenkten ihren reichen Provinzen kaum Aufmerksamkeit. Als der Gelehrte Alkuin das Leben des heiligen Willibrord schilderte, berichtete er, der Heilige habe um das Jahr 690 die Insel Walcheren missioniert, und zwar in einem »Dorf namens Walichrum, wo ein Götzenbild als Rest des alten Irrwahns geblieben war«. Dieses Dorf war Domburg, das eine Insel gewesen war, bevor der Mensch die Küstenlinie umzugestalten begann. Willibrord zertrümmerte das Götzenbild vor den Augen seines Wächters, der den Heiligen angriff und in seiner Wut mit dem Schwert am Kopf verletzte. »Aber«, so schrieb Alkuin, »Gott verteidigte seinen Knecht.« Großmütig rettete der Heilige den Heiden vor der Rache seiner Begleiter, doch der Mann »wurde am selben Tage vom Teufel besessen und beendigte am dritten Tage sein elendes Leben«, wie dies häufig bei Menschen geschieht, die in die Hände einer zornigen Menge geraten.[11]
In den Annalen, den historischen Aufzeichnungen, die Mönche für ihren eigenen Gebrauch anlegten, finden sich Hinweise auf einen brutalen Wikingerüberfall 837 auf Domburg – »in insula quae Walacra dicitur« (»auf der Insel namens Walcheren«). Dabei wurden viele Menschen getötet, zahlreiche Frauen entführt und »große Mengen Geldes unterschiedlicher Art« geraubt, und die Wikinger vermochten regelmäßige Tributzahlungen zu erzwingen. Die verborgene Siedlung mit nur einer Straße auf der großen Düne war offenbar ein reicher kleiner Ort, den zu plündern sich lohnte.
Wir lesen also von Überfällen und Kämpfen, der Boden aber erzählt noch eine andere Geschichte. Als moderne Archäologen die Fundstätten in der Nähe des Strandes untersuchten, fanden sie nicht viel, das an Krieg erinnerte, nichts Niedergebranntes oder Zertrümmertes oder zu Schuttbergen Getürmtes; nichts von jenen blutigen Ereignissen, aus denen die Geschichte üblicherweise besteht und die von den Menschen aufgezeichnet werden. Es fanden sich lediglich Spuren eines jahrhundertelangen Lebens und seines langsamen, traurigen Rückzugs, als der Sand ins Land hineingeweht wurde und nichts von Wert zurückblieb – außer den Toten natürlich.
Diese ganze Lebenskraft versank im Sand eines kleinen Stücks Strand, auf dem die Badenden spielten und heute noch spielen.
Dieses Buch handelt von der Wiederentdeckung jener verlorenen Welt und von ihrer Bedeutung für uns: vom Leben im Umfeld der Nordsee zu einer Zeit, als das Wasser der einfachste Verkehrsweg war, als das Meer eine Verbindung zwischen Menschen, Glaubensüberzeugungen und Ideen herstellte und für den Transport von Töpfen, Wein und Kohle genutzt wurde. Dies ist nicht die übliche Geschichte von konfusen Schlachten und diversen Königen und der Ausbreitung des Christentums. Dieses Buch berichtet davon, wie der ständige Austausch über das Meer hinweg und das noch unsichere Wissen, dass man die Dinge auch anders machen konnte, das Denken der Menschen zutiefst zu verändern begannen. Dieses kalte graue Meer in dunklen Zeiten machte die moderne Welt möglich.
Bedenken wir, was sich nach dem Ende des Römischen Reichs verändern musste, damit die Entwicklung der Städte, Staaten und Sitten, wie wir sie heute kennen, beginnen konnte: unser Recht, unsere Vorstellungen von Liebe, unser Geschäftsleben und unser Bedürfnis nach einem Feind, um uns selbst zu definieren. Händler brachten Münzen und Geld und damit auch die abstrakte Vorstellung eines Wertes, die erst die Mathematik und die moderne Wissenschaft ermöglichte. Wikingerüberfälle zerstörten ebenso viele Städte, wie sie entstehen ließen, und von Bischöfen oder Landesherren freie Städte konnten allmählich eine neue Art von Handel aufbauen. So entstand eine Gemeinschaft von Menschen, die Handel trieben und stark und selbstbewusst genug waren, um mit Königen und staatlichen Mächten Krieg zu führen: unsere Welt der Spannung zwischen dem Geld und allen übrigen Mächten.
Die Menschen veränderten die Landschaft, und während sie lernten, mit dem in der Natur angerichteten Schaden umzugehen, verbreiteten sie auch die Vorstellung, dass sie frei waren und Rechte besaßen. Die Seefahrt machte die Mode möglich, sichtbar und begehrenswert. Die Freiheit der Frauen, selbst zwischen Ehelosigkeit, eheloser Schwangerschaft oder Heirat zu wählen, veränderte das Wirtschaftsleben an der Nordsee auf gänzlich unerwartete Weise.
Das Recht wandelte sich von lokalen Bräuchen, die jeder kannte, zu einer Sprache und einer Sammlung von Texten, für die man auf Juristen angewiesen war. Die freien Berufe entstanden, zunächst Priester, die sich aus der säkularen Welt herauszuhalten hatten, dann Juristen, die das Recht zu einer Art Religion machten, dann Ärzte und alle übrigen. Ohne sie wüssten wir nicht, was eine Mittelschicht ist: Menschen, deren Macht auf ihrem Fachwissen beruht. Die Pest begann die Armen in Wertvolle und Wertlose zu sondern und ermöglichte es den Autoritäten, das Leben sehr genau zu regeln – wie man Kinder aufzuziehen und wo man zu leben hatte – und schließlich Barrieren zwischen Städten und Staaten zu errichten, dies alles natürlich zu unserem eigenen Wohl, ganz wie die Sicherheitsmaßnahmen auf den Flugplätzen oder die ständige Überwachung. Die Zusammenarbeit, auf die man sich einließ, wenn es darum ging, das Land vor Überschwemmungen zu schützen, Schiffe mit vielfältigen Ladungen loszuschicken und gegen Verlust zu versichern oder die Bezahlung zu organisieren, wenn man Fisch ins Baltikum brachte und Getreide mit zurück nach Amsterdam nahm – auf dieser Zusammenarbeit errichteten wir am Ende den Kapitalismus. Und zugleich wurden all diese Fakten und Informationen ihrerseits zu jener Ware, die sie heute sind.
All das geschah in Zeiten, von denen die meisten von uns kaum etwas wissen: in den mehr als tausend Jahren zwischen dem, was wir alle über das kaiserliche Rom zu wissen glauben – Armeen, schnurgerade Straßen, Villen, Tempel, Zentralheizung und Schnecken als Mahlzeit –, und dem, was wir über Amsterdam zu seinen Glanzzeiten im 17. Jahrhundert zu wissen glauben – Schiffsflotten, Heringe, Gold, Genever, Gemälde, Giebel und saubergefegte Straßen. Zwischen diesen beiden Bildwelten, grob gesagt zwischen 700 und 1700, liegen die Zeiten, die wir immer noch gedankenlos das »finstere Mittelalter« und dann das »Hochmittelalter« nennen, die, wie wir alle wissen, aus Burgen, Burgfräulein, Rittern und wunderschön illuminierten Handschriften bestehen. Es ist, als stellten wir uns vor, menschlicher Erfindungsgeist und Perversion und Wille wären jahrhundertelang ausgesetzt worden und das Leben hätte sich in bloßes Dekor verwandelt.
Dokumente gehen natürlich verloren oder verbrennen oder zerfallen. Schriftliche Quellen sind zwangsläufig unvollkommen. Am besten erhalten sich Dokumente, wenn eine langlebige Institution sie in einem Bauwerk wie den Kathedralen benötigt, die ein ganzes Jahrtausend oder mehr überdauern können. Ein Brief über den Anbau einer Feldfrucht oder den Kauf von Hemden verschwindet vielleicht ebenso wie Liebesbriefe und alte Prozessakten, aber eine Urkunde über kirchlichen Landbesitz überlebt mit großer Wahrscheinlichkeit. Nur kleine Ausschnitte des Lebens werden schriftlich aufgezeichnet und aufbewahrt, und dies jeweils nur aus ganz besonderen Gründen und aus einer sehr speziellen Perspektive – der eines Richters oder Bischofs, eines Königs oder Abts. Sie übergehen, was zu ihrer Zeit jeder wusste oder was niemand zu sagen wagte. Selbst geschichtliche Darstellungen, die mit großer Autorität und gestützt auf sämtliche bisherigen schriftlichen Quellen verfasst wurden, sollten wir nur als Hinweise auf die Vergangenheit betrachten.
Aber wir haben großes Glück. Wir verfügen heute über eine ganz neue Art von Beweisen, mit denen sich manche Lücke füllen lässt und die unser Bild der Geschichte fast bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die Archäologie enthüllt und deckt auf, ganz wie das Meer in Domburg es tat; aber im Unterschied zum Meer geht sie systematisch vor und liefert Funde, die neben die schriftlichen Quellen treten können. Plötzlich erweitert sich das Bild; wir sehen Leben und Zusammenhänge. Manchmal stehen die Ergebnisse der Grabungen in deutlichem Widerspruch zu den bekannten Texten und Archiven, denen wir gerne vertrauen möchten, weil wir keine anderen besitzen. Manchmal lassen sie sich nur schwer interpretieren, weil all die aus dem Boden geklaubten Stücke nur dann einen Sinn ergeben, wenn wir sie in einen Zusammenhang stellen, und bei der Herstellung solcher Zusammenhänge müssen wir uns auf das stützen, was wir aufgrund anderer Funde an anderen Fundorten bereits zu wissen glauben.
Bringen wir Worte und Objekte jedoch zusammen, ist die neue Geschichte auf weitaus überzeugendere Weise menschlich. Das Leben hört nicht einfach auf, wenn Rom fällt und das Reich zusammenbricht und die Überlieferung der in klassischem Latein verfassten Texte abbricht – und das nicht einmal bei den diversen Einfällen der Sachsen und Vandalen, Goten und Hunnen in Westeuropa. Die Menschen verloren nicht ihre Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, Handel zu treiben, einander zu bekriegen und ganz allgemein ihr Leben zu verändern, nur weil so wenige Dokumente erhalten geblieben sind. Tatsächlich verloren sie nicht einmal die Fähigkeit, solche Dokumente zu verfassen und zu lesen. Das Leben ging weiter. Wir benötigen lediglich andere Werkzeuge, um es zu finden und zu beschreiben.
Mancherorts überlebten römische Städte, aber sie veränderten sich. Die römischen Straßen funktionierten auch weiterhin, und Gleiches gilt für das alte römische System der Relaisstationen, in denen man bei langen Reisen eine Rast einlegen und die Pferde wechseln konnte. Nützliche Pflüge und Werkzeuge verschwanden nicht einfach, weil Historiker das Ende eines Zeitalters dekretierten. Einige recht fortschrittliche Vorrichtungen wie das horizontale Wasserrad für Wassermühlen wurden bereits Jahrhunderte vor ihrem Nachweis in Dokumenten gebaut. Die Technologie des Reisens – von den Tauen, die man als Traverse zwischen Bug und Heck spannte, um Boote seetauglich zu machen, bis hin zum Sonnenkompass, der die Navigation außerhalb der Sichtweite der Küste ermöglichte – wurde ständig weiterentwickelt. Die Menschen wollten sich fortbewegen und dachten intensiv darüber nach, wie sie das anstellen konnten. Selbst die Gestalt der Erde und ihre Grenzen veränderten sich im Denken der Menschen.
Man braucht sich nur von der Vorstellung eines dunklen Zeitalters abzuwenden, schon beginnt man andere Stimmen zu hören. Die Frauen waren nicht immer stumm oder machtlos, eigene Entscheidungen zu treffen – wir haben vielleicht nur nicht hingehört oder an den falschen Orten gesucht. Die hochgebildete und heilige Hildegard von Bingen verbrachte den größten Teil des 12. Jahrhunderts als Nonne, hatte Visionen, war eine Mystikerin und komponierte eine zu ihrem Klosterleben passende Musik, aber sie schrieb auch Briefe an Empfänger in ganz Europa und stand im Mittelpunkt einer gelehrten Konversation. Sie kannte sich mit Empfängnisverhütung aus und schrieb auch darüber.
Wer diese Geschichte finden will, muss sowohl in Bibliotheken graben als auch gepflügte Felder genau in den Blick nehmen. Es gilt, sich die Aufzeichnungen der Menschen über die Steine am Strand von Domburg anzusehen und sich dann all die Zusammenhänge vorzustellen, die in dieser Geschichte enthalten sind: Menschen, die in Bewegung sind und all das, was sie tun, denken oder glauben können. Nichts ist jemals vollkommen neu oder gesichert oder leer. Grenzen verschieben sich. Sprachen verändern sich. Menschen wandern. Die Römer bauten einen Tempel, um ihre Handelsschiffe aufs Meer schicken zu können; dann errichteten Kaufleute eine Handelsstadt, deren Namen wir nicht mehr kennen; dann ließen sich dort die für ihre Überfälle und Plünderungen berüchtigten Wikinger nieder. Dieser Strand birgt die Geschichte einer Welt, die in ständiger Veränderung begriffen und unablässig in Bewegung war. Dort finden sich außerdem die Waffen, die eindringende fränkische Krieger um 800 zurückließen. Armeen zogen umher, und die Macht ging in andere Hände über. Doch gelegentlich stellen sich die größten Veränderungen ein, wenn Menschen sich auf Reisen begeben, und das nicht immer zu Zeiten und aus Gründen, die in den Lehrbüchern genannt werden. Die Identität hing davon ab, wo man lebte und woher man gekommen war, nicht von einer abstrakten Idee der Rassen- oder Volkszugehörigkeit. Die Völker waren nicht so klar voneinander getrennt wie später durch die Grenzen im 19. Jahrhundert, aus denen sie sich nur hervorwagten, um zu erobern oder besiegt zu werden. Tatsächlich wagten sie sich recht oft hinaus, um die Seiten zu wechseln.
Statt der düsteren Irrtümer hinsichtlich der Reinheit des Blutes, rassischer Identität, homogener Nationen mit je eigener Seele, eigenem Geist und andersartiger Natur haben wir es hier mit etwas weitaus Spannenderem zu tun: der Geschichte von Menschen, die eine Wahl trafen, nicht immer frei und zuweilen unter fürchterlichem Druck, aber dennoch eine Wahl – Menschen, die erfinderisch waren und selbst über ihr Leben bestimmten.
Die Vorstellung eines »finsteren Zeitalters« ist unser Irrtum. Es wäre besser, wenn wir die Zeit, die unsere Vorfahren durchlebten, als den »langen Morgen« unserer Welt bezeichneten.
Wohlgemerkt, nichts von alledem ist modern, denn es gehört zu einer Zeit, die durch ein ganz anderes Denken und Verhalten geprägt war. Die Entfernungen waren nicht dieselben, die Weltkarten waren nicht dieselben, die Institutionen mochten zwar ähnliche Namen tragen, waren aber dennoch ganz anders als die Institutionen, die wir heute kennen. Aus den notwendigen Bedingungen unserer heutigen Welt hätte auch eine ganz andere Welt hervorgehen können. Aber wenn wir herausfinden können, was geschah und warum es geschah, beginnen wir vielleicht auch zu verstehen, wie unser modernes Leben und unsere moderne Zeit möglich wurden – vom Kalender bis hin zu den Terminmärkten, von den ersten Herausgebern heiliger Schriften bis hin zur Experimentalwissenschaft.
Es gibt noch eine weitere Komplikation in dieser Geschichte – nämlich wie wir sie üblicherweise erzählen. Wir betrachten den Glanz unserer Vergangenheit durch die Brille der italienischen Renaissance, als an den Küsten des Mittelmeers, wie man sagt, die Zivilisation wiederentdeckt wurde, in Schriften, die tausend Jahre zuvor an den Gestaden desselben Meeres verfasst worden waren. Das Recht, das die Gesellschaft in einer uns vertrauteren Weise zu ordnen begann, wird als das Römische Recht bezeichnet. Die Kirche ganz Nordeuropas wurde von Rom aus organisiert. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass der Norden darauf wartete, vom Süden zivilisiert zu werden; schließlich kam das Christentum von dort. Schon im Jahr 723 erklärte ein Bischof namens Daniel einem Heiligen namens Bonifatius, sein bestes Argument gegen die Heiden des Nordens sei der Hinweis, dass die Welt christlich werde und ihre Götter nichts dagegen unternähmen. »Und warum besitzen diese, d.h. die Christen, fruchtbare Länder und Gebiete, die Wein und Öl erzeugen und mit sonstigen Schätzen im Überfluß gesegnet sind, diesen aber, d.h. den Heiden, und ihren Göttern haben sie nur die immer von Kälte starrenden Länder gelassen, in denen man fälschlicherweise glaubt, daß sie immer noch herrschen, nachdem sie aus dem ganzen Erdkreis vertrieben worden sind?«[12]
Wenn wir von einem »finsteren Zeitalter« sprechen, stellen wir Kriege, Invasionen, Überfälle und Eroberungen in den Vordergrund. Aber das alles finden wir auch bei uns und in unserer Zeit, und wir leben dennoch unser Leben. Bis vor ganz kurzer Zeit konnte man noch schreiben, es sei zu »massenhaften Ausrottungen«, zur Vernichtung eines Volkes durch ein anderes gekommen, als die Angelsachsen die Nordsee überquerten und die Macht über die Briten und Britannien übernahmen, obwohl sehr viel für einen weitaus längeren, sanfteren und freundlicheren Übergangsprozess spricht.[13] Wir laufen Gefahr, all das zu vergessen, was wirklich im Umfeld des Meeres geschah, in einer Zone des Handels und des Glaubens, die sich mindestens von Dublin bis Danzig, von Bergen bis Dover erstreckte. Für den Mittelmeerraum gelten uns vielfältige Verbindungen und in alle Richtungen wirkende Einflüsse als selbstverständlich: die biblischen Geschichten, die Heldengedichte Homers und Hesiods, die Handelsrouten von Ost nach West und umgekehrt. Die Nordsee besaß das meiste davon ebenfalls, und die Folgen waren bemerkenswert.
Ich möchte diese Geschichte so gut erzählen, wie ich sie in den Quellen und in den Werken von Gelehrten rund um die Nordsee zu finden vermag. Das ist kein chauvinistisches Unterfangen. Der Süden verliert nichts von seiner Bedeutung, wenn wir daran erinnern, was im Norden geschah. Es ist vielmehr ein Versuch, ein vollständigeres, farbigeres und genaueres Bild unserer geschichtlichen Herkunft zu zeichnen.
Die Strandbesucher entfernten sich niemals sonderlich weit von den Annehmlichkeiten der Küste. Wir werden weiter hinausgehen, auch wenn wir dazu unseren Horizont überschreiten müssen.
Es gab einmal eine Zeit, da niemand sich vorstellen konnte, weiter nach Norden vorzudringen, denn die Nordsee galt als der Rand der Welt. Im Jahr 16 unserer Zeitrechnung versuchte der Römer Drusus Germanicus mit seiner Flotte nach Norden vorzustoßen, wurde jedoch von Stürmen zurückgeschlagen. Der Dichter Albinovanus Pedo begleitete ihn und schrieb, die Götter hätten sie zurückgerufen, damit sie nicht das Ende von allem erblickten. Pedo fragte sich, warum sie mit ihren Schiffen diese fremden Meere schändeten und Unruhe in den ruhigen Heimen der Götter stifteten. Denn die Nordsee war nicht nur »das Meer ewiger Finsternis«, wie der arabische Geograph al-Idrisi sie nannte.[14] Sie war auch der Ort, an dem die Ozeane zusammenstießen und die Gezeiten entstanden, wenn das Wasser in bodenlose Höhlen hinabstürzte und wieder herausströmte; der Ort, an dem die Wasser zu jener »uranfänglichen und ersten Materie« zurückkehrten, »die am Anbeginn der Welt bestanden hatte … und ›Abgrund‹ genannt wird«.[15]
Im 7. Jahrhundert meinte Isidor von Sevilla, die bekannte Welt werde »orbis genannt, weil sie wie ein Rad ist, das vom Ozean umflossen wird«. Dieser Ozean musste sehr viel kleiner sein als das trockene Land, denn in der apokryphen Esra-Apokalypse heißt es: »Am dritten Tag hast du dem Wasser befohlen, sich im siebten Teil der Erde zu sammeln, während du sechs Teile getrocknet und bewahrt hast.« Er war jedoch auch ein beängstigendes Hindernis, eine die Kontinente umgebende Barriere; vielleicht allzu wild, aber eher noch zu seicht, zu schlammig oder zu sehr von Unkräutern bewachsen, als dass man ihn überqueren konnte. Es mochte möglich sein, durch die heißen, dürren Zonen im Süden hindurchzugelangen, aber der vereiste Norden war nichts anderes als das Ende der Welt.[16]
Die Barriere war nicht bloß physischer Natur. Das Meer war ein Ort des Bösen, an dem der biblische Leviathan lebte, das Ungeheuer der Tiefe. Der Antichrist, der »Hochmütige«, ritt rückwärts auf dem Kopf eines Meeresdrachen, wie ja auch die Wikinger in Schiffen fuhren, deren Bug ein Schlangenkopf zierte.[17] Die Genesis und das Buch Hiob bestätigten die Einschätzung der Geographen, dass die See sich nicht bändigen lasse, dass der Drache, der dort lebte, der Drache des Chaos sei und dass dort der Abgrund lauere. Wenn die Apokalypse des Johannes versprach, das Meer werde verschwinden, dann war dies gleichbedeutend mit dem Ende des Bösen schlechthin.[18]
Es war ein kaum bekanntes Meer, das auf seine Erforschung wartete: eine Zone zwischen Himmel und Erde, zwischen der vertrauten Küstenlinie und dem, was auch immer da draußen liegen mochte. Die Iren erzählten wundersame Heiligengeschichten über Meerfahrten, die sie Immrama nannten, »Umherrudern«.[19] Darin wird berichtet, wie Einsiedler in See stachen, weil sie sich irgendwo in weiter Ferne an einem vollkommen ruhigen Ort niederlassen wollten. Heilige machten sich per Schiff auf die Suche nach dem Gelobten Land im Westen, den Inseln der Seligen.
Diese Geschichten sind voller Wunderdinge, aber es fehlt auch nicht an praktischen Ratschlägen. In St. Brandans wundersamer Seefahrt aus dem 8. Jahrhundert, einer Heiligenlegende über eine Fahrt zum Himmel und zu den Toren der Hölle, finden sich auch Anleitungen zum Bau eines solchen Schiffes, eines Fellboots aus Rinderhäuten und Eichenrinde über einem hölzernen Rahmen, dessen Außenhaut mit Fett imprägniert wurde. Wir erfahren, dass der Heilige und seine Reisegefährten auch Ersatzhäute und zusätzliches Fett mitnahmen.[20] Das Meer war dazu da, benutzt zu werden, auch wenn es eines Heiligen bedurfte, den Versuch zu wagen. Und obwohl an manchen wundersamen Begebenheiten durchaus Zweifel angebracht sind – etwa dass die Reisegesellschaft alljährlich mehrere Monate auf dem Rücken eines äußerst wohlwollenden Wals verbringt –, zeigen einige der phantastischsten Geschichten doch eine verführerische Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit.
Die Seeleute sehen einen hohen Berg, der hinter schwarzen Klippen aus dem Meer emporragt, der Gipfel scheinbar in Wolken gehüllt, die sich allerdings als Rauch erweisen. Der Berg speit himmelhohe Flammen aus, die er anschließend wieder einzusaugen scheint. Die Felsen gleich unten am Meer glühen rot wie Feuer. Dort stoßen Brandan und seine Mannschaft auf Judas Ischariot, der auf einem nackten Fels hockt, während die Wellen über ihm zusammenschlagen und ihm dadurch, wie er sagt, eine angenehme Erholung bieten. Am Abend kehrt er zurück in den Berg, die Wohnstätte des großen Leviathan, wo Teufel ihn wegen seiner Sünden quälen und er »Tag und Nacht wie ein Stück geschmolzenes Blei in einem Tiegel« brennen muss.[21]
Die Sünder und Teufel oder die Vorstellung, dass ein Berg die verdammten Seelen mit einem freudigen Feuerstoß begrüßt, sind keine historischen Tatsachen, auch wenn sie für Gläubige eine sehr eindrucksvolle Lektion darstellen mögen. Aber wir erfahren, dass Brandan nach der Abkehr von dem Inselberg nach Süden fährt, woraus folgt, dass diese Insel hoch oben im Norden liegen muss. Weit im Norden von Irland, wo St. Brandans wundersame Seefahrt geschrieben wurde, liegt das vulkanische Island – und zudem noch ein Meeresgebiet, in dem über einer der großen Bruchlinien der Erdkruste tatsächlich kleine rauchende Inseln plötzlich aus dem Wasser emporsteigen. Brandans Seefahrt ist also eine Fahrt zu bekannten Orten.
Der Mönch Dicuil schrieb über all die nördlich von Irland gelegenen Inseln: »Auf einigen von ihnen habe ich gelebt, andere habe ich besucht; einige habe ich nur aus der Ferne gesehen, während ich von wieder anderen gelesen habe.«[22] Höchstwahrscheinlich kam er nie über die Hebriden oder vielleicht über die Orkney-Inseln hinaus, doch andere fuhren sehr viel weiter: bis nach Thule, die halb mythische Insel nördlich von allem. Dicuil zitiert antike Autoren, die von einer Insel berichten, welche »Tag und Nacht unter den Strahlen der Sonne erglänzt« und im Winter gar keinen Tag kenne. Er schreibt auch: »Geistliche, die vom ersten Februar bis zum ersten August auf der Insel lebten, haben mir gesagt, dass die untergehende Sonne sich [an den Tagen um die Sonnenwende] versteckt, als wäre sie hinter einem Hügel verschwunden, so dass es in dieser kurzen Zeitspanne keine Dunkelheit gibt.« Dann habe man genug Licht, um sich des Nachts die Läuse aus den Kleidern zu lesen.
Dieses Thule klingt sehr nach Island.
Das im frühen 12. Jahrhundert entstandene Isländerbuch berichtet, als die Wikinger Island um 870 zu besiedeln begannen, hätten sie dort Priester angetroffen, aber diese Priester hätten sich geweigert, mit Heiden zusammenzuleben, seien deshalb weggegangen und hätten »irische Bücher und Glocken und Krummstäbe« zurückgelassen, »an denen man erkennen konnte, dass sie Iren waren«.[23] Trotz all der bei Dicuil zu findenden Geschichten über absonderliche Dinge – über Menschen mit Pferdefüßen oder mit Ohren von solcher Länge, dass sie ihren ganzen Körper darin einhüllen konnten; über Elche, deren Oberlippe so weit herabhing, dass sie nur zu fressen vermochten, wenn sie rückwärts gingen; oder auch über die Schwierigkeiten, Einhörner zu fangen, weil sie solchen Lärm machten – können wir doch eines als historische Tatsache festhalten: die beständige und eifrige Bewegung auf dem Meer.
Dieses Meer war noch nicht kreuz und quer von altbekannten Schiffsrouten für Handel und Krieg durchzogen wie das Mittelmeer. Im Norden war das Meer noch voller Legenden, und wenn die Männer in See stachen, wussten sie, dass sie den Rand der Welt erkundeten. Um 1075 schrieb der Geistliche Adam von Bremen seine zweifelhafte Hamburgische Kirchengeschichte. Er lebte in der Hafenstadt Bremen, wo er von den Seeleuten erfahren konnte, was sie über das Meer zu wissen glaubten. Er nahm an, der Weg nach Norden führte vorbei an den Orkney-Inseln, die so salzig waren, dass die Schiffe für die Durchfahrt starke Winde benötigten, und weiter nach Island, wo das Eis so alt und schwarz war, dass es brannte, wenn man es anzündete. »Hinter Nordmannien, welches das äußerste Land des Nordens ist, findet man keine Spur menschlicher Wohnung und nichts als den Ocean, der fürchterlich von Anblick und unbegränzt, die ganze Welt umfaßt.« Schwarzer Nebel senkte sich dort herab, das Meer war wild, und man gelangte an jenen Punkt, wo alle Fluten des Meeres in die Tiefe gesaugt und wieder ausgespuckt wurden. Wer noch weiter segelte, dem erging es wie König Harald dem Harten, der, »als vor ihren Augen die Grenzen der schwindenden Welt düster dalagen, dem ungeheuren Schlunde des Abgrundes kaum mit rückwärts gewendeten Schritten wohlbehalten entrann«.[24]
Die Menschen wollten diesen Abgrund überqueren und herausfinden, was dahinterlag. Irgendwann um die Wende zum 13. Jahrhundert glaubte der anonyme Autor der Historia Norwegiae, alles über die Gefahren und Wunder des Nordens zu wissen. Er wusste, dass es dort Strudel und vereiste Landzungen gab, die gewaltige Eisberge ins Meer schleuderten; Meeresungeheuer, die Seeleute verschlangen; Walrösser mit enormen Mähnen und riesenhafte Wesen ohne Kopf und Schwanz.[25] Er gibt Berichte wieder, wonach das Meer kochte, die Erde Feuer spie und ein großer Berg aus dem Wasser emporstieg; aber er war ein gebildeter Mann und glaubte nicht, dass dies ein böses Omen darstellte. Er meinte nur, dass Gott es verstehe, wir Menschen dagegen nicht.
Er interessierte sich nun nicht mehr für die Schrecken des Meeres, sondern für die Dinge, die man fand, wenn man diese Regionen durchquerte. Adam von Bremen füllte den Norden mit Menschen, die niemals gingen, sondern auf einem Bein hüpften, oder mit solchen, die Menschenfleisch aßen (»und daher ebenso gemieden, als mit Recht unbesprochen bleiben«). Da gab es Goten und blaue Menschen, Drachenanbeter und »Pruzzen«, die »sehr menschenfreundliche Menschen« waren. Es gab Hundsköpfe und Menschen mit nur einem Auge auf der Stirn; und wenn die Amazonen ein Kind gebaren, was geschehen konnte, nachdem sie einen durchreisenden Händler verführt oder einen ihrer männlichen Gefangenen zu solchem Dienst gezwungen oder vielleicht auch nur Wasser getrunken hatten, dann hatte es den Kopf auf der Brust, falls es ein Junge war, während die Mädchen zu wunderschönen Frauen heranwuchsen, die jeden Mann vertrieben, der auch nur in ihre Nähe kam. An den Grenzen der Welt gelangte auch die Vernunft an ihre Grenzen.[26]
Zwischen der Entstehungszeit der Wundersamen Seefahrt des heiligen Brandan und der Abfassung der Historia Norwegiae waren viele Schiffe nach Norden und Westen hinausgefahren, hatten Menschen und Ladung übers Meer transportiert und die See genutzt, die einst nur eine Quelle reinen heiligen Schreckens gewesen war. Eine tiefgreifende, aber noch nicht vollständig abgeschlossene Veränderung, denn jenseits des eisigen Nordens lag immer noch ein großes unbekanntes Gebiet, das man mit Geschichten füllen konnte. Aber die Mystiker Deutschlands und der Niederlande, denen das Meer als Symbol eines feindseligen, reinigenden Raumes gedient hatte, begannen diese Metapher nun durch die der Wüste zu ersetzen. Das Meer war allzu geschäftig, allzu praktisch, während die Wüste immer noch rein und äußerst fremdartig erschien. Man kannte das Meer allmählich. Als die Mystikerin Hadewijch im 13. Jahrhundert über das Wasser schreibt, sieht sie darin nicht mehr die erschreckende Aussicht von einst. Die tiefe See ist für sie nicht länger eine Bedrohung für das Leben oder das Ende der Welt, sondern eine Möglichkeit, über das stürmische Wesen Gottes nachzudenken oder darüber, wie man sich in der Liebe verlieren kann. Leviathan ist zumindest für den Augenblick verschwunden.[27]
Es gab allerdings immer noch Ungeheuer, sogar solche, die übers Meer reisten. Eisbären und deren Felle finden sich kaum jemals in den Akten der Zollbehörden, aber diese wilden Tiere wurden lebendig nach Norwegen gebracht, als Bestechungsgeschenke, die durchaus begehrt waren: Gelegentlich, wenn auch nicht oft, tauchen sie sogar an den Höfen Englands und Frankreichs auf.[28] Der unruhige Norden war wie Afrika oder Asien eine ferne, fremdartige Gegend, aber auch eine Quelle von Wunderdingen, die man kennen, mit denen man handeln und die man benutzen konnte.
Nehmen wir zum Beispiel die mittelalterliche Geschichte von Audun, einem Mann, der fast nichts besaß, bei Verwandten in den Westfjorden arbeiten und leben musste und seine Mutter zu versorgen hatte. Er hatte jedoch Glück und gelangte in den Besitz eines Eisbären. In Island kaufte man fast alles auf Kredit, denn die Menschen mussten auch im Frühjahr essen, obwohl die Wolle und die Tuche, die sie gegen Nahrungsmittel eintauschten, erst im Sommer fertig waren. Für ihre Versorgung waren sie auf Schiffer aus Norwegen angewiesen, die größtes Interesse an Informationen über die tatsächliche Kreditwürdigkeit ihrer Kunden hatten. Audun leistete einem dieser Kapitäne dabei so gute Dienste, dass der ihm anbot, ihn mit nach Grönland zu nehmen. Audun verkaufte seine Schafe, um seine Mutter zu unterstützen, denn er war rechtlich verpflichtet, sie mit allem zu versorgen, was sie benötigte, um sechs Jahreszeiten – drei Winter und drei Sommer – zu überstehen, dann stach er in See.[29]
In Grönland traf er einen Jäger mit einem Eisbären, der »außergewöhnlich schön« war und »rote Wangen« hatte. Er bot dem Mann sein ganzes Geld für den Bären an. Der erwiderte ihm, das sei nicht klug, aber Audun erklärte, das sei ihm egal. Er wollte eine Spur in der Welt hinterlassen, indem er den Bären einem König schenkte – ein ebenso exotisches und kostbares Geschenk wie das Nashorn, das in späterer Zeit ein Papst erhalten sollte.
Einen Bären in einem kleinen Schiff mehrere Tage lang übers Meer zu schippern ist sicher haarig, aber durchaus nicht unglaubwürdig. Ein Geistlicher, der von Island zum Festland fuhr, um dort zum Bischof geweiht zu werden, nahm einen »weißen Bären aus Grönland« mit, und dieses Tier war »eine große Kostbarkeit«; es landete schließlich in der Menagerie des Kaisers. Als die Grönländer 1125 einen eigenen Bischof haben wollten, schickten sie zur Unterstützung ihres Wunsches dem König von Norwegen einen Bären, und ihr Plan ging auf.[30] Bären kamen sogar noch sehr viel weiter herum. König Håkon von Norwegen besiegelte seinen Handel mit König Heinrich III. von England mit einer Reihe von Geschenken, zu denen Falken, Pelze, Narwalstoßzähne, ein lebender Elch und ein lebender Eisbär gehörten.[31] Die Ungeheuer des Nordens wirken nun fast schon domestiziert. In Island, wo ein Eisbär allenfalls auf einer Treibeisscholle gesichtet werden konnte, was ein seltener Anblick war, bestimmte das dort geltende Recht: »Wer einen zahmen Eisbären hat, soll ihn ebenso behandeln wie einen Hund.«
Audun fand sich völlig mittellos in einem Kriegsgebiet wieder, zusammen mit einem hungrigen Bären, dem es sicher nachzusehen gewesen wäre, wenn er seinen Betreuer für ein Mittagessen gehalten hätte. Die Fahrt nach Süden dauerte so lange, dass der Bär, selbst wenn er in Grönland ein Jungtier gewesen sein sollte, inzwischen groß und sehr hungrig gewesen sein musste. Der König von Norwegen erbot sich, das Tier zu kaufen, doch Audun lehnte ab und fuhr weiter. Er schaffte es nach Dänemark, aber nun besaß er buchstäblich nichts mehr außer einem Bären, der dem Hungertod nahe war. Ein Höfling bot beiden Nahrung an, sofern er zur Hälfte das Eigentum an dem Bären erhielt. Audun hatte keine Wahl.
Es handelt sich um eine Geschichte, und so rettete der dänische König natürlich Audun und seinen Bären. Er zahlte Audun eine Reise nach Rom und zurück, und selbst der norwegische König musste eingestehen, dass Audun wahrscheinlich das Richtige getan hatte, als er es ablehnte, ihm den Bären zu verkaufen. Norwegische Könige zahlten damals wie die dänischen mit Schiffen, Lebensmitteln und Zeit, aber nicht mit Silber. Weil Audun den Bären behielt, bis er in Dänemark war, gelangte er zu großem Reichtum in Form von Geld, das er für beliebige Zwecke verwenden konnte. Der Mensch meidet nun nicht länger den Abgrund hoch oben im Norden und lebt in ständiger Angst vor Ungeheuern, sondern macht Geschäfte mit ihnen, und zwar in bar.
Diese Geschichte ist ein Volksmärchen über einen Mann und einen Bären, doch sie verweist auch auf einen geschichtlichen Augenblick, in dem die Welt erkennbar modern wird: Geld, Verkehr, Handel, Ehrgeiz. Aber natürlich entscheiden wir selbst, was wir wissen wollen.
Deshalb kommt der Realität dieser verborgenen Vergangenheit so große Bedeutung zu. Sie umfasst die Vorstellung ganzer Völker von dem, was sie sind, wie sie denken, woher sie kommen und weshalb sie herrschen: von all dem, was sie wissen wollen.
»Das Vergessen – ich möchte fast sagen: der historische Irrtum – spielt bei der Erschaffung einer Nation eine wesentliche Rolle«, meinte Ernest Renan einmal; daher sei die Geschichtswissenschaft eine Gefahr für die Nation. Und Eric Hobsbawm fügte hinzu: »Ich halte es für die erste Pflicht des modernen Historikers, solch eine Gefahr zu sein.«[32]
Jede Nationalgeschichte ist in aller Regel extrem lückenhaft. So hingen und hängen die Iren sehr an der Vorstellung einer Insel der Heiligen und Gelehrten, was durchaus nicht falsch ist, außer dass sie die Räuber, Sklavenhalter und Händler auslässt. Manche Holländer hegten ein tiefes Misstrauen gegen alles Mittelalterliche, weil es unweigerlich katholisch und daher unpatriotisch und falsch sein musste, aber es ist keineswegs einfach, mit einer Geschichte zurechtzukommen, die vor dem protestantischen 16. Jahrhundert vollkommen leer sein soll, und es kann auch komische Züge annehmen. Als 1885 in Amsterdam das neue Rijksmuseum in seinem ganzen pseudomittelalterlichen Glanz aus lauter gotischen Spitzbögen und Türmchen eröffnet wurde, erklärte König Wilhelm III.: »Ich werde niemals einen Fuß in dieses Kloster setzen.« Die Einstellung der Norweger ist sogar noch komplizierter, denn das Mittelalter war die Zeit, da Norwegen unabhängig und mächtig war, bevor Dänen und Schweden die Macht übernahmen und ihre Nationalgeschichte zu schreiben begannen. Deshalb übergehen die Norweger nicht das Mittelalter, sondern die nachfolgenden Jahrhunderte, die sie als »vierhundertjährige Nacht« bezeichnen. Als die erste norwegische Nationalversammlung, eine vollkommen demokratische Körperschaft, 1814 zusammentrat, erklärte der Präsident in völliger Verdrehung der Tatsachen: »Damit ist der norwegische Thron wiedererrichtet worden.«[33]
Und es gibt noch Schlimmeres. Die Völker im Umfeld der Nordsee besitzen eine bemerkenswerte Geschichte, die ich hier erzählen möchte, aber sie gerät allzu leicht zur Behauptung einer nordischen Überlegenheit: der Vorstellung, dass die Länder des Südens – wo die Zitronenbäume blühen und die Menschen Zeit haben, darunter zu sitzen – von ihnen lernen sollten und großen, dünnen, blonden Leuten die Herrschaft über kleine, untersetzte, dunkelhaarige Leute zustehe. Als ein kleiner, untersetzter, dunkelhaariger Mensch aus dem Norden bin ich damit gar nicht glücklich; und dass die Autoren der nordischen Sagas all ihre Leibeigenen und Sklaven wie mich aussehen ließen, macht mich wütend.
Und noch ein weiteres, ganz besonderes Übel lastet auf den Legenden des Nordens: Die Geschichte der Verbindungen wird verdreht, um Trennungen der blutigsten Art zu rechtfertigen. Der deutsche Nationalismus war stets fasziniert von seinen Verbindungen nach Skandinavien. Man denke an Wagner, der Geschichten von drachentötenden Superhelden aus dem Nibelungenlied und die Götter des alten Island für seinen Ring-Zyklus aufbereitete, oder an Fritz Lang, der die Nibelungen verfilmte, wobei er sich bemühte, ein vollkommen mittelalterliches Epos über »Deutschland auf der Suche nach einem Ideal in seiner Vergangenheit« zu schaffen, und schließlich mit Goebbels’ Lob zurechtkommen musste, hier sei »ein Filmschicksal nicht aus der Zeit genommen worden, aber so modern, so zeitnah, so aktuell gestaltet«.[34]
Die Wiederentdeckung des großen sächsischen Poems Heliand – der im 9. Jahrhundert im Stil eines nordischen Heldenepos wiedererzählten Evangelien – regte so manchen zu überbordenden Phantasien an. Im 19. Jahrhundert ließ August Vilmar sich zu der Behauptung hinreißen, dieses Werk sei »mit allem grossen und schönen ausgestattet, was das deutsche volk, das deutsche herz und leben zu geben hatte«. Der Heliand zeige allerlei Dinge, die Vilmar für typisch deutsch hielt, etwa »die lebhafte freude des Deutschen an beweglichem vermögen«. Irgendwie schloss er auch, die Bekehrung aller deutschen Stämme zum Christentum sei ein Beweis dafür, dass Deutschland eine einzige Nation sei, denn »die lauterkeit und festigkeit der gesinnung und die innere einheit und einigkeit mit sich selbst übertrug der dichter … auf die personen seiner heiligen geschichte«.[35] Die sächsische Sicht und das sächsische Denken im Heliand wurden zu einem pangermanischen Mythos: Jesus und Bismarck stehen dort in einer Reihe. Vilmar war entzückt von den im gesamten Text zu findenden groben Bemerkungen über die »faulen« Menschen des Südens, meist Juden, und die offenkundige Überlegenheit der »germanischen« Schüler. Seine Vorstellungen sollten Bestand haben. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs waren die in sächsischer Sprache erzählten Evangelien gleichsam zu einer markigen Geschichte von deutscher Männlichkeit geworden.[36]
In den 1930er Jahren wurde die Geschichte der Hanse – in der sich Handelsstädte zusammengeschlossen hatten, um die Macht von Nationalstaaten wirkungsvoll zu untergraben – irgendwie zu einem Anspruch auf die Vorherrschaft der deutschen Nation gemünzt. Es war, als könnte die Tatsache, dass es die Hanse einst gegeben hatte, die vielen hundert Jahre auslöschen, in denen es sie nicht gab. Und in der wichtigen französischen Zeitschrift Annales erschienen in den 1930er Jahren Artikel, die heute unlesbar sind, weil sie alle erdenklichen »spirituellen und intellektuellen Kräfte« hinter dem Kaufmannsbund behaupten und aus Geschäftsbüchern eine ganze Metaphysik ableiten.[37] Doch das ist noch nicht das Schlimmste. In ihrem Bestreben, eine verbrecherische Rassenidee zu verwirklichen, sollte die SS zu einer perfekten, nahezu mythischen Bande nordischer Schläger werden, erkennbar nicht nur an Typus und Form des Schädels, sondern auch eingebunden in eine sorgfältig ausgesuchte Vergangenheit. Ohne jede Ironie gab es während des Zweiten Weltkriegs in Norwegen Plakate, auf denen sich ein Wikinger hinter einem SS-Mann, Freibeutern und einem Mitglied der Ausländerpolizei einreihte, auf sonderbare Weise mit ihnen vereint im Kampf gegen das Spiegelbild der Nazis, den Bolschewismus.[38]
Die Geschichte kann auch beim Töten helfen, falls man nicht aufpasst, deshalb sei hier eines gesagt. Ich feiere hier den Beitrag des Nordens zur Kultur Europas, aber das heißt nicht, dass ich darüber den Glanz des Südens vergäße. Es handelt sich um eine Geschichte von Verbindungen. Ich möchte einen Teil aus der Gesamtgeschichte herauslösen, um ihn deutlicher zu konturieren, weil dieser Teil so oft übersehen wird.
Der deutsche Nationalismus ging in die Irre, das liegt auf der Hand, und er tat dies auf besonders hässliche Weise. Ein Engländer kann dagegen einige der im 19. Jahrhundert entstandenen, ebenso für das inbrünstige Singen von Hymnen und Fahnenschwingen heranziehbaren englischen und britischen Versionen der Vergangenheit lesen und sie schlicht als absurd abtun. Das aber wäre ein Fehler. Denn sie besitzen immer noch außergewöhnliche Macht.
Die Engländer haben eine Geschichte, die jedes Schulkind kennt und in der Angelsachsen irgendwann im 5. Jahrhundert die Küste Britanniens stürmten, die einheimische britische und keltische Bevölkerung vertrieben oder sogar ausrotteten und das Gesicht der Insel für immer veränderten. Wir wurden germanisch und begannen, eine Art von Englisch zu sprechen. Wir wurden Christen in einer immer noch heidnischen Welt. Wir entwickelten uns zu einer eigenständigen Nation, sechs Jahrhunderte bevor das sonderlich viel bedeutete, und wir besaßen, was jede Nation braucht: eine Geschichte über ihre Ursprünge.
Dafür können wir uns auf eine hehre Autorität berufen. Bedas Kirchengeschichte des englischen Volkes ist das Werk eines großen Gelehrten, der in seinem Kloster in Jarrow Zugang zu einer sehr schönen Bibliothek hatte.[39] Es wurde um das Jahr 731 abgeschlossen, womit es zeitlich näher als alle sonstigen Quellen an der darin beschriebenen Invasion liegt – aber doch nicht ganz nah. Beda berichtet, wie er seine Forschungen betrieb. Ein Abt in Canterbury erzählte ihm, was in Canterbury geschehen war, der sich wiederum auf die Erinnerung noch älterer Leute und auf schriftliche Quellen stützte. In der Zwischenzeit reiste ein späterer Erzbischof von Canterbury nach Rom, durchstöberte dort mit Genehmigung des Papstes die Bücherregale im Vatikan und kehrte mit Briefen von Papst Gregor zu Beda zurück. Als der in seiner Geschichte über den heiligen Cuthbert und dessen Leben auf der Insel Lindisfarne schreibt, behauptet er, er habe mit jedem glaubwürdigen Zeugen, den er finden konnte, gesprochen oder im Briefwechsel gestanden.
Aber ist Beda selbst glaubwürdig? Er schrieb über die Zeiten, die ihm ganz besonders am Herzen lagen: die der christlichen Missionierung und ihres Erfolgs. Wenn er über frühere Zeiten schreibt, so sagt er, habe er sich an ältere Autoren gehalten, was durchaus natürlich war, da er doch an solche Autoritäten glaubte.[40] Sein Buch war kein wissenschaftliches Werk und auch nicht Geschichtsschreibung im modernen Sinne. Er stellte seine Quellen nicht in Frage, sondern fügte sie lediglich zusammen – eine glänzend konzipierte Sammlung. Sein Buch ist natürlich eine sächsische Darstellung sächsischer Siege, ein christliches Traktat. Von einem sächsischen Mönch war kaum etwas anderes zu erwarten.
Und da beginnen die Schwierigkeiten. Beda sagt, schon lange vor der Landung sächsischer Missionare habe ein König in Britannien namens Vortigern sächsische Söldner eingeladen, über die Nordsee zu ihm zu kommen und ihm zu helfen, die Feinde der Briten zurückzuschlagen. Er und seine Verbündeten hätten zuvor die Römer um Hilfe gebeten, aber die Römer seien anderweitig beschäftigt gewesen, und die Pikten wie auch die Iren hätten weiterhin Raubzüge unternommen. Beda sagt, im Jahr 449 seien drei Langschiffe mit Männern eingetroffen, die eigentlich das Land wie Freunde hätten verteidigen sollen, es aber in Wirklichkeit wie Feinde erobern wollten. Gildas, seine Quelle aus dem 6. Jahrhundert, schreibt durchaus farbiger: »Eine Bande von Flegeln brach hervor aus der Höhle der barbarischen Löwin und kam auf drei Schiffen herüber.«[41] Sie fanden ein reiches Land vor, hielten die Briten für Feiglinge und ließen aus ihrer Heimat eine weitaus größere Flotte mit vielen weiteren Kriegern kommen. Jüten, Sachsen und Angeln trafen ein, unter Führung von Hengist und Horsa, und ihnen folgten Horden von Siedlern, so viele, dass die einheimischen Briten nervös wurden. Mit gutem Grund. Die Sachsen richteten schon bald die Waffen gegen ihre Verbündeten. Sie verwüsteten nahezu die gesamte Insel – die »sterbende« Insel, schreibt Beda. Häuser stürzten ein, christliche Priester wurden am Altar niedergemetzelt, niemand war da, um die toten Bischöfe zu begraben, und als die Briten in die Berge flohen, wurden sie in Massen niedergemacht. Einige zwang der Hunger, sich zu ergeben, manche verließen ganz das Land, andere suchten Zuflucht in den Wäldern und Bergen, wo sie von dem lebten, was sie dort fanden. Die Briten gingen fort, und England war sächsisch.[42]