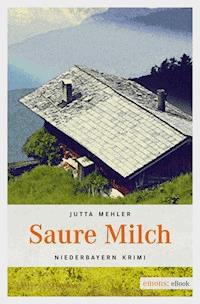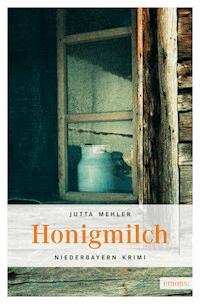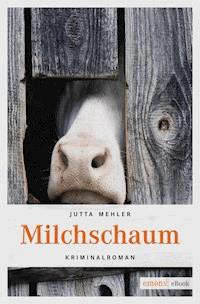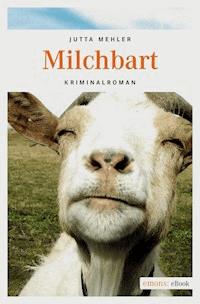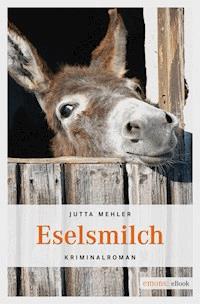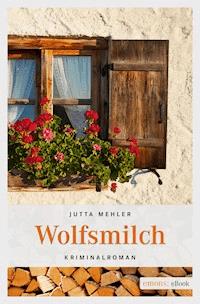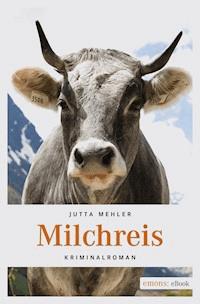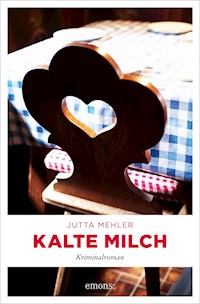Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Es geht um Lilli. Lilli isst zu wenig. Eigentlich isst sie gar nichts. Lilli wird immer dünner. Lilli muß magersüchtig sein, sagt sich Emma, ihre Mutter. Falsch, Emma, grundfalsch. Lilli hat Leukämie. Prognose vierzig Prozent. Vierzig auf ihr Leben, sechzig auf ihren Tod. Die Therapie heißt: Chemo und Knochenmarktransplantation. Eine traurige Geschichte? Nein. Lilli geht es gut, meistens jedenfalls. Weil sie Freunde hat, die wisse, was nottut. Weil Emma alle Heiligen und sogar Albert Einstein anruft, damit sie ein gutes Wort für Lilli einlegen. Bei wem? Das ist Emma doch egal. Jutta Mehler erzählt die Geschichte der fünfzehnjährige Lilli, die durch die Diagnose "Leukämie" jäh aus ihrem sorglosen Teenagerleben gerissen wird. Die Karnkheit erschüttert das Leben der ganzen Familie. Der Therapieverlauf ist unerbittlich, und sie hat mit Nebenwirkungen und Rückschlägen zu kämpfen - und damit, das nicht jedes Kind diese Krankheit überlebt. Lillis Geschichte keine Geschichte des Leidens, sondern eine Geschichte der Stärke und des Glücks. Mit bewundernswerter Energie und unpathetischer Aufopferung begleitet Emmma ihre Tochter durch diese Zeit, an deren Ende Lillis Genesung steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jutta Mehler, Jahrgang 1949, hängte frühzeitig das Jurastudium an den Nagel und zog wieder nach Niederbayern, wo sie während ihrer Kindheit gelebt hat. Seit die beiden Töchter und der Sohn erwachsen sind, schreibt Jutta Mehler Romane und Erzählungen, die vorwiegend auf authentischen Lebensgeschichten basieren. Im Emons Verlag erschien ihr Roman »Moldaukind«.
Der vorliegende Roman basiert auf tatsächlichen Ereignissen; die Figur der Lilli Sand und ihr Schicksal sind in weiten Teilen authentisch. Weitere Figuren sind ebenfalls authentisch, jedoch bis zur Unkenntlichkeit verändert; andere wiederum sind frei erfunden.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten © Titelfoto: aboutpixel.de/svair Umschlaggestaltung: Ulrike Strunden eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-561-7
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meine Kinder
und für alle,
die da waren, als Lilli sie brauchte.
Teil 1
1
LILLI WAR MAGERSÜCHTIG. Ganz bestimmt war sie das.
Das hatte Emma Sand gerade noch gefehlt.
Drei Kinder, eine Scheidung, ein Umzug, ein neuer Ehemann, und dann setzte sich die Jüngste in den Teenagerkopf, magersüchtig zu werden.
Emma hatte schon oft genug von diesem ominösen Übel gehört: Die Mädchen können einfach nicht mehr damit aufhören, nichts zu essen. Wenn sie doch mal was schlucken, dann kotzen sie es gleich wieder aus. Bei Jungen gab es so was nicht.
»Anorexia«, schrieb Emmas Pschyrembel (154. Auflage aus dem Jahr 1964), »Appetitmangel, Herabsetzung des Triebes zur Nahrungsaufnahme.«
Gut gesagt, dachte Emma und blätterte in ihrem »Nachschlagewerk für gesunde und kranke Tage« (5. Auflage aus dem Jahr 1970, Hochzeitsgeschenk).
»… Ursache sind psychische Störungen, hier kennen wir die bei Mädchen im Anschluss an die Geschlechtsreife auftretende sogenannte postpubertäre Magersucht; sie stellt eine gutartige Störung dar.«
»Kommt mir gar nicht gutartig vor«, murrte Emma, »vor vollen Tellern zu verhungern.«
Emma sollte demnächst erfahren, was »nicht gutartig« wirklich bedeutet.
***
»Nein, niemals!«, behauptete Lillis ältere Schwester Katharina Sand (Mausi genannt) unnachgiebig am Telefon, als Emma die Diagnose »Magersucht« fachkompetent bestätigt haben wollte. »Lilli leidet nicht unter einer krankhaften Essstörung, sie ist nicht der Typ dafür.« Mausi stand kurz vor ihrem medizinischen Staatsexamen, bastelte bereits an einer Doktorarbeit und sollte wohl wissen, wie ergreifend eindeutig das Schlüssel-Symptom bei Magersucht ist.
»Ha!«, schnappte also Emma dagegen. »Und wie soll ich mir eine typische Magersüchtige vorstellen? Fett?«
Mausi schwieg patzig zurück.
»Andererseits«, lenkte Emma ein, »ist die Lilli so eine Süße und Liebe, gar nicht so – wie sagt man da heute – ätzend, na unleidlich halt, wie so manch andere.«
»Hm«, grunzte Dr.Mausi in spe befriedigt.
Abgesehen von dem unübersehbaren Indiz, dass Lilli immer dünner und blasser wurde, war es sehr schwer nachzuweisen, wie wenig sie eigentlich aß. Lilli saß mit der Familie am Tisch, lachte und plapperte über dies und das und hantierte mit Messer und Gabel. Emma, Emmas Ehemann, Bruder Ingo und dieser oder jener Gast schmatzten und schluckten und merkten überhaupt nicht, dass Lilli gut zwanzig Minuten an einer halben Gurkenscheibe herumsäbelte.
Erst beim Abwasch fragte sich Emma: Was hat Lilli nun eigentlich gegessen?
Sie nahm sich fest vor, Lilli zu einem Arzt zu bringen.
Doch Lilli hatte ganz schlecht Zeit.
Es war gerade der Beginn der Pfingstferien, und Lilli wollte samt Freundin Tini ein paar Tage bei ihrem Vater und dessen neuer Familie in Unterföhring verbringen.
»Fressorgien werden die zwei da nicht feiern«, muffelte Emma.
Sie hatte ohnehin insgeheim die schnurdünne Freundin Tini im Verdacht, Lilli in diesen abwegigen Magerkeitswahn hineingezogen zu haben.
Emma wollte den Ausflug nicht kurzerhand verbieten, deshalb begnügte sie sich damit, zu hoffen, dass der Tapetenwechsel und die berühmte Lasagne von Papas neuer Frau die Wand vor Lillis Magen bröckeln ließen. Unter der Hoffnung nagte in Emma die Angst, dass Lillis obskure Krankheit schon zu weit fortgeschritten war.
Kein einziges Mal kam Emma auf den Gedanken, Lillis häufiges Nasenbluten könnte mit dem Appetitmangel irgendwie zusammenhängen.
Die kurze Zeit bis zu Lillis Rückkehr verging für Emma widerborstig. Sie wünschte sich jede Minute, Lilli käme kraftstrotzend und pausbäckig zur Tür herein, dabei wusste sie ganz genau, was Wünsche für gewöhnlich an den Realitäten ändern.
Emma wartete mit Bangen.
Lilli kam bleichgesichtig von der Reise zurück. Sie setzte sich kurzatmig eine Weile auf die unterste Treppenstufe, bevor sie nach oben in ihr Zimmer ging.
»Gut«, gab sich Emma am kommenden Tag ein zweites Mal geschlagen, »Arztbesuch, wenn wir zurück sind, aber dann auf der Stelle!«
Es war eben schon so lange geplant: Lillis fünfzehnter Geburtstag, er fiel auf den Pfingstmontag dieses Jahr, sollte mit Emma plus Ehemann und mit Lillis Bruder Ingo gefeiert werden, im Württembergischen, wo Ingo studierte. Ein Ferienappartement war schon gebucht. Lilli freute sich seit Monaten darauf, ihren heißgeliebten Bruder wiederzusehen, wie hätte ihr Emma das vermasseln können. Lilli war ohnehin kein Kind, dem man eine Bitte abschlug, denn Lilli bat selten um etwas.
Emma packte.
Am folgenden Morgen verstaute Emmas Mann das Gepäck im Kofferraum, und Lilli legte sich quer über die Rücksitze.
In der Raststätte »Frankenhöhe« konsumierte Lilli ein halbes Kartoffelscheibchen und verschwand in der Toilette.
Emma schnaubte.
Lilli lag wieder quer hinten im Wagen, als sie bei Ingo ankamen. Sie stieg aus dem Auto und setzte sich auf den Bordstein.
Emma hatte genug. Sie lieh sich das örtliche Telefonbuch vom Vermieter des Appartements und klingelte die ansässigen Ärzte durch. Sie erfuhr von diversen Tonbandansagen, dass die Sprechstunden für heute schon beendet waren, machte stur weiter und erwischte eine bereits pensionierte Frau Dr. Meyer-Grau, die sich bereit erklärte, Lilli und Emma zu empfangen: Ja gut, sie wolle sich das Mädchen ansehen, jetzt gleich.
Frau Dr. Meyer-Grau beäugte und beklopfte, nahm Lilli Blut ab und hielt einen Vortrag über die Vorzüge des Vitamin E.
»Sehen Sie nur, Frau Sand!«, rief Frau Doktor, nachdem sie Lilli herumgedreht hatte, um sie von hinten zu taxieren. »Lilli hat einen großen blauen Fleck auf dem Rücken!«
Emma sah es.
»Beim Sport, beim Hochsprung ist mir das passiert«, warf Lilli ein.
Denkt die, ich verprügle meine Tochter?, durchzuckte es Emma.
»Tja«, sagte Frau Doktor, »da müssen wir erst einmal die Laborwerte abwarten. Das dauert. Die Feiertage, Sie wissen schon. Rufen Sie mich am Mittwoch an.«
»Und was«, drängelte Emma, »können wir inzwischen tun?«
»Nichts«, sagte Frau Dr. Meyer-Grau. »Weiter wie bisher, aber nicht überanstrengen, das Kind.«
»Überanstrengen! Da wäre ich selbst nicht drauf gekommen«, maulte Emma verstohlen.
Lilli schaute an ihrem Geburtstag vom Bett aus zu, wie die anderen mit aufgespießten Weißbrotbrocken durch die Käsemasse im Fonduetopf kreisten.
»Was hab denn ich?«, rief Lilli, als das Faxgerät am Mittwoch nach Pfingsten die Laborwerte ausspuckte.
Sands waren am Abend zuvor nach Hause gekommen, und Emma hatte gleich am Morgen bei Frau Dr. Meyer-Grau im Württembergischen angerufen. Die ließ Emma per Fax Lillis Blutwerte zukommen und per Telefon den guten Rat, mit Lilli einen Kinderarzt aufzusuchen.
»Auch darauf bin ich schon selbst gekommen«, knurrte Emma, während das Faxgerät die Liste der Blutwerte heraushechelte.
»Thrombozyten: 18.000 / Normalwert 160.000 bis 360.000, Hb: 6,1 / Normalwert 12 bis 15, Leukozyten: 26.000 / Normalwert 6.000 bis 8.000, was hab denn ich?«, japste Lilli.
Emma fragte bei Dr.Mausi in spe nach.
»Was hat denn die Lilli?«, schrie Mausi ins Telefon. »Hat die Leukämie! Nein, nein, das gibt’s doch nicht, keine Angst, Mama, es wird sich schon aufklären. Geh zum Doktor mit Lilli, gleich!«
Emma raffte die Ausdrucke mit den Laborwerten zusammen und schleppte Lilli zur Kinderärztin.
Frau Dr. Schild setzte eine bedenkliche Miene auf und sagte: »Da müssen wir eine stationäre Aufnahme in Betracht ziehen.«
Was immer auch herauskommt als Diagnose, überlegte Emma, in das Krankenhaus hier am Ort kommt mir die Lilli nicht. Die haben schon 1949 meinem Großvater beinahe den Garaus gemacht. Dabei war der bloß zuckerkrank. Was man so hört, haben die sich in den letzten fünfzig Jahren kein Quäntchen gebessert. Ganz böse Mäuler behaupten sogar, alle Unfallopfer, die noch einigermaßen bei Sinnen sind, flehen die Sanitäter während des Krankentransports an, sie bloß nicht in das Krankenhaus nach Kranzhausen zu bringen, egal, wohin, nur nicht nach Kranzhausen!
»Wir bringen Lilli nach Erlangen, meine ältere Tochter ist dort …«, versuchte es Emma diplomatisch.
»Gut«, nickte Frau Dr. Schild und griff zum Telefon.
Nach dem Gespräch potenzierte sie die bedenkliche Miene. »Man sagte mir eben, eine lange Anfahrt sei der Patientin nicht zuzumuten. Man empfiehlt das nächst gelegene Krankenhaus aufzusuchen, in Kranzhausen. Ich melde Sie an.«
Frau Doktor hatte Lilli angemeldet und die verehrten Kollegen gleich vorgewarnt.
»Sie wollen also überhaupt nicht zu uns«, empfing der Vizepädiater des Krankenhauses in Kranzhausen Lilli und Emma (der Chefarzt war im Urlaub, es waren schließlich noch Pfingstferien).
Der Vize ließ Lilli vor sich auf- und abpatrouillieren. »Sie hat Senkfüße, sehen Sie nur, Frau Sand, Senkfüße!«
Emma sah gar nichts, es war ihr auch restlos egal, ob Lilli Senk-, Knick- oder Plattfüße hatte, das war schließlich kein Casting. Emma wollte wissen, was Lilli fehlte und wie es nun weitergehen sollte.
»Wir behalten Lilli über Nacht hier«, sagte der Vize.
Das Zimmer war groß wie ein Tanzsaal, und Lillis Bett stand ganz einsam darin herum.
Eine junge Ärztin, taubstumm, vermutete Emma, nahm Lilli Blut ab und verschwand wieder.
Gegen halb acht versprach Lilli zu schlafen, und Emma ging nach Hause.
2
EMMA KAM AM FOLGENDEN TAG um neun Uhr früh zurück.
Lilli grinste ziemlich schief aus dem Kopfkissen. »Mama, glaub mir, das ist echt wie im Spukschloss hier. Weiße Gestalten schweben herein und wieder hinaus. Aber keiner sagt was oder schert sich sonst den Teufel um mich.«
Treffend beschrieben, fand Emma. Sie würde irgendetwas unternehmen müssen.
Nein, doch nicht, der Vize wallte herbei. Er hatte die Mitleidsmiene auf (jahrelange Praxis offensichtlich, geübt vom Beinbruch bis zum Exitus).
»Ich schlage vor, Lilli in eine der Münchner Unikliniken zu bringen.«
»Gut«, stimmte Emma erleichtert zu. »In welche?«
»Tja, also, man muss jetzt sicherlich öfters hin- und herfahren. Also, das Schwabinger Krankenhaus, das ist von hier aus mit dem Auto am schnellsten zu erreichen. Wenn man allerdings mit dem Zug fahren muss, dann ist …«
»Welche Klinik für Lilli am besten geeignet ist, würde ich gerne wissen«, fauchte Emma.
»Tja, also, das Schwabinger Krankenhaus, das liegt im Norden von München, in Schwabing.«
Lilli versuchte, ihren Lachkrampf als Schluckauf zu vermarkten. Emma hätte am liebsten Vizeblut fließen sehen.
»Schön«, entschied sie kurzerhand und ohne irgendwelchen rationalen Gedankengängen eine Chance zu geben, »wir nehmen nicht das Schwabinger, sondern das andere. Wird Lilli im Krankenwagen dorthin gebracht?«
»Tja, also …«
»Wann?«, setzte Emma nach.
»Mal sehen, wann einer gerade mal Zeit hat.«
»Das kann doch nicht sein!« Emma stampfte unbeherrscht mit dem rechten Fuß auf. »Sie als Chef hier können doch wohl selbst bestimmen, wann ein Krankentransport stattfindet und wann nicht.«
Der Pädiater schlich sich.
Schon ein halbes Stündchen später tauchten zwei lange Kerle mit wehenden Haaren auf, einer brünett, einer blond. »Dann pack mers halt«, kündigten sie an.
Der Vize drückte sich irgendwo in der Weite des Krankensaales herum (Intensität der Mitleidsmiene: Stufe rot, gewöhnlich dem finalen Stadium vorbehalten).
»Tapferes Frauchen«, turtelte er in Emmas Richtung.
»Man sollte ihm eine hineinlangen, mitten in seine schleimige, scheinheilige Visage«, giftete Emma, nahm stattdessen Lillis Hand und trottete neben dem Rollbett her.
»Blaulicht?«, rief Goldhaar zurück.
»Nicht nötig«, winkte die Mitleidsmiene ab.
Braunhaar schob Lilli in den Krankenwagen, ließ Emma einsteigen und warf die Tür zu. Lilli richtete sich auf, stützte sich mit dem Ellbogen ab und legte Kinn und Wange in die hohle Hand: »Mami meinst du, ich hab was Schlimmes?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Emma ehrlich. Ihre Kinder log sie eigentlich nie an.
»Hat der Doktor gar nichts gesagt?«, fragte Lilli.
»Nein«, antwortete Emma, »und wenn, dann hätte ich dem sowieso nichts geglaubt.«
Lilli lachte und legte den Kopf aufs Kissen. Der Krankenwagen schaukelte und ruckelte.
»Die Fahrt bis München wird ungemütlich werden«, sagte Emma. »Ist dir schlecht?«
»Bisschen«, murmelte Lilli, und das hieß, sie war kurz davor, zu kotzen. Sie machte die Augen zu. Im Wagen war es brütend heiß. Ein Hochsommertag, obwohl erst Anfang Juni. Im Sanka gab es keine Klimaanlage, und falls irgendwo Frischluft herumgeblasen wurde, dann jedenfalls nicht in Lillis Richtung.
Goldhaar fädelte sich in den Autobahnverkehr. Das Rütteln nahm etwas ab, dafür röhrte jetzt der Motor aus überforderten Zylindern.
»Mami, glaubst du auch, die haben den Sanka vom Schrott?«
»Woher denn sonst«, knurrte Emma, »ich frage mich, was ihm wohl alles fehlt.«
»Verschleppter Achsenbruch«, schlug Lilli vor, »weil es gar so hopst und ruckelt.«
»Gasseilverkalkung«, grinste Emma.
»Bremsklotzentzündung«, prustete Lilli und musste kotzen.
Emma drückte Lilli eine Nierenschale aus grauer Pappe in die Hand und hielt ihren Kopf. Lilli würgte ausgiebig. Die ganze Mühe war aber umsonst, denn von nichts kommt nichts, das weiß schon jedes Vorschulkind.
3
DAS KONNTE NICHT WAHR SEIN! Bis vor zwei Minuten noch hatten sie alle Zeit der Welt gehabt, und auf einmal lag Lilli inmitten eines surrenden weißen Bienenschwarms. Emma boxte sich zu ihr durch.
»Nein«, plärrte Lilli und würgte unter Strapazen eine Handvoll Nichts aus dem Magen, »nicht schon wieder Blut abnehmen, die haben doch erst.«
»Es geht nicht anders, wir müssen es selbst überprüfen«, sagte einer der weißen Mäntel und schob Emma weg.
»Verstehe«, drückte sich Emma wieder vor Lillis Nase, »aber sie muss doch nicht zusehen dabei!«
»Komm, Lilli, geht ganz schnell.«
Lilli hatte inzwischen kapiert, dass sich die Ärzte hier selbst ein Bild machen und sich nicht auf die Befunde aus Kranzhausen verlassen wollten. Das fand Lilli in Ordnung. Sie streckte den Handrücken in das weiße Gewusel.
Es raschelte und dauerte und murmelte.
»Mama!«, weinte Lilli.
»Das muss doch schon vorbei sein, warte, Lilli, ich schau mal, ja?«
Emma beugte sich schräg nach hinten, linste zwischen zwei Ellenbogen hindurch, drehte sich zurück und grinste Lilli an: »Weißt du, was die gemacht haben?« Sie kicherte. »Die haben den Gummihandschuh von dem Doktor versehentlich mit dem Heftpflaster auf deinen Handrücken geklebt und kriegen ihn jetzt nicht mehr ab. Der Doktor pappt praktisch an dir dran.«
Lilli lachte.
Es ging auf zwei Uhr zu. Lillis Blutprobe war im Röhrchen, der Doktor war befreit, der Schwarm hatte sich aufgelöst, aber nun fing es erst richtig an. Lilli musste eingehend untersucht werden: mit Ultraschall, mit Röntgenstrahlen, mit Augen und Ohren und Händen, mit Elektroden.
Lilli hing noch am EKG, da wurde Emma ins Arztzimmer gerufen.
»Lilli hat nur 1.200Thrombozyten«, erklärte einer der Doktoren. »Bei einem so niedrigen Wert besteht die Gefahr von inneren Blutungen. An Lillis Beinen sind bereits punktförmige Hautblutungen, Petechien, zu erkennen.«
Emma dachte an den großen blauen Fleck auf Lillis Rücken. Die Petechien hatte sie für Pickel gehalten.
»Lilli bekommt jetzt sofort Thrombozyten über eine Transfusion zugeführt. Dadurch hoffen wir, einen Wert von zirka 30.000 zu erreichen. Die akute Gefahr innerer Blutungen wäre damit vorerst beseitigt. Lillis Hämoglobinwert ist ebenfalls viel zu niedrig, das bedeutet, sie hat auch zu wenig Erythrozyten. Um den Hb zu erhöhen, bekommt Lilli anschließend eine Bluttransfusion.«
Emma nickte, bald würde es Lilli besser gehen.
Der Doktor, der Emma alles erklärte, war groß und steif und dunkelblond. Er sah aus wie ein Bürokrat, und so sprach er auch.
Emma mochte Bürokraten. Sie hatten so was standhaft Aufrichtiges, wenn sie nicht im Steueramt saßen, fand sie.
»Ich werde Sie später noch mal zu mir ins Büro holen, Frau Sand«, sagte der Bürokrat. »Aber zuerst bringen wir Lilli auf Station, die Thrombozyten, die wir für sie bestellt haben, sind schon da.«
Emma glaubte sich in einem Sciencefictionfilm, Kategorie Horrorszenario, als sich hydraulisch die Panzerglastür zu Station Intern III öffnete: In den Betten, an den Tischen, auf Krabbeldecken und Sofas, überall glatzköpfige Kinder, hohläugig und abgemagert, Teenager, Babys, alle Altersstufen.
***
»Frau Sand«, sagte der Bürokrat wenig später im Arztzimmer, »das ist Professor X, Chef der Onkologie, und das ist Dr. Y, Arzt auf Station, so wie ich.«
Der Professor sah aus wie seine Schützlinge: klapperdürr und hohläugig, auf dem Kopf hatte er allerdings ein paar luftige graue Flusen. Dr. Y sah aus wie Roger Moore.
»Frau Sand«, sagte das promovierte und habilitierte Skelett, »den Blutwerten nach müssen wir davon ausgehen, dass Lilli an Leukämie erkrankt ist. Genaues wissen wir erst nach einer Knochenmarkspunktion. Wir haben es in der Regel mit zwei Formen der Leukämie zu tun: der akuten lymphatischen Leukämie, die 85 Prozent unserer Fälle ausmacht und meist eine sehr gute Prognose hat – die Wahrscheinlichkeit einer Heilung liegt bei 80 Prozent. Und der akuten myeloischen Leukämie, die entsprechend seltener vorkommt und schwerer zu behandeln ist. Bei AML liegt die Prognose um die 50 Prozent.«
»Wir gehen folgendermaßen vor«, übernahm der Bürokrat das Wort, »morgen werden wir Lilli einen Hickmankatheter legen. Es handelt sich dabei, vereinfacht gesagt, um eine Kanüle. Sie führt durch die Jugularvene und endet im rechten Herzvorhof, das andere Ende der Kanüle tritt am Brustmuskel wieder aus. Für Infusionen und zum Blutabnehmen braucht der Hickman mehr oder weniger nur aufgedreht zu werden. Er erspart den Kindern das schmerzhafte Stechen in die Venen, die sowieso mit der Zeit anschwellen und bei der Chemotherapie sogar platzen würden. Der Hickman wird unter Vollnarkose eingesetzt. Die notwendige Knochenmarkspunktion wird auch noch während der Narkose durchgeführt.«
Er lächelte Emma freundlich an: »Wollen Sie es Lilli selbst erklären?«
»Ja«, sagte Emma, »ganz bestimmt.«
Der Bürokrat nickte und machte Emma die Tür auf. Sie ging langsam den Flur hinunter auf das Zimmer zu, in dem Lillis Bett stand.
Leukämie. Chemotherapie. Fälle. Prozentsätze. Lotteriespiel?
Lilli war kein Fall und keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Lilli war Lilli, Punktum. Lilli würde mit heiler Haut herauskommen – musste mit heiler Haut da herauskommen.
Emma trat an Lillis Bett und sagte ihr, dass die Diagnose Leukämie hieß, dass der Professor wüsste, wie man das behandelt, und dass Lilli dafür einen Hickmankatheter brauchte.
»Ich hab Angst, Mami«, flüsterte Lilli und bekam Tränen in die Augen.
»Das ist gar nicht gut«, sagte Emma. »Da müssen wir ein Abkommen treffen.«
Lilli sah ihre Mutter erstaunt an.
»Wir machen das so«, fuhr Emma fort, »ich übernehme die Angst, voll und ganz und ohne Limit. Du kümmerst dich um das, was für dich gerade ansteht. Abgemacht?«
»Abgemacht«, bestätigte Lilli, und Emma schüttelte ihr die Hand, als wäre Lilli der Bundespräsident und Emma Margaret Thatcher.
Lilli lächelte und sah erleichtert aus.
Emma begann die Angst bereits zu spüren und auch die Erschöpfung. Es war acht Uhr vorbei. Sie ging zur Toilette und tupfte sich mit einem Papierhandtuch kaltes Wasser auf die Augenlider. Als sie zurückkam, hing ein Schild an Lillis Bett: »Dieses Kind darf ab sofort nichts mehr essen«, stand in der Sprechblase des darauf abgebildeten Pumuckl zu lesen.
Lilli isst schon seit drei Wochen nichts mehr, seufzte Emma innerlich. Aber gut, es ist eben wichtig, zwölf Stunden vor einer Narkose nüchtern zu bleiben.
***
Auf dem Nachttisch klingelte das Telefon. Es war Dr. Mausi (bald nicht mehr in spe). Emma hatte sie morgens informiert, wohin Lilli gebracht werden würde. Mausi wusste Bescheid.
Jetzt pumpte sie Optimismus und gute Laune und platte Scherze durch das Telefonkabel in Lillis Ohr. Emma hielt Mausis künstlichen Frohsinn für schwer übertrieben, aber Lilli biss an wie die Forelle vor dem Gewitter.
Dr. Mausi war sich noch nicht einmal zu blöd, mit Lilli zu wetten: »Weißt du, Lilli, du musst zählen, wenn du das Narkosemittel bekommst. Du musst zählen und zählen, und wenn du aufhörst, dann weiß der Doktor, dass du eingeschlafen bist. Also ich wette, du kommst höchstens bis drei.«
Lilli hielt dagegen. Sie legte grinsend den Hörer auf. Die Wette will sie gewinnen, unbedingt, sonst noch etwas Wichtiges? Nein!
Dr. Mausi hat, so scheint es, aufgepasst im Fach Kinderpsychologie.
Es ging auf zehn Uhr zu. Emma saß auf einem Stuhl vor Lillis Bett zwischen dem Infusionsständer und einem Stapel pappegrauer Nierenschalen. Lilli döste ein, und vor Emmas Augen begann das Krankenbett zu rotieren, schneller und schneller, ein weißer Wirbel mit einem orangefarbenen Pumuckl-Haarschöpfchen.
»Frau Sand!«
»Ja, ja, bitte, Schwester, kann ich mich hier irgendwo hinlegen, die Nacht über?«
»Das ist bei uns so geregelt: Für Mütter von Kleinkindern haben wir Schlafliegen, die neben dem Krankenbett des Kindes aufgestellt werden. Für die Mütter von Kindern im Schulalter, die zu weit entfernt wohnen, um nach Hause zu fahren, steht eine Elternwohnung zur Verfügung. Für die Väter natürlich auch«, fügte sie lachend hinzu.
Emma nahm einen Schlüsselbund in Empfang und versprach Lilli, Punkt acht Uhr am nächsten Morgen wieder neben Pumuckl aufzutauchen.
An der Kreuzung vor dem Hospital schwenkte Emma nach links, so wie es ihr Schwester Lockenkopf erklärt hatte. Sie ging bis zur dritten Querstraße, bog ab, suchte Hausnummer 17 und stieg in den dritten Stock.
Schön war es da: Wohnzimmer, Küche, Bad und drei Schlafzimmer für hier gestrandete Mütter oder Väter; Naturholzmöbel, frische Bettwäsche im Schrank, frische Handtücher auf der Kommode. Alles blitzsauber. Emma registrierte es mit Dankbarkeit. Sie war froh darüber, dass die Verantwortung für Waschen, Bügeln, saubere Fenster und staubfreie Möbel jetzt nicht bei ihr lag.
An der Wand im Flur hing ein Telefon mit Zähler. Emma rief ihren Mann an, sagte ihm, dass Lillis Diagnose Leukämie lautete und dass er bis auf Weiteres allein mit Haus und Hund zurechtkommen müsse. Dann diktierte sie ihm, was für Lilli und Emma einzupacken und nach München zu schaffen war. Emmas Mann versprach, sich um alles zu kümmern und gleich am nächsten Tag nach München zu kommen.
»Gut«, sagte Emma und nahm es als selbstverständlich. Ihr Mann war schließlich alt genug für ein bisschen Eigenständigkeit. Es war jetzt eben vorbei mit dem Bemuttern und Fürsorgen. Er war ja nicht krank, er hatte bestimmt nicht mal Kopfweh.
»Ach«, sagte Emma, bevor sie auflegte, »bring Leo Leopard mit, aber steck ihn in eine Plastiktüte, damit er nicht dreckig wird.«
Leo Leopard wohnte seit Jahren in Lillis Bett. Er war gut 50 Zentimeter lang, hatte ein rundes, freundliches Gesicht und dicke Pfoten. Leo hatte bereits mehrere Operationen hinter sich, weil sein Bauchfell ständig aufplatzte. Emma gab sich immer große Mühe, an seinen Flanken entlang möglichst unsichtbare Nähte anzulegen. Auf dem Rücken war Leos Plüschfell noch erstaunlich dicht und flaumig.
»Bitte«, sagte Emma, als sie gegen halb zwölf in ihrem Bett lag, »bitte helft Lilli.«
Wen sie damit ansprach, wusste sie selbst nicht.
4
AM DONNERSTAG, DEM 3. JUNI 1999, um elf Uhr früh hatte Lilli den Hickmankatheter intus. Der Bürokrat prüfte via Röntgenstrahlen nach, ob die Kanüle auch wirklich zum Herzvorhof führte.
Die Arbeit des Chirurgen sah recht ordentlich aus. Durch einen kleinen Schnitt rechts in den Hals hatte er die Kanüle in die Jugularvene gefädelt und sie darin weitergeschoben, bis sie im Vorhof angekommen war. Dann hatte er vom Schnitt aus einen schmalen Tunnel gegraben und das andere Ende der Kanüle darin bis zur Brust vorgeschoben. Dort hatte er ein Loch durch die Haut gebohrt und die Kanüle heraustreten lassen. Irgendwo in dem Tunnel hatte der Doktor eine Muffe eingebaut, damit die Kanüle nicht verrutschen konnte. Der Schnitt im Hals war sauber zugenäht.
»Früher«, sagte der Bürokrat zu Emma, »haben wir das Ende der Kanüle einfach aus dem Schnitt heraushängen lassen, durch den es eingeführt wurde. Aber wir mussten beobachten, dass sich diese Stelle sehr leicht infiziert. Deshalb wird jetzt unter der Haut zum Brustmuskel getunnelt. Da ist die Austrittsstelle weniger kritisch. Wenn die Wunde verheilt ist, muss sie nicht einmal mehr abgedeckt werden.«
Lilli verschlief das Röntgen und die Ankunft von Leo Leopard. Sie verschlief etliche Anrufe und natürlich das Mittagessen.
»Ich kann nicht mehr richtig sehen, alles ist verschwommen«, weinte sie, als sie aufwachte.
»Da putzen wir doch schnell die Vaseline von den Wimpern«, schlug die Schwester mit der Knollennase vor. »Weißt du, bei einer Narkose werden die Augen ganz dick eingecremt, damit sie nicht so austrocknen.«
Lilli sah wieder klar, und schon fing sie an zu jubeln. Sie hatte die Wette gewonnen, haushoch hatte sie gewonnen. Emma war Zeuge gewesen. Emma hatte im grünen Kittel, in grünen Pantoffeln und mit einem grünen Mützchen auf dem Kopf (wie ein Laubfrosch, hatte Lilli gefeixt) im Vorraum des Operationssaales bei Lilli bleiben dürfen, bis Lilli eingeschlafen war.
»Sechs, ich hab’s bis sechs geschafft«, erzählte Lilli jedem, der an ihr Bett trat.
»Ja«, konnte Emma bestätigen, »bei sechs ist sie hochgefahren und hat ›Ich hab schon haushoch gewonnen!‹ gekräht, dann war sie weg.«
»Du musst sofort Mausi anrufen«, verlangte Lilli.
Am Abend war der Narkoserausch verflogen, der Schnitt am Hals, der blieb, und er tat höllisch weh. Lilli presste das Kinn ans rechte Schlüsselbein.
»Möchtest du ein Schmerzmittel?«, fragte die Schwester, die Ringelsocken trug.
»Weiß nicht«, weinte Lilli.
»Du musst das selber entscheiden«, verlangte Schwester Ringelsocke.
»Was meinst du denn, Mami?«, fragte Lilli.
»Wie wär’s, wenn du noch ein wenig wartest«, sagte Emma, »vielleicht schläfst du sowieso gleich wieder ein, und wenn nicht, dann kannst immer noch was einnehmen.«
Mit dieser Lösung waren sowohl Lilli als auch Schwester Ringelsocke zufrieden.
Lilli schlief ein.
5
AM FREITAG KONNTE LILLI SEHEN, sie konnte aufstehen, sie konnte die Schmerzen am Hals ertragen, essen konnte sie kaum was. Obwohl sie freie Auswahl hatte, den ganzen Tag: Morgens, mittags und abends kam das Essen aus der Krankenhausküche, pünktlich und ungerufen. Aber darauf waren die Kinder auf Station Intern III gar nicht angewiesen.
»Das ist unsere eigene Küche«, sagte Schwester Blondzopf zu Emma. »Fast alle Kinder hier bekommen eine Chemotherapie, und die macht ihnen schwer zu schaffen. Die kleinen Patienten haben meistens überhaupt keinen Appetit. Außerdem spielen ihre Geschmacksnerven verrückt, sodass die Kinder völlig neue Vorlieben und Abneigungen entwickeln. Wir müssen aber um jeden Bissen froh sein, den sie schlucken. Deshalb haben wir eine Küche. Mütter und Väter können hier zubereiten, worauf ihr Kind gerade Lust hat.«
Die Vorratsschränke waren voll.
Lilli hatte auf gar nichts Lust, und soweit Emma beurteilen konnte, hielten sich auch die Wünsche der anderen Kinder in bescheidenen Grenzen.
Es gab allerdings zwei Ausnahmen: Billi und Benni hingen schon gleich nach dem Frühstück mit ihren Nasen dicht an dem Aushang, der jeweils das Mittagsmenü ankündigte. Sie saßen Punkt elf am Küchentisch, die Gabeln fest in der Faust. Billi und Benni holten sich einen Nachschlag um zwölf, einen weiteren um eins, und um halb zwei vertilgten sie die Reste.
B&B waren überhaupt ganz anders als die anderen Kinder von Station Intern III: Sie waren dick und rund wie Mecki, als er aus dem Schlaraffenland kam, sie hatten beide einen dichten Haarschopf, und sie zogen keinen Infusionsständer hinter sich her.
»Das Cortison macht sie so hungrig«, schnappte Emma auf, als sie in der Küche für Lilli ein Omelett briet, das B&B sehnsüchtig beäugten. »Mit Cortison werden gutartige Tumore behandelt«, bekam Emma mit. Cortison schien Emma das glatte Gegenteil von Chemo zu sein.
Als Emma mit dem Omelett in das Zimmer zurückkam, in dem Lilli gemeinsam mit Baby-Sophia und der achtjährigen Gerti untergebracht war, saß ein kleiner Junge auf Lillis Bettkante. Er war dunkelhäutig, hatte schwarze Augen und schwarze Locken. Emma schätzte ihn auf zehn oder elf Jahre.
»Wen haben wir denn da?«, fragte sie.
Lilli zuckte die Schultern.
»Den kennt keiner«, sagte die Mutter von Baby-Sophia, sah von ihrem Strickzeug auf und warf einen strengen Blick auf Lillis exotischen Besucher. »Er hängt immer allein rum. Nur nachmittags kommt sein Vater für ein paar Stunden. Die Mutter hat noch nie einer gesehen.«
»Wie heißt du denn?«, fragte Lilli das Kind auf ihrem Bett.
Der Junge lächelte und machte den Mund auf. Bevor er etwas sagen konnte, meldete sich Sophias Mutter wieder: »Er hat einen völlig unaussprechlichen Namen. Klingt wie Ala Ung Si Tu. Deutsch kann das arme Kerlchen auch nicht richtig.«
Lilli grinste – ziemlich schief, weil ihr der Schnitt am Hals wehtat – und sagte zu dem dunklen Gesicht vor ihr: »Ala-ung-si-tu, wie wär’s, wenn ich dich Ali nenne?«
Die schwarzen Locken wippten, als er nickte.
»Möchtest du nicht dein Omelett essen, bevor es kalt wird?«, mischte sich Emma ein.
Lilli schüttelte den Kopf, Ali auch.
Emma trug den vollen Teller wieder in die Küche zurück, schnitt das Omelett in der Mitte quer durch und stellte es auf den Tisch. B&B saßen bereits wartend da, mit Messer und Gabel in den Fäusten und je einem blanken Tellerchen vor der Nase.
Auf dem Rückweg zu Lilli hörte sie Baby-Sophia weinen. Als Emma ins Zimmer trat, hatte Sophias Mutter ihr Strickzeug bereits in einem Korb verstaut und bemühte sich, den Säugling aus dem Gitterbettchen zu heben. Sie hätte dringend eine dritte Hand gebraucht, die den dünnen Schlauch festhielt, der vom Infusionsständer zu Sophias Hickmanzugang führte und durch den eine gelbe Flüssigkeit sickerte. Die Kanüle verhedderte sich mit dem Bettzeug. Emma wollte schon zu Hilfe zu eilen, da sagte Lilli: »Ich muss aufs Klo.«
Ali rutschte von der Bettkante und trollte sich.
»Möchtest du aufstehen, oder soll ich ein Töpfchen holen?«, fragte Emma.
Lilli entschied sich für die Toilette in der Mitte des Flurs, der an den Krankenzimmern entlangführte.
Das Kinn ans Schlüsselbein gepresst, damit die Schnittwunde unter Dach und weder Dehnungs- noch Spannungskräften ausgesetzt war, schlurfte Lilli aus dem Zimmer. Ihren Infusionsständer schob sie neben sich her. Eine klare Flüssigkeit tropfte aus der Flasche. Wasser, hatte der Bürokrat gesagt, bloß Wasser.
Als Emma die Tür hinter Lilli schloss, hörte sie, wie Sophias Infusionsständer Alarm piepte. Die Kanüle musste abgeknickt sein, sodass sich die gelbe Flüssigkeit zurückstaute. Eine der Schwestern würde jetzt gleich kommen und nach Baby-Sophia sehen.
Lilli verschwand in der Toilette, und Emma setzte sich auf eines der Sofas im Flur, während sie wartete. Durch die offene Tür schräg gegenüber konnte sie in das Spielzimmer schauen. Legotürme und Playmobilfahrzeuge lagerten auf einem knallblauen Teppich, der – so stand auf einem Schild zu lesen – keinesfalls mit Straßenschuhen betreten werden durfte.
Die Spielsachen wurden von Spendengeldern gekauft, hatte Emma an diesem Morgen in der Küche von einer Apfel schälenden Mutter erfahren. Ebenso die Bücher und Videofilme, die sich in Regalen im Flur stapelten.
Die Kücheneinrichtung samt Vorräten und die Elternwohnungen (es gab noch eine zweite, vier Blocks weiter) wurden ebenfalls durch Spenden finanziert und von der Elterninitiative betreut, das hatte ein Gurke hobelnder Vater hinzugefügt.
Lilli kam aus der Toilette und sah aus, als hätte sie den Durchstieg der Eigernordwand bei Schlechtwetter hinter sich.
»Ich glaub, ich mach ein Nachmittagsschläfchen«, sagte sie.
Das traf sich günstig. Denn kaum lag Lilli im Bett, tauchte der Bürokrat auf und bat Emma ins Arztzimmer.
***
»Die gute Nachricht ist«, sagte der Professor zu Emma, »dass es sich bei Lillis Erkrankung nicht um eine akute Leukämie handelt. Die schlechte Nachricht: Die Diagnose lautet MDS. Lilli leidet an einer bei Kindern sehr seltenen Sonderform der myeloischen Leukämie.«
»MDS«, übernahm der Bürokrat, »heißt Myelodisplastisches Syndrom. Ganz einfach gesagt bedeutet es, dass Lillis Knochenmark nicht mehr richtig arbeitet. Es hat aufgehört, Thrombozyten zu produzieren, stellt viel zu wenig Erythrozyten her und macht zu viele Leukozyten. Andererseits sind keine typisch entarteten Blutzellen nachzuweisen, die das klinische Bild einer myeloischen Leukämie zeigen, jedenfalls im Moment.
Es ist in diesem Fall notwendig, circa zwei Wochen abzuwarten. Während dieser Zeit wird Lilli, soweit erforderlich, mit Thrombozytenkonzentrat und mit Erythrozytenkonzentrat versorgt. Nach Ablauf dieser Frist müssen wir noch mal eine Knochenmarkspunktion durchführen. Das Ergebnis wird uns zeigen, ob sich das Knochenmark von selbst wieder regeneriert hat und vernünftig arbeitet oder ob es dazu übergegangen ist, degenerierte Zellen, man nennt sie Blasten, zu produzieren.«
Es stand also abzuwarten. Möglicherweise besann sich Lillis Knochenmark auf seine Pflicht. In diesem Fall gäbe es für Lilli keine Leukämie, keine Chemotherapie und keine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
»Möglicherweise« war aber kein Grund, aufzuatmen. Im Gegenteil, »möglicherweise« implizierte Ungewissheit, und Ungewissheit macht Angst.
»Zwei Wochen«, fragte Emma, »hier in der Klinik?«
»Nein, nein«, antwortete der Professor. »Lilli muss nur so lange hier bleiben, bis sich die Operationswunde geschlossen hat und die Blutwerte in einem erträglichen Bereich liegen. Wir rechnen mit drei bis vier Tagen.«
Emma nickte und verließ das Büro des Professors. Sie ging in Lillis Zimmer, setzte sich neben ihr schlafendes Kind und bat die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fielen, Lillis Knochenmark zu inspirieren.
6
ALS EMMA AM FOLGENDEN MORGEN, es war Samstag, der 5. Juni 1999, den Flur entlang auf Lillis Zimmer zuging, schepperte Ali mit seinem Infusionsständer vor ihr her. Klare Flüssigkeit tropfte aus einem Beutel in seine Kanüle. Vielleicht auch bloß Wasser, dachte Emma. Ihr fiel ein, dass Ali gestern ohne Infusionsgerät unterwegs gewesen war, und im selben Augenblick fragte sie sich, wieso er eigentlich Haare hatte. Außer B&B und Lilli waren alle Kinder glatzköpfig. Lilli war neu hier, B&B bekamen Cortison statt Chemotherapie. Aber was war mit Ali? Er war doch wohl schon länger auf der onkologischen Station. Cortison bekam er gewiss nicht, denn seine Arme und Beine waren dünn wie Stecken.
Ali öffnete die Tür zu Lillis Zimmer und fuhr mit seinem Infusomat neben ihr Bett. Er lächelte Lilli zu, deutete auf den Schnitt an ihrem Hals und sagte: »Aua.«
»Achmed, lach net, sonst kriegst dei Sach net«, kam in diesem Moment eine Kinderstimme vom anderen Ende des Zimmers.
Emma blickte hinüber. Auf einem Stuhl an Gertis Bett lümmelte ein Junge und feixte. Emma schätzte ihn auf zwölf oder dreizehn Jahre, er musste Gertis Bruder sein. Emma verabscheute ihn sofort.
Sie war noch nie ein Ausbund an Toleranz gewesen, und jetzt hatte sie alles, was an Nachsicht und Verständnis in ihr steckte, für Lilli und die krebskranken Kinder auf Station Intern III reserviert, mehr als alles. Aus diesem Grund reagierten Emmas Hormone – oder waren es die Enzyme – ziemlich hitzig auf den Jungen, der sich da über Ali lustigmachte.
Früchtchen, dachte Emma, klopft saublöde Sprüche und kommt sich auch noch toll vor dabei – cool kommt er sich vor. Hat überhaupt nicht kapiert, wie gut er dran ist im Vergleich zu seiner Schwester und allen anderen hier auf dieser Horrorstation. Man sollte ihm eins aufs Maul geben, aber kräftig.
Emma hätte das am liebsten selbst übernommen. Es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass ihre Geduld mit gesunden Kindern innerhalb weniger Tage auf ein pathologisches Maß geschrumpft war.
Sie wandte sich Lillis Bett zu, weil sie Ali laut lachen hörte. Lilli zeigte ihm gerade, wie prächtig sie schielen konnte. Er versuchte es nachzumachen, bekam es aber nicht hin.
»Du musst mit beiden Augen auf deine Nasenspitze schauen«, sagte Lilli und zeigte es ihm noch mal. Ihre braunen Augen blitzten nur wenige Nuancen heller als Alis schwarze.
Ali setzte sich auf die Bettkante und übte. Gertis Bruder sah zu ihm hinüber und ließ ein abfälliges Zischen hören. Gerti hatte die Augen geschlossen und lag still da. Sie sah krank aus, weiß und hohlwangig. Durch ihre Kanüle floss rote Brühe.
Wo ist denn die Mutter von dem Strolch?, dachte Emma. Höchste Zeit, dass er hier verschwindet. Für Gerti ist das bestimmt kein Gewinn, wenn der an ihrem Bett flegelt.
Ali schielte schon fast so perfekt wie Lilli, als Gertis Vater hereinkam. Er klopfte seiner apathischen Tochter entspannt aufs knochige Händchen und sagte: »Wir müssen dann – Fußballtraining. Morgen schaun wir wieder vorbei.«
»Naa«, quengelte das Früchtchen, »net schon wieder, is ja langweilig, und der blöde Doktor da vorn gafft mir jedes Mal in’ Hals rein, als wenn ich die Pest einschleppen tät.«
Gerti schluchzte leise.
»Dass die sich immer so anstellt«, maulte ihr Bruder.
Eine halbe Sekunde, bevor Emma der Kragen platzte, gab Lillis Infusomat ein Alarmsignal. Die Wasserflasche war leer. Schwester Ringelsocke kam mit einem Plastikbeutel voll Blut herein, hängte ihn an Lillis Ständer und schloss ihn an ihre Kanüle an.
»Wenn Lilli allergisch darauf reagiert – rote Flecken, Schwellungen –, sofort Bescheid sagen«, trug sie Emma auf.
Emma würde Lilli keine Sekunde aus den Augen lassen, solange die Infusion lief, darauf konnte Schwester Ringelsocke Gift nehmen.
»Muss Ali nicht in sein Zimmer?«, erkundigte sie sich.
»Wer?«, fragte die Schwester und merkte im selben Moment, wen Emma meinte. »Ihr habt ihn Ali getauft«, lachte sie. »Keine schlechte Idee. Bist du damit einverstanden?«, fragte sie Lillis Besuch.
Er nickte und schielte sie an. Ringelsocke schielte gekonnt zurück und griff sich seinen Infusionsständer. »Dann komm mal mit, Ali, dein Vater ist schon da.«
7
DER SCHNITT IN DEN HALS, er marterte Lilli.
Wenn sie vom Bett zur Toilette ging, dann schlurfte sie daher, als wäre sie Quasimodos Töchterchen: Lilli drückte das Kinn hart an die rechte Schulter, wodurch sich automatisch ihre linke Schulter hochzog. Diese Verrenkung knickte die rechte Hüfte nach innen, was wiederum zur Folge hatte, dass Lilli den linken Fuß nachzog.
Fest verzahnt mit der Hickmankanüle, fuhr der Infusionsständer auf seinen vier Rädern neben ihr her.