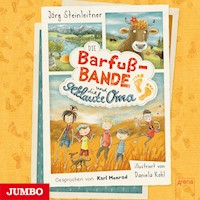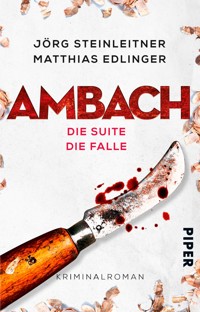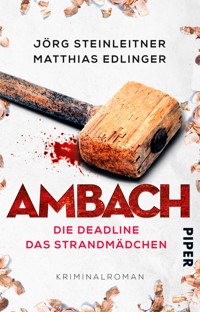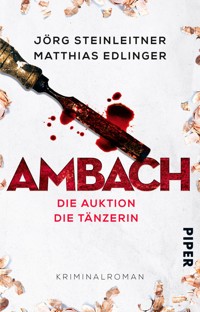
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Felix Ambach kann nichts so richtig gut – außer schnitzen. In den Augen seines Bruders Christian, eines angesehenen Kunsthistorikers, zählt das jedoch wenig: Er behandelt Felix wie einen Versager. Bis Felix genug hat. Um sich zu rächen, fälscht er einen alten Kunstschatz. Er will ihn Christian unterjubeln und ihn dann als Fälschung enttarnen – schon wäre der Ruf seines Bruders zerstört. Doch die Dinge laufen nicht ganz nach Plan. Ehe er sich's versieht, gerät Felix in das Visier eines zwielichtigen Kunstsammlers. Der macht ihm ein so brisantes wie verlockendes Angebot ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97083-9
November 2016
© Matthias Edlinger / Jörg Steinleitner 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Covermotiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
PROLOG
Die Frau saß auf der Küchenarbeitsplatte. Aus ihrem Minirock heraus spreizte sie ihre nackten Beine in Richtung des Fensters, wo man in der Linde eine Amsel hätte singen hören können. Doch hier in der Küche waren nur die spitzen Töne zu vernehmen, die die Frau in regelmäßigen Abständen ausstieß. Sie waren lauter und lustvoller als jedes Vogelgezwitscher. Zudem vermischten sich die Töne der Frau mit jenem tieferen, aber nicht weniger enthemmten Stöhnen des Mannes, der sich zwischen ihren Beinen zu schaffen machte. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, Unterhose und Hose auszuziehen. Allerdings war beides bis auf Höhe der Unterschenkel hinabgerutscht. Vermutlich trug auch die Frau noch ihren Slip, vermutlich hatte er ihn nur zur Seite geschoben.
Hätte Felix Ambach sich den beiden noch weiter als bis zum Türrahmen genähert, hätte er sehen können, dass sich auf der Oberlippe der Frau winzige Schweißperlen gebildet hatten, dass ihre Wangen gerötet waren. Die Frau war vierundzwanzig Jahre alt, ihr Haar kurz und dunkelblond. Ihr leicht geöffneter Mund harmonierte perfekt mit den fein geschnittenen Gesichtszügen. Die Szene erinnerte an eine Helmut-Newton-Fotografie, aber sie war echt.
Der Mann zwischen den Beinen der jungen Frau war außer Atem. Unter seinem hellblauen Hemd verbarg sich ein kleiner Bauchansatz, den man selbst einem Mittdreißiger nicht wünschte. Dafür stand er kurz vor der Fertigstellung seiner Doktorarbeit in Kunstgeschichte, in der es um »irgendetwas mit Heiligenfiguren« ging; kein besonders erotisches Thema für einen Zweiunddreißigjährigen, aber die Erotik fand ja im Hier und Jetzt statt – auf der Küchenarbeitsplatte. Zu erwähnen bliebe, dass der Doktorand sich für unwiderstehlich hielt. Dass die Frau sich nach Sicherheit sehnte. Zwei Parameter, die einander nicht zwangsläufig widersprechen. Der Mann war Felix Ambachs älterer Bruder Christian. Die Frau war Felix’ Freundin Maria.
Gewesen.
Denn direkt, nachdem Felix Ambach mit starrem Blick und vom Türrahmen der Küche aus die beiden in flagranti ertappt hatte, hatte er kehrtgemacht, die Tür mit der Glaseinfassung derart hart zugeworfen, dass das Glas einen hässlichen Riss bekommen hatte, und in grenzenloser, durch Verzweiflung und Schmerz angereicherter Wut nur zwei hilflose Worte gebrüllt: »Du Arschloch!« Seine Stimme hatte sich dabei leicht überschlagen.
Brüder kann man sich nicht aussuchen. Sie sind immer schon da. Insbesondere, wenn sie sechs Jahre älter sind, wie im Fall von Christian Ambach. Interessanterweise richtete sich Felix’ Wut beinahe ausschließlich auf den Bruder, der seine Freundin in seiner Wohnung vögelte, während er nicht da war. Und nicht etwa auf seine Freundin Maria, die ja letztlich auch exakt fünfzig Prozent zur Entstehung der Situation beigetragen hatte. Vermutlich war es ein wenig Restliebe, die für diese nicht ganz gerechte Fehlleitung von Felix’ Gefühlen gesorgt hatte. Eine Restliebe, die trotz des Vorfalls auf der Küchenarbeitsplatte auch die folgenden Jahre überstehen sollte. Jahre, in denen Dr. Christian Ambach sich zu einem der renommiertesten Experten für Alte Kunst – Spezialgebiet Madonnen, Marienfiguren und Putten – im deutschsprachigen Raum und Felix Ambach zu einem der am meisten bemitleideten Loser im Dorf entwickeln würde. Die Frau, Maria, würde bei jenem bleiben, der an diesem noch kühlen Frühlingstag ihre Beine gespreizt hatte, obwohl sie die Freundin des jüngeren und zweifellos attraktiveren Bruders gewesen war. Sie würde diese Entscheidung für eine solide bürgerliche Existenz an der Seite eines Mannes, den viele für ein »blasiertes Arschloch« hielten, für einen charakterlosen, selbstverliebten, überheblichen und leicht aufbrausenden Zeitgenossen ohne jedes Einfühlungsvermögen, durchaus an einigen Tagen des Jahres bereuen; an den meisten jedoch nicht. Wobei jene Tage der Reue im Laufe der Zeit immer mehr wurden im Verhältnis zu den anderen. Doch Christian zu verlassen war keine Option. Dagegen sprach schon, dass Maria ihrer Tochter Soleil eine Trennung auf keinen Fall zumuten wollte. Und war Christian wegen seines Erfolgs als Kunstsachverständiger nicht ohnehin viel auf Reisen? Boten sich einer Ehefrau ohne Existenzsorgen dadurch nicht auch in einem neu gebauten Einfamilienhaus mit mauerartiger Hecke Freiheiten?
Ihr Kontakt zu Felix blieb lose, aber er hielt. Zwangsläufig: Durch die Ehe mit Christian war sie schließlich Felix’ Schwägerin geworden. Er war im Haus der Eltern im kleinen Hinteröx geblieben, war dem Vater, einem Schreiner, bis zu dessen Tod zur Hand gegangen. Ein hart und widerwillig verdientes Brot, denn längst hatten die schwedischen Möbelhäuser die Welt der Küchenarbeitsplatten erobert und für jemanden, der geschickt mit Holz umgehen konnte, boten sich immer weniger Verdienstmöglichkeiten. Letztlich war das, was den Vater Ambach über Wasser hielt, Tagelöhnerei. Und mehr hatte Felix, obwohl zur Arbeit mit Holz außergewöhnlich talentiert, daraus auch nicht gemacht.
So lebte das Trio – Maria, Christian und Felix – aneinander vorbei, während der Vater sich beinahe zu Tode soff, um sich dann zu erhängen, und die Mutter jämmerlich an Krebs zugrunde ging. Felix brauchte nicht viel zum Leben, er schlug sich durch. Half mal hier beim Aufsetzen eines Dachstuhls, sprang mal dort ein, wenn ein alter Hof abgerissen oder saniert werden musste, oder er verlegte minderwertiges Fertigparkett in ebenso minderwertigen Fertighäusern. Eigentlich war es verwunderlich, dass Felix zu einem wurde, den sie im Dorf einen »Nichtsnutz« und »faulen Sack« nannten, denn er war vielerorts zu gebrauchen und sein Geschick in allen Spielarten des Handwerks war überdurchschnittlich. Besonders liebte Felix die Holzschnitzerei und -bildhauerei, eine für brotlos gehaltene Kunst. Zu Unrecht, wie sich im weiteren Verlauf der Ereignisse herausstellen würde. Doch dies war nicht die einzige schwerwiegende Fehleinschätzung, der die rund vierhundert Bewohner von Hinteröx unterlagen: Auch, dass sich Felix Ambach zehn Jahre, nachdem er seine Freundin mit seinem eigenen Bruder beim Liebesspiel auf der Küchenarbeitsplatte erwischt hatte, durch eine unglückliche Verkettung der Umstände immer tiefer in ein Verbrechen von beträchtlichem Ausmaß verstricken würde, ahnte im Dorf niemand. Aber ist dies nicht das Merkmal aller großen Katastrophen – dass man sie erst erkennt, wenn sie ihre mörderische Wirkung bereits entfalten?
Eins
Felix Ambach war selbst überrascht, mit welcher Wucht die schwere Axt durch die Werkstatt flog, die er seit dem Tod des Vaters allein nutzte. Beim Aufprall auf das alte Regal splitterte Holz. Bücher, Kunstbände, hölzerne Rohlinge und einige fertige Schnitzfiguren stürzten in die Tiefe. Ein gläserner und schon lange nicht mehr benutzter Aschenbecher ging scheppernd zu Bruch.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich der aufgewirbelte Staub legte, bis er aufhörte, im Gegenlicht zu tanzen. Auch außerhalb der Werkstatt war der Aufprall zu hören gewesen, ein Eichhörnchen hatte sich verschreckt auf einen Baum in Sicherheit gebracht. Jetzt war es hier draußen, vor dem Ambach’schen Hof, still. Kein Tier wagte es, die Ruhe zu durchbrechen, die in den nächsten Minuten einen so kühnen wie gefährlichen Plan gebären würde.
Felix Ambach stand schwer atmend in der Werkstatt. Sein hagerer Körper zitterte noch Sekunden – vielleicht waren es sogar Minuten – nach dem folgenreichen Axtwurf. Es war eine Mordswut, die ihn beben ließ. Doch allmählich fand sein Puls zur Ruhe. Der Sechsunddreißigjährige wischte sich die dunkelblonden halblangen Haare, die schon lange kein professioneller Schnitt mehr geformt hatte, aus der Stirn und sah sich mit seinen kühlen blauen Augen die Zerstörung im Raum an, die sein Wurf angerichtet hatte. Wäre die Axt anstatt auf ein Bücherregal auf einen menschlichen Schädel getroffen, so hätte sie diesen sauber in zwei Teile geteilt. Felix Ambach hatte keine sichtbaren Muskeln, aber Kraft. Schuld an seinem Ausbruch war ein Telefongespräch mit dem älteren Bruder gewesen. Wieder mal hatten sie gestritten. Ausnahmsweise nicht wegen Maria. Gefühle hatte Felix keine mehr für sie – jedenfalls glaubte er das. Außerdem machte der Vertrauensbruch nur einen Teil der Verachtung aus, die die Brüder füreinander hegten: Regelmäßig hatte der größere Bruder den kleineren mit Prügeln und anderen Gemeinheiten drangsaliert. Und genau genommen war Christian Ambach der Hauptschuldige daran, dass sein Bruder ein Loser geworden war. Denn eigentlich war Felix viel talentierter als er. Bereits als Bub hatte er nicht nur erstaunlich filigrane Holzfiguren geschnitzt, sondern sich auch für die Geschichte der Holzbildhauerei und ihre herausragendsten Vertreter interessiert. Aus Felix Ambach hätte ein Künstler werden können. Als Neunzehnjähriger stand er sogar kurz davor, in die Bildhauerklasse der Kunstakademie aufgenommen zu werden. Doch dann hatte Christian einen Tag vor der Abgabe Felix’ Skulptur »Die Liebenden und der Klumpfüßige« zerhackt und in das Feuer des Küchenofens geworfen. Als Felix fassungslos vor den lodernden Flammen stand, sagte sein großer Bruder: »Das ist wahre Kunst. Sieh es als Performance, Felix. Ich nenne sie ›Das Scheitern des Niveaulosen‹.«
Etwas in Felix’ Innerstem war an diesem Abend zu Bruch gegangen. Und er hatte ein für alle Mal begriffen: Sein großer Bruder duldete keinen König neben sich.
Aber auch die Eltern hatten Anteil an dem brüderlichen Hass, insbesondere der Vater. Er und seine Frau schenkten ihrem Erstgeborenen alle Liebe. Christian hatte seinerzeit als geplantes Kind alle Liebe und Zuwendung bekommen, zu der die Eltern fähig waren. Alle Wünsche hatten sie ihm erfüllt, soweit dies angesichts der begrenzten finanziellen Mittel möglich gewesen war. Und so konnte er den Weg des Erfolgs und der Karriere einschlagen. Heute stellte der Experte Dr. Christian Ambach in der Kunstszene etwas dar.
Felix hingegen war zur Unzeit zur Welt gekommen, wenn man es genau nahm: Seine Geburt war überflüssig gewesen. Nicht nur, dass der Vater sich gar kein weiteres Kind mehr gewünscht hatte: Sechs Jahre nach der Geburt des ersten Sohns hatte – auch wegen der Sauferei des Vaters – die Geldnot die Familie endgültig in den Würgegriff genommen.
Dass ihn der Vater lieber nicht bekommen hätte, hatte er Felix ein Leben lang spüren lassen. Und der Vater Ambach hatte diesbezüglich und deswegen eine harte Entscheidung getroffen: Weil das Geld der Familie nicht für zwei Kinder und den Alkohol reichte, wurde einzig Christian respektiert und gefördert – mit Geburtstagsgeschenken, Studium, Promotion, Ansehen und liebevoller elterlicher Zuwendung. Zwar versuchte die Mutter, gegen diese Ungerechtigkeit anzugehen, aber sie war dafür viel zu schwach gewesen. Warum die Mutter derart wenig Energie aufbringen konnte, erfuhr Felix erst viele Jahre später. Beiläufig, im Hausflur, bei einem Telefonat mit ihr. Er stand neben der Kommode mit dem alten orangefarbenen Telefon mit Wählscheibe und hörte von ihr, die vom Krankenhaus aus anrief, die niederschmetternde Diagnose.
Dieses klobige Telefon mit dem schweren Hörer hätte sich Felix just in diesem Moment des Ärgers in seine Werkstatt gewünscht. Dann hätte er seine ganze Wut am Telefonhörer auslassen können. Hätte den Hörer mit Wucht auf die Gabel donnern können. Hätte seinen Hass gleich einem Blitz durch das Telefongerät in den Boden fahren lassen können.
Stattdessen hielt er jetzt ein läppisch leichtes und für seine von der Arbeit gehärteten, außergewöhnlich kräftigen Hände viel zu kleines Plastikhandy am Ohr; und ihm blieb nichts anderes übrig, als eine lächerlich kleine Taste zu drücken, um das Gespräch mit seinem Bruder zu beenden. Ohne ein Wort des Abschieds natürlich.
Immerhin hatte er nicht das Mobiltelefon gegen die Wand geworfen – ein neues hätte er sich angesichts seiner angespannten Finanzlage unmöglich leisten können –, sondern zur Axt gegriffen und mit ihr seine Wut mittels gewaltsamen Wurfs in das alte Holzregal hineingearbeitet.
Dieses Mal war der Bruder zu weit gegangen.
War es nicht so, dass sie beide die Kinder ihrer Eltern waren? Brachte dies nicht auch mit sich, dass beide für die von der Friedhofsverwaltung in Rechnung gestellten Kosten für das elterliche Grab aufzukommen hatten?
»Hundertzwanzig Euro, Christian«, hatte er den Bruder am Telefon angefleht. »Christian, es geht nur um hundertzwanzig Euro. Das ist für dich doch ein Klacks!«
Aber der Bruder hatte auf das Prinzip verwiesen: »Ich habe vor sieben Jahren bezahlt. Jetzt bist du dran.« So machte er das immer. Ein Prinzipienreiter, ein Unmensch, fand Felix. Aber eben auch sein Bruder, auf ewig mit ihm verknüpft.
»Ich habe das Geld aber nicht. Ich bin gerade knapp bei Kasse … Und du … du … hast es doch!« Die letzten Worte hatte er nur zögerlich geäußert.
»Darum geht es nicht«, hatte der Bruder kaltschnäuzig geantwortet.
»Leih es mir, Christian!«
»Weißt du was«, hatte der große Bruder hierauf erwidert, und seine Stimme war sehr leise geworden. »Du kriegst von mir gar nichts. Weil du eine Null bist. Weil du, wenn ich jetzt bezahle, in zwei Wochen wieder auf der Matte stehst …«
»Das stimmt überhaupt nicht, ich habe dich nie angepumpt … nur jetzt – es geht um Mamas Grab.« Felix stutzte – warum hatte er »Mama« gesagt und nicht »Mutter«? Für einen Moment spürte er tiefe Traurigkeit.
»Du musst endlich einmal auf eigenen Beinen stehen, Felix. Ich kann dich nicht immer aus der Scheiße holen.«
»Christian, es gibt zurzeit keine Jobs für mich …«
»Dann geh halt auf den Bauarbeiterstrich nach München und kratze Asbest von den Wänden.«
»Und wenn ich dir nächsten Monat einfach hundertzwanzig weniger Miete überweise …?«
»Dann schmeiß ich dich raus. Endgültig. Du zahlst doch eh fast nichts für das Haus! Ich könnte es locker fürs Doppelte vermieten! Übernimm endlich mal Verantwortung für dein Leben! Wer bin ich denn? Ich bin doch nicht dein Depp. Du bist mir schon viel zu lange viel zu billig weggekommen. Hundertzwanzig popelige Euro für das Grab unserer Mutter wirst du jetzt wohl noch auftreiben können, du Versager.«
Da war es wieder, dieses Wort: Versager. Und wie in früheren Auseinandersetzungen verließ Felix auch dieses Mal die Schlagfertigkeit. Anstatt dagegenzuhalten, legte er einfach auf. Es hatte keinen Sinn, dem Bruder Paroli zu bieten. Christian war gebildet, erfolgreich, er war es gewöhnt, vor Menschen zu sprechen, es war ihm ein Leichtes, Felix das Wort im Mund herumzudrehen. Als Felix nach der Axt griff, spürte er tiefen Hass, aber auch große Hilflosigkeit. Dann kam der Wurf, potenziell Schädel spaltend. Und jetzt, beim Herausziehen der Axt aus dem Bücherregal, fiel sein Blick auf einen der Kunstbände, die aus dem staubigen Möbel gefallen waren. Die Seite, die durch den Sturz des Buchs aufgeschlagen worden war, zeigte das Schwarz-Weiß-Foto des berühmten Reliefs von den vierzehn Nothelfern, angefertigt aus Lindenholz von dem legendären Holzbildhauer Tilman Riemenschneider; im Original etwa 60 Zentimeter hoch und 120 Zentimeter breit, Entstehungszeit Anfang des 16. Jahrhunderts. Das Foto war Bestandteil eines wissenschaftlichen Aufsatzes von Dr. Christian Ambach. Zunächst fiel Felix’ Blick nur auf das abgebildete Relief. Doch dann begann er den Aufsatz des Bruders zu lesen. Und was hier stand, brachte ihn auf eine Idee, die mehrere Menschen das Leben kosten würde:
»… geht aus der vom Fürstbischof zu Würzburg verfassten Urkunde eindeutig hervor, dass der sterbenskranke Geistliche im Jahr 1494 Riemenschneider beauftragt hat, für die private bischöfliche Wohnstatt eine Serie der vierzehn Nothelfer als kleinere, einzeln stehende Statuen zu schnitzen. Bischof Rudolf II. von Scherenberg aber ist 1495 verstorben. Der Schriftwechsel zwischen Riemenschneider und der bischöflichen Kanzlei zeigt, dass die vierzehn Skulpturen zum Zeitpunkt des Todes von Bischof Rudolf noch nicht vollständig fertiggestellt waren – und auch nicht von dessen Nachfolger abgenommen und bezahlt wurden.«
Felix nickte. Er fand den Schreibstil seines Bruders zwar etwas langweilig, blätterte aber trotzdem um und las weiter.
»Zwar verfügte Riemenschneider auch über gute Beziehungen zum neuen Fürstbischof Lorenz von Bibra. Doch dieser weigerte sich, die vierzehn Skulpturen abzunehmen. Stattdessen gab er dem Bildhauer den Auftrag zu einem Relief, das immerhin dieselben Motive und Figuren abbilden sollte.
Vieles spricht dafür, dass dies die wahre Vorgeschichte des Riemenschneider’schen Reliefs ist. Da uns das berühmte Relief bis heute in wunderbarem Zustand erhalten ist, muss angenommen werden, dass auch die für Bischof Rudolf von Scherenberg geschnitzten Nothelfer-Skulpturen noch existieren. Aber wo könnten diese Schätze verborgen sein? Fristen sie unerkannt auf einem verstaubten Dachboden in Würzburg oder anderswo in Deutschland oder Europa ein trauriges Dasein? Muss die Hoffnung sämtlicher Kunstliebhaber, einmal ihrer ansichtig zu werden, ein frommer Wunsch bleiben? Viele Fragen, keine Antworten – und letztlich steht nur eines fest: Das Auffinden der vierzehn Nothelfer käme einer kunsthistorischen Sensation gleich …«
Wenn Felix später darüber nachdachte, kam es ihm so vor, als hätte das Schicksal das Buch an genau dieser Stelle aufgeschlagen. Als wäre es ein göttliches Zeichen gewesen.
Zwei
Obwohl Felix Ambach impulsiv war, machte er sich nicht sofort an die Umsetzung seines Plans. Zunächst galt es noch einer Pflicht nachzukommen, die ihm am Herzen lag und für die er Geld benötigte. Genauer gesagt: einhundertzwanzig Euro. Er riss die linke Schublade der Werkbank auf, öffnete die darin liegende Blechdose, leerte ihren Inhalt auf die Bank und griff sich aus dem Haufen verrosteter Nägel und Schrauben die Münzen heraus. Dann eilte er ins Wohnhaus und holte das in der Kaffeedose verbliebene Kleingeld. In einer seiner Hosen, in seinem ausgebeulten Lederportemonnaie und in einem Buch fanden sich noch einige kleinere Scheine, sodass er am Ende seiner Suchaktion auf hundertachtzehn Euro und zwölf Cent kam. Er war selbst überrascht. Und damit war es noch nicht getan: Die Pfandflaschen aus der hinter der Küche gelegenen Kammer brachten ihm zusätzlich knappe sechs Euro.
Es war seltsam, aber obwohl er wusste, dass die Münzen und Scheine in seiner Hosentasche sein vorerst letztes Geld waren und obwohl er keine Ahnung hatte, wovon er in den nächsten Wochen leben würde, spürte Felix mit einem Mal einen Antrieb und eine Schaffenslust, wie er sie seit Langem nicht – vielleicht sogar noch nie in seinem Leben – gefühlt hatte. Er befand sich jetzt auf einer Mission. Alles würde sich fügen. Ja, sein Bruder hatte schon recht: Jetzt war es an ihm, Verantwortung zu übernehmen. Schon bald würde Christian, das Arschloch, sehen, zu was ein Versager fähig war.
Die Ambach’sche Werkstatt lag – wie auch das direkt gegenüberliegende Wohnhaus – ziemlich abseits. Das verwilderte Grundstück grenzte rückseitig an den vornehmlich aus Nadelhölzern bestehenden Wald. Dennoch kam es manchmal vor, dass sich Wanderer aus der Stadt hierher verirrten. Oder ein neuer, des Lesens nicht sehr mächtiger Paketdienstfahrer, der das winzige Büro der Jusos im Ort einfach nicht finden konnte. Bog man im Dorf einmal falsch ab, dann landete man eben auf dem Feldweg, der zu Ambachs Hof führte. Hinter dem Haus ging der Weg in einen Forstweg über. Aber jetzt waren weder Wanderer noch Paketfahrer unterwegs. Felix passierte den Feldweg und gelangte zur Dorfstraße. Er wollte zum Rathaus, um seiner Pflicht zu genügen. Während er so ging, spürte er Zuversicht. Und anscheinend war auch das Schicksal einverstanden mit seinen Plänen, denn auf halber Strecke traf er Hubert Novak, der ihm noch Geld für die Restaurierung einer alten Holztür schuldete. Er zahlte ihm die achtzig Euro in bar.
»Firma dankt, Rechnung brauch ich keine«, meinte der Auftraggeber. »Und du … wenn du magst: Ich hab noch fünf Türen oben, vielleicht wär da ein Rabatt drin?«
»Für dreihundertfünfzig könnt ich’s machen.«
»Abgemacht«, sagte Novak, die beiden besiegelten das Geschäft per Handschlag.