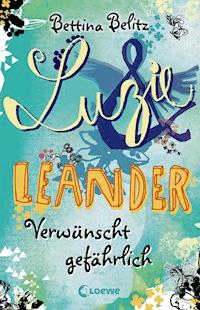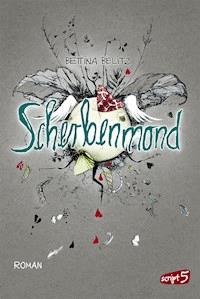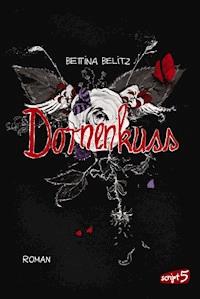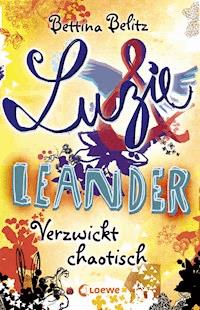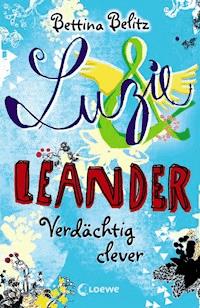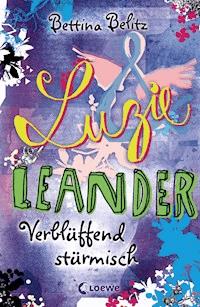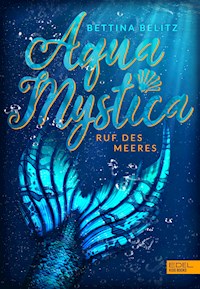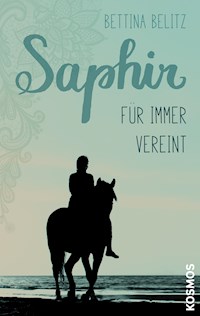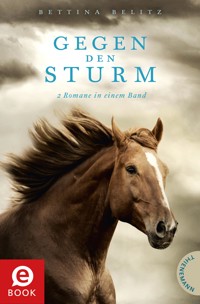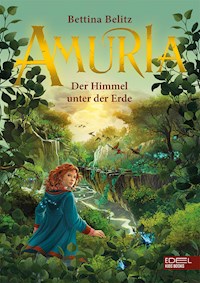
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Kids Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Maja staunt nicht schlecht, als sie sich bei einem ihrer Streifzüge durch den neuseeländischen Regenwald nach einem schwindelerregenden Sturz in einer fantastischen Welt wiederfindet. Ihre Bewohner leben in Harmonie mit Tieren und Pflanzen, alles ist hell und schön – nur Maja passt nicht hierher. Sie, der Eindringling, stört Amurias Gleichgewicht, schlimmer noch: Als Menschenkind könnte sie Amurias geheime Existenz verraten. Ihr bleibt nur eine Chance: Zusammen mit dem jungen Nebelhüter Nalu muss sie einen gefährlichen Auftrag erfüllen, dann erst darf sie nach Hause zurückkehren. Sie ahnt nicht, dass die Reise, auf die der geheimnisvolle Junge und sie aufbrechen, nicht nur die Grundfesten Amurias, sondern auch die ihrer eigenen Welt erschüttern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Mondscheinkind
Schlammschlacht
Auf Nimmerwiedersehen
Hungersnöte
Sitzkreis
Tödliches Paradies
Der Nachthelle Hirsch
Sonne und Mond
Die Silberlagune
Abschiedsklänge
Zwischen den Welten
Willkommen im Nichts
Der Geist des Feuers
Verwandlungskünste
Sternenzauber
Dünnes Eis
Geschwisterkriege
Das ewige Gleichgewicht
Lichtblicke
Himmel und Erde
Auf Immerwiedersehen
Mondscheinkind
»An der Westküste sind gestern früh wieder zwölf Wale gestrandet und verendet. Warum immer zwölf?«, fragte Mama besorgt.
»Ja. Passt zu den Delfinen bei Wellington. Auch zwölf«, antwortete Papa und klickte ein paarmal mit der Maus. »Zur gleichen Zeit haben wir neue seismische Aktivitäten gemessen, obwohl der Berg schläft. Ich sag dir, da gibt es einen Zusammenhang. Es muss einen geben – wenn ich nur wüsste, welchen!«
»Und wenn ich nur wüsste, warum es jedes Mal zwölf sind …«, murmelte Mama.
Noch immer hatten sie nicht bemerkt, dass ich hinter ihnen stand. Es musste schon ein Tornado durchs Zelt fahren, damit sie mal ihre Arbeit vergaßen. Denn sie lebten für ihre Arbeit.
Seit ich denken konnte, versuchten meine Eltern, die Welt zu retten. Für sie sah das allerdings so aus, dass sie stundenlang über ihren Laptops brüteten, Kurven und Diagramme betrachteten, die sich kaum veränderten, oder aufwendige Messungen vornahmen – und zwar rund um den Globus. Ich war erst dreizehn und hatte schon in Südamerika, auf Island, in Mexiko und auf den Kanarischen Inseln gelebt, doch nun waren wir endlich wieder an dem Ort gelandet, den ich am meisten liebte: Neuseeland. Genauer: Mount Taranaki auf Neuseelands Nordinsel. Meine Eltern waren verrückt nach Vulkanen, auch wenn sie am Fuß eines Vulkans kaum etwas anderes machten, als ihre Messstationen und Laptops aufzubauen, und sich manchmal den ganzen Tag kaum vom Fleck bewegten.
Ich war da anders. Anstatt die Natur über den Computer auszuwerten, befand ich mich lieber mittendrin, ganz besonders in dem märchenhaften Regenwald am untersten grünen Gürtel des Mount Taranaki.
Goblin Forest nannten die Einheimischen ihn, den Kobold-Wald. So sah er auch aus – und noch wollte ich nicht akzeptieren, was meine Eltern und ihre Kollegen glaubten, herausgefunden zu haben. Dass dieser dichte, sumpfige Wald zu sterben begann und mit ihm die süßen Kiwivögel, die Papa und ich früher zusammen behutsam aus ihren Erdhöhlen gezogen hatten, damit ich sie in meinen Armen hielt und er ihnen Fußbänder mit Sendern anlegen, sie wiegen und vermessen konnte. Nie hatte ich ihre sanften schwarzen Kugelaugen vergessen können und erst recht nicht, wie weich sie sich anfühlten, wenn sie wieder schläfrig wurden und sich schwer in meine Hand schmiegten, um weiterzudösen. Kiwis waren nur nachts richtig munter, bei Helligkeit versteckten sie sich und schliefen. Doch das würde mich nicht abhalten, auch tagsüber nach ihnen zu suchen.
Wir waren schon drei Tage im Camp, und ich hatte es bisher nicht eine Minute verlassen dürfen. Meine Eltern konnten nicht erwarten, dass ich noch länger bei ihnen herumsaß und ihnen dabei zuschaute, wie sie irgendwelche komplizierten Analysen auswerteten. Das war todsterbenslangweilig. Gestern Abend hatte ich sie endlich breitschlagen können, mir die Erlaubnis zu geben, dass ich heute Mittag allein durch den Wald streifen durfte. Schließlich kannte ich mich hier aus.
»Hey, ihr zwei.« Es dauerte ein paar Sekunden, bis meine Eltern ihre Blicke von den Bildschirmen lösten und sich fragend zu mir herumdrehten. »Ich zieh dann mal los. Okay?«
Mama und Papa seufzten beide auf und warfen sich einen kurzen Blick zu. Dann zwang Mama sich zu einem Lächeln.
»In Ordnung, Maja, aber denk daran, was wir gestern Abend besprochen haben. Du bleibst auf den beschilderten Wegen. Kein Schritt abseits der Pfade!«
»Ja, und sobald Nebel aufzieht, bleibst du stehen und wartest, bis er sich legt«, redete Papa weiter, über dessen Augen sich dicke Kummerfalten gebildet hatten. Er machte sich schon jetzt Sorgen, ich sah es genau.
»Ich weiß nicht …«, wandte ich achselzuckend ein. »Hier ist dauernd Nebel. Könnte sein, dass ich dann stundenlang im Wald rumstehe.«
»Da ist was dran.« Mama legte Papa beruhigend die Hand auf den braun gebrannten Unterarm. »Wir haben den Berg seit drei Tagen nicht gesehen. Trotzdem, bei dichtem Nebel hältst du dich an Papas Rat, ja? Das Klima hat sich eben verändert … Wir können sie deshalb aber nicht zwingen, immerzu hierzubleiben«, schloss sie in Papas Richtung, weil der schon wieder aus tiefstem Herzen aufseufzte, als hätte ich gar keine andere Chance, als mich im Nebel zu verirren.
»Wir könnten schon, wenn wir das wollten …«, grummelte Papa und verzog sein stoppelbärtiges Gesicht. »Aber wir wollen ja nicht.«
»Nein, wir wollen nicht«, bestätigte Mama sanft, doch auch sie wirkte angespannt. »Wir können Maja nicht im Camp einsperren.«
»Hallo, ich bin noch da!« Feixend winkte ich ihnen zu. »Ihr könnt mit mir direkt reden. Ich werde schon nicht verloren gehen im Wald.«
»Wäre ja nichts Neues.« Papa nahm einen Schluck aus seiner Wasserflasche und blickte mich ernst an. »Du erinnerst dich, was passiert ist, als wir das letzte Mal am Taranaki waren?«
»Klar«, erwiderte ich betont locker und schulterte meinen Rucksack. »Und eigentlich war es gar nichts.«
»Gar nichts?« Die Plastikflasche knackte in Papas Hand, weil er sie versehentlich zu fest drückte. »Du warst zwei Tage lang wie vom Erdboden verschwunden, und wir haben dich überall gesucht! Und zwar genau in diesem Wald!«
»Schatz, bitte …« Erneut strich Mama über seinen Unterarm, und er unterdrückte ein angestrengtes Schnaufen. »Maja ist jetzt dreizehn, keine vier mehr. Und sie hat ein Handy dabei.«
»Ja, und außerdem ist nichts Schlimmes passiert. Ich hatte nicht einmal eine Verletzung! Nur ein paar Kratzer, mehr nicht.« Und dazu Erinnerungen, an die ich heute selbst nicht mehr zu glauben wagte. Weil sie zu fantastisch waren, zu paradiesisch, zu … zu schön für einen Sturz in ein schlammiges Erdloch.
»Überlebensmaßnahme des Gehirns«, hatte der Kinderpsychologe gesagt, zu dem meine Eltern mich zwei Jahre später geschleppt hatten, weil ich immer wieder von diesen Erlebnissen erzählt hatte. Es habe sich Sachen ausgedacht und für wahr gehalten, die nicht da gewesen seien, aber für tröstende Gefühle gesorgt hätten, solange ich in Gefahr gewesen sei. Trotz meiner sechs Jahre hatte ich verstanden, was er damit gemeint hatte – und irgendwann glaubte ich selbst nicht mehr daran. Ja, ich musste mir das alles eingebildet haben, diese lichtdurchflutete Welt mit ihren seltsamen flimmernden Bewohnern, den zahmen Fabelwesen und Wasserfällen, die aussahen, als würden sie aus Regenbogenkristallen bestehen. So etwas gab es in Wirklichkeit nicht.
Trotzdem war es mir jedes Mal unangenehm, wenn Mama und Papa mich an dieses Kapitel meiner Kindheit erinnerten. Als hätte ich mich nicht im Wald verirrt, sondern meinen Verstand verloren.
»Dir ist nichts passiert, aber wir sind fast Amok gelaufen vor Sorge«, knurrte Papa. »Ein zweites Mal halte ich das nicht aus. Aber gut, Katja hat recht, du bist nun älter und … vernünftiger …« Er verkniff sich ein Lachen. Besonders vernünftig war ich wirklich nicht. Zu gerne verließ ich befestigte Wege, näherte mich wilden Tieren, kletterte auf steilen Felsen herum, spielte mit Feuerquallen oder kämpfte mit Riesenwellen. Aber ich war eben auch ziemlich gut in diesen Dingen. »Halte dich einfach an das, was wir ausgemacht haben. Nur bis zur nächsten Hütte, dann umkehren. Keine Experi- mente.«
»In Ordnung, keine Experimente«, versprach ich artig. Fürs Erste genügte es mir, endlich wieder im Goblin Forest zu sein. Alles Weitere würde sich schon ergeben. In Neuseeland warteten immer irgendwelche Abenteuer, auch auf den befestigten Wegen.
»Und denk daran, Maja, die Natur hier hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Leider.« Mamas Lächeln schwand. »Der Wald bekommt wegen dem ständigen Dunst und Nebel zu wenig Sonne ab, viele Pflanzen wachsen nicht mehr so prächtig, und die Kiwis … die Kiwis sind ausgestorben.«
»Glaube ich nicht«, widersprach ich stur. »Die verstecken sich nur.«
Erneut warfen Mama und Papa sich einen vielsagenden Blick zu, doch anstatt mir weitere Warnungen mit auf den Weg zu geben, stand Papa auf, trat auf mich zu und umfasste mein Gesicht, um mich wie so oft auf mein Feuermal zu küssen. Es prangte über meinen Brauen, exakt in ihrer Mitte, und hatte die Form einer Mondsichel in einem Vollmond. Also quasi zwei Monde in einem.
»Dann pass gut auf dich auf, Mondscheinkind. Bis heute Abend.«
»Ja, bis heute Abend.« Auch Mama stand auf, um mich in den Arm zu nehmen.
Sie benahmen sich, als würde ich zu einer Weltreise aufbrechen. Dabei wollte ich nur eine halbtägige Wanderung machen, deren Strecke ich früher fast jeden Tag mit Papa gelaufen war. Ich war mir sicher, dass ich sie noch in- und auswendig kannte.
»Ruf an, wenn was ist. Ach, und Maja …« Mama schaute mir forschend in die Augen. »Wir werden ein wenig länger bleiben als sonst. Vielleicht findest du in der Schule ein oder zwei Mädchen, mit denen du in Zukunft …«
»Länger ist nicht für immer«, unterbrach ich sie leise. »Das lohnt nicht. Bin dann weg, viel Spaß mit euren langweiligen Diagrammen!«
Ehe Mama etwas einwenden konnte, schlüpfte ich durch den Zelteingang nach draußen in die frische Kühle und marschierte dem Wald entgegen. Ich wusste genau, was Mama mir hatte sagen wollen – dass ich mir Freunde suchen sollte, mit denen ich zusammen durch die Natur streifen konnte. Oder vielleicht mal ganz andere Dinge tun, als immer nur Gefahren zu suchen.
Aber ich wollte keine anderen Dinge tun. Ich war gerne draußen und fühlte mich dort niemals allein. Vor allem aber wollte ich keine Freundschaften mehr knüpfen, die ich nach einiger Zeit doch wieder aufgeben musste, weil woanders auf der Welt Tiere ausstarben und sich Erdkrusten verschoben. Das hatte keinen Sinn – und es tat weh. Davon hatte ich die Nase voll. In meinem Leben waren nicht die Tiere und Pflanzen vom Aussterben bedroht, sondern die Freunde. Also war es besser, gar nicht erst welche zu haben.
Sobald ich das Camp hinter mir gelassen hatte, beschleunigte ich meine Schritte, denn ich konnte es kaum erwarten, dass sich das dunkelgrüne Dach des Goblin Forest über mir schloss und ich mir vorkam wie der einzige Mensch weit und breit. Zwar gehörten die ausgeschilderten, durch Holzplanken befestigten Wege zu den beliebten Touristenpfaden, doch bei dem feuchten, dunstigen Wetter, das im Moment herrschte, verirrten sich nur wenige von ihnen hierher.
Schon nach den ersten Metern musste ich mir meine Kapuzenjacke überziehen, weil es aus den Ästen und Zweigen kalt auf mich heruntertropfte, ein ständiges Klack-klack-klack, und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, warum es mir so merkwürdig fremd und unheimlich vorkam: Die Vogelstimmen fehlten. Kein einziger Vogel zwitscherte oder rief – ganz anders als früher, wo Papa und ich manchmal kaum unsere Schritte gehört hatten vor lauter Gesang aus den Wipfeln über uns. Bis auf das ständige Tropfen der Nässe aus den Bäumen war es totenstill.
Entschlossen lief ich weiter. Vielleicht war ich noch nicht weit genug in den Wald vorgedrungen, und die Vögel hatten sich in seine Mitte zurückgezogen. Doch nun fiel mir auf, dass er sich tatsächlich verändert hatte, ich konnte es nicht mehr ignorieren.
Die Farne wirkten blass, manchen von ihnen schien sämtliche Lebenskraft ausgegangen zu sein, ihre langen Wedel lagen flach auf dem sumpfigen Boden. Einige Bäume verloren ihr Laub, sahen kahl und tot aus, und andere wuchsen krumm um sich selbst herum, oder ihre Stämme waren übersät von Wucherungen, die aussahen wie Geschwüre. Sie erinnerten mich an giftige Pilze und sendeten einen dumpfen, modrigen Geruch aus.
Überhaupt müffelte der Wald. Früher hatte mich sein Duft immer an eines der Kräutershampoos erinnert, die Oma benutzt hatte. Nun aber hatte ich das Gefühl, mich durch Schwefeldämpfe zu bewegen, ja, an manchen Stellen trieb der Gestank nach faulen Eiern mir fast die Tränen in die Augen.
Mama und Papa hatten recht – hier stimmte etwas nicht. Das war nicht der Goblin Forest, wie ich ihn kennengelernt hatte, und nun fürchtete ich auch, dass es wahr war, was sie vermuteten. Kiwis gab es hier keine mehr. Wäre ich ein Kiwi, hätte ich mich hier auch nicht wohlgefühlt. Aber wenn sie ausgestorben waren, was hatte sie vernichtet? Und gab es tatsächlich einen Zusammenhang mit den Delfinen und Walen, die dauernd an der Küste strandeten?
Noch immer hoffte ich, nach der nächsten Wegbiegung würde ich in meinen alten, geliebten Zauberwald eintauchen. Als die Farne wieder dichter und kraftvoller wuchsen und ich ein paar zarte Vogelstimmen hörte, ganz in der Ferne, wurde ich schneller und fand mich ein paar Schritte weiter mitten in einer undurchdringlichen Nebelbank wieder, ohne dass ich sie hatte kommen sehen.
»Wow, Wahnsinn«, flüsterte ich fasziniert, denn es war ganz so, wie man es immer sagte: Ich sah kaum die eigene Hand vor meinen Augen. Der gesamte Wald schien verschwunden zu sein. Nur noch an dem ständigen Klack-klack-klack der fallenden Wassertropfen konnte ich erkennen, dass sich Bäume um mich herum befanden.
Und jetzt? Stehen bleiben, wie Papa es verlangt hatte, und warten, bis der Nebel weitergewandert war und ich wieder mehr sehen konnte?
Nein, das war mir zu langweilig und nützte nichts, wenn der Nebel sich an dieser Stelle festsetzte. Umkehren wollte ich aber auch nicht. Links von mir sah es aus, als versuchte Licht, durch den Dunst zu dringen, er wirkte dort nicht ganz so dicht und grau. Also doch die Holzplanken für eine kurze Wegstrecke verlassen? Bis ich wieder etwas sehen konnte? Und mal ehrlich, hatte ich nur eine Sekunde ernsthaft daran gedacht, immer auf den Planken zu bleiben?
»Nein«, wisperte ich und machte einen großen Schritt zur Seite, nur um erneut zu erstarren, denn ich fühlte etwas, was ich in diesem Wald noch nie gefühlt hatte, ach, ich hatte es auch an anderen Orten noch nicht gefühlt: Angst. Innerhalb einer Sekunde hatte sie sich in meinem Bauch festgefressen und wanderte von dort in meine Arme und meine Beine bis hinunter zu meinen Füßen. Der linke sank bereits in den morastigen Untergrund ein.
Ja, ich hatte Angst. Das war neu. Erstaunt lauschte ich in den grauen Dunst hinein. Ich konnte mein eigenes Herz pochen hören. Es hatte bisher keine einzige Situation gegeben, in der ich in der Wildnis um mein Leben gefürchtet hatte. Doch genau so fühlte es sich an. Als ob ich sterben würde, wenn ich noch einen Schritt weiter machte.
Das konnte nicht sein. Dieser Wald war kein Sumpf. Ich hatte mich damals mit Papa oft abseits der festen Wege bewegt, sonst hätten wir die Kiwis niemals gefunden. Wir hatten auch nasse Füße bekommen, aber das war normal im Goblin Forest. Genau deshalb waren ja die Holzstege montiert worden. Aber weiter als bis zu den Knöcheln waren wir nie in den Boden eingesunken.
War ich vielleicht genau an der Stelle, an der ich damals … verschwunden war? Meine Eltern hatten das Camp Hals über Kopf abgebrochen, nachdem sie mich wiedergefunden hatten, und waren zurück nach Europa geflogen, um sich von ihrem Schrecken zu erholen. Ein halbes Jahr lang hatte Papa an einer Universität Vorträge gehalten und Mama nach neuen Projekten gesucht, bis beide einen Rappel bekommen hatten und wir in die mexikanische Dschungelwelt abgereist waren. Ich war seitdem nicht mehr in diesem Wald gewesen.
Erinnerte sich etwas in mir an meinen … Sturz? Angeblich war ich gefallen und hatte zwei Tage in einer Erdhöhle verbracht, bevor ich die Kraft gefunden hatte, herauszukrabbeln und zurück auf den Pfad zu gehen. Wo meine Eltern mich endlich gefunden hatten.
Bang schaute ich an mir herunter. Ich fühlte, dass mein linkes Bein schon bis zum Knöchel in kaltem Schlamm steckte, aber sehen konnte ich es nicht. Ab der Taille abwärts verschwand mein Körper im Dunst und dieser ungewohnte Anblick machte mich auf einmal so schwindelig, dass ich das Gleichgewicht verlor.
Mir blieb nichts anderes übrig, als auch meinen rechten Fuß von den Holzplanken zu lösen, um nicht in den Matsch zu fallen, und musste drei weitere Schritte vom Steg weg machen, um mich zu fangen. Doch der Nebel hier war nicht weniger dicht. Er hatte nur eine andere Farbe. Irgendwie gelblich … beinahe künstlich. Und er roch – süß? Nach Blüten? Jedenfalls stank er nicht nach faulen Eiern. Er sah giftig aus, doch meine Nase fand ihn so köstlich, dass ich weiter in diese gelbe Wolke hineinstapfte, und mit jedem Meter, den ich zurücklegte, wurde meine Angst kleiner, bis ich sie kaum mehr spürte.
Der gelbe Dunst fühlte sich vertraut an. Warm war er auch und verlockend … Schon streifte ich mir meine Jacke vom Körper und ließ sie achtlos fallen, um meine Arme durch seine glitzernden Schleier zu ziehen und an ihnen zu riechen, als unter mir der Boden bebte und ich erschrocken die Augen aufriss. Vor mir stand jemand. Ja, da war jemand gewesen, ich hatte es genau gesehen, für einen winzigen Moment nur, aber da war eine Gestalt gewesen, nicht viel größer als ich, und es hatte fast so gewirkt, als ließe sie den gelben Dunst entstehen. Er kam aus ihren Händen! Spielte mir da etwa jemand einen Streich?
»Hallo?«, rief ich in den Nebel hinein, doch er verschluckte meine Stimme sofort. »Hallo, wer ist denn da? Hey, zeig dich, das ist nicht witzig …«
Keine Reaktion. Stattdessen wurde der Geruch so süß und betörend, dass mir zum zweiten Mal schwindelig wurde. Gut, dann musste ich mich eben wieder bewegen, das hatte vorhin schließlich auch geholfen.
Mit ausgestreckten Armen zog ich meine Füße aus dem schmatzenden Schlamm und stapfte auf den Punkt zu, wo ich die Gestalt gesehen hatte. Weit konnte sie ja nicht gekommen sein. Da! Da war sie wieder, etwas weiter links, und wieder strömten goldgelbe Schlieren aus ihren Händen und aus ihren … ihren Füßen? Scheiße, was war das denn? Ein Junge, der Nebel aus seinen Händen und Füßen schickte und mich dabei ansah, als ob … als ob ich ein Ungeheuer wäre, dabei … dabei war ich doch diejenige, die …
Ich hörte mich aufschreien, als befände ich mich weit, weit weg – viel zu leise, gedämpft und zart, obwohl ich spüren konnte, wie meine Lungen sich dabei blähten, denn ich brüllte um mein Leben. Unter mir war kein Grund mehr. Der Boden brach ein, als hätte ich auf dünnem Geäst gestanden und würde Tonnen wiegen, und ich wurde im Fallen so schnell im Kreis gewirbelt, dass es in meinen Ohren zu rauschen begann. Sterne tanzten vor meinen Augen, und mein Magen schlug Purzelbäume.
Mein Hilfeschrei blieb oberhalb der Erde und verhallte so schnell, wie ich nach unten gezogen wurde. Niemand hörte ihn. Da war nur noch das ewige Klack-klack-klack der fallenden Wassertropfen. Wieder war es, als hätte der Erdboden mich verschluckt, und meine Eltern würden mich vergeblich suchen und ihren Albtraum ein zweites Mal durchleben müssen.
Stumm, ohne jeden Klang, wurde ich hinab in die Tiefe geschleudert, und noch bevor ich das Bewusstsein verlor, wusste ich: Es war echt gewesen.
Mein Verstand hatte sich nichts ausgemalt, meine Erinnerungen waren keine kindlichen Fantasiebilder gewesen, die mich hatten schützen sollen, während ich mich fern meiner Eltern in dieser magischen, unbegreiflichen Welt bewegt hatte.
Ich hatte das alles wahrhaftig erlebt.
Und nun kehrte ich zurück.
Schlammschlacht
Nein. Nein, das war nicht die Welt, in der ich als Kind zwei lichterfüllte Tage verbracht hatte. Der Sturz hatte sich ganz ähnlich angefühlt wie damals, und zum ersten Mal hatte ich mich bewusst daran erinnern können. Ich war nach einem Fehltritt abseits des Hauptpfads gestürzt, Kilometer abwärts, und dabei in schwindelerregender Geschwindigkeit um mich selbst gewirbelt worden.
Doch ich war in einem Paradies gelandet, nicht in einem Dreckloch. Dieser Schmodder, in dem ich nun keuchend darum kämpfte, Luft zu bekommen und mich irgendwo festhalten zu können, war jedoch ein einziges widerliches, stinkendes Dreckloch.
Vor allem aber hatte in der Paradieswelt niemand versucht, mich umzubringen. Was jetzt zweifellos geschah – und mein Möchtegernmörder war kein anderer als der seltsame Nebelheini von eben.
»Hör endlich auf mit dem Mist!«, brüllte ich ihn Schlamm spuckend an, als er zum dritten Mal meine Hände von den feuchten Holzplanken über mir schob, sobald ich sie umklammert hatte. Er musste mich dafür nur sanft mit seinen nackten Zehen anstupsen, und sofort verließ mich meine Kraft. Ein ganz mieser Zauber war das – oder ich durch meinen Sturz so schwach, dass er mich zerdrücken konnte wie eine lebensmüde Fliege, wenn er wollte.
Strampelnd hielt ich mich oberhalb der braunen, modrigen Brühe, in der ich gelandet war, und holte erneut tief Luft, um meine Arme aus dem Schlick zu ziehen und nach den Planken zu greifen. Denn wenn ich mich nicht bald auf den Steg wuchtete, würde ich von diesem Sumpf verschlungen werden, und zwar bei lebendigem Leibe.
Dieses Mal hatte ich mit den Füßen des Jungen ge- rechnet, der stumm über mir stand und nur darauf wartete, dass ich mich zu retten versuchte, und war schneller als er. Ich packte seinen linken Knöchel, um mich daran hochzuziehen und ihm gleichzeitig einen kräftigen Biss zu verpassen, doch meine Zähne schlugen ins Leere und erwischten dabei nur ein Stück meiner Zunge. Es tat so weh, dass ich wütend aufquietschte.
»Hilf mir, verdammt! Ich ertrinke sonst, siehst du das nicht …«, brachte ich noch mühsam hervor, ehe meine Hände wieder abrutschten und ich in diesem fiesen Moder, der mich umgab, nach unten sank.
Ich war eine echt gute Schwimmerin, doch hier nützte mir das überhaupt nichts. Es war, als ob jede Bewegung, die ich machte, mich verspottete, sie zog nur Energie aus mir, ohne dass ich mir mit meinen Schwimmstößen helfen konnte. Trotzdem ruderte ich wie ein Hündchen mit Armen und Beinen, in der Hoffnung, ich könnte mich dadurch mit dem Kopf über Wasser halten. Dabei streckte ich immer wieder einen meiner Füße nach unten und versuchte, etwas Festes zu finden, an dem ich mich abstoßen konnte. Vergeblich. Unter mir befand sich das pure schwarze Nichts.
Okay, dann war es das wohl, dachte ich und presste panisch meine Lippen zusammen, um ja nichts von dieser ekligen Matschbrühe zu schlucken, was jedoch bald passieren würde, wenn mich nicht irgendetwas oder irgendwer rettete. Dieses Mal ging ich nicht nur im Goblin Forest verloren, ich starb auch darin. Vermutlich unauffindbar, denn der Sumpf fraß mich auf, als wäre er ein gieriges Monster, dessen Lieblingsspeise aus rothaarigen Mädchen bestand. Und endlich hatte er wieder eines gefunden. Er schmatzte sogar dabei, ich hörte es, während ich weiter nach unten gesogen wurde, und das machte mich so zornig, dass ich mich ein letztes Mal aufbäumte und wie ein Delfin durch den Morast pflügte. Im gleichen Moment griff etwas – oder jemand? – nach meinen Haaren, zerrte mich unsanft aus dem Schlick und wuchtete mich hinauf auf die feuchten Holzplanken.
Sieh einer an, dachte ich grimmig, als ich zwei nackte Füße vor mir erkannte. Der Nebelheini hatte also doch einen Rest Anstand im Leib, auch wenn er mir bei seinem halbherzigen Rettungsversuch wehgetan hatte. Hustend und würgend hieb ich meine Faust gegen seine Wade, was sich anfühlte, als hätte ich einen Wackelpudding geschlagen, und strich mir mit triefenden Händen die verschlammten Haare aus dem Gesicht, um ihn ansehen zu können.
Sofort wurde mir derart kalt, dass ich zu schlottern begann. Sein Blick … und diese Augen! Sie leuchteten so hell, dass ich mich geblendet fühlte und versucht war, wieder wegzuschauen, doch das allein war es nicht, was mich frösteln ließ. Es war der Ausdruck in ihnen, verächtlich, voller Abscheu und Hass und … Angst?
Reglos stand der Junge neben mir auf dem Steg und schaute auf mich herunter, als wäre ich die Ausgeburt der Hölle und müsste sofort wieder hinab in den Moder gestoßen werden. Erst als meine Stirn unangenehm zu prickeln begann, begriff ich, weshalb er nicht aufhörte, mich anzustarren.
»Jetzt glotz nicht so blöd, das ist ein Feuermal. Hab ich seit meiner Geburt. Das hat nichts zu bedeuten, ist nur eine Anomalie«, leierte ich genervt herunter, was ich in den vergangenen Jahren unzähligen neuen Mitschülern hatte erklären müssen. »Ich bin weder eine Hexe noch dämonisch, da spielen nur ein paar Pigmente verrückt … Sag mal, verstehst du mich eigentlich? Hallo?«
Noch immer klebte sein Blick an meiner Stirn, und seine Augen begannen dabei so intensiv zu leuchten, dass ich meine Wimpern senken musste, weil ich das Gefühl hatte, jeden Moment blind zu werden, wenn ich länger hineinsah.
Doch schon in der nächsten Sekunde streiften meine Blicke sie wieder. Ich konnte nicht anders. Blaugrün waren sie, wie ein Bergsee von oben, nur gleißender und glitzernder.
»Bist auch nicht gerade ein Hingucker, wenn ich ehrlich bin«, setzte ich hinterher, weil er immer noch schwieg.
Ach, ich war nicht ehrlich, ich log wie gedruckt. Dieser Typ hatte zwar versucht, mich zu killen, aber er war der Hingucker schlechthin mit seinen Bergsee-Augen, seiner klaren bräunlichen Haut und den halblangen dunklen Haaren, die durch ein dunkelgrünes Band aus der Stirn gehalten wurden. Man musste ihn anschauen, denn alles an ihm schien zu strahlen, von innen heraus, und auch das erinnerte mich … an damals? Aber warum standen wir dann auf einem feuchten Steg mitten in einem Sumpf? Den Sturz mochte ich mir ja eingebildet haben, und ich war vielleicht auch kurz ohnmächtig gewesen. Außerdem war ich beinahe gestorben, da durfte man ein bisschen durcheinander sein, fand ich. Trotzdem passte hier nichts zusammen. Diese Landschaft kannte ich nicht. Weder aus der Realität noch aus den Erinnerungen von damals. Die ja angeblich alle Einbildung gewesen waren.
Tja, das hier war leider echt. Ich war klatschnass und voller Schlamm, meine Zunge blutete, und meine Hände waren übersät von beißenden Schürfwunden – und allmählich verlor ich die Geduld. Hübsch war mein Mörder/Retter ja, aber ätzend schweigsam.
»Wo sind wir?«, fragte ich ihn betont langsam auf Englisch und übersetzte meine Frage anschließend in sämtliche anderen Sprachen, die ich gelernt hatte.
Keine Regung in seinem Gesicht zeigte, ob er mich verstand oder auch nur hören konnte, und statt zu antworten, hob er nur seine feingliedrigen, aber kräftigen Hände und ließ erneut gelb glitzernden (und äußerst wohlriechenden) Nebel aus ihnen strömen, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Und mich selbst auch nicht.
»Okay, besten Dank, das ist also alles, was du draufhast. Blödmann. Mist, das kann doch nicht sein …«, stöhnte ich und verbarg mein Gesicht in meinen schlammverkrusteten Händen.
Ich hatte schon vieles erlebt. Manches davon war wirklich wunderlich gewesen. Wie der Schamane in Mexiko, den wir nicht fotografieren durften, weil er glaubte, dann auf der Stelle zu sterben, und der den ganzen lieben langen Tag zwischen zwei Pyramiden saß, ununterbrochen rauchte und mit den Geistern sprach (was er sehr ausführlich getan hatte). Auch die Nordlichter hatten auf mich oft wie Zauberei gewirkt, und auf Island nicht an Elfen zu glauben, war kaum möglich.
Aber dieser Typ ließ goldgelben Glitzerrauch aus seinen Fingern strömen und hatte Augen, die aussahen, als würden sie von innen heraus angestrahlt werden. Sie fingen das Licht nicht ein, sondern sendeten es aus. Was schlichtweg nicht sein konnte, denn in jedem Schädel war es dunkel. Wenn ich Mathe lernen musste, herrschte in meinem eigenen sogar finsterste Nacht, ohne jede Aussicht auf Sonnenschein. Das mit dem Nebel konnte ja noch ein blöder Trick sein, aber seine Augen … Ja, seine Augen erinnerten mich vage an damals, auch wenn dieser Sumpf der Welt von damals nicht im Geringsten glich.
Nun tat ich doch das, was Papa mir aufgetragen hatte, falls der Nebel zu dicht wurde, auch wenn er garantiert nicht von dieser Sorte Nebel ausgegangen war. Ich kauerte mich zitternd auf den Steg und wartete, bis der gelbe Dunst sich so weit gelichtet hatte, dass ich wieder etwas sehen konnte. Währenddessen hoffte ich inständig, dass ich danach den Wald erblicken und meinen vertrauten Pfad erkennen würde (und der Nebelheini ein für alle Mal verschwunden war). Denn mein Handy war nicht mehr in meiner Hosentasche, wahrscheinlich war es im Schlamm verloren vergangen. Ich war ganz auf mich selbst angewiesen.
Doch nichts davon traf ein. Die Gestalt des Jungen konnte ich zwar nur noch aus weiter Ferne ausmachen. Er bewegte sich eilig von mir weg, und ich hatte dabei nach wie vor das Gefühl, dass er mich abgrundtief hasste, denn er blickte immer wieder drohend über seine Schulter zurück, wobei seine Gletscheraugen gleißende Blitze in meine Richtung schickten und mir im Kopf wehtaten.
Doch der Wald tauchte nicht wieder auf. Rechts und links des langen Holzsteges blubberte der Sumpf schmatzend und gurgelnd vor sich hin. Ab und zu zerplatzten auf seiner Oberfläche tellergroße Blasen und verströmten dabei einen schimmeligen Gestank.
Obwohl ich bibberte, legte ich mich rücklings auf die Holzplanken und schaute nach oben. Kein Himmel zu erkennen, alles verlor sich in diffusen Dunstwolken. Ich konnte nicht einmal sagen, welche Tageszeit wir hatten. Es herrschte weder Helligkeit noch Dunkelheit, sondern eine Dämmerung, die ich nicht zuordnen konnte und sich kein bisschen veränderte. Beinahe vermisste ich den gelben Nebel, der wenigstens nett ausgesehen und angenehm gerochen hatte.
Nun war alles grau und öde. Keine Farben mehr. Und wie im Wald vorhin fehlten die Stimmen der Vögel. Ob in dem Schmodder unter mir Tiere lebten, wollte ich gar nicht erst überprüfen. Ich war froh, ihm entkommen zu sein, auch wenn ich immer noch keine Ahnung hatte, wo ich mich befand. Außer dem schmalen Steg, der in eine riesige anthrazitfarbene Nebelbank führte – gerade hatte sie den Jungen verschluckt, als wäre er nie da gewesen –, gab es hier nichts. Keine Bäume, an denen ich hochklettern und mir einen Überblick verschaffen konnte, keine Wege, keine Schilder, kein fester Grund. Etwas Trostloseres als diesen Sumpf hatte ich nie gesehen, und nun, da ich den Jungen nicht mehr erkennen konnte, bekam ich es wieder mit der Angst zu tun. Ich war außer Atem und erschöpft von meinem Kampf gegen das Ertrinken, zu gerne hätte ich mich ein wenig ausgeruht. Doch ich musste ihm folgen, und zwar sofort. Er wollte mich nicht bei sich haben, so viel hatte ich verstanden, aber vielleicht konnte ich mich unbemerkt an seine Fersen heften und den Weg zurück auf die beschilderten Pfade finden. Noch immer klammerte ich mich an die Idee, mich lediglich verirrt zu haben, dass der Wald sich in den vergangenen Jahren tatsächlich so stark verändert hatte, dass ich ihn nicht mehr wiedererkannte. Mama hatte mich davor gewarnt. Außerdem befand ich mich auf einem hölzernen Steg, und im Nationalpark am Fuße des Mount Taranaki wimmelte es von Stegen.
Mühsam rappelte ich mich auf, wrang mir die letzte Nässe aus den Haaren und meinem Shirt und befreite notdürftig meine nackten Unterschenkel und Unterarme von der Schlammkruste, die sie inzwischen bedeckte. Es beruhigte mich, dass ich meine Kette mit dem kleinen Feuerstein noch trug, die Papa mir geschenkt hatte. Mein Handy und meinen Rucksack hatte ich im Sumpf allerdings auf Nimmerwiedersehen verloren, und damit auch meinen Proviant, und meine Kehle brannte bereits vor Durst. Auch meine Schuhe hatte der Schlamm mir von den Füßen gezogen. Aber irgendwohin würde dieser Steg führen, und ich hatte schon ganze Tageswanderungen hinter mich gebracht, ohne viel zu essen und zu trinken. Ich würde das schaffen und nach Hause finden.
Doch als ich nach wenigen Schritten in die nächste dichte Nebelbank eintauchte, fühlte ich mich wie der letzte Mensch auf der Welt.
Einsam, verloren, vergessen.
Auf Nimmerwiedersehen
»Okay, ich gebe es zu, Papa, du hattest doch recht«, wisperte ich und erschauerte am ganzen Körper, weil meine Stimme sich viel zu dünn und kraftlos anhörte. Ja, wäre ich doch nur auf dem Pfad geblieben! Dann wäre ich jetzt längst zurück im Camp bei meinen Eltern, und wir würden uns irgendeine fade Konservensuppe aufwärmen und beim Essen erzählen, was wir den Tag über erlebt hatten. Doch nun bekam ich Angst, ihnen nie wieder von meinen Abenteuern berichten zu können.
Denn dieses hier nahm gar keine gute Wendung. Außerdem war es öde und langweilig geworden, aber das hätte ich liebend gerne in Kauf genommen, wenn ich nur wieder hätte zurückkehren können. Obwohl der Steg nur wenige Biegungen nahm und die meiste Zeit stur geradeaus führte, hatte sich die Landschaft kein bisschen verändert.
Ich lief von einer Nebelschwade in die nächste, umgeben von blubbernden grauen Sümpfen. Alles sah gleich aus, und auch die Dämmerung veränderte sich nicht. Das diffuse schwache Licht um mich herum wurde weder heller, noch schwand es, dabei hätte ich schwören können, schon mindestens vier Stunden unterwegs zu sein.
Überprüfen konnte ich es nicht, denn mein Handy war mir ja verloren gegangen. Ich war auf mein Bauchgefühl angewiesen, und das wurde immer schlechter, je hungriger ich wurde. Doch am schlimmsten plagte mich der Durst. Meine Zunge fühlte sich an, als wäre sie auf die doppelte Größe angeschwollen, und ständig klebten meine Lippen aneinander fest. Auch meine Nase war wie verstopft.
Wieso war ich an keinem einzigen Schild vorbeigekommen? Der Egmont National Park war bekannt für seine gute Beschilderung, das hatte Mama Papa gestern noch gesagt, als sie darüber diskutiert hatten, ob man mich allein losziehen lassen könne. Wahrscheinlich bereuten sie es ebenso bitter wie ich.
Obwohl ich wusste, dass es zwecklos sein würde, formte ich meine Hände zu einem Trichter und rief laut: »Mama, Papa, hört ihr mich? Ich bin hier, in den Sümpfen! Mama! Papa! Hallo! Ich bin es, Maja!«
Nicht einmal ein Echo schallte zurück und erst recht keine Antwort. Wenn wenigstens ein Vogel gerufen hätte oder davongeflattert wäre! Aber Tiere gab es in diesem Sumpf nicht. Ich war vollkommen allein, und bald würde ich keine Kraft mehr haben weiterzulaufen. Meine Beine zitterten vor Erschöpfung, und jeder Schritt tat mir im ganzen Körper weh. Ich musste Wasser finden, dringend, sonst würde ich im Lauf der nächsten Stunden elend verdursten.
Weil mir so schwindelig wurde, dass ich nicht mehr stehen konnte, ließ ich mich im Schneidersitz auf dem feuchten Holzsteg nieder und stützte meinen Kopf in die Hände, um zu neuer Energie zu kommen. Dieser Steg musste zu einem Ziel führen, sonst war er sinnlos. Er war meine einzige Rettung, und ich durfte jetzt nicht die Hoffnung verlieren, nur weil ich erschöpft und durstig war. Irgendwann hörte jeder Sumpf auf und ging in eine andere Landschaft über, so wie jede Wüste endete und jedes Meer an eine Küste brandete. Einen Moment lang musste ich an meinen Lieblingstraum denken, in dem ich plötzlich eine verwunschene, tropisch wirkende Lagune entdeckte, mitten in einem Wald, und es kaum erwarten konnte, dem glasklaren Wasser entgegenzulaufen und in ihm zu baden. Auch hier konnte die Landschaft sich verändern, heller und freundlicher werden – doch dazu musste ich weiterlaufen.
»Los, weiter, Maja«, sprach ich mir Mut zu, richtete mich stöhnend auf und stemmte mich auf meine Beine. Noch immer fühlten sie sich weich und matschig an, doch der Schwindel im Kopf war verflogen.
Mit gleichmäßigen kleinen Schritten setzte ich meinen Weg fort, ohne jedoch nach rechts und links zu schauen. Meine Augen hafteten an meinen nackten, verschlammten Füßen, deren Sohlen bereits wund und von Blasen übersät waren, aber es beruhigte mich, dabei zuzusehen, wie sie sich über die Holzbohlen bewegten.
»Maja ist zäh«, hatte Mama immer wieder gesagt, wenn Papa sich um mich sorgte, und sie hatte recht: Ich war zäh. Wenn es sein musste, würde ich noch weitere vier Stunden über diesen Steg laufen und …
Moment.
Aufmerksam hob ich meinen Kopf. Da war ein anderes Geräusch zwischen dem andauernden Blubbern und Glucksen des Sumpfes. Heller und klarer und … flüsternd? Flüsterte da etwas oder jemand?
»Hallo?«, rief ich fragend in den Dunst hinein und spitzte die Ohren. Wieder wehte das Geräusch zu mir herüber, als würde es antworten, doch es konnte nicht von einem Mensch stammen, es hörte sich eher an wie … wie Wasser? Oder war ich bereits so ausgehungert, dass ich Halluzinationen bekam?
Zögerlich machte ich ein paar Schritte nach vorne, blieb wieder stehen und hielt sogar die Luft an, um besser lauschen zu können. Nun hörte ich es erneut, näher und deutlicher als eben noch. Ich irrte mich nicht. Es musste Wasser sein, das plätscherte und dabei klang wie ein leises, zufriedenes Summen. Das war merkwürdig, doch ich war zu durstig, um mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Dort vorne, wo das Wasser sang, musste der Sumpf zu Ende sein, und wenn es aus einem Felsen kam, konnte ich es wahrscheinlich sogar gefahrlos trinken. Quellwasser war fast immer genießbar.
Jetzt konnte ich nicht mehr langsam gehen. Erst begann ich zu marschieren, dann zu laufen, dann zu rennen, bis meine Beine wieder zu zittern anfingen und ich mein Tempo drosseln musste, um nicht hinzufallen. Doch als ich mich umsah, jauchzte ich vor Freude und Erleichterung laut auf.
Endlich, dachte ich überglücklich, endlich! Endlich begann der graue Nebel sich zu lichten, und aus dem Sumpf erhoben sich erste grüne Stellen, bewachsen mit Farnen und zarten, kurzen Blumen, deren Blütenblätter rosa und tiefblau aus dem düsteren Einerlei des Morastes herausleuchteten. Am liebsten wäre ich auf eine dieser kleinen Inseln gesprungen und hätte mir die Blumen aus der Nähe angesehen, doch dieses Mal blieb ich vernünftig. Ich konnte mir jetzt keine Experimente mehr leisten. Deshalb winkte ich ihnen nur fröhlich zu, als könnten sie mich sehen, und blieb stocksteif stehen, weil sie ihre Blütenköpfe zu mir drehten und ganz leicht nickten – fast wie eine freundliche Begrüßung.
»Okay, ich hab Halluzinationen«, stellte ich halblaut fest und legte meine Hand auf mein wild jagendes Herz. War denn alles, was ich sah und hörte, nur Einbildung? Auch das Wasser? Gab es etwa in Wirklichkeit gar keine Quelle, aus der ich trinken konnte?
Im Schleichgang setzte ich mich wieder in Bewegung, bis ich die nächste grüne Insel aus dem Sumpf ragen sah, und ich kam mir reichlich blöde vor, als ich erneut meine Hand hob und den Blumen zuwinkte. Aber es geschah das Gleiche wie eben: Sie drehten ihre hübschen Köpfe zu mir und nickten mir zu.
»Das gibt es nicht. Sorry, aber das …« Es konnte nicht wahr sein. Und doch kam es mir vertraut vor. Plötzlich war mir, als hörte ich mich selbst lachen, aber nicht als dreizehnjährige Maja, sondern als kleines Kind. Hell, perlend und so vergnügt, dass ich automatisch lächeln musste. Hatte ich Mama und Papa und dem Psychologen nicht lang und breit davon erzählt? Dass es in diesem Land unter der Erde Blumen gegeben hatte, die meine Freunde gewesen waren und mich angeschaut hatten?
Was bedeutete das jetzt? Dass ich verrückt wurde und der erste Schub sich schon gezeigt hatte, als ich vier Jahre alt gewesen war, oder … oder dass es die nickenden Blumen wirklich gab? Argwöhnisch starrte ich sie an, doch nach einigen Sekunden drehten sie sich mit eingeklappten Blütenblättern von mir weg, als würden ihnen meine forschenden Blicke nicht gefallen.
»Sorry«, flüsterte ich und kniff meine Augen fest zusammen, um wieder zur Vernunft zu kommen.
Okay, gut, ich sah Blumen, die mir zunickten und auf mein Winken reagierten. Das konnte am Durst und Hunger liegen. Aber das rauschende Wasser musste echt sein. Deshalb schaute ich jetzt am besten wieder stur auf meine Füße, bis es direkt vor mir war und ich davon trinken konnte.
Wenn nicht, war ich sowieso bald tot, und dann war es herzlich egal, ob ich verrückt wurde oder nicht. Und ich hatte vor meinem Dahinsiechen immerhin mit Blumen gesprochen. Das konnte nicht jeder Mensch von sich behaupten.
Doch schon nach wenigen Schritten, die sich unwirklich und wackelig anfühlten, als würden die Holzplanken unter mir beginnen, sich aufzulösen, musste ich meinen Blick von meinen Füßen losreißen.
Direkt vor mir saß etwas auf dem Steg, was ich nie zuvor gesehen hatte, nicht einmal im mexikanischen Dschungel. Es wirkte wie eine Mischung aus einer langbeinigen Spinne und einem Schmetterling. Schmetterling deshalb, weil es transparente, geschwungene Flügel auf dem Rücken trug, die sich in Zeitlupentempo geschmeidig auf und ab bewegten.
»Ich weiß nicht, ob du eklig oder hübsch bist«, murmelte ich rätselnd und kniete mich nieder, um das Insekt genauer zu betrachten. »Ich hoffe nur, dass du nicht giftig bist.«
Denn es war knallbunt, und die meisten kleinen, knallbunten Tiere waren giftig. Am Amazonas hatte es Frösche gegeben, deren Haut von Giftdrüsen nur so übersät gewesen war und die ich auf keinen Fall hätte anfassen dürfen. Aber sie hatten nicht minder geleuchtet als dieses Exemplar.
Kritisch betrachtete ich seine acht Spinnenbeine, die von hellgrünen Härchen bedeckt waren, unter denen die Chitinhaut dunkelblau schimmerte. Sein wulstiger Panzer hingegen glitzerte schwarz-grün, während die Flügel ebenfalls blau waren, bedeckt von hellroten Tupfen und Minispiralen. Am Kopf saßen zwei lange gelbe Fühler, die sich suchend nach mir ausstreckten, als würde das Tier in Kontakt mit mir treten wollen. Dabei blickten seine vier Augen mich ruhig, wachsam und verwirrend intelligent an.
»Du beißt mich, wenn ich dich anfasse, oder? Okay, ich fasse dich nicht an, kein Thema«, versicherte ich eilig, als es seine langen Beine gleichmäßig in Bewegung setzte und näher kam, dann aber wieder stoppte. Zwischen meinen Zehen und seinen Fühlern befanden sich nur wenige Millimeter.
Noch immer sah es mich direkt an. Spinnen waren nahezu blind, trotz ihrer acht Augen. Doch dieses Wesen musste mich sehen können. Anders konnte ich mir seinen direkten, klugen Blick nicht erklären.
»Ich freu mich auch, dich zu treffen«, sprach ich leise weiter, als könnte es mich verstehen. Es tat gut, mit jemandem zu reden nach meinen aufreibenden, trostlosen Wanderstunden, auch wenn dieser Jemand eine Schmetterspinne war. »Wusstest du nicht genau, was du mal werden solltest? Ach, wenn Papa dich nur sehen könnte …«
Dann wärst du längst in einen Plastikbehälter gesetzt worden, um im Labor untersucht zu werden, dachte ich. Ja, Papa hätte seine Freude an diesem Tierchen gehabt, aber es war zu schade für ein Terrarium.
»Wo bin ich hier gelandet? Kannst du mir das verraten?«
Die Schmetterspinne kam noch ein Stückchen näher, streckte elegant ihren linken Fühler aus und berührte mich damit an meinem rechten großen Zeh. Kichernd zuckte ich zurück. Das kitzelte.
»Ich kann deine Sprache nicht übersetzen. Und ich habe Durst. Ich brauche Wasser, dringend. Deshalb muss ich jetzt weitergehen, aber es war schön, dich … Huch!«, machte ich überrascht, denn die Schmetterspinne hatte sich mit einem tänzerischen Satz umgedreht und bewegte sich halb krabbelnd, halb flatternd von mir weg, ganz so, als wollte sie mir etwas zeigen. Weil ich sowieso hatte weiterlaufen wollen, zuckte ich nur ergeben mit den Schultern und folgte ihr.
Dafür, dass sie nicht größer war als mein Handteller, war sie ziemlich flink auf ihren acht Beinchen, viel flinker als ich, doch sobald ich zu weit zurückfiel, blieb sie ruhig sitzen und wartete, bis ich zu ihr aufgeschlossen hatte. Ich war so beschäftigt damit, sie im Blick zu behalten, dass ich erst an dem weichen, ungewohnten Gefühl unter meinen nackten Sohlen merkte, dass ich den Steg verlassen und festen Grund erreicht hatte. Ja, ich hatte den Sumpf endgültig hinter mir gelassen, und das Rauschen des Wassers dröhnte in meinen Ohren. Weit konnte es nicht mehr sein, und hätte mir nicht wieder eine Nebelschwade die Sicht versperrt, hätte ich es wahrscheinlich schon gesehen.
»Warte einen Moment«, bat ich die Schmetterspinne, kniete mich nieder und drückte meine Hände in das fluffige, dichte Grün, das den elastischen Boden jenseits des Sumpfes bedeckte. Es sah aus wie Moos, aber die glitzernden Tropfen, von denen es bedeckt war, bewegten sich zitternd hin und her. Als ich sie vorsichtig mit den Fingerspitzen berührte, zerplatzten sie nicht, sondern rollten mit einem melodischen Sirren zur Seite und suchten sich einen neuen Platz. Ich musste dreimal hinsehen, bis ich erkannte, dass es gar keine Wassertropfen waren, sondern winzige Käfer, deren durchsichtige Flügel um ihren gesamten kugelrunden Körper verliefen. Jedes Käferchen besaß mindestens acht dieser Flügel, manche auch zwölf. Während ich ihr Treiben beobachtete, blieb die Schmetterspinne geduldig neben meinen Knien sitzen und schlug nur ein paarmal mit ihren bunten Flügeln. Doch wie vorhin ließ sie mich nicht aus ihren Augen.
»Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin, aber ich muss endlich etwas trinken.« Seufzend stand ich auf und suchte nach einem Weg zwischen den Mooskäferchen hindurch, aber zu meiner Verwunderung wichen sie meinen Schritten von ganz allein aus. Nicht einer von ihnen geriet in Gefahr, von mir zertreten zu werden, obwohl sie nicht größer als der Kopf einer Stecknadel waren.
Jetzt krabbelte und flatterte die Spinne mir wieder voraus, bis ich sie in der Nebelschwade kaum mehr erkennen konnte. Eifrig folgte ich ihr und stand plötzlich in gleißender Helligkeit, als hätte es all die dunkelgrauen Nebel und Sümpfe niemals gegeben. Blinzelnd versuchte ich, meine Augen vor dem grellen Licht zu schützen, und als ich dabei nach unten schaute, sah ich zum ersten Mal seit Stunden wieder meinen Schatten. Doch er war nicht schwarz, wie ich es von ihm kannte, sondern schimmerte azurblau.
Erst nach Sekunden gelang es mir, meinen Blick zu heben, und wurde dabei mit dem prachtvollsten Wasserfall belohnt, den ich jemals gesehen hatte. Ich vergaß sogar kurz meinen Durst, während ich suchend nach oben schaute, um herauszufinden, woher seine in sämtlichen Regenbogenfarben leuchtenden Fluten kamen. Doch er schien endlos zu sein und sich direkt aus dem wolkenverhangenen Himmel herabzustürzen. Ihn umgaben Felsen, dicht bewachsen von Farnen, lianenartigen Pflanzen und Tausenden von leuchtenden Blumen in allen Farben, aber den Anfang und das Ende dieser Felsen konnte ich nicht sehen. Es war, als würden sie frei in der Luft schweben, genauso wie der Wasserfall, denn er mündete nicht in einen Teich, sondern … Fasziniert beugte ich mich vor und rechnete fest damit, dass sich wenige Schritte vor mir ein Abgrund auftat.
Doch den gab es nicht, zumindest konnte ich ihn nicht sehen. Unterhalb der Felskante bildete das Wasser einen See über dem Nichts und floss seitlich weiter, um von dort aus nach oben aufzusteigen. Das war nicht möglich. Wasser folgte der Schwerkraft, es sei denn, es kam aus einem Geysir. Aber das hier war Wasserfallwasser, rein, klar und ohne stinkende Dämpfe. Trotzdem hatte es einen Klang, der vollkommen neu für mich war. Ich kam mir vor, als stünde ich in einer Kirche aus Wasser, in der vier Orgeln gleichzeitig gespielt wurden. Dennoch war es mir nicht zu laut. Ich hätte sogar dabei einschlafen können.
»Das ist alles so krass«, sagte ich lautlos, ohne mich auch nur eine Sekunde fremd oder verloren zu fühlen. Mir war viel mehr, als würde ich endlich heimkommen, ins Reich meiner Kindheit, jene Erinnerungen, von denen alle geglaubt hatten, ich hätte sie mir nur eingebildet.