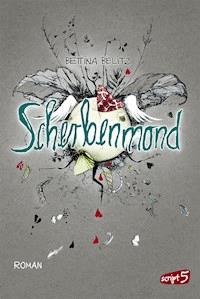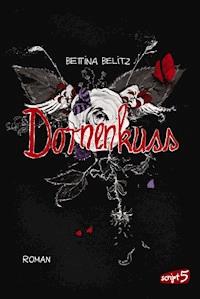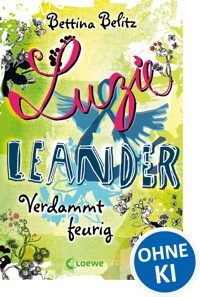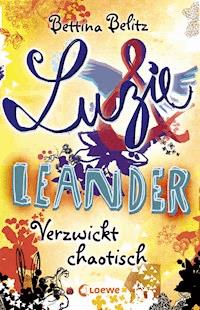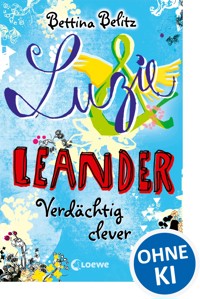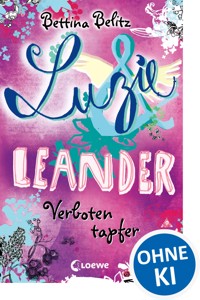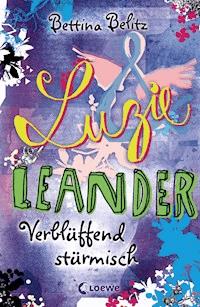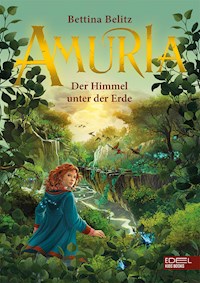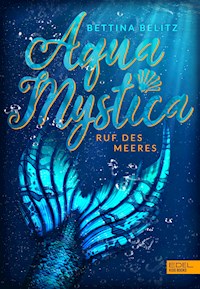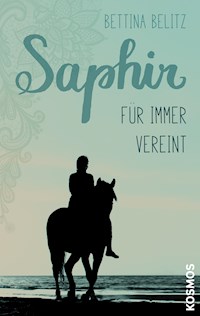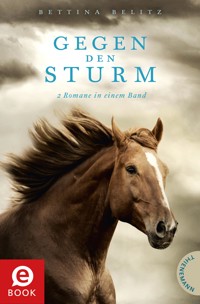Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Luzie & Leander
- Sprache: Deutsch
Die Heimlichtuerei muss ein Ende haben, findet Luzie. Leander soll endlich seinen Dreisprung vollenden, durch den er zum Menschen werden kann. Aber dafür muss Luzie erst einmal ordentliche Verhältnisse in ihrem eigenen chaotischen Leben schaffen. Da ist ihre bisherige Kopf-durch-die-Wand-Methode nicht unbedingt das geeignete Mittel. Auch Leander hat noch eine letzte Aufgabe zu erledigen. Er soll nämlich Luzies noch ungeborenes Geschwisterchen beschützen. Und – wie sollte es anders sein – Luzies Mama macht es ihm da leidlich schwer. Mit dem achten und letzten Band der Reihe führt Bestsellerautorin Bettina Belitz die charmante Liebesgeschichte von der halsbrecherischen Traceuse Luzie und ihrem (überforderten) Schutzengel Leander zu einem glücklichen Ende. Allerdings nicht ohne noch einmal haarscharf an allen Fettnäpfchen der Pubertät vorbeizuschrammen. Die himmlische Jugendbuch-Reihe von Bettina Belitz! Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen erzählt die Splitterherz-Autorin, wie sich Luzie und ihr Schutzengel Leander durch das Pubertätschaos kämpfen und die erste Liebe erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Tapferes Schneiderlein
Weisheit in Schwarz
Frauengespräche
Zwei auf einen Schlag
Im Totenreich
Der letzte Schrei
Fremde Freunde
Dolce vita
Samsara
Elefanten unter sich
Türkisch für Anfänger
Die Welt, so schön
Familienangelegenheiten
Die andere Seite
Schlechtes Timing
Adieu, mon amour
Sternenstaub
Alle Bände der Reihe »Luzie & Leander«
Über die Autorin
Weitere Infos
Impressum
Tapferes Schneiderlein
»Sag mal, hast du Pflaster auf deinen Brillengläsern? So wird das nichts, wie oft soll ich es dir noch zeigen?« Ohne jedes Feingefühl oder gar eine Entschuldigung zog ich der Kleinen den rosafarbenen Stofffetzen aus ihren Händen und schob sie vom Stuhl, wobei ich sofort spürte, wie angespannt sie war. Doch meine Geduld war erschöpft. Was sie da fabrizierte, würde nicht einmal für einen Lumpen-Puppenball taugen. »Erst exakt drunterlegen. Dann die Spule spannen. Dann anfangen … vorsichtig … eine Hand hier, die andere dort, langsam, mit Gefühl …«
Gleichmäßig ratterte die Nadel über das Stück Jeansstoff und zog eine exakte Naht. Versonnen verfolgten meine Augen ihre Spur. Ja, so sah es schön aus …
Doch bevor ich mich beruhigen konnte, riss mich ein ersticktes Geräusch dicht neben mir aus meiner Trance. Jetzt weinte sie auch noch. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Das hatten wir doch gestern erst gehabt. Und vergangene Woche. Und bereits in der allerersten Stunde.
»Vom Heulen wird es auch nicht besser«, fuhr ich sie an, bereute meinen groben Tonfall aber sofort und suchte in meiner Hose nach einem Taschentuch. Doch das, was ich fand, wollte ich selbst der Brillenschlange nicht anbieten. Also zog ich kurzerhand den Stoff aus der Maschine und reichte ihn ihr.
»Aber … aber das ist doch … das soll doch …«
»Luzie.« Herr Rübsam sprach lediglich meinen Namen aus, ruhig und ohne jede Härte, doch es genügte, dass ich in mich zusammensackte und mich schuldbewusst umdrehte. Er schaute mich an wie ein Hund, durch dessen Hüttendach es seit drei Tagen ununterbrochen regnete. Er war diese Geschichte hier leid, genauso wie ich. Doch keiner von uns durfte es leid sein.
»Liegt es im Bereich des Machbaren, dass wir eine einzige Workshopstunde hinter uns bringen, ohne dass du eines der Mädchen zum Weinen bringst?«
»Sie wollte ein Cape für ihre Barbiepuppe nähen. Alleine das bringt mich zum Weinen«, zischte ich gedämpft und rückte ein Stück zur Seite, damit Herr Rübsam Nadine ein Taschentuch geben konnte, das nur unwesentlich sauberer wirkte als meines. Ein paar Brötchen- und Tabakkrümel rieselten heraus, als sie sich mit abgewandtem Blick schnäuzte. Herr Rübsam ergriff mich sanft beim Ärmel, führte mich von den anderen weg zum Fenster und sah mir fest in die Augen. Ich gab mir alle Mühe, kühl durch ihn hindurchzublicken, spürte aber, wie mir das Blut warm ins Gesicht flutete und sich hinter dem rechten Ohr staute. Mit einer Bewegung meines Halses versuchte ich, gegen den Druck anzugehen, doch meine Gehörmuschel ließ nur ein leises Knacken ertönen.
»Luzie«, sagte Herr Rübsam noch einmal. »Es spielt keine Rolle, wer hier was nähen will. Du bringst es ihnen bei; ganz egal, was sie zum Üben kreieren möchten. Und weißt du auch noch, warum du hier bist?«
»Ja«, entgegnete ich störrisch und verschränkte die Arme. »Ich muss hier Buße tun.«
»Du musst keine Buße tun, sondern hast die Chance, trotz all der Geschehnisse in der Vergangenheit auf dieser Schule und in deiner Klasse zu bleiben, indem du nachmittags einen Näh-Workshop für die Orientierungsstufe leitest. Das ist keine Strafe, sondern eine Chance. Ich wiederhole es gerne ein drittes Mal: eine Chance. Also nutze sie. Fünftklässlerinnen zum Weinen zu bringen ist etwas anderes.«
»Sie kriegt es aber auch echt nicht auf die Reihe …«, verteidigte ich mich mit halber Kraft. Ich wusste selbst, dass ich eine Lehrerin zum Fürchten war – aber ich hatte erst während dieses verfluchten Workshops gemerkt, wie kompliziert Nähen eigentlich ist. Was man alles beachten muss und wie schnell eine solche Maschine außer Kontrolle geraten kann – was ständig passierte, wenn nicht ich sie bediente. Entweder verhedderte sich das Garn oder die Spule verhakte sich, Fäden rissen, Stoffstücke rutschten schief unter der Nadel hindurch – es war mir ein Rätsel, wieso mir das Nähen so schlafwandlerisch leicht fiel und die Brillenschlange jeden Tag Stoffstücke für die Abfalltonne produzierte.
»Sie fürchtet sich vor dir. Siehst du das nicht?«, murmelte Herr Rübsam und deutete unauffällig zu Nadines Tisch. Mit hängenden Schultern saß sie vor der Nähmaschine und schluchzte alle paar Sekunden traumatisiert auf, so als hätte ich sie geschlagen. Ein Bild des Jammers. Das sah ich auch, doch es half mir nicht, sie besser leiden zu können – im Gegenteil, ihre Unsicherheit und Angst machten mich nervös.
»Ich will wieder Parkour trainieren … mit meinen Jungs … oder wenigstens einen Parkour-Workshop leiten, warum geht das denn nicht?«
»Weil das Krankenhaus nicht so viele Betten freihat und weil es eine Belohnung wäre, keine Chance.«
Einen Moment lang überlegte ich, ob es sich auszahlen würde, mit Herrn Rübsam darüber zu diskutieren, ob eine Belohnung nicht ebenfalls eine sehr wichtige Chance sein könnte, mich zu beweisen, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Ich war nicht in Form, schon den ganzen Tag nicht. Meine Knochen fühlten sich schwer an, meine Muskeln waren müde, und ich hatte noch kein einziges Mal richtig gelacht. Mit wem auch? Sofie war mir immer noch böse, die Jungs behandelten mich, als hätte ich die Pest, und Leander tauchte seit Wochen nur noch nachts auf, um mit wichtiger Miene an die Decke zu starren und ab und zu grüblerisch »Hmmm …« oder »Aaaah, ich verstehe jetzt …« oder aber »Genau, so muss es sein« zu raunen. Da keine neuen Pflegeprodukte im Bad standen, keine unbekannten CDs in meinem Regal landeten und er keine neuen Klamotten trug, konnte ich davon ausgehen, dass er sich seine Zeit nicht mit »Leihen« vertrieb. Als Leihen bezeichnete Leander schlichtes Klauen. Das hatte er offenbar aufgegeben. Er ging ohne etwas in der Hand morgens weg und kam abends ohne etwas wieder – und doch war er unentwegt in Gedanken versunken, ohne sie jemals mit mir zu teilen. Wann immer ich ihn danach fragte, erntete ich nur eine zackig erhobene Hand und ein wichtigtuerisches Pscht!. Auch das reizte mich. Kein Wunder, dass ich Fünftklässlerinnen zum Weinen brachte. Irgendwo musste ich meinen Frust schließlich abreagieren.
»Für heute kannst du gehen, es ist ja fast vier Uhr«, drang Herrn Rübsams belegte Raucherstimme durch meine unliebsamen Leander- und Brillenschlangengedanken. »Bitte gib dir etwas mehr Mühe, und sei ein bisschen freundlicher. Nur ein bisschen. Diese Mädchen haben dich mal bewundert und jetzt …« Zweifelnd blickte Herr Rübsam über die Bankreihen. Ja, ich sah es selbst. Meine Schülerinnen wirkten allesamt eingeschüchtert, und ich hatte das unangenehme Gefühl, dass sich in ihren Respekt mir gegenüber von Tag zu Tag mehr Ablehnung mischte. Nach unserem Parkour-Event an Weihnachten war ich an der Schule so etwas wie eine Heldin gewesen. Fremde Schüler sprachen mich an und wollten von mir wissen, wie man Parkour lernt und was ich schon alles gemacht habe. Aber mit meiner vermeintlichen Klauerei (Leander) und den noch vermeintlicheren Zigaretten (wieder Leander) und meinem abgebrochenen Erziehungslager in den USA (Leander hoch fünf) hatte ich mir meine Sympathien größtenteils verspielt. Es wurde viel getuschelt und gelästert, doch in meine Augen blickte fast niemand mehr. Noch ein paar weitere Workshopstunden dieser Art, und die Mädchen würden eine Petition einreichen, eine andere Leiterin zu bekommen. Herr Rübsams Bedingung aber war gewesen, dass ich es bis zum Schuljahresende durchzog – mit Erfolg. Also noch zwei geschlagene Monate. Außerdem musste ich meinen Notendurchschnitt verbessern und hatte versprochen, in den Pausen im Kiosk zu helfen. Brötchen schmieren statt Breakdance. Mein Leben war furchtbar uncool geworden. Es zog Kraft aus mir, all diese Dinge zu tun. Mir war schleierhaft, wie ich unter solchen Voraussetzungen mit Leander den Dreisprung vollenden sollte – und zwar in seinem wichtigsten finalen Schritt, der Menschwerdung. Wir hatten nur noch ein begrenztes Zeitfenster, und was tat er? Schottete sich in alter Gewohnheit von mir ab und weigerte sich, mir zu sagen, was Onkel Gunnar ihm in den USA mit auf den Weg gegeben hatte. Ich wusste nichts außer dem, was er mir bereits verraten hatte – Ordnung, Klarheit, Frieden. Genau das suchte ich vergeblich, sowohl in mir als auch in allem anderen. Dazu eine schwangere Mutter mit unberechenbaren Stimmungsschwankungen – ich war bedient. Selbst Papa verschwand immer öfter auch abends in den Keller, weil er sich Mamas Emotionsattacken nicht mehr gewachsen sah.
»Verabschiede dich wenigstens noch. Okay?«, bat mich Herr Rübsam.
»Hm«, machte ich unbestimmt und trat vor das Lehrerpult. »Wir sind für heute fertig. Morgen bringe ich euch bei, wie man Pailletten auf Stoff appliziert.« Oh Gott, meine Jungs würden sich totlachen, wenn sie mir zuhören würden. »Ist gar nicht so schwer«, schickte ich mit einem gezwungenen Lächeln hinterher, als ich sah, dass einige Mädchen erschrocken zusammenzuckten. »Wir können sie auch kleben. Ohne Nähmaschine. Oder draufbügeln. Ja?«
Keine Antwort, nur ein paar skeptische Blicke oder von mir weggedrehte Gesichter. Ob ich sie mal kräftig anbrüllen sollte, um sie aus ihrer Starre zu erwecken? »Chance, Luzie«, erinnerte ich mich selbst. »Chance. Nutzen.«
»Dann bis morgen. Pailletten sind toll!«
Als hätte ich die Peitsche geschwungen, suchten die Mädels in Windeseile ihre Sachen zusammen und flohen aus dem Klassenzimmer. Prima gemacht, Luzie.
Seufzend begann ich, den Saal aufzuräumen und die Nähmaschinen und Stoffreste zurück in den Schrank zu bugsieren. In einer Woche sollten wir damit beginnen, die Kostüme für die Sommeraufführung der Schultheater-AG zu entwerfen – und ich schaffte es nicht einmal, den Mädchen beizubringen, wie man Puppenkleider nähte.
Als ich die Schule verließ, war fast niemand mehr da. Die Gänge wirkten kalt und verwaist, nur der penetrante Geruch des Mittagessens erinnerte daran, dass sich hier vor Kurzem noch Menschen gedrängt hatten. Doch auch beim Essen war ich seit meiner Rückkehr aus den USA von meinen Jungs getrennt – ich stand nämlich hinter der Theke. Ich durfte ihnen höchstens ab und zu ein paar Fischstäbchen auf den Teller legen – auch ein Bestandteil meines Resozialisierungsprogrammes.
In der S-Bahn stopfte ich mir nicht wie üblich die Kopfhörer in die Ohren. Erstens ging mir neuerdings meine eigene Musik auf die Nerven – und zweitens hatte ich mir das mit dem Druckgefühl im rechten Ohr nicht eingebildet. Jetzt gesellte sich sogar ein leises Pochen dazu und die Hitze hinter der Ohrmuschel schien sich rhythmisch zu verstärken. Gleichzeitig begann ich im Rücken zu frösteln. Bitte nicht … Nicht wieder eine Mittelohrentzündung. Ich zog die Kapuze meiner Fleecejacke über den Kopf; manchmal half das. Doch das Pochen war noch da, als ich die Tür zur Wohnung aufschloss, ein paar Sekunden lauschte – alles ruhig, wunderbar, Mama machte ein Schwangerschaftsnickerchen – und auf Zehenspitzen zu meinem Zimmer schlich. Jetzt war ich froh, dass Leander nicht da sein würde. Alles, was ich wollte, war, mich ins Bett zu verkriechen, mich einzukuscheln und …
»Was, bitte, ist das denn?«
»Etwas leiser, chérie. Lautes Tönen ist ab sofort kontraproduktiv.«
»Aber …«
»Das ständige Aber solltest du dir ebenfalls abgewöhnen. Auch das bringt uns nicht voran.«
Mühsam schluckte ich ein weiteres Aber herunter und versuchte einmal mehr in meinem Leben zu verstehen, zu sortieren und einzuordnen (und am besten sogleich zu verdrängen), was ich sah. Mein ganzes Zimmer war verändert worden, ohne dass ich sagen konnte, was Leander genau damit gemacht hatte. Es wirkte heller und dunkler in einem, irgendwie aufgeräumter und ruhiger. Ja, tatsächlich, die Bücher standen ordentlicher im Regal, und es lagen keine Klamotten mehr herum, sogar der Schreibtisch war halbwegs frei – war das die Ordnung, von der Onkel Gunnar gesprochen hatte und die wir nun brauchten? Aber warum hatte Leander dann all die anderen Dinge hereingeschleppt, die nicht hierher gehörten? Warum dieses kleine Tischchen am Boden vor dem Fenster mit … ja, womit eigentlich? War das etwa eine Buddhastatue? Wieso standen Teelichter und Duftlampen auf der Fensterbank? Und was tat Leander auf der lilafarbenen Matte, während er mir gewohnt forsch Anweisungen gab – Gymnastik? Wenn ja, war es eine sehr merkwürdige Form der Gymnastik und hatte garantiert nichts mit Parkour oder Breakdance zu tun. Er stemmte die Unterarme in den Boden, balancierte den Rest seines lang gestreckten Körpers auf seinen Zehenspitzen und reckte das Kinn nach oben, fast wie eine Robbe. Seine schönen Wuschelhaare hatte er auf dem Hinterkopf zu einem kleinen straffen Knoten gebunden, außerdem trug er eine weite graue Sporthose und oben nur ein dunkelblaues Trägershirt.
Am meisten irritierte mich jedoch die Musik. Viel zu langsam, viel zu sanft, viel zu entspannt. Sie machte mich zappelig.
»Nein, Luzie, lass es an. Hab ich extra aus dem Netz runtergeladen und gebrannt, wir brauchen …«
»Wir brauchen gar nichts. Wenn du so einen weichgespülten Mist hören willst, geh in ein Seniorenheim oder in einen Wellnesstempel, aber nicht in meinem …«
»Doch«, entgegnete Leander bestimmt, ließ sich hinuntersinken, bis seine Brust nur wenige Millimeter von der Matte entfernt war, verharrte dort und schob den Oberkörper gemächlich wieder hoch. Mir entging nicht, wie seine Armmuskeln sich dabei anspannten, und das verwirrte mich so, dass ich nicht mehr wusste, was ich eigentlich sagen wollte.
»Hier«, keuchte er, nachdem er sich ein drittes Mal hinabgesenkt und hochgestemmt und ich ihn fasziniert dabei beobachtet hatte. »Puh, ist das anstrengend.«
»Was ›hier‹?«, fragte ich belämmert. Ich konnte meine Augen nur schwer von seiner halb entblößten Brust loseisen.
»Na, hier in deinem Zimmer. Dein Zimmer muss ein Hort des Friedens und der Entspannung und Selbstfindung werden.«
»Hast du wieder von Papas Danziger Goldwasser getrunken?« Kritisch beäugte ich Leander, und zum ersten Mal seit Wochen sah er mich direkt an. Sofort schien mich das Licht seines rechten blauen Auges zu blenden, und ich geriet fast ins Taumeln. Doch noch mehr brachte mich der wissende, erwachsene Ausdruck in ihm aus der Fassung. Oje. Er hatte einen Plan. Es würde beginnen. Leander würde mir nun mitteilen, wie wir seine Menschwerdung angingen. Ohne zu wissen, was er mir sagen wollte, hätte ich meine beiden Hände dafür ins Feuer gelegt, dass er sich in seinem Plan kolossal irrte. Trotzdem, eines war sicher – getrunken hatte er nicht. Die Klarheit, mit der er mich anblickte, ließ jeden Vorwurf in mir ersterben, bevor ich ihn zu Ende denken konnte. »Okay, was war das dann eben? Das da?« Ich zeigte auf die Matte.
»Der Hund«, erklärte Leander selbstgefällig. »Yoga.«
»Yoga«, äffte ich ihn nach. »Weicheier-Sport. Und warum glaubst du, dass Yoga …«
»Luzie, eines vorab. Wir werden nicht alles ausdiskutieren können, was in den nächsten Wochen passiert. Manches, was ich tue, wirst du einfach hinnehmen müssen, auch wenn du es nicht verstehst. Du solltest darin eigentlich etwas Übung haben.«
»Oh ja, die habe ich wahrlich«, erwiderte ich kühl, zog meine Jacke aus und ließ meinen Hintern auf das Bett plumpsen. »Was riecht hier so?«
»Lavendelöl. Hab es auf unsere Kopfkissen geträufelt. Für schönere Träume.«
»Leander … Was ist passiert?« Ich klang kläglich und verunsichert, nur leider nicht so anklagend, wie ich wollte.
»Noch nichts. Aber es muss etwas passieren. Etwas Bahnbrechendes. Das weißt du doch, Luzie, oder? Was wir nun vor uns haben? Willst du es denn noch?«
»Ich …« Ohne zu wissen, warum, brach ich ab. Mir war, als ob sich ein schweres Gewicht auf meinen Magen herabsenkte. »Du meinst … dass du ein Mensch wirst? Und sichtbar für alle?«
Leander nickte nur, ohne seine blau-grünen Huskyaugen von mir abzuwenden.
»Schon, klar, ja, natürlich …« Wieder hielt ich inne. Aus dem Innehalten wurde Schweigen. Und aus dem Schweigen Angst. »Es … es ist nur …«
»Es wird alles verändern«, bestätigte Leander ernst. »Alles.«
»Ja. Alles. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, oder?« Jetzt erst wurde mir bewusst, was für ein Irrsinn das eigentlich war, woran wir seit Monaten arbeiteten. Wir griffen in den Kosmos ein. Wir wollten es schaffen, aus einem Engel einen Menschen zu machen. Gut, Leander würde sich selbst niemals als einen Engel bezeichnen – aber die Sache blieb die gleiche. Bis zu seinem Körperfluch hatte niemand von uns Menschen ihn je gesehen, gehört oder gespürt. Nun – gespürt hatte ich ihn vielleicht, doch zu keiner Sekunde hatte ich geahnt, dass es aus ihm rührte – aus einem Wächter, der immerzu in meiner Nähe war. Wir Menschen bezeichnen es als Intuition, Eingebung, siebter Sinn, wenn wir Engel spüren. Manchmal empfinden wir auch plötzlichen Trost oder ein Gefühl des Schutzes – und denken, dieses Gefühl käme aus uns. Aber so ist es nicht.
»Die andere Möglichkeit wäre, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich denke, dass es so endet, wenn ich es nicht schaffe. Denn diese Geist-Sache ist wohl abgehakt.«
Ja, ich wusste das auch. Selten hatte Leander auf mich realer und menschlicher gewirkt als jetzt – sah man mal von dem irisierenden Licht in seinem blauen Auge und der Tatsache ab, dass nur ich das alles wahrnehmen konnte.
»Also denke ich …«, fuhr Leander sinnierend fort, »dass es am Ende dieses Zeitfensters einfach Plopp macht und ich weg bin. Schluss, aus, Ende.«
Ich lachte freudlos auf. Zu oft hatte ich mir das in den letzten Jahren gewünscht – dass es in gewissen Situationen Plopp machte und ich Leander ein für alle Mal los war. Denn er hatte mich ständig zur Weißglut getrieben und in Nöte gebracht, aus denen ich mich kaum mehr herausmanövrieren konnte. Trotzdem war es eine Vorstellung, die beinahe mein Herz zum Stehen brachte.
»Indiskutabel«, vermeldete ich matt.
»Gut. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wann wir den Sprung wagen müssen. Mittsommernacht. Noch besser wäre Samhain, aber das ist zu lange hin … viel zu lange. Das kann nicht gemeint sein. Zur Mittsommernacht sind die Wände auch dünn, und dann …«
»Welche Wände?«
»Die Wände zwischen den Menschen und den Toten, den Lebenden und den Geistern, zwischen dem, was wir sehen und nicht sehen …« Ungelduldig wedelte Leander mit den Händen, wobei sich zwei Strähnen aus seiner kunstvollen Yoga-Frisur lösten und in sein Gesicht fielen. Oh, er stand ihm, dieser alberne Knoten. Er betonte seine ohnehin markanten Wangenknochen. »Musst du nicht verstehen. Was ich vorhin schon andeutete – und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, sozusagen die Basis: Du musst mir vertrauen. Vertrau mir am meisten, wenn du mich am wenigsten verstehst.«
»Pffff …«, machte ich und ließ mich rücklings aufs Bett fallen. Das fing ja klasse an. »Leander, das kann ich nicht, weil du ständig falsche Dinge planst und mir niemals davon erzählst. Ich muss wissen, was du ausheckst, sonst wird es garantiert in die Hose gehen!«
»Du wusstest es doch auch in der Vergangenheit nicht.«
»Ja, genau, und …« Als ich begriff, was ich da sagen wollte, entglitten mir die Worte und Argumente. Touché. Trotz aller Turbulenzen und Gefahren waren wir mit jedem Abenteuer ein Schrittchen weiter gekommen. Aber eben nur ein Schrittchen, und dieses Mal ging es um was Größeres, Vollkommeneres.
»Vertrauen hat was mit Trauen zu tun, Luzie. Mit Mut. Du bist doch mutig, oder?«
»Klar.« So ganz glaubte ich mir nicht, obwohl Leander im Prinzip recht hatte. Letztes Jahr war ich sogar von einem Hochhausdach zum anderen gesprungen. Doch ich hatte dieses ungute Gefühl, dass er eine ganz andere Sorte von Mut meinte – eine, die ich noch nicht kannte.
»Geht es dir nicht gut, chérie?«
»Mein Ohr.« Ich richtete mich wieder auf, ließ jedoch die Schultern hängen, wie es vorhin die Brillenschlange getan hatte. Doch bei ihr ging es nur um ein blödes Cape für eine Barbiepuppe. Nicht um die Metamorphose eines Schutzengels. »Pocht und tut weh.«
»Entgiftung«, dozierte Leander weise und ließ kurz sein Grübchen sehen. »Dein Körper entgiftet wieder. Wird er noch öfter tun.«
»Du meinst wegen der Schlange und ihrem Biss?« Automatisch schaute ich auf mein Bein, das nach dem Angriff der Klapperschlange zwischenzeitlich auf die dreifache Größe angeschwollen war. Beinahe wäre ich dabei draufgegangen. Nun erinnerte nur noch die Narbe daran.
»Nicht alleine das. Wir müssen dir deine schlechten Eigenschaften austreiben. Dein eigenes Gift.«
Empört schnappte ich nach Luft. »Mein was? Gift? Schlechte Eigenschaften? Ich habe keine schlechten Eigenschaften!«
»Ach nein? Wie wäre es mit Lügen? Abmachungen brechen? Andere Menschen vor den Kopf stoßen? Faulheit? Egoismus …«
»Klappe halten«, fauchte ich unterdrückt. Schreien durfte ich nicht, denn Mama zu wecken war, als würde man einen hungrigen Löwen reizen. »Für Faulheit bist du der Spezialist. Und wozu brauchen wir eigentlich einen Buddha?« Gegen die anderen Vorwürfe konnte ich nicht viel sagen, sie trafen alle zu. Doch sie hätten es nicht, wenn Leander nicht in mein Leben geflattert wäre. Jedenfalls größtenteils nicht.
»Als Erinnerung. An Frieden und Lächeln und Gelassenheit.«
»Mein Herz quillt über davon«, ätzte ich und linste zu der kleinen Statue hinüber. Ihr Lächeln sah wirklich friedlich aus und die entspannt geschlossenen Augen auch. Irgendwie mochte ich diesen Anblick, auch wenn ich der Meinung war, dass Leander wie so oft vollkommen durchdrehte.
»Genau«, entgegnete er nachsichtig. »Ich weiß, dass es schwer ist. Und noch schwieriger wird. Wir fangen mit kleinen Schritten an. Aber diese Schritte musst du gehen, Luzie. Versprichst du mir das?«
»Und was machst du derweil? Yoga? Mit Yoga zum Dreisprung, ja, das ist es sicher, was Onkel Gunnar gemeint hat …« Genervt hieb ich mit der rechten Faust in mein Kopfkissen.
»Vertrauen, Luzie«, erinnerte Leander mich tadelnd. »Ich tue meinen Teil, und glaub mir, er ist groß. Aber ich darf nicht darüber reden.«
»Die alte Leier.«
»Ja. Ist nun mal so. Doch dieses Mal bist auch du gefragt, und nur ich kann dir sagen, was zu tun ist.«
Mir lag schon wieder ein kräftiges Aber auf der Zunge, doch auch das würgte ich hinunter. Egal, was ich erwidern und protestieren wollte – es lief stets auf den einen Punkt hinaus. Vertrauen. Das überforderte mich jetzt schon.
»Darf ich denn wenigstens wissen, wo du die letzten Wochen warst? Und warum du jetzt plötzlich alles zu wissen glaubst?«, versuchte ich einen anderen Weg.
Leander wies mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf. »Gelesen. Viel gelesen. Mir meinen Teil gedacht und wieder gelesen. Und nun geht es an die Praxis.«
»Gelesen? Aber wo hast du denn … oh.« Trotz meiner Ohrenschmerzen und meinem übervollen Kopf musste ich grinsen. Ja, das ergab Sinn. Ich hatte ihn so ziemlich jeder Tat verdächtigt – doch darauf wäre ich nicht gekommen, obwohl ich die Berichte in der Zeitung studiert und sogar den Beitrag im Regionalfernsehen geguckt hatte, da er gesendet wurde, als ich Mama abends die Schultern massieren musste. In der Zentralbibliothek der Uni Mannheim waren regelmäßig Bücher aus den Regalen verschwunden und Tage später plötzlich wieder aufgetaucht – entweder im Regal am richtigen Platz oder aber aufgeschlagen auf einem der hinteren Tische, ohne dass im Computer irgendein Leihvorgang vermerkt worden war. Man ging von Studentenstreichen aus, aber es war auffällig, dass sich fast alle Bücher mit religiösen und philosophischen Themen befassten und zudem einige Seiten fehlten, die fein säuberlich herausgeschnitten waren. Der »Dieb« hatte sich jedoch auf seine Weise erkenntlich gezeigt und fast jeden Tag frische Blumen (die offensichtlich aus städtischen Rabatten gerupft worden waren) auf das Pult der Bibliothekarin gelegt. Die arme Frau zweifelte zunehmend an ihrem Verstand, bekannte aber im Fernsehinterview, dass sie keine Angst habe und sich beim Arbeiten selten so wohl gefühlt habe. Den Studenten solle man ihre Streiche nachsehen, sie hege keinen Groll. Nun hatte dieser Spuk wohl ein Ende, und die Bibliothekarin musste sich an die Normalität zurückgewöhnen.
»Bücher über Religion? Ihr von Sky Patrol glaubt doch an fast nichts. Und ich übrigens auch nicht.«
»Darum geht es nicht. Es geht – na ja, eigentlich geht es um die Suche nach Glück. Aber die ist anders als die meisten Menschen sich das vorstellen. Luzie, wie ich schon sagte, du …«
»Ich weiß schon. Vertrauen.« Ich streifte die Sneakers von meinen Füßen und zog mir die Decke über den Bauch. Das Frösteln in meinem Rücken rieselte durch meinen ganzen Körper. Die ersten Anzeichen eines Fieberschubs? Erschöpft schloss ich die Augen. Jetzt konnte ich die Musik besser ertragen. Sie machte mich schläfrig und vertrieb die unruhigen Gedanken an das, was Leander und mir bevorstand. Niemals durften die Jungs erfahren, dass ich so einen Mist in meinem CD-Player liegen hatte, aber für den Moment … für den Moment war es richtig.
Für wenige Sekunden sah ich noch einmal Leanders zweifarbige Augen aus dem Dunkel auftauchen, wie sie mich so gewiss und klar anblickten. Dann schlief ich ein.
Weisheit in Schwarz
Tock, tock, tock. Nein, das war nicht mein Ohr, und es war auch nicht in meinem Ohr. Es war außerhalb. Blinzelnd öffnete ich meine Augen. Im Zimmer war es dämmrig, bald würde die Sonne aufgehen, es war also noch viel zu früh, um auch nur mit dem kleinen Zeh zu wackeln oder gar zu denken. Seufzend drehte ich mich auf die andere Seite und wickelte mich noch etwas fester in meine Decke ein. Ich hatte mir das Geräusch bestimmt nur eingebildet. Also weiterschlafen. So lange, wie ich wollte. Schule war bis auf Weiteres gestrichen, denn ich war krank, und ausnahmsweise war es mir recht. Wenn das Fieber mal gesunken war, war es durchaus angenehm, eine Mittelohrentzündung zu haben. Natürlich nervte das taube Gefühl im Ohr, und meine Mattheit ließ mich daran zweifeln, jemals wieder Parkour machen zu können. Auch war es langweilig, tagein, tagaus in meinem Zimmer zu liegen, an die Decke oder aus dem Fenster zu gucken und darauf zu warten, dass Leander sich zu mir gesellte und mir ein paar Yogaübungen vorführte oder einfach nur vor dem Buddha saß und ihn anschaute, als könne er sich im nächsten Moment in einen Tiger verwandeln, wenn man ihn nur lang genug fixierte.
Ich wusste nicht, was Leander tagsüber trieb; ich wusste nur, dass er da war, in der Wohnung, und dort durch den Flur und die Zimmer huschte – das konnte ich vor allem dann spüren, wenn ich meine Augen schloss. Seine Präsenz war so stark geworden, dass ich sie beinahe wie eine Wärmewolke fühlte, die an mir vorbeizog, wenn Leander mein Zimmer passierte. Doch ich hatte den Verdacht, dass er meine Gegenwart mied, weil ich ihm krank zu unleidlich war. Nur vor dem Einschlafen, wenn die Schmerzen am stärksten waren, setzte er sich an mein Bett und verfiel in einen eigenartigen monotonen Gesang, bei dem er wenige Silben in einem ständigen gleichmäßigen Wechsel wiederholte – und das oft eine halbe Stunde am Stück. Er selbst hielt die Augen dabei geschlossen und regte sich kaum. Als er das erste Mal damit anfing, wollte ich noch diskutieren und zetern, doch er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich verstand kein Wort von dem, was er da sang, es hörte sich fremdartig an, und so oft ich auch zuhörte – ich konnte mir diese kurze Strophe nicht merken. Leander behauptete, ich müsse nicht wissen, was er da tue, und er tue es für sich selbst, ich solle ihn einfach nur lassen. Ich glaubte ihm kein Wort. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass dieser Singsang uns bei dem Dreisprung helfen könnte. Aber bis Mittsommer waren es noch einige Wochen, und bisher hatte Leander mich nicht mit weiteren Aufträgen belästigt.
Also zögerte ich mein Kranksein hinaus. Denn bei aller Langeweile und Einsamkeit, die es mit sich brachte: Ich war davon befreit, kleinen Mädchen das Nähen beizubringen, musste mich nicht in der Schule quälen und Tag für Tag erkennen, wie wenig mich noch mit den Jungs verband. Mama bat mich nicht mehr, ihr abends die Schultern zu massieren (dafür war jetzt Oma Anni zuständig), und ich konnte in Ruhe vor mich hinträumen. Von den wundersamen Wüstenabenden bei Onkel Gunnar, von Pete, dem Indianer, von den Sonnenuntergängen Arizonas und dem blauen riesigen Mond und …
Tock, tock, tock. Ich war wieder eingedämmert, doch dieses Tock, tock, tock hatte eine Intensität, die ich nicht mehr ignorieren konnte. Sprang die Heizung an? Nein, trotz des viel zu kalten Mais hatte Papa sie bereits ausgestellt, und wir lebten bei schaurigen 18Grad. Da sollte es auch niemanden verwundern, dass ich nicht richtig gesund wurde. Oder … oder konnte Leander plötzlich wieder fliegen, war auf dem Dach gelandet und klopfte gegen das Fenster? Kehrten seine Engelskräfte zurück?
Schlagartig war ich hellwach und setzte mich auf, um mit aufgerissenen Augen zum Fenster zu schauen. Ja, da war Leander. Allerdings innerhalb des Zimmers. Entspannt lehnte er am Fensterrahmen und blickte lächelnd durch die Scheibe nach draußen, wo eine rabenschwarze Krähe auf dem Sims saß. Nun legte sie ihren Kopf schräg, plusterte sich auf und äugte fragend zu Leander, bevor sie erneut ihren Schnabel gegen den hölzernen Rahmen hieb, als würde sie um Einlass bitten. Tock, tock, tock. Vorsichtig drehte Leander den Griff.
»Nein! Lass es zu und scheuch sie weg! Schlag gegen das Fenster!«, rief ich flüsternd, um meine Eltern nicht zu wecken. Ich mochte keine Krähen. Sie erinnerten mich an das, was tagtäglich unten in Papas Leichenkeller vor sich ging, und davor gruselte es mich mehr denn je, seit ich von der Klapperschlange gebissen worden und selbst fast über den Jordan gegangen war.
Doch Leander öffnete das Fenster einen Spalt und verharrte still. Neugierig lugte die Krähe zu uns herein. Ihr Schnabel kam dem Spalt bereits gefährlich nahe.
»Bitte jag sie fort!«
»Nein«, wisperte Leander beinahe zärtlich. »Wir brauchen ein weises Tier.«
»Sie ist schwarz.« Ich wusste es doch. Seine Gesänge machten ihn irre. So schön und beruhigend sie auch klangen, wenn er sie mit seiner rauen, warmen Stimme vortrug – Leander wurde zwar kein Geist mehr, verlor aber seinen Verstand.
»Ein WEISES Tier, Luzie. Mit rundem s, nicht mit scharfem. Krähen sind weise Tiere. Sie wird uns helfen. Wir sollten versuchen, sie zu zähmen.« Schon hatte Leander seine Hand dem Spalt genähert, als wolle er ihr Gefieder kraulen, und anstatt wegzuflattern, legte der blöde Vogel nur seinen Kopf schräg.
»Lass das!« So schnell es meine lädierte Verfassung erlaubte, war ich neben ihm und schlug das Fenster zu. Empört krächzend hüpfte die Krähe drei Schritte rückwärts auf das Dach, um drohend ihre blau schimmernden Flügel zu spreizen. Doch sie flog nicht fort, sondern sah mich nur unbeirrt aus ihren runden, starren Augen an.
»Mensch, Luzie, fast wäre ich so weit gewesen, sie zu berühren … Wieso machst du es kaputt?«
»Ich mag eben keine Krähen. Außerdem sind Krähen wilde Tiere. Man zähmt sie nicht. Aua …« Das plötzliche Aufspringen war mir in mein Ohr gefahren. Klopfend verlangte es nach Aufmerksamkeit. Wie immer, wenn es schmerzte, legte ich meine Handfläche darauf, als könne ich es damit heilen. Ich fühlte mich nach wie vor schwach und zerschlagen.