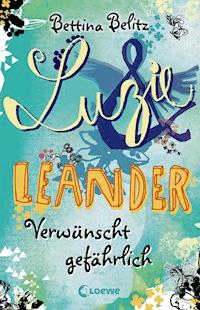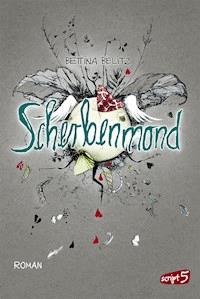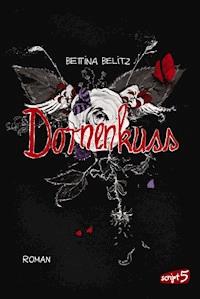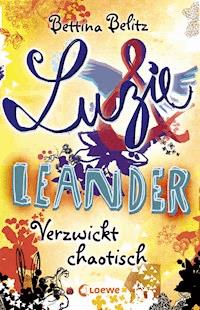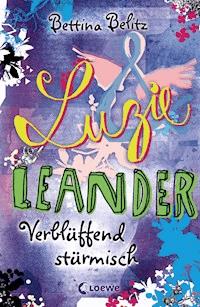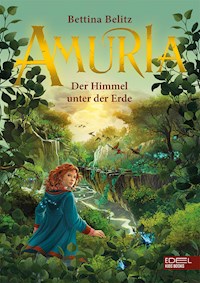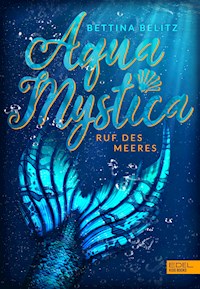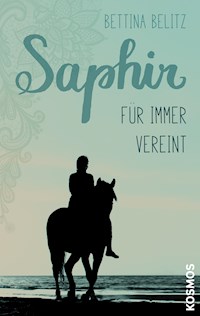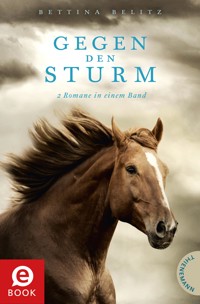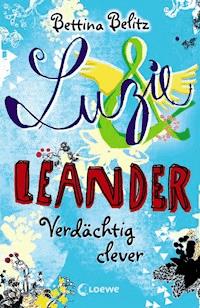
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Luzie & Leander
- Sprache: Deutsch
Einen unsichtbaren Mitbewohner zu haben, ist genauso kompliziert, wie es klingt: Wegen Leander hat Luzie ständig Ärger mit ihren Eltern. Bis denen der Geduldsfaden reißt und Luzie in einem Erziehungscamp in Colorado landet. Als Luzie schon denkt, dass selbst Leander sie im Stich gelassen hat, taucht er auf und bittet sie um Hilfe: Zusammen mit ihr will er die letzten Geheimnisse des Dreisprungs ergründen. Und die Zeit drängt, denn durch den misslungenen Versuch, ein Mensch zu werden, verwandelt Leander sich nach und nach in einen Geist ... "Verdächtig clever" ist der siebte Band der Luzie und Leander-Reihe. Die himmlische Jugendbuch-Reihe von Bettina Belitz! Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen erzählt die Splitterherz-Autorin, wie sich Luzie und ihr Schutzengel Leander durch das Pubertätschaos kämpfen und die erste Liebe erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kraut und Rüben
Wie Johnny und Vanessa
Kümmerling mit Kuss
Katze mit Kater
Fluchtvereitelung
Außer Kontrolle
Last Exit Colorado
Die Quadratur des Kreises
Leichtgewichte
Winnetou mal anders
On the road
Spiel mir das Lied vom Tod
Unter Geiern
Die Unvollendete
New Mexico Dream
Menschenkind
Alle Bände der Reihe »Luzie & Leander«
Über die Autorin
Weitere Infos
Impressum
Kraut und Rüben
»Das gibt’s doch gar nicht«, flüsterte ich mit einem leichten Anflug von Panik in der Stimme. »Das gibt’s nicht!«
Dabei wusste ich seit einem Jahr sehr gut, dass Dinge, die es eigentlich nicht gab und meiner Meinung nach auch nicht geben durfte, aus meinem chaotischen Leben nicht mehr wegzudenken waren. Die Schaltzentrale dieser Dinge, die es nicht geben durfte – Leander von Cherubim, einst Schutzengel, nun Nervtöter –, stand zu Eis gefroren in der Zimmerecke und sah mir mit undurchdringlicher Miene dabei zu, wie ich zum dritten Mal meinen Schulrucksack durchwühlte und anschließend sämtliche Papiere und Mappen und Collegeblocks auf meinem Schreibtisch hochhob, ausschüttelte und wieder ablegte. Dabei ahnte ich bereits, dass nichts Nennenswertes dabei herauskommen würde – und schon gar nicht mein Deutschreferat, nach dem ich so verzweifelt suchte. Ja, mein Schreibtisch war niemals ordentlich und in meinem Rucksack herrschten ohnehin andere Gesetze als die der Physik und Wahrscheinlichkeit, aber normalerweise fand ich mich darin problemlos zurecht. Man brauchte keine Ordnung, wenn man seine Unordnung durchschaute. Und ich hätte schwören können, dass ich das Referat gestern Abend in meinen Rucksack gelegt hatte. Wo es nicht war. Es war einfach nicht da!
»Steh nicht so dumm rum, sondern hilf mir gefälligst!«, pflaumte ich Leander an. »Such mit!«
»Das hat keinen Sinn.« Seine blau-grünen Augen blickten emotionslos durch mich hindurch und ich verspürte plötzlich eine unbändige Lust, ihm in den Bauch zu boxen. »Dein Referat ist nicht da, weil du es nie geschrieben hast.«
»Hab ich wohl!«, rief ich erzürnt. »Zwei geschlagene Stunden hab ich dran gesessen, während du mal wieder irgendwelche Kitschromane gelesen und mit Mama ferngesehen hast!«
Ohne dass Mama davon wusste, wohlgemerkt. Deshalb musste ich dringend meinen Tonfall dämpfen, denn niemand außer mir konnte Leander sehen und hören. Einverstanden, wir hatten Fortschritte gemacht. Immerhin war er im Herbst wie ein Mensch krank geworden – sehr krank – und mit einem raffinierten Trick meinerseits hatte ihn Serdans Cousin, ein angehender Arzt, untersuchen können. Er hatte sogar seine Lunge abgehört. Nur wenige Tage später hatte die versammelte Schule samt Eltern und Lehrern dabei zugesehen, wie Leander in einem Ganzkörper-Spiderman-Kostüm Parkour machte und tosenden Beifall dafür erntete, während ich in den Wochen danach ständig unangenehmen Fragen ausweichen musste. Denn niemand wollte mir glauben, dass ich nicht wusste, wer dieser Traceur war, der sich so elegant über den Laufsteg bewegt hatte.
Trotzdem blieb es im Alltag so, wie es seit über einem Jahr war: Leander war für alle Menschen außer mir nicht sicht- und hörbar, aber fühlbar, und er entwickelte immer mehr Mittel und Wege, mein Dasein zu einem Albtraum verkommen zu lassen. Auch bei meinem jetzigen Problem hatte ich ihn im Verdacht. Er musste mit dem verschwundenen Referat zu tun haben, obwohl ich mir nicht erklären konnte, warum. Bisher hatte Leander meine schulischen Leistungen immer vorangetrieben, anstatt sie zu boykottieren, ja, er hatte sogar Referate für mich verfasst. Doch Leander war zu einem leibhaftigen Rätsel geworden. Ich verstand ihn nicht mehr und er selbst machte sich auch nicht die Mühe, mir zu erläutern, was in ihm vorging. Stattdessen tat er so, als sei alles in bester Ordnung.
In meinem grenzenlosen Frust stopfte ich wahllos Bücher und Hefte in meinen Rucksack und schloss hastig die Schnalle, denn die Zeit drängte, sonst würde die S-Bahn ohne mich abfahren. Mir graute es jetzt schon vor dem Deutschunterricht. Vor lauter Wut und Hilflosigkeit wusste ich nicht einmal mehr, was ich gestern überhaupt aufgeschrieben hatte, ich konnte es also auch nicht mündlich vortragen. Denn ich war in meinem Kopf mit anderen, wichtigeren Fragen als mit der deutschen Romantik beschäftigt gewesen. Nämlich mit der Romantik meines eigenen Lebens, und um die war es schlechter bestellt denn je. Nicht dass ich mir ununterbrochen Romantik erhoffte oder gar Kitsch. Aber Leander bot nicht einen Hauch davon.
Ich verstand es nicht. Noch so ein Satz, den ich aus meinem Wortschatz streichen sollte, denn er brachte mich nicht weiter. Und ich dachte und sagte ihn viel zu oft. Er raubte mir Energien. Auch jetzt lag er mir auf den Lippen und schien mir die Luft zum Atmen zu nehmen.
Körperwächter waren grundsätzlich schwer zu verstehen, ja, das hatte ich inzwischen begriffen. In der Theorie wussten sie eine Menge über menschliche Gefühle, doch die Praxis war eine Katastrophe und man sollte nie davon ausgehen, dass ein menschelnder Körperwächter wie Leander sich jemals wie ein echter Mensch verhalten würde. Aber nach unserer Parkour-Show beim Weihnachtsschulfest war Leander mir näher gewesen denn je und ich hatte gespürt, dass es ihm ernst war. Mit mir. Als seiner … seiner Freundin? So etwas Ähnliches musste er gedacht oder gewollt haben, denn er hatte mich im Arm gehalten und an meinem Ohr geknabbert und mich … mich geküsst. Lange. So lange, dass meine Knie wieder zu zittern begonnen hatten, und zwar nicht, weil ich gerade Hochleistungssport betrieben hatte. Es hatte an ihm gelegen. Nur an ihm. An meinem Leander.
Ich hatte gedacht, dass es nun leichter werden würde mit uns – wo wir doch wussten, dass wir uns … liebten? War es das gewesen? Liebe? Unwillkürlich schüttelte ich den Kopf, während ich in meine Sneakers schlüpfte und nach meiner Jacke griff. Schon an jenem kalten Abend nach der Show hatte ich leichte Beklemmungen verspürt, als ich in meinem Bett lag und Leander neben mir auf dem Sofa und ich daran dachte, wie innig wir uns geküsst und umarmt hatten. Einen Moment lang war ich versucht, zu türmen und die Nacht im Wohnzimmer auf der Couch zu schlafen, wenn ich es nicht so wunderschön gefunden hätte, Leanders halbwegs gesundem Atem zu lauschen. Gleichzeitig hatte mich dieses Atmen schier wahnsinnig gemacht.
Als hätte Leander das gewusst und als hätte es ihn inspiriert, legte er es von nun an tagtäglich darauf an, mich wahnsinnig zu machen. Nicht mit seinem Atem – oh nein, mit anderen Dingen. Verschwundenen Hausaufgaben zum Beispiel. Oder indem er die Wohnung verwüstete, während ich weg war. Oder indem er das Auge über meinem Bett, das ich in einem Anfall von Kreativität an die Wand hatte malen wollen, vollendet hatte. Doch es war kein schönes Auge geworden, es sah aus wie aus einem miesen Horrorfilm. Das Auge eines Zombies. Leander konnte gut zeichnen, er hätte auch ein schönes Auge malen können, aber im Gegenteil, er malte ein Auge, das einen das Fürchten lehrte. Mama war beinahe rückwärts umgefallen, als sie es morgens erblickt hatte, und hätte ich nicht gerade im Bett gelegen, wäre es mir ähnlich ergangen. Das geschah zu allem Überfluss auch noch an einem Morgen, an dem ich verschlafen hatte – wie so oft in den vergangenen Wochen, weil mein Wecker nicht klingelte oder ich zu erschöpft war, um ihn zu hören, nachdem ich mich die halbe Nacht herumgewälzt und gefragt hatte, was zum Teufel mit Leander los war und warum er so tat, als wären wir allenfalls lose Bekannte, die zufällig miteinander in einem Zimmer wohnten. Wie konnte er sich so verhalten nach all dem, was ich für ihn getan hatte, als er krank gewesen war? Am Weihnachtsabend hatte er noch behauptet, sich menschlicher denn je zu fühlen, und so langsam schwante mir, dass ein menschlicher Leander kein guter Leander war. Ich vermisste den Engel-Leander der ersten Stunde. So ungeschickt und hysterisch und aufbrausend er damals gewesen war: Er wäre mir lieber gewesen als dieser gefühlskalte, provokante Typ, der jetzt unentwegt in meiner Nähe war. Doch wenn er mal rausging und sich auf den Straßen Ludwigshafens seine Zeit vertrieb, konnte ich mich auch nicht entspannen. Meine Gedanken kreisten Tag und Nacht um ihn.
Blöderweise war meine Nähmaschine kaputt und Mama würde erst einwilligen, sie reparieren zu lassen, wenn sich meine Schulnoten verbesserten, also konnte ich mich auch damit nicht ablenken. Und seine Schulnoten zu verbessern, war äußerst schwierig, wenn ein Referat zur Notenverbesserung spurlos verschwunden war. Meine letzte Deutscharbeit hatte ich in den Sand gesetzt, weil Leander bis drei Uhr morgens am Computer gesessen und sich in irgendwelchen Chatrooms herumgetrieben hatte, sodass ich vollkommen übernächtigt in den Unterricht getorkelt war. Chatrooms … Was wollte er da? Er hatte ein Mädchen in seinem Zimmer, er brauchte keine Chatrooms! Allein daran zu denken, versetzte mir tausend feine, schmerzende Stiche in meine Brust.
Ich musste etwas dagegen tun. Ich hatte keine Lust, wegen eines Jungen, der sich derart danebenbenahm, unentwegt schlecht gelaunt zu sein. Das war etwas für Sofie und ihre Kicherfreundinnen, aber nicht für mich. Diese Macht sollte niemand über mich bekommen, kein Engel und auch kein Mensch. Ich hasste es, so viel über Leander nachzudenken und zu keiner Erklärung zu kommen. Es war Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Aber selbst wenn die Nähmaschine noch funktioniert hätte, hätte sie mich nicht trösten können. Meine letzten Kreationen waren völlig danebengegangen. Einmal hatte ich mir sogar die Nadel der Maschine durch den Finger gestochen und Mama musste mich mit einem Stück schwarzem Faden, der mitten durch die Fingerkuppe verlief, in die Notaufnahme fahren. Es war keine große Sache, sie zogen den schwarzen Faden wieder heraus und nähten die Wunde mit einem durchsichtigen Faden, was den behandelnden Arzt zu etlichen unterirdisch schlechten Wortwitzen motivierte, die keiner von uns hören wollte. Doch was mich dabei wirklich ärgerte, war, dass ich mir sicher gewesen war, ein anderes Programm eingestellt zu haben, und dieser Unfall gar nicht hätte passieren dürfen. Aber ich war mir ja auch sicher gewesen, dass ich mein Referat geschrieben hatte, und nun blieb es unauffindbar.
Es gab nur eine Medizin für einen solch verunglückten Morgen: Parkour. Mein einziger Hoffnungsschimmer in diesen Tagen. Immerhin, unsere Eltern hatten nach unserer Show eingesehen, dass Parkour nicht ein Selbstmordkommando, sondern ein ernst zu nehmender Sport war, dem auch sie Respekt zollen mussten. So viele Leute hatten uns Beifall geklatscht, sogar Standing Ovations gegeben, da konnten sie sich nicht gegen uns stellen. Niemand hätte das verstanden. Selbst Herr Rübsam hatte in einigen sehr umständlichen Sätzen zu bedenken gegeben, dass solch großes Talent nicht verkümmern dürfe.
Allerdings war Parkour im Hause Morgenroth zu einer »Wenn, dann«-Angelegenheit geworden. Ich durfte nicht einfach so trainieren und mich mit den Jungs treffen. Erst musste ich eine Vorableistung bringen und meistens waren es unsinnige, langweilige Haushaltstätigkeiten, die mir Mama und Papa aufbrummten. Vor allem Papa plagte sich mit der Angst, ich könne mich zu einer Egoistin entwickeln, und legte großen Wert darauf, dass ich »meinen Beitrag zur Gemeinschaft« leistete. Das beinhaltete: Treppe wischen, Straße kehren, Spülmaschine ausräumen, Bad putzen, bügeln. Oder – das war die Gegenleistung für heute Nachmittag gewesen – die Küchenschränke auf Vordermann bringen. Das war dringend nötig, denn Mamas Kochsessions trieben immer seltsamere Blüten. Obwohl das meiste, was sie sich an Herd und Ofen zurechtbuk und -braute, misslang oder zweifelhaft schmeckte, hatte sie zugenommen und das gefiel ihr ganz und gar nicht. Vermutlich hielt sie es deshalb für sicherer, dass ich die Küchenschränke aufräumte, bevor sie dabei wieder einer neuen Kochidee erlag oder jedes Lebensmittel, das sie fand, probehalber vorkostete.
Die Küchenschränke hatte ich vor dem Schlafengehen trotz Referat neu geordnet und dabei sogar ausgewischt, von meinem nicht existenten Referat würden Mama und Papa heute außerdem nicht mehr erfahren – also stand wenigstens einem zünftigen Parkour-Training mit meinen Jungs nichts im Wege. Ohne Leander Tschüs zu sagen oder ihn anzusehen, verließ ich mein Zimmer und kickte die Tür so heftig mit der Hacke zu, dass sie scheppernd ins Schloss fiel.
»Luzie, bitte, muss das sein? Wir sind doch nicht bei Jebs!«
Ich verkniff mir einen Kommentar und wartete mit gesenkten Lidern, bis Papa an mir vorbeigelaufen und in den Hausflur verschwunden war, um hinunter in den Keller zu seinen Leichen zu gehen. Jebs. Keine Ahnung, wer diese Jebs waren, aber den Satz hörte ich nicht zum ersten Mal. Zweifellos mussten diese Jebs jedoch mit den Hempels (und ihrem Sofa) befreundet sein, denn die wurden in Zusammenhang mit Unordnung und schlechtem Benehmen mindestens genauso oft erwähnt. Ich konnte beide Sätze nicht mehr hören.
Aufseufzend betrat ich die Küche, wohl wissend, dass an Frühstück nicht mehr zu denken war. Mama saß mit der Hand auf ihrem Bauch am Tisch und blickte angeekelt in ihre Kaffeetasse. Auf ihrem Teller lag ein angebissenes Brötchen, dick mit Nutella beschmiert. Normalerweise gab sie ein Nutellabrötchen nicht aus der Hand, bis sie den letzten Krümel verschlungen hatte und ihre pink geschminkten Lippen von dunkelbraunen Pünktchen gesprenkelt waren.
»Morgen«, begrüßte ich sie in gedämpftem Tonfall. Vielleicht hatte sie ja Kopfschmerzen. Wenn sie Kopfschmerzen hatte, war sie noch unberechenbarer als sonst und in letzter Zeit war ihr dabei häufig übel. Eine fatale Kombination.
»Das heißt guten Morgen, Luzie. Guten Morgen.«
Wunderbar. Ein Körperwächter, den ich nicht die Bohne interessierte, ein verschwundenes Referat, ein Anschiss von meinem Vater und eine angesäuerte Mutter mit Migräne. Heute war wirklich nicht mein Tag.
»Okay, dann eben guten Morgen«, entgegnete ich spitzer als beabsichtigt und biss mir sofort auf die Zunge. Ich sollte mich zusammenreißen. Schließlich wollte ich etwas von Mama, um das ich mehr kämpfen musste als um alles andere. »Ich muss gleich los und … also, ich treffe mich nach der Schule noch mit den Jungs zum Training. Bin dann zum Abendessen wieder …«
»Hiergeblieben!«, unterbrach Mama mich donnernd und deutete nach hinten auf die Küchenschränke.
»Die hab ich aufgeräumt. Gestern Abend noch.«
»Das hast du wohl geträumt, mein Fräulein.« Schnaufend stand Mama auf, ohne die Hand von ihrem Bauch zu nehmen, und klappte alle drei Oberschränke nacheinander auf, und so wie sich ihre Türen öffneten, öffnete sich auch mein Mund. Ich war sprachlos. Zeit genug für Mama, mir das Innere der Unterschränke zu präsentieren. Es war alles noch schlimmer, als ich es gestern vorgefunden hatte. Umgekippte Zucker- und Mehltüten, falsch aufeinandergestapelte Backformen, verkehrt sortiertes Geschirr und selbst von der Tür aus konnte ich sehen, dass die Böden der Schränke schmutzig und klebrig waren.
»Hatten wir nicht eine Abmachung? Hm? Und was ist das? Kraut und Rüben, Luzie, Kraut und Rüben!«
»Ich hab sie aufgeräumt«, wiederholte ich lahm und spürte, wie mein Gesicht sich verhärtete und eine heiße Woge Hass meinen Bauch überschwemmte. Warum, zum Teufel? Warum tut Leander so etwas?, fragte ich mich verwirrt und zornig zugleich. Das war Mobbing, übelstes Mobbing! Er schikanierte mich. Verdammt, er hatte selbst Parkour gemacht bei unserer Show! Und nun ging alles wieder von vorne los? Er sorgte dafür, dass ich nicht trainieren durfte? Langsam schüttelte ich den Kopf.
»Ich habe sie aufgeräumt«, sagte ich ein drittes Mal, dem festen Wissen zum Trotz, dass sich dadurch am Zustand der Schränke nichts ändern würde.
»Und was sagst du dann dazu?«, fragte Mama spitz. Ich erkannte erschrocken, dass ihre Unterlippe bebte. Nicht weinen, bitte nicht. Das halte ich nicht aus. »Wie erklärst du dir das? Waren es Kobolde?«
»So etwas Ähnliches!«, blaffte ich zurück, in der Hoffnung, dass Leander wie fast immer im Flur herumlungerte und lauschte und endlich, endlich ein schlechtes Gewissen bekommen würde. »Und ich gehe nach der Schule trainieren. Das kannst du mir nicht verbieten! Ich muss das tun!«
Ich musste es tun, weil es das Einzige war, was in meinem Leben noch Spaß machte. Ich brauchte es, dringender denn je.
»Das tust du nicht, Luzie, nein!«
Doch ich war schneller als sie. Ehe Mama den Küchentisch umrundet hatte, erreichte ich die Haustür und jagte die Treppe hinunter. Sie würde mich nicht kriegen – was sollte das auch bringen? Ich musste zur Schule! Ich war in letzter Zeit schon zu oft zu spät gekommen und hatte mir deshalb Verwarnungen eingefangen, sie durfte mich gar nicht aufhalten.
»Scheiße! Verdammte, blöde Scheiße!«, fluchte ich, als ich mich auf den letzten freien Sitz der S-Bahn fallen ließ, weil ich die Spannung in meinem Bauch nicht mehr aushielt. Ich hatte das Gefühl, aus meinem Körper heraushüpfen zu wollen. Die ältere Frau vor mir, die ihren Einkaufskorb auf den Knien balancierte und den Henkel mit beiden Händen umfasste, äugte mich vorwurfsvoll an und murmelte etwas Tadelndes in sich hinein. Doch das Wort »unmöglich« sprach sie laut und klar aus, damit es auch jeder hörte.
»Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Mist!«, rutschte es mir heraus. Doch eigentlich meinte ich gar nicht sie. Ich meinte Leander. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, Leander von Cherubim, du fabrizierst genug davon. Aber lass mich bitte, bitte in Frieden.
Wie Johnny und Vanessa
Schon auf dem Heimweg begann das Hochgefühl, das bisher jedes Parkour-Training begleitet hatte und auch anschließend mindestens noch vier, fünf Stunden anhielt, sich zu verflüchtigen und einer dumpfen Vorahnung Platz zu machen. Von Straßenecke zu Straßenecke wurden meine Schritte langsamer und ich ertappte mich dabei, wie ich in Schaufenster stierte, ohne etwas zu sehen, was mich interessierte. Ich schindete Zeit, doch je mehr ich trödelte, desto gewichtiger und endgültiger wurde das ungute Gefühl, bis ich mich bewegte, als habe ich Bleigewichte an den Händen und Füßen. Nicht einmal der strahlend blaue Frühlingsabendhimmel und der milde Wind, der durch die Gassen strich – ein Wetter, das mir sonst Flügel verlieh –, konnten daran etwas ändern.
Es würde unangenehm werden zu Hause, darauf musste ich mich einstellen. Andererseits war das, was mich dort erwartete, nichts Neues und ich hatte im Grunde auch nichts Neues getan, sondern »nur« unerlaubt Parkour gemacht. Dabei hatte ich die grundsätzliche Erlaubnis dafür sogar bekommen, obwohl ich vorher mehrfach heimlich trainiert hatte. Für meine Eltern musste das ein doppelter Vertrauensbruch sein. Ich brauchte mir nichts vorzumachen, das war viel, viel schlimmer als früher. Doch insgeheim baute ich auf eine gute Tat Leanders. Er musste eingesehen haben, dass er zu weit gegangen war, und irgendetwas veranstaltet haben, was meine Eltern versöhnlich stimmte. Bisher hatte er in den entscheidenden Momenten immer begriffen, was richtig und falsch war, und mir manchmal sogar die Haut gerettet. Das würde er auch dieses Mal tun. Er musste es tun!
Aber sobald ich den Schlüssel herumdrehte und den Hausflur betrat, spürte ich, dass meine Hoffnungen vergebens waren. Es war zu still. Und zu dunkel. Aus Papas Leichenkeller drang kein Licht, was bedeutete, dass er oben in der Wohnung war, bei Mama, deren Alfa im Hof stand. Sie warteten dort auf mich, zu zweit. Ich stockte. Einen Moment lang war ich versucht, noch eine Runde um den Block zu laufen. Doch je mehr Zeit ich verstreichen ließ, desto heftiger würden sie sich in ihr Donnerwetter hineinsteigern. Also biss ich die Zähne zusammen und marschierte nach oben in die Wohnung, wo es ebenso dunkel und still war wie im Treppenhaus. Noch immer zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen, wenn ich nach Hause kam und kein Tapsen von Hundepfoten auf glatten Holzdielen ertönte, doch Mogwai hätte mich jetzt auch nicht retten können.
»Hallo, bin wieder da!«, rief ich. Keine Reaktion. Doch sie waren da, ich fühlte es. Und jetzt? Sollte ich versuchen, mich in mein Zimmer einzuschließen? Nein, das war albern und brachte sowieso nichts. Ich hatte nicht solch großen Mist gebaut, wie sie dachten, aber ich hatte Mist gebaut und sollte mich lieber stellen. Feige war ich noch nie gewesen.
Trotzdem wurde mir beinahe übel, als ich die Küchentür aufstieß und in Mamas und Papas nachtschwarze Mienen blickte.
»Ich hab nur trainiert, mit meinen Jungs. Sonst nichts. Nur Sport gemacht«, verteidigte ich mich rasch, bevor mich einer von ihnen angreifen konnte. »Das ist doch kein Verbrechen, oder?«
»Das nicht«, erwiderte Papa mit eisiger Stimme und schob einen Geldbeutel, der unter seiner Hand gelegen hatte, in die Mitte des Küchentischs. Mamas Geldbeutel, dunkellila mit pinkfarbenen Nähten. Verständnislos schaute ich ihn an, während Papas Lippen kaum mehr zu sehen waren und Mamas anschwollen, einer ihrer vielen Tränenvorboten. »Das hier schon.«
»Was, ›das hier‹?«, fragte ich schwach. »Die Farbe? Ja, ein Verbrechen, sehe ich auch so.«
»Luzie!«, donnerte Papa so laut, dass ich einen erschrockenen Satz zurück machte. Auch Mama zuckte zusammen. »Zum Henker, Rosa, wir hätten ihr einen anderen Namen geben sollen, Luzie klingt immer niedlich, selbst wenn man es schreit, und niedlich ist sie nicht in diesen Wochen und Monaten! Ganz und gar nicht!«
Ich machte einen weiteren vorsichtigen Schritt zurück, denn aus Papas Mund lösten sich beim Schreien Spuckefontänen. Er war das nicht gewohnt. Papa blieb fast immer leise und vor allem drückte er sich fast immer vornehm aus. Eben hatte er sich geradezu normal angehört, wie jeder andere Vater auch, und das machte mir mehr Angst als die Tatsache, dass ich nicht wusste, wovon er sprach.
»Warum tust du das, Luzie? Wozu brauchst du so viel Geld? Was kaufst du dir davon?«, fragte Mama mit erstickter Stimme. Sie hörte sich an, als habe sie geweint, und das nicht nur zehn Minuten lang. Vielleicht sogar den ganzen Nachmittag.
»Ich … nichts. Ich habe mir nichts gekauft. Welches Geld überhaupt?« Ach, verflucht, wieso fragte ich das? Eigentlich wusste ich genau, was hier vor sich ging. Aus Mamas Börse musste Geld entnommen worden sein und vermutlich nicht nur fünf oder zehn Euro. Anscheinend benötigte Herr von Cherubim wieder neues Nobelrasierwasser. Warum »lieh« er es sich nicht wie bisher? Gut gefunden hatte ich das nie, aber wenigstens konnte ein unsichtbarer Dieb nicht festgenommen werden, und wenn Leander behauptete, dass er nie im gleichen Laden Sachen lieh und die Bosse der Drogeriemärkte ohnehin in Reichtum schwammen, wollte ich ihm das gerne glauben. Ich selbst hatte kein Geld für seinen Luxusfimmel. Mein Taschengeld reichte gerade so aus, um ihm hin und wieder etwas zum Anziehen zu kaufen. Für seine Körperpflege musste er selbst sorgen.
»Es ist immer dasselbe«, sagte Papa kopfschüttelnd und warf einen gequälten Blick zu Mama hinüber, die grünlich im Gesicht geworden war, als sei ihr ebenso schlecht wie mir. »Sie stellt etwas an, leugnet es, stellt wieder etwas an, leugnet es … Ich kann und werde ihr die Wahrheit nicht aus dem Leib prügeln. Niemals.« Stöhnend schloss er die Augen und fuhr sich mit beiden Händen über seine Halbglatze. »Luzie, letzte Chance. Sag uns, warum du das Geld gestohlen und was du damit gemacht hast.«
»Ich habe kein Geld gestohlen. Und es stimmt, du kannst mir die Wahrheit nicht aus dem Leib prügeln«, entgegnete ich leise, sah ihn aber nicht dabei an, weil ich sonst angefangen hätte zu heulen. Stattdessen kniff ich die Lippen zusammen, bis sie mir wehtaten. Sprechen konnte ich nicht mehr.
»Gott, sie ist so stur, von wem hat sie das nur …«, flüsterte Mama. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Gut. Luzie, du hast deine Chance gehabt.« Papa war zu seinem üblichen leisen, unaufgeregten Tonfall zurückgekehrt, doch das Pochen an seiner Schläfe verriet mir, dass es ihn unsagbar viel Kraft kostete. Mir wäre es fast lieber gewesen, wenn er mich angeschrien hätte. »Du hast sie nicht genutzt. Hausarrest. Für die nächsten drei Monate. Taschengeld ist gestrichen. Und an Parkour kannst du wieder denken, wenn du volljährig bist und deine eigene Wohnung hast, wo du tun und lassen kannst, was du willst.«
»Nein. Nein!« Jetzt war ich diejenige, die brüllte. »Ich hab das verdammte Geld nicht genommen, ich brauche nichts, alles, was ich brauche, sind meine Jungs und …« Oje, wie hörte sich das denn an? Aber spielte das noch eine Rolle? Mein Leben war zu Ende. Drei Monate lang Hausarrest? Kein Parkour als Ausgleich? Jeden Tag Leanders Launen ausgeliefert, der alles noch schrecklicher machte, als es ohnehin schon war? »Ihr könnt mich mal! Alle beide!«, rief ich wutentbrannt, rannte in mein Zimmer, schmiss meinen Rucksack in die Ecke und trat so fest gegen die Schranktür, dass sie einen deutlich sichtbaren Sprung bekam. Doch das machte mir nur Lust, ein weiteres Mal hineinzutreten, ja, und gerne auch ein drittes Mal, während ich spürte, dass Mama und Papa mir nachkamen und mir mit beträchtlichem Sicherheitsabstand fassungslos bei meiner Raserei zusahen. Was sie dabei nicht sahen, war Leander, der reglos in der Ecke zwischen Bett und Fenster stand und keine Notiz von mir nahm – ja, er hatte die Lider sogar gesenkt.
Wütend nahm ich mein Kissen und schleuderte es ihm ins Gesicht, doch noch immer rührte er sich nicht. Ich ließ alles folgen, was ich in die Hände bekam, meinen Teddy, ein paar Schuhe, CDs, Stifte und schließlich auch ein Unterhemdchen, das eine Millisekunde lang wie eine weiße Friedensfahne mit dem Träger an Leanders linkem Ohr hängen blieb, bevor es gemächlich zu Boden segelte. Erst Mamas lautes Schluchzen brachte mich wieder zur Besinnung. Ohne sie anzusehen, warf ich mich gegen die Tür, um sie zu schließen; ich konnte die beiden nicht mehr ertragen. Doch am allerwenigsten konnte ich Leander ertragen.
»Du Arschloch!«, brüllte ich ihn an, was Mama und Papa hören und weswegen sie denken mussten, ich meine meinen eigenen Vater, doch ich konnte mich nicht beherrschen. Es fiel mir schwer genug, nicht mehr Sachen durch die Gegend zu pfeffern. Leander blieb starr stehen und warf nur einen schrägen Blick auf das Unterhemd zu seinen Füßen. Dann sahen seine Augen wieder an mir vorbei ins Nichts. »Willst du mich fertigmachen?«, zischte ich ohne Stimme.
Was jetzt kam, war nur für seine Ohren bestimmt, ich musste leise bleiben, auch wenn es sich in meiner Kehle anfühlte, als würde ich dabei stranguliert werden. Leander schüttelte kaum merklich den Kopf, sagte jedoch nichts, sondern blickte weiter an mir vorbei. Er schaffte es nicht einmal mehr, mir ins Gesicht zu sehen.