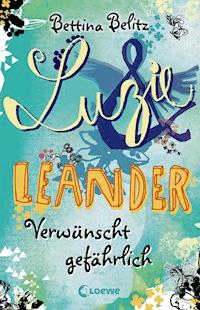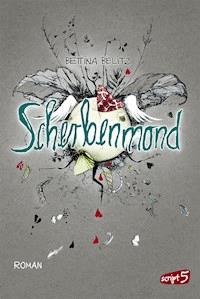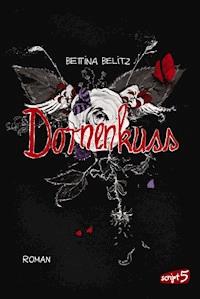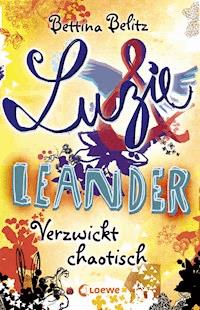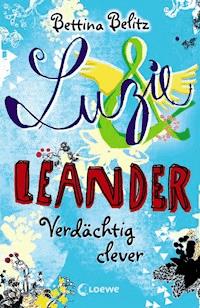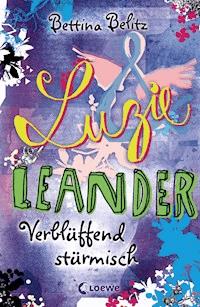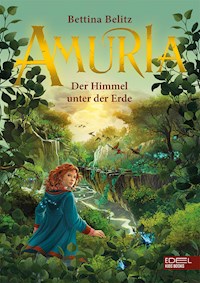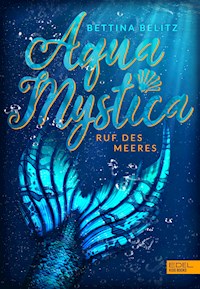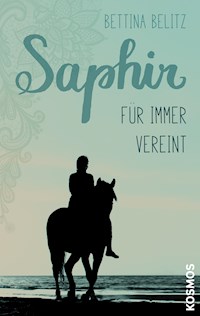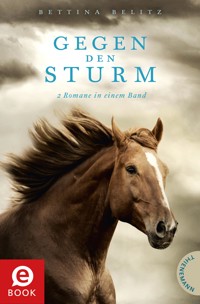Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Luzie & Leander
- Sprache: Deutsch
Die himmlische Jugendbuch-Reihe von Bettina Belitz als eBook! Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen erzählt die Splitterherz-Autorin, wie sich Luzie und ihr Schutzengel Leander durch das Pubertätschaos kämpfen und die erste Liebe erleben. Luzie Morgenroth und Leander von Cherubim kommen blendend miteinander aus – wenn Luzie nicht gerade ihren Lieblingssport Parkour betreibt. Denn Leanders Job als unsichtbarer Wächter ist es, Luzie zu beschützen, ohne dass sie etwas davon mitbekommt. Keine leichte Aufgabe bei einem Mädchen, das lieber mit Jungs über Dächer klettert und auf Geländern balanciert, als zu Hause zu sitzen oder zum Ballett zu gehen. Eines Tages hat Leander genug. Er tritt in Streik – und ahnt nicht, dass damit die Probleme erst beginnen. "Verflucht himmlisch" ist der erste Band der Reihe Luzie & Leander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Der Tag davor
»Seppo! Hey!« Er blieb nicht stehen. Verdammt. Ich kannte das schon. Jedes Mal war das so. Wir hatten den ganzen Nachmittag zusammen trainiert und er lief allein nach Hause, obwohl wir in der gleichen Straße wohnten. Nur zehn Minuten zuvor hatte er mir gezeigt, wie ich mich besser abrollte, wenn ich zwei Meter in die Tiefe sprang. Und jetzt kannte er mich plötzlich nicht mehr.
»Giuseppe Antonio Lombardi!«, brüllte ich über den Bürgersteig. So rief ihn seine Mutter, wenn er wieder mal nicht tat, was er tun sollte. Und das kam fast so oft vor wie bei mir und meiner Mutter. Er zuckte kurz zusammen, ging aber weiter. Okay, dann musste ich ihn eben einholen.
Vielleicht fand er es ja uncool, mit einem Mädchen durch die Straßen zu laufen. Ich fand es uncool, dass er vor mir weglief oder tat, als hörte er mich nicht. Er musste mich hören. Ich konnte wirklich sehr gut laut schreien.
Jetzt hatte er fast den Zebrastreifen an der letzten Kreuzung vor unserer Straße erreicht. Ich legte den Kopf schräg und schätzte die Entfernungen ab. Das war etwas, was ich nicht so gut konnte wie laut schreien. Aber diesen Bürgersteig kannte ich in- und auswendig. Zwei Schritte bis zum Mülleimer, fünf vom Mülleimer bis zur Parkmauer, dann Sprung auf das Geländer, balancieren, zurück auf den Asphalt, abrollen. Vor allem abrollen. Sonst würde es wieder wehtun. Wenn ich sofort losspurtete, würde ich ihn einholen, bevor er die Kreuzung überquerte. Es war ein einfacher Run. Fast zu einfach.
Ich startete aus dem Stand. Meine Muskeln waren noch warm und weich. Der Mülleimer quietschte kurz unter meinen Sohlen, doch bevor er wackeln konnte, war ich schon auf der Mauer und setzte zum Geländer über. Balancieren war meine Spezialität. Das konnte ich besser als alle Jungs zusammen. Sogar besser als Seppo. Deshalb nannten sie mich manchmal »Katz«. Das gefiel mir. Ganz besonders, wenn Seppo mich Katz nannte.
Ich hechtete ihm direkt vor seine Zehenspitzen und rollte mich seitlich ab. Ohne Verletzungen. Ging doch.
»Mensch, Luzie.« Endlich blieb er stehen. Mit einem Satz federte ich auf meine Füße zurück.
»Warum läufst du vor mir weg?«
Er schnaubte und schaute zur Seite und dann auf den Boden, als gäbe es da etwas ungeheuer Interessantes zu sehen. »Ich lauf nicht vor dir weg …«
»Doch, tust du«, entgegnete ich. »Jeden Abend.«
»Ich laufe nicht weg, ich laufe nach Hause«, brummte er.
»Ich auch!«, rief ich empört. Die Frau vor uns drehte sich mit verkniffenem Blick zu uns um. »Wir sind quasi Nachbarn, wir können zusammen nach Hause gehen.«
»Nerv mich nicht, Luzie«, murmelte Giuseppe und beschleunigte seine Schritte. Gut, dann musste ich eben das Thema wechseln.
»Wir haben neues Material da«, sagte ich mit gesenkter Stimme. Seppo blieb sofort stehen.
»So«, erwiderte er und fummelte an den Bändern seines Kapuzenshirts herum.
»Ganz frisch heute Mittag eingetroffen. Eine Oma. Herzstillstand. 85Jahre.«
»Eine Oma …«, stöhnte Giuseppe und setzte sich wieder in Bewegung. »Das ist doch langweilig. Das ist gar nichts.«
Mein Papa war Bestatter. »Heribert Morgenroth. Wir helfen Ihnen immer.« So lautete sein Slogan. Ich fand, dass das fast klang, als könne er die Toten auferwecken. Und manchmal sah es auch so aus. Wenn er mit ihnen fertig war, lächelten sie. Alle lächelten. Ich hab sie mir oft angesehen. Papa meinte, der Tod müsse etwas sehr Schönes sein, denn nach einigen Stunden würde jeder seiner Kunden glücklich aussehen. Ja, er nannte die Toten Kunden.
Serdan und Billy hatte ich schon einige Male heimlich in den Keller geschleust. Ein Toter fünf Euro. Sie waren richtig scharf darauf, einen Toten zu sehen. Und ich bekam dafür ein schönes Extrataschengeld.
Nur bei Giuseppe hatte es noch nicht geklappt. Das wurmte mich. Denn Giuseppe war für mich etwas anderes als Billy und Serdan. Giuseppe war der beste Traceur von ganz Ludwigshafen – na ja, zumindest vom Hemshof, dem Stadtteil, in dem wir aufgewachsen waren und immer noch lebten. Einmal ist er sogar von einem Dach zum anderen gesprungen. Und er konnte aus dem Stand einen Salto drehen. Außerdem hatte er mir alles beigebracht, was ich konnte. Er war mein Lehrer. Und ich wollte, dass er endlich mal zu mir nach Hause kam. Wir kannten uns seit dem Kindergarten und trotzdem hatte er mich noch nie besucht. Außer an meinen Geburtstagen. Aber das zählte nicht.
»Auch eine tote Oma ist eine Leiche«, versuchte ich ihn zu überreden.
»Jaaa«, antwortete Giuseppe gedehnt. »Aber ich will mal was richtig Krasses.«
»Ich hab dir Bescheid gesagt, als wir vor zwei Wochen den Autounfall unten liegen hatten. Aber da …«
»Ich musste Pizzakartons falten«, unterbrach Giuseppe mich. »Weißt du doch.«
Tja, seltsam. Als ich Billy und Serdan zu den Omis und Opis in den Keller geschleust hatte, musste Seppo auch Pizzakartons falten. Ganz plötzlich.
Den Autounfall hätte ich mir nur mit Giuseppe angeschaut. Aber niemals allein oder mit den anderen. Billy hätte nur rumgelacht und blöde Witze gerissen und Serdan hätte gar nichts gesagt. Serdan sagte nie etwas und das störte mich nicht, aber von Angesicht zu Angesicht mit einem zerfetzten Toten hätte mich sein Schweigen nervös gemacht. Vor dem Autounfalltoten hatte sogar ich mich gefürchtet. Aber meistens bekam Papa steinalte Omis und Opis angeliefert, die friedlich im Bett eingeschlafen waren. Ich wusste nicht, wie er das anstellte. Vielleicht verheimlichte er die anderen Toten vor mir. Jedenfalls ließ Giuseppe sich nicht locken mit der frischen Omi und wir waren schon in unsere Straße eingebogen.
»Morgen mache ich es«, sagte ich spontan. »Morgen.«
»Was?« Seppo kratzte sich fragend in seinen dunklen Haaren. Ich musste zu ihm hochschauen, um in seine Augen zu sehen. Hoffentlich würde ich bald ein bisschen wachsen.
»Meinen Herbstrun.«
»Das tust du nicht.« Seppo schüttelte ungläubig den Kopf. »Nee, Katz, das machst du nicht.«
»Mach ich wohl. Es ist Herbst, oder?«, entgegnete ich und zeigte auf die Bäume am Straßenrand. Sie hatten fast alle Blätter verloren. Mehr Herbst ging nicht. Mehr Herbst war Winter. Und ich machte in jeder Jahreszeit einen neuen Luzie-Run. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Mein Frühjahrsrun hatte in der Notaufnahme geendet. Eigentlich lief er ganz ordentlich, bis zu dem Moment, als ich in einer engen Gasse vom einen Fensterbrett auf das vom Haus gegenüber springen wollte. Der Sprung war okay. Die Landung aber wurde eine Katastrophe. Ergebnis dieser Katastrophe: zwei Platzwunden, die genäht werden mussten, Prellungen, gebrochener Ringfinger. Mama und Papa hatte ich erzählt, ich sei über einen Hydranten gestolpert.
Der Sommerrun war genial. Ich hatte drei Bäume eingebaut. Meine zweite Spezialität. Auch deshalb nannten sie mich Katz. Ich bewegte mich durchs Dickicht wie ein Panther. Das Problem war nur, dass der Ast der Pappel brüchig war und mir Schwung nahm, als er abknickte. Ich prallte mit beiden Schienbeinen auf die Lehne der Parkbank, anstatt mit den Sohlen aufzusetzen. Da hab ich fast geheult. Immerhin waren meine Schienbeine nicht gebrochen. Und nur weil ich mich in letzter Sekunde gedreht hatte – warum, wusste ich nicht –, bin ich nicht mit dem Kreuz auf die Lehne geknallt. Das hätte böse ausgehen können. Richtig böse. Ist es aber nicht.
Eigentlich hatte ich jedes Mal Glück gehabt – oder eben Glück im Unglück. Und deshalb, beschloss ich, würde ich morgen meinen ultimativen Herbstrun machen.
»Hey, Katz, du bist echt nicht schlecht, aber …« Giuseppe sah mich zweifelnd an. »Lass das lieber.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin so weit. Sicher. Morgen nach der zweiten Pause. Vom Fenster auf das Pausenhofdach, dann auf die Laterne, Baugerüst, runter, Papierkörbe, Turnhallengeländer.«
»Oh Gott, Luzie – die Lampe, nee, mach das nicht!«
Ich hatte mir die Lampe genau angesehen. Da war Platz für meine Füße. Nicht viel, aber genügend. Ich hatte kleine Füße. Und wenn es nicht regnete, würde sie nicht rutschig sein. Vielleicht würde sie ein bisschen schwanken, aber wie gesagt: Balancieren, das konnte ich.
»Morgen nach der zweiten Pause«, wiederholte ich stur. Wir waren bei der Pizzeria von Giuseppes Eltern angekommen. Schräg gegenüber wohnten wir, in einem schmalen, dunklen Haus mit hohen Decken. Altbau. Im Keller lagen Papas Kunden, im Erdgeschoss hatte er seine Ausstellungs- und Geschäftsräume eingerichtet und obendrüber befand sich unsere Wohnung. Der Dachboden erstickte in altem Gerümpel und musste seit Jahren dringend aufgeräumt werden. Aber dafür hatten Mama und Papa nie Zeit. Von meinem Zimmer aus konnte ich auf Seppos Haus gucken. Es war niedriger als unseres und sah freundlicher aus, aber drum herum roch es fast immer nach Knoblauch. Und leider, leider ging Giuseppes Zimmer zum Hof hinaus, sonst hätte ich ihn ein wenig bespitzeln können. Ich konnte aber nur ins Restaurant gucken. Giuseppes Mutter war fest davon überzeugt, dass die Pizzeria Lombardi mehr Gäste gehabt hätte, wenn diese beim Essen nicht auf einen Leichenwagen hätten starren müssen. Zu viel Tod verderbe den Appetit, meinte sie.
»Du bist verrückt«, sagte Giuseppe, als wir sein Zuhause erreicht hatten. »Echt verrückt.«
»Kann sein«, erwiderte ich achselzuckend. »Ich mache es trotzdem. Schaust du zu?«
»Klar.« Er grinste schief. »Irgendwer muss dich ja auffangen, wenn du abstürzt.«
»Ich stürze nicht ab.«
»Werden wir sehen.« Seppo boxte mich kurz in die Seite und verschwand in der Pizzeria.
»Ja, genau, das werden wir«, flüsterte ich.
Er wollte mich auffangen. Natürlich würde ich nicht abstürzen, ganz bestimmt nicht. Aber wenn, würde er mich auffangen.
Der Abend davor
»Hatschi!«, nieste ich laut. Die Suppe vor mir kräuselte sich.
»Prost Mahlzeit«, knurrte Mama und reichte mir ein zartrosa Taschentuch. »Erkältet?«
»Kann nicht sein«, antwortete ich matt. Und es durfte vor allem nicht sein. Wieso bekam ich ausgerechnet jetzt eine Erkältung? Ich hatte mich dick angezogen, wie immer für das Training im Herbst und Winter. Ich hatte mich vorher genügend aufgewärmt und gleichzeitig darauf geachtet, nicht zu viel zu schwitzen. Denn das war schlecht für die Beweglichkeit. Aber seitdem ich beschlossen hatte, dass ich den Herbstrun machen würde, musste ich niesen und mein Hals kratzte. Egal. Rennen und springen konnte ich auch mit verstopfter Nase. Und Fieber bekam ich sowieso fast nie.
»Was habt ihr denn getrieben da draußen?«, fragte Mama weiter. Wie jeden Abend. Und jeden Abend erfand ich etwas. Mama und Papa wussten nicht, dass ich Parkour machte. Sie fanden es bedenklich genug, dass ich mich nie mit Mädchen traf und stattdessen mit »diesen Jungs« zusammen war. Aber weil wir jeden Freitagabend bei Lombardis Pizza bestellten (für mich mit extrascharfer Peperonisalami, für Papa mit Pilzen, für Mama mit Meeresfrüchten), jedes Jahr im Restaurant Silvester feierten und Giuseppe ein anständiger Junge war (dachten sie), hatten sie nichts dagegen, solange er dabei war. Er war schließlich der Nachbarssohn.
Auch Seppos Eltern wussten nicht, dass er ein Traceur war. Wir machten das alle vier heimlich und trafen uns deshalb etwas abseits des Hemshofs im Friedenspark. Das würde so lange gut gehen, bis uns doch mal jemand sah. So wie ich eines Nachmittags Giuseppe gesehen hatte, als er über die Halfpipe gesprungen und ohne Stopp die Wand des Toilettenhäuschens hochgeklettert war. Nein, klettern konnte man das nicht nennen. Es war eher ein Schlängeln. Dann Salto rückwärts, Stand. Ohne zu wanken.
In diesem Moment wusste ich, dass ich das auch tun wollte, und nervte Giuseppe so lange, bis er einwilligte, mich zu trainieren. Vielleicht willigte er nur ein, weil ich gedroht hatte, seiner Mutter zu erzählen, was er da so trieb. Das war mir aber egal. Hauptsache, ich würde in seine Parkour-Gruppe aufgenommen werden. Jetzt trainierten wir seit anderthalb Jahren zusammen, Serdan, Billy, Seppo und ich, und daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. Wir mussten eben vorsichtig sein.
Mein Run morgen in der Schule würde klappen. Zwei waren nicht glücklich ausgegangen – der dritte musste gut laufen. Die Pausenhofüberdachung reizte mich schon lange. Jeden Morgen saß ich auf meinem Platz neben dem Fenster, schaute raus auf dieses Dach und stellte mir vor, wie es sich anfühlen würde, aufs Fensterbrett zu steigen, die Scheiben aufzustoßen, in die Knie zu gehen und …
»Luzie, ich habe dich etwas gefragt.«
Ach, Mama war ja auch noch da. Und die Suppe. Ich schlürfte die letzten drei Löffel, putzte mir meine laufende Nase und nuschelte: »Rumgehangen. Hatschi!«
Rumgehangen war nicht ganz verkehrt. Wir hängten uns vor jedem Training an die Reckstangen auf dem Kinderspielplatz im Park und machten Klimmzüge, um unsere Armmuskeln zu stärken.
»Du gehörst in die Koje, junge Dame«, sagte Mama streng. Sie scheuchte mich von meinem Platz und schob mich über den schmalen Flur rüber in mein Zimmer.
»Mama!«, rief ich protestierend, als ich mein Bett erblickte. »Nicht schon wieder!«
Über der rosafarben bezogenen Matratze prangten eine rosa-weiß gestreifte Decke und ein rosa-weiß gestreiftes Kissen. Ich fand es schauderhaft.
»Es ist hübsch«, sagte Mama spitz. »Rosa ist hübsch.«
Ja, das war wieder einer dieser Momente, in denen ich mich fragte, warum ich so beknackte Eltern haben musste. Mein Papa war schon über fünfzig, hatte kaum mehr Haare auf dem Kopf und ging mit Krawatte um den Hals ins Bett, damit er jederzeit seinen Slogan wahr machen konnte: »Wir helfen Ihnen immer.« Wenn Heribert Morgenroth »immer« sagte, meinte er »immer«. Deshalb: Krawatte und gebügeltes Hemd, damit er innerhalb von drei Minuten aussah, wie ein Bestatter seiner Meinung nach aussehen musste. Denn oft würden seine Kunden in der Nacht geholt, betonte er. Geholt. Er sagte nicht »sterben«. Nein, er sagte »geholt«. Er war sich sicher, dass sie geholt wurden. Er meinte, nach einigen Stunden würden sie plötzlich so glücklich aussehen und etwas würde sich verändern in seinem Kellerraum. Dann sei derjenige, der sie geholt habe, zusammen mit ihrer Seele verschwunden. Puh, Papa war wirklich beknackt.
Aber Mama schien mir noch viel beknackter zu sein. Sie war zehn Jahre jünger als Papa und hatte früher als Diskuswerferin Medaillen gesammelt wie andere Pokemon-Karten. Sogar bei den Olympischen Spielen. Aber mit dem Diskuswerfen wurde man weder berühmt noch reich und deshalb kannte sie heute niemand mehr. Sie hatte breitere Schultern als Papa (was kein Kunststück war, aber lustig aussah, wenn die beiden Silvester miteinander tanzten) und gab jeden Tag irgendwelchen ehrgeizigen Mädchen Turnunterricht. Ich hatte auch mal zu diesen Mädchen gehört, aber Mama war eine schreckliche Trainerin und ich nicht ehrgeizig genug. Sie brach manchmal in Tränen aus, wenn man es nicht so machte, wie sie sich das vorstellte. Das war mir echt peinlich gewesen. Es war peinlich, wenn da eine Frau in der Halle stand, die Schultern wie ein Mann hatte und früher Metallscheiben durch die Gegend geschleudert hatte, und bitterlich weinte.
Mama war außerdem rosasüchtig. Sie zog sich fast nur rosa an und ersetzte ihr Rosa höchstens zwischendurch mal mit Pink. Oder einem blassen Lila. Aber meistens war sie rosa. Sie sagte, das sei ein schöner Kontrast zu der schwarz-grauen Welt von Papa. Es würde Licht in die Finsternis bringen.
Mich hätte sie auch gerne rosa gehabt. Wenn sich die Gelegenheit bot, versuchte sie, in meinem Zimmer etwas rosa zu machen. Ich hasste das. Mama durfte rosa sein, von mir aus. Sie hieß schließlich Rosa. Und Rosa stand ihr gut, das musste ich zugeben. Wenn Mama etwas Dunkles trug, konnte man Angst vor ihr bekommen. Rosa war schon in Ordnung. Aber deshalb musste ich doch nicht auch Rosa tragen! Rosa zu dunkelroten Haaren – das sah grausam aus. Wie ein missratenes Waldbeerendessert. Zu meinen Haaren passte nur Grau und Schwarz und Blau. Und auf keinen Fall wollte ich ein rosafarbenes Zimmer haben.
Mama behauptete gern, sie habe Papa nur wegen seines Namens geheiratet. Rosa Morgenroth. Das sei ein Name wie aus einem Roman. Und vor allem klinge er nicht nach Diskuswerfen.
Sie hatte wahrhaftig einen gehörigen Knall.
Aber ich war zu müde und zu verschnupft, um mit Mama zu streiten. Dann würde ich heute Nacht eben in Rosa schlafen. Wenn es dunkel war, sah ich es ja zum Glück nicht.
Ich packte meine Schultasche, ging ins Bad, duschte, putzte mir die Zähne und wartete, bis Mama nach unten zu Papa in den Keller gegangen war. Sie versuchte bestimmt wieder, Papa zu überreden, dass sie die Omi schminken durfte. Mama schminkte furchtbar gerne andere Menschen und vor allem tote Menschen, obwohl sie keine Ahnung davon hatte. Deshalb bekamen meine Eltern oft Streit. Papa verstand unter dem Herrichten von Leichen etwas völlig anderes als Mama.
Jetzt war es endlich still. Ich schlüpfte aus meinen Hausschuhen und lupfte meinen Pyjama ein Stückchen, damit ich mich nicht in den zu langen Hosenbeinen verheddern konnte. Wie sagte Giuseppe immer? »Vorbereitung ist alles.« Ich streckte mich, nieste noch einmal und jagte los. Es war ein kurzer Run. Der kürzeste überhaupt. Der Zu-Bett-geh-Run. Ich machte ihn jeden Abend.
Mit den Zehenspitzen den Lichtschalter austreten, in zwei Sätzen aufs Fensterbrett springen, Vorhang zuziehen, Rolle vorwärts auf die Matratze. Der Lattenrost krachte und ich sackte ein Stück tiefer. Mist. Ich brauchte dringend ein neues Bett. Doch ich konnte mich nicht dazu aufraffen, aufzustehen, die Matratze hochzuhieven und die herausgesprungene Latte zurück in ihre Verankerung zu schieben. Mir taten auf einmal sämtliche Knochen weh. Schlucken konnte ich auch kaum mehr. Mein Hals fühlte sich dick und geschwollen an.
Aber ich durfte morgen nicht kneifen. Es würde aussehen, als hätte ich Schiss bekommen. Und ich hatte keinen Schiss. Nein, ich freute mich drauf.
Ich würde meinen Herbstrun durchziehen und Giuseppe aus der 10b würde zuschauen. Mir, der dreizehnjährigen Luzie aus der 8c.
Das war alles, was zählte.
Der Tag
Verdammt, wo steckte der Kerl nur? Ich beugte mich weit aus dem Fenster und ließ meine Blicke über den Schulhof schweifen. Noch heute Morgen in der S-Bahn hatte Giuseppe gesagt, dass er meinen Herbstrun filmen wolle. Mit dem Handy. Und wenn er gelang und ich nicht stürzte wie beim Frühlings- und Sommerrun, würden wir ihn ins Internet stellen. Aber jetzt konnte ich Seppo nirgendwo entdecken und die Pause war fast vorbei.
Eine kalte Windböe streifte meine Nase. Ich musste niesen und bekam gleichzeitig einen Hustenanfall. Mir traten die Tränen in die Augen. Keuchend schluckte ich. Autsch, mein Hals. Die Erkältung hatte sich über Nacht verschlimmert, nicht verbessert – und es war kein Wunder. Als ich morgens aufwachte, lag ich ohne Decke auf dem Bett. Sie war auf den Boden gerutscht. Ich wusste nicht, wie lange ich ohne Decke geschlafen hatte, aber es war kalt im Zimmer gewesen und meine Nase so verstopft, dass ich fast keine Luft mehr bekommen hatte. Ich verstand das nicht. Das war mir noch nie passiert. Normalerweise rollte ich mich in die Bettdecke ein wie ein Einsiedlerkrebs in seine Muschel. Nur die Nasenspitze schaute heraus.
Da! Jetzt sah ich ihn. Seppo lehnte oben im Kunstsaal am Fenster und gab mir ein Zeichen. Er hatte das Handy schon in der Hand. Es klingelte zum zweiten Mal. Gleich würde unsere Lehrerin ins Klassenzimmer kommen. Ich drückte beide Fensterflügel weit auf.
»Oh Luzie, mach bloß das Fenster zu, es ist schon kalt genug«, jammerte Sofie. »Außerdem bist du krank. Es reicht, dass du uns alle anniest.«
Ich achtete nicht auf sie. Sofie hatte immer etwas zu jammern, ob ich krank war oder nicht, ob es kalt war oder warm. Das durfte man nicht persönlich nehmen.
»Die hat wieder was vor«, unkte Lena und begann mit Sofie zu tuscheln. Was hieß hier »wieder«? Okay, im Sportunterricht machte ich gerne etwas anderes als das, was gefragt war. Und manchmal ging ich über die Schulbänke nach draußen und nicht über den Boden. Teilweise auch im Handstand. Aber das, was jetzt kommen würde, hatte es noch nicht gegeben in der 8c.
Ein letztes Mal prägte ich mir die Strecke ein. Dach, Lampe, Gerüst, Mülleimer, Turnhalle. Zwei Meter konnte ich aus dem Stand springen. Mindestens. Vor allem, wenn ich ein bisschen bergab springen konnte. Und das Dach war sicher einen halben Meter tiefer als das Fensterbrett. Giuseppe fing an zu grinsen und winkte albern herüber. Der dachte, ich hätte Schiss. Ich wurde sauer. Er war doch immer derjenige, der sagte, man solle vorher die Umgebung abchecken und seine Grenzen kennen und respektieren. Und jetzt grinste er blöd, weil ich genau das tat. Mein Husten verebbte. Ich konnte Luft holen, ohne dass es im Hals kratzte. Sofort schwang ich mich auf das Fenstersims und gab Seppo ein Zeichen.
»He, Luzie, was machst du denn?!«, rief Sofie hinter mir. Sie klang ängstlich. Auch das war nichts Neues. Aber nun rief nicht nur sie nach mir. Alle redeten durcheinander.
Ich ging in die Knie und stieß mich ab. Dann flog ich. Mit einem Ruck im Magen landete ich beidfüßig auf dem Dach. Ohne auch nur ansatzweise aus dem Takt zu geraten, spurtete ich weiter. Darauf kam es an. Es musste geschmeidig aussehen. Sie nannten mich Katz. Ich musste mich wie eine Katze bewegen. Und das konnte ich.
Mit drei großen Schritten hatte ich das Dach überquert und sprang der Lampe entgegen. Ich ging wieder in die Knie, als ich landete, die Arme ausgebreitet – aber ich hatte recht gehabt, sie bot genug Platz, mehr als genug, und ja, sie schwankte, aber das machte nichts. Ich stand. Die Rufe hinter mir vermischten sich mit Applaus und Pfiffen. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Trauben von Schülern an den Fenstern hingen. Doch im Parkour durfte man sich keine Verzögerungen leisten. Und ich hatte noch Kraft, obwohl sich ein neuer Hustenanfall anbahnte.
Wie ein Raubtier auf der Jagd hechtete ich zum Baugerüst, griff mit den Händen nach den Eisenstangen, zog mich hoch, rannte über die polternden Planken hinüber ans andere Ende. Hier musste ich mich nach unten hangeln, wie beim Turnen am Reck, noch einmal abstoßen und – nein. Nein. Nein! Scheiße!
Ich versuchte, meine Füße im Schwung zur Seite zu reißen, aber es war zu spät. Scheppernd trafen sie auf den vollen Farbeimer, der mitten auf dem Gerüstboden stand, ein blöder, dummer, überflüssiger Farbeimer. Eine blaue Fontäne schoss mir entgegen, während ich das Gleichgewicht verlor und stürzte. Alles wurde blau, blaue Sprenkel auf meinen Armen, meinem Gesicht, meinen Händen, dann ergoss sich der Rest über meinen Nacken. Ich kippte nach hinten und wusste, dass ich mir gleich fürchterlich wehtun würde, denn ich würde genau dort aufprallen, wo ich eigentlich mit den Füßen landen wollte: auf dem eisernen Mülleimer. Doch für einen kurzen Moment wurde es totenstill. Ich hing reglos in der Luft, nichts bewegte sich mehr, die blauen Farbtropfen erstarrten und bildeten ein seltsames Muster, ja, fast eine Gestalt – war es eine Gestalt? Blickten da zwei Augen auf mich herunter? Bedeutete das, dass ich jetzt sterben würde? Holte mich jemand?
Dann war es vorbei und ich fiel. Auch das kannte ich schon. Zuerst waren da nur der Schreck und das flaue Gefühl im Magen. Wie eine Welle, die durch den Körper schießt. Und dann kam der Schmerz. Er kam immer erst später. Genau dann, wenn ich dachte, och, ist ja gar nicht so schlimm. Und das war umso gemeiner.
Also hing ich schief und krumm auf dem Mülleimer und wartete auf den Schmerz. Und dabei fiel mir ein, dass Giuseppe ja noch oben am Fenster des Kunstsaals stand und filmte. Er hatte alles gesehen. Und aufgenommen. Nein, niemals würde ich jetzt mit ihm reden, ihn anschauen können. Was für eine Blamage. Mein Herbstrun war nicht nur gescheitert, nein, ich war auch verletzt und über und über mit blauer Farbe besudelt. Schon hörte ich, wie sich Schritte näherten und Stimmen laut wurden. Und dann kam der Schmerz, stechend und brutal. Meine Schulter … Oh Gott, tat das weh … Ich ließ mich auf den Asphalt rutschen. Alles drehte sich. Was war mit meinem Kopf los? War das jetzt Blut oder Farbe, was über meine Schläfe lief? Ich versuchte, es mit dem Finger abzustreifen, aber ich konnte meinen Arm nicht heben.
»Luzie! Luzie …«
Das war Giuseppe. Mir würde nichts anderes übrig bleiben, als mich ohnmächtig zu stellen. Ja, das war das Beste. Nicht mehr da sein. Ich schloss die Augen.
»Ich habe es so satt! Satt!!! Ich will nicht mehr! Aus, Schluss, vorbei!«
Ich wurde noch ein bisschen starrer. Was war denn das jetzt? Giuseppes Stimme klang jedenfalls anders. Komplett anders. Jede menschliche Stimme klang anders. Es hatte sich irgendwie transparent angehört. Als würde Glas sprechen. Flüssiges Glas. Wer zum Teufel sprach wie flüssiges Glas? Und warum war er oder es so wütend?
Plötzlich fühlten sich meine Ohren an, als würde jemand dicke Wattekugeln hineinstopfen. Das Johlen und Rufen der anderen verstummte. Auch die Vögel waren still. Stattdessen breitete sich ein dumpfes Grollen unter mir aus, das über meinen Körper kroch und sich auf meine Haut legte. Ein wütendes Grollen, wie Paukenschläge. Erst nach Sekunden ebbte es wieder ab.
»Ach, Vater, komm schon, es ist doch egal, sie ist ohnmächtig, sie kann mich nicht hören, schnurzegal, und verdammt, ich möchte endlich mal die Menschensprache benutzen, immer nur muss ich zuhören, den ganzen Mist, Tag und Nacht blablabla, blubb, nie darf ich was machen oder sagen, immer nur aufpassen, ich mag nicht mehr, finito, ich bin fertig mit dieser – Göre!« Ich spürte eine Berührung an meiner Seite, da, wo nichts wehtat, knapp oberhalb meines Gürtels. Als ob eine Welle mich kitzelte. Mehr nicht. Ein Schauer rieselte über meinen Rücken.