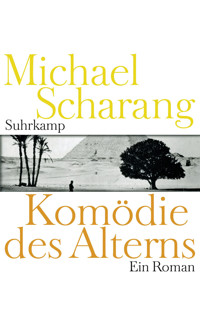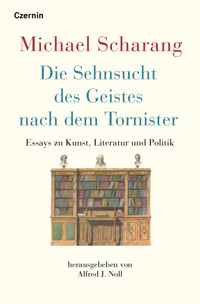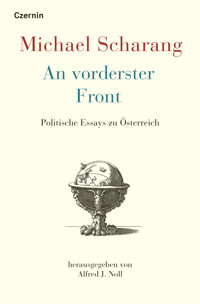
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michael Scharang ist unter den heutigen Schriftstellern wohl derjenige, der am konsequentesten die österreichischen Zustände kommentiert und kritisiert. Er weiß seit jeher: »Der Gang der Geschichte wird im Großteil der Welt noch nicht von Vernunft und Aufklärung geleitet, sondern von purer Herrschsucht.« Gilt das auch für Österreich? Scharang legt in seinen polemischen Beiträgen offen, woran es krankt: »Man ist geneigt, ein Loblied auf den Stillstand zu singen, wenn man in Österreich erlebt, wie Geschichte zurückgedreht wird«, schreibt Scharang. Die hier versammelten politischen Essays geben Auskunft darüber, warum das so ist, und sie machen nachvollziehbar, in welcher Weise diesem Zustand beizukommen ist. »Da der Gegner übermächtig zu sein scheint, muss der literarische Kampf von höchster geistiger und sprachlicher Schärfe sein. Eine Polemik, ein Essay, selbst ein Leserbrief, die den Rang eines Kunstwerks nicht zumindest anstreben, taugen auch politisch nichts.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Scharang
AN VORDERSTER FRONT
oder
Die Wahrheit des Essays ist seine Schönheit
Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Alfred J. Noll
Michael Scharang
AN VORDERSTERFRONT
oder
Die Wahrheit des Essays ist seine Schönheit
Hrsg. und mit einem Nachwort
versehen von Alfred J. Noll
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Scharang, Michael: An vorderster Front oder Die Wahrheit des Essays ist seine Schönheit. Herausgegeben von Alfred J. Noll
Wien: Czernin Verlag 2025
ISBN: 978-3-7076-0880-9
© 2025 Czernin Verlags GmbH, Kupkagasse 4, 1080 Wien, Österreich
Autorenfoto: Otto Breicha / brandstaetter images / picturedesk.com
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Coverabbildung: Richard Gaywood, The Trustees of the British Museum
Druck: Finidr, Český Těšín
ISBN Print: 978-3-7076-0880-9
ISBN E-Book: 978-3-7076-0881-6
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne des Urheberrechtsgesetzes behalten wir uns ausdrücklich vor.
INHALT
DIESEN STAAT KANN KEIN SKANDAL ERSCHÜTTERN, DENN ER IST SELBST EIN SKANDAL
DIE DEMOLIERUNG ÖSTERREICHS
WER NICHT ARBEITET, SOLL AUCH NICHT ESSEN
BRECHT-BOYKOTT IN ÖSTERREICH
ICH WEINE NICHT, ICH FLUCHE!
LITERATUR UND POLITIK
WIEN, WIEN, NUR DU ALLEIN ...
ÖSTERREICH (GE)DENKT, DEUTSCHLAND LENKT
DAS WUNDER ÖSTERREICH
DER ENDSIEG DES WESTENS ÜBER DEN OSTEN TRÄGT SEIN ENDE BEREITS IN SICH
BARBAREI, 3. AUFLAGE
DIE UMNACHTUNG EINES LANDES
HEUTZUTAG EIN LINKER SEIN
UNGLÄUBIG SCHÜTTELT DER UNGLÄUBIGE DEN KOPF
KULT UMS KAPITAL
DER ERSTE TAG
KUNST, KAMPF, KANZLER
DAS RASANTE TEMPO DES LANGSAMEN NIEDERGANGS
JAHRMARKT DER FINANZEN
DER TERROR UND DIE TERRORBEKÄMPFUNG – WAS FÜR EIN HÜBSCHES PAAR
FEBRUAR ’34 – EIN GLÜCKSFALL
ERSTUNKEN UND ERLOGEN
VERGESST DIESES EUROPA
SIE LIESSEN DIE ARME HÄNGEN
BAHN FREI FÜR DIE DRITTE REPUBLIK
ZUR LAGE DER NATION
IST DIE LINKE SCHULD AM AUFSTIEG DER RECHTEN? JA!
DER WEG ZURÜCK
SPOTTGESANG
NACHBEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS
NAMENSVERZEICHNIS
DRUCKNACHWEISE
DIESEN STAAT KANN KEIN SKANDAL ERSCHÜTTERN, DENN ER IST SELBST EIN SKANDAL
Die zeitgenössische österreichische Literatur hat ihre Lehrzeit mit Ach und Krach hinter sich gebracht. Es war keine schöne Zeit. Die Literatur musste lernen, wie man sich in einem literaturfeindlichen Land Aufmerksamkeit verschafft, sie musste aber auch lernen, dafür scharfe Rügen einzustecken: Die Art, wie sie Skandalöses ans Licht bringe, sei selbst skandalös, maßlos übertrieben, ungerecht, hasserfüllt.
Vornehmlich Journalisten und Politiker erheben diesen Vorwurf. Mit Recht. Für sie ist ein Skandal wertvolles Rohmaterial, für das feste Regeln der Weiterverarbeitung existieren: Er muss bis ins Kleinste ausgeschlachtet und optimal verwertet werden. Jedes andere Verhalten würde in der Kommerzwelt den Verdacht erregen, der Journalist oder Politiker verstehe sein Geschäft nicht.
Im Gegensatz dazu interessiert den Schriftsteller der Skandal, wenn überhaupt, nicht als Einzelereignis, sondern als exemplarischer Fall. Ihm geht es nicht nur um die kleine Wahrheit der Fakten, sondern auch um das große Risiko der Erkenntnis.
Ich bin weit davon entfernt, die Vorteile der künstlerischen und philosophischen Weltsicht preisen zu wollen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die Weltsicht der Journalisten Gefahr läuft, die Wirklichkeit zu verkennen, wenn sie nicht merkt, dass die Welt in Veränderung begriffen ist.
In Österreich hat die Umwertung aller Werte damit begonnen, dass die Journalisten nicht mehr Skandalen nachjagen, sondern, umgekehrt, eine Unzahl von Skandalen sich ergebenst um die begrenzte Zahl von Journalisten bemüht. Jeder Skandal will rasch noch in die Zeitung, ehe er vom nächsten verdrängt wird.
Die Wirklichkeit praktiziert zurzeit, was man bislang der Literatur vorwarf: Sie übertreibt maßlos. Der Blick, aufs Althergebrachte eingestellt, bekommt nur noch kleine Ausschnitte des monströsen Ganzen zu sehen. Deshalb der Irrglaube, Skandale seien bloß ein Auswuchs, dem mit Moral und gutem Willen beizukommen ist. Dieser Staat, diese Gesellschaft selbst sind der Auswuchs. Auch wenn die empfohlene Meinung anders lautet: Die einzelnen Affären erschüttern den Staat keineswegs, im Gegenteil, sie sind es, die ihn gerade noch zusammenhalten. Die Skandale schützen den Staat, indem sie von dessen skandalösem Charakter ablenken. Sie bilden, nachdem die überkommenen Österreich-Klischees verjuxt sind, den letzten schönen Schein, der auf diesem Land liegt, auf dieser extrem widersprüchlichen, aber durch massive Lügen und Einschüchterungen extrem harmonisierten Gesellschaft.
Wo einerseits Gegensätze nicht aufbrechen, andererseits Wunden nicht heilen dürfen, wo über alles ein Pflaster des Konsenses geklebt und der permanent austretende Eiter von Zeitungspapier aufgesogen wird, dort landet eine Gesellschaft, paralysiert von den sogenannten Zukunftsvisionen ihrer Politiker, unweigerlich in der Vergangenheit. Die Zweite Republik, auf der Suche nach sich selbst, scheint sich in der Ersten wiederzufinden.
Dass die Abendland-Verteidiger angesichts der österreichischen Zustände den Untergang kommen sehen, ist klar. Tatsächlich aber handelt es sich nicht einmal um einen Niedergang. Die Zweite Republik war nie besser (und nie schlechter), als sie heute ist, sie war nur jünger. Deshalb hat man ihr viel nachgesehen und auf später gesetzt. Diese Hoffnungen waren falsch, vor allem waren sie unbegründet. Was wiederum kein Grund für den enttäuschten Staatsbürger sein sollte, den Staat krankzujammern. Denn von darniederliegenden Gemeinwesen redet nur die Gilde der Heuchler, die Symptome beklagt, vor den Ursachen aber erschrocken die Augen verschließt.
Die Republik ist bloß in die Jahre gekommen, und somit treten ihre Charaktermerkmale, Verlogenheit und ein Hang zum Betrug, deutlicher hervor. Es ist nur logisch, dass auch bei denen, die das System tragen, diese Charaktermerkmale nun klarer zum Vorschein kommen. Das bestreiten die betreffenden Herrschaften neuerdings auch nicht mehr. Man kann sie aller erdenklichen Vergehen bezichtigen, ohne dass sie mit der Wimper zucken. Ehrenbeleidigungsprozesse, einmal ein Gesellschaftsspiel der Oberschicht, werden zur unlukrativen Sache der Obdachlosen. Das herrschende Gesindel, versierter in der Machtausübung als die brutalen Vorfahren, zieht bewusst Kritik und Beschimpfungen auf sich. Es nimmt klugerweise lieber in Kauf, von der Bevölkerung verachtet zu werden, als das System preiszugeben; dieses Selbstbedienungssystem, in dem es genügt, rückgratlos dazuzugehören, um sich die Taschen füllen zu können. Der Rest wird ans Ausland verscherbelt. Der hochmögende Gauner lebt geradezu davon, sich zur Personalisierung der allgemeinen Gaunerei zu eignen. Mit jedem Schimpfwort, das er der Bevölkerung entlockt, hat er die Öffentlichkeit ein weiteres Stück entpolitisiert.
Dem Ungeist, den die Entpolitisierung produziert, entstammt das Dogma, doch um Himmels willen nicht immer in der Vergangenheit zu wühlen, lieber leuchtenden Auges in die Zukunft zu schreiten. Ein lebenswichtiges Dogma für einen Staat, der sich streng absetzt von dem vorangegangenen verbrecherischen Regime, zahlreiche Verbrecher jenes Regimes aber nicht nur integriert, sondern gleich auch zu Stützen der Gesellschaft gemacht hat. Die österreichische Demokratie, nicht im Kampf gegen den Faschismus entstanden, ist deshalb zu einem guten Teil eine Demokratie der Nazis und Ständestaat-Faschisten, heute noch. Das Standardargument, die alten Nazis würden einmal aussterben, war immer ein Argument der Opportunisten und Sympathisanten. Die Blut-und-Boden-Typen haben, wie es ihrer Natur entspricht, fleißig gesät, so dass das reaktionäre Potenzial in Österreich heute größer ist als irgendwann nach 1945. Staat und Gesellschaft, nur an der Oberfläche demokratisch, atmen erleichtert auf und sammeln sich hinter Waldheim.
Das offizielle Österreich rühmt, wenn es Rückschau hält, den alten Wiederaufbau und das neue Österreich-Bewusstsein. Ab beidem ist etwas Wahres und viel Falsches dran. Das neue Österreich-Bewusstsein, gewiss erfreulicher als das großdeutsche, gründet dennoch auf einer Lüge, noch dazu auf der schamlosesten, der man sich je in diesem Land bediente: dass Österreich mit den Nazigräueln und den Kriegsverbrechen nichts zu tun hatte. Mit dieser Lüge handelte sich die Zweite Republik eine gewisse nationalsozialistische Kontinuität ein. Die heimischen Unschuldslämmer konnten ohne Gewissensbisse und Substanzverlust den Rassen- und Fremdenhass herüberretten in die neue Zeit. Deshalb der ekelhafte chauvinistische Zug im alt-neuen Bewusstsein.
Der heroische Wiederaufbau. Wer damals arbeitend dabei war, hat nur den einen Rat weiterzugeben gehabt: in diesem Land keinen Handgriff mehr zu tun als unbedingt notwendig – so groß sind Verrat und Enttäuschung gewesen. Mit revolutionären Versprechungen wurden die Arbeiter geködert, aufbauen aber mussten sie eine Neuauflage der alten Gesellschaft. Als sie sich geprellt sahen und aufbegehrten, wurden sie von gewerkschaftseigenen Schlägerbanden niedergeknüppelt – welcher Fortschritt gegenüber dem Februar 1934, als Militär eingesetzt werden musste. In jedem Fall ein glorreiches Ereignis: Der Geist der Sozialpartnerschaft war geboren. Mittlerweile sind Zweite Republik und Sozialpartnerschaft synonym.
Anfangs sollte die Sozialpartnerschaft nur die Arbeiter mit möglichst geringen Löhnen und die sozialdemokratischen Arbeiterführer mit möglichst großen Privilegien bei der Stange halten. Später wollte man mehr; entsprechend tiefer reichen heute die Wurzeln der Korruption. Die Sozialpartnerschaft entwickelte sich zur Geheimregierung der legendären Gremien, welche abseits von Verfassung und Volksvertretung wirken und das Parlament zur gymnastischen Anstalt degradieren. Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr, ihr diente als Vorbild die Ausschaltung des Parlaments im Jahr 1933 durch die Austrofaschisten.
Heute besinnt sich das österreichische Bürgertum, nach der kurzen patriotischen Nachkriegseskapade, wieder auf seine einzige Glanzzeit, auf den Ständestaat, als es politisch und wirtschaftlich eine Marionette des Auslands war, und setzt alles daran, diese Position wiederzuerlangen. Als Einstandsgeschenk möchte es dem Auslandskapital die verstaatlichte Industrie zu Füßen legen.
Bei ihrer Gründung unterschied sich die Zweite von der Ersten Republik vor allem dadurch, dass sie dank der Schwer- und Rüstungsindustrie, die sie vom Hitlerregime erbte, wirtschaftlich bedeutend besser ausgestattet war. Mangels Privatkapital wurde diese Industrie verstaatlicht. Einer der Gründe, warum die Großparteien eine Koalition bildeten: Das Staatseigentum sollte als Futtertrog für die Parteien, außerdem noch als billiger Zulieferbetrieb für die anfangs schwache Privatwirtschaft dienen. Diese Aufgabe haben die Staatsbetriebe erfüllt, nun wird demontiert. Die Zweite Republik auf dem Weg in die Erste.
Die Machthaber in diesem Land – das ist beileibe nicht nur die Regierung – spüren, dass dieser Weg in die Sackgasse führt, dass ihre Perspektiven in Wirklichkeit nur Untergangsfantasien sind. Typischerweise ist das gegenwärtige Kabinett, an dem Deutschnationale beteiligt sind, bereits ein Gruselkabinett. Mit diesen Leuten ein Wort über die Zukunft zu wechseln, schon gar über eine demokratische, ist kaum mehr möglich. Die Zeit, bis ihnen die Bevölkerung auf die Schliche kommt, nützen sie, um an sich zu raffen, was immer sie zwischen die Finger kriegen. Deshalb ist das einzige Gefühl, das in Österreich in der Luft liegt: Es wird bald nichts mehr da sein. Infolgedessen breitet sich die Raffgier aus wie die Pest, vom Minister bis zum Abt, vom Staatsanwalt bis zum Apotheker langen die Herrschaften blindwütig und zwanghaft zu. Sie haben wieder einmal die Gelegenheit zu demonstrieren, wozu die Elite taugt.
Gerade in finsterer Zeit darf ein bisschen Schabernack nicht fehlen. Deshalb müssen zur Belustigung des geplagten Volkes auch die »Alternativen« mit einer eigenen Kandidatin zur Wahl des Bundespräsidenten antreten. Sie ist unschlagbar als Verkörperung österreichischer Unabhängigkeit – sie muss nur noch schnell aus der SPÖ austreten. Dieses Opfer bringt sie unter anderem deshalb, »damit Unzufriedene ihre Proteststimme nicht einem Kandidaten geben müssen, dessen Erfolg im Ausland als Beweis für eine neue Braunfärbung Österreichs aufgefasst würde«. Ich verstehe zwar nicht, warum die Kandidatin dem Kandidaten einen »Erfolg im Ausland« nicht gönnen will, bin aber dankbar für den Einblick ins Alternative dieser Politik. Der betulich-vornehme Ton weist auf die lächerliche Funktion, welche die Kandidatin objektiv spielt: einem Groß-Kandidaten notfalls zur Stichwahl zu verhelfen und für eine neue Partei, der sie noch nicht beigetreten ist, eine Testwahl zu veranstalten. Warum soll der Staatsbürger nicht auch einmal alternativ verarscht werden?
Die Kunst hat es schwer, mit dem hiesigen Ungeist Schritt zu halten, doch in letzter Zeit ist es einigen Künstlern gelungen, ästhetisch die Höhe der Sozialpartnerschaft zu erreichen. Ein junger Regisseur fasst das Programm der neuen Avantgarde und gleich auch das Konzept seines neuen Films in einem Satz zusammen: »Da ist diesmal wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.« Der klassische Widerspruch von Kunst und Politik scheint in Österreich endlich aufgehoben zu sein. Eine Politik, welche den Geschmack verdirbt, versöhnt sich mit einer Kunst, welche diesen Geschmack bedient. Das alles hat eine fundierte gesellschaftliche Basis: eine demoralisierte Bevölkerung, die seit 1918 so viele Niederlagen hinnehmen musste bei dem Versuch, aus einer demokratischen Verfassung eine demokratische Wirklichkeit zu machen, dass sie es sich heute gefallen lässt, von den heimischen Unterhaltungskretins in den politischen Schlaf gesungen zu werden.
Die Unterhaltungsbranche, anderswo Moden unterworfen, ist hier neben der katholischen Kirche, die für jenseitige Unterhaltung sorgt, eine furchterregende Konstante. Für sie gab es 1938 keinen Anschluss, weil sie schon angeschlossen war, für die gab es 1945 keine Befreiung, weil sie ausgeschlossen blieb, und nach 1945 weder Wiederaufbau noch Krise, weil sie immer obenauf und krisenfest war: der zuverlässige Humus für eine solide reaktionäre Entwicklung.
Es soll Länder geben, in denen fürchtet man den Zeitgeist als Vorreiter rechter Tendenzwenden. In Österreich läuft die Geschichte anders. Gegen den Ungeist hat nicht einmal der Zeitgeist eine Chance.
Ein Schreckensbild? Nein, nur das Genrebild eines Landes, in dem alles seine Ordnung hat, seine alte, unerträgliche Ordnung.
(1986)
DIE DEMOLIERUNG ÖSTERREICHS
oder
Der Weg in den demokratischen Faschismus
Staatsverschuldung hat nicht nur Nachteile. Je größer sie ist – und die des österreichischen Staates lässt sich international bereits herzeigen –, desto leichter ist die Frage zu beantworten, wem der Staat gehört: denjenigen natürlich, denen er Geld schuldet.
Nun sind die Leute, die ihm Geld leihen, keine Wohltäter. Sie wissen, man kann auf Dauer und risikolos an nichts besser verdienen als an einem Staat, dem man fortwährend Geld leiht. Sie kassieren gute Zinsen, und dieses neue Geld borgen sie wiederum dem Staat, damit er überhaupt noch Zinsen zahlen kann. Dass diese Leute dabei immer reicher werden, nehmen sie als Fügung des Schicksals hin; Sorgen jedoch bereitet ihnen die Verarmung des Staates. Würde nämlich die Zinsenlast die Staatseinnahmen übersteigen, wäre der Geschäftsablauf beträchtlich gestört.
Bis jetzt waren die Geldleute gut beraten, sich eine Regierung zu halten, die große Schulden macht. Allmählich muss aber auch daran gedacht werden, dem Staat zu nicht geliehenem Geld zu verhelfen, damit er liquid bleibt. Man nennt das Budgetsanierung. Und wie man weiß, lässt sich so etwas nur machen, indem man einem Großteil der Bevölkerung das private Budget kürzt: durch Senkung des Reallohns, durch Reduzierung der Arbeitsplätze, durch Einschränkung der sozialen Leistungen.
Die ÖVP giert zwar danach, diese Aufgaben übertragen zu bekommen, doch die Geldleute, denen bekanntlich ideelle Werte wie Ehre und Treue mehr bedeuten als materielle, die Geldleute also lassen die SPÖ nicht fallen. Außerdem brennt die Sozialdemokratie darauf, ihrer historischen Aufgabe nachzukommen, auch in Zeiten sozialen Niedergangs für soziale Ruhe zu sorgen.
Das Mindeste, was gewünscht wird, ist eine Koalition der Großparteien. Lieber noch hätte man eine sogenannte Konzentrationsregierung mit allen Parlamentsparteien. Das wäre auch gerechter – denn warum sollen jene Deutschnationalen, die sich in der FPÖ sammeln mussten, weil sie eine Karriere in der ÖVP oder SPÖ verpasst haben, warum sollen die ausgeschlossen werden vom Demolieren des Landes, das in ihren Augen in nicht angeschlossenem Zustand ohnedies keine Existenzberechtigung hat.
Jede Großpartei behauptet natürlich, sie schaffe, was die Geldleute wollen, auch allein. Doch die sind nicht so borniert und engherzig. Sie würden sogar die Partei der Grünen, falls die ins Parlament einzieht, teilnehmen lassen, denn da die Begüterten zumindest über einen Nebenwohnsitz im Grünen verfügen, wissen sie, was sie an der Natur und an den Grünen haben.
Ein Aufruf der Präsidentschaftskandidatin der Alternativen, Meissner-Blau, lautet nach dem »großartigen Ergebnis vom 4. Mai« charakteristischerweise so: »Unterstützerinnen und Unterstützer! ... Das war ein Anfang – den es fortzusetzen gilt, damit die Großparteien uns und unsere Argumente nicht mehr vergessen ... Die Lebensfragen unseres Landes dürfen nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden!« Die Beliebtheit von Frau Meissner-Blau rührt daher, dass sie sich mit ihren Argumenten an die Großparteien wendet und uns einfache Leute damit verschont; und dass sie sich nur insofern um die Lebensfragen kümmert, als sie auf der Tagesordnung stehen.
Während sie uns strengen Gesichts, aber generös, einen Freiraum zubilligt, hat der andere prominente Grüne, Günther Nenning, den harten männlichen Part zu spielen: einen freundlich-blöd anzugrinsen und dabei zuzuschlagen. »Die Teilnahme von Kommunisten«, äußerte er sich, damals noch SPÖ-Mitglied, »ist unerwünscht. Die Kommunisten mögen schweigen. Sie haben von der Demokratie keinerlei Freiheit zu fordern, nicht einmal die ihrer nackten politischen Existenz.« Der Zusammenhang? Nein, es ging nicht darum, dass Stalin auf eine Gedenktafel an seinem Wiener Wohnhaus bestanden hätte, sondern ob Brecht in Österreich gespielt werden darf.
Die politische Demolierung Österreichs hat nicht nur einen aktuellen wirtschaftlichen Anlass, sondern auch eine historische Triebfeder. Die österreichische Bourgeoisie machte mit der bürgerlichen Demokratie wenige und schlechte Erfahrungen. Vor 1918 hütete sie sich vor jedem Emanzipationsversuch gegenüber der Monarchie, denn die kaiserlich-königliche Herrschaft garantierte dem österreichischen Bürgertum eine parasitäre Dominanz über die nationalen Bourgeoisien der anderen in das Imperium gepressten Länder. Danach, in der Ersten Republik, setzte die Sozialdemokratie alles daran, ein bürgerlich-demokratisches System und einen ordentlichen (heimischen) Kapitalismus aufzubauen, damit ja keine der im Lehrbuch vorgesehenen geschichtlichen Perioden zu kurz kommt.
Fünfzehn Jahre lang war das begriffsstutzige, weil stockkonservative und erzkatholische Bürgertum einfach fassungslos, dann erst besann es sich und beseitigte dieses ihr zugedachte System mitsamt den sozialdemokratischen Gönnern. Es löste nicht nur die Partei der Sozialisten auf, sondern auch die eigene und konstruierte, angelehnt ans reichsdeutsche Vorbild, eine österreichische Volksgemeinschaft, angesichts des sprichwörtlichen hiesigen Völkergemischs eine besondere Groteske, die dementsprechend benannt wurde: Vaterländische Front.
Diese vier Jahre, 1934 bis 1938, waren die einzige politische Blütezeit des österreichischen Bürgertums; leider mit dem Schönheitsfehler, dass die damalige Regierung, die Struktur des bürgerlichen Lagers widerspiegelnd, überwiegend aus illegalen Nazis bestand; sogar der Bundesleiter der Vaterländischen Front besaß, wie kürzlich entdeckt wurde, das zweite, zukunftsweisende Parteibuch.
Heutzutage bemüht sich die Rechte zwar nicht um ein den Fakten entsprechendes, doch um ein sauberes Geschichtsbild, nicht der Geschichte, sondern der Zukunft wegen. Eine Bemühung, die vor dem aberwitzigsten Schwachsinn nicht zurückschreckt.
Ein Leserbrief an »Die Presse« erlaubt Einblick ins neue bürgerliche Selbstverständnis: Der Austrofaschismus sei kein faschistisches, sondern ein grundanständiges autoritäres Regime gewesen, der Nationalsozialismus hingegen dem Geiste nach eine linke Diktatur.
Die absolute geistige und politische Perversität gehört also mit zu den Ursachen für die Wende in Österreich – was nirgends so klar ablesbar ist wie in der »Presse«. Zwar werden Demokratie und Republik noch mit Zurückhaltung attackiert, doch brechen die Putschfantasien bei jedem geeigneten Anlass ungehemmt hervor: »Der grauenvolle (spanische) Bürgerkrieg ist nicht aus heiterem Himmel von einer Handvoll putschender Offiziere in eine friedliche, korrekte Demokratie getragen worden ... Die Republik war nicht imstande, jene Staatsordnung aufrechtzuerhalten, der sie verpflichtet war.« Selbstverständlich legitimiere das nicht die Intervention des Militärs, aber »es nimmt den Republikanern jeden Anspruch auf die Glorie, sie – und sie allein – seien die Verteidiger von Recht, Freiheit und Demokratie gewesen«.
Auch Franco war also ein Verteidiger von Recht, Freiheit und Demokratie. Sodass hinter dem scheinbaren Widerspruch von Republikanern und Faschisten endlich das Gemeinsame sichtbar wird: eine neue Volksgemeinschaft von Demokraten und Faschisten, heute propagiert, weil morgen als politische Praxis erwünscht. Der demokratische Faschismus – das aktuellste und hoffentlich letzte politische Programm der Bourgeoisie. Ein Programm, das selbstverständlich über Österreich hinaus Gültigkeit hat.
Die österreichische Variante des demokratischen Faschismus kann auf klerikalen Beistand nicht verzichten. Klug wartete der Papst den Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab. Der Entscheid für Waldheim war für den Vatikan das Signal, dass auch im zurückgebliebenen Österreich die Wende endlich in Gang kam, und er förderte diesen Prozess sofort, indem er Hermann Groër zum Wiener Erzbischof ernannte, einen militanten Hinterwäldler, von dem sich sogar die Konservativen vorläufig distanzieren, weil er für Taktik nicht taugt: Ihm steht das reaktionäre Programm ins Gesicht geschrieben.
Eine außerordentliche Herausforderung für den Herausgeber der »Presse«, der ja seiner gesamten Kundschaft, den Konservativen und den Reaktionären, Rechnung tragen muss, eine Herausforderung, der wir einen Leitartikel verdanken, der zu den journalistischen Höhepunkten der Zweiten Republik zählt – auch insofern, als er das Ende dieser Republik ankündigt: »Das ›katholische Österreich‹ des letzten Jahrtausends samt dem ›Erzhaus‹ gibt es längst nicht mehr, warum sollte aber deswegen eine Wiederverchristlichung vom Wurzelgrund her unmöglich sein?« Der klägliche Ersatz für das Erzhaus ist ein Erzdepp, der uns mithilfe eines Wurzelsepps wiederverchristlichen will und dabei vor keiner Scheinheiligkeit zurückschreckt: Die Kirche Roms vertraue bei solchen Entscheidungen »auf das unkalkulierbare Wirken des Heiligen Geistes«.
Gefährlicher als dieser Schwachsinn ist nur mehr, ihn nicht ernst zu nehmen. Schulmeister wirkt nur deshalb komisch, weil er ein Ereignis geistig interpretieren muss, in dem kein Geist mehr waltet. Was er auch zugibt, nachdem er das geistige Pflichtpensum erfüllt hat: »Die Ernennung von Groër bedeutet ein Programm.« Groër sei »ein Mann der Frömmigkeit und des Gebets, der weltverändernden Kraft, die aus dem Heiligtum kommt. Wie erstaunlich, was gerade er da an Jugend über Roggendorf gewann.«
Roggendorf ist bekanntlich Groërs »spirituelles Zentrum im nördlichen Niederösterreich«, und dort hat der Mann bereits geleistet, dort hat er die Jugend herangeführt an Führungsaufgaben für Heimwehr und Vaterländische Front, die im demokratischen Faschismus vielleicht anders heißen werden.
Wo innenpolitisch für die Zukunft gesorgt wird, darf ein außenpolitisches Konzept nicht fehlen. Leitend beteiligt daran ist eine Frau Leitenberger, besser bekannt unter der Bezeichnung Schreckliche Ilse. Sie gehört noch der alten Rechten Internationale an und ist deshalb unentbehrlich für die Schulung der neuen. Denn sie verkörpert noch wirkliche Brutalität. Die österreichische Rechte hat die Lehre, die ihr der Landsmann Hitler erteilt hat, nicht vergessen: Wollt ihr ostmärkischen Provinzler es in der weiten Welt zu was bringen, müsst ihr euch doppelt anstrengen. Eichmann und Kaltenbrunner taten es und wurden seine Musterschüler.
Heute dient Österreichs Rechte dem Reagan, und zwar mit einer Ergebenheit, wie der sie daheim bei seinen fanatischsten Anhängern nicht findet. Das dürfte sich bis zu ihm durchgesprochen haben, denn als Dank schickte er das Mitglied einer Parfümhändler-Familie als Botschafter nach Wien, der seine Verehrung gleich mit der Ankündigung erfreute, Österreichs Neutralität könne kein Dauerzustand sein. Eine erlösende Botschaft für Österreichs Bourgeoisie. Da sie es nie zur Eigenständigkeit gebracht hat, zuerst nur ein Spielball des Kaisers, dann nur eine Marionette Mussolinis und schließlich nur der Bluthund Hitlers sein durfte, sehnt sie sich auch jetzt immerfort nach Anlehnung und Abhängigkeit. Sie ist neben den heimischen Nazis die unpatriotischste Kraft in Österreich, weshalb ihre Partei, die ÖVP, den »Neuen Patriotismus« zum neuen »Grundwert« erhebt. Meinte der alte Patriotismus die Verteidigung des Landes, so meint der neue dessen Verkauf. Je bodenloser die Skrupellosigkeit der Spekulanten, desto lauter schreien sie nach den sogenannten Grundwerten.
Niemand kann die bürgerliche Sehnsucht nach diesen Grundwerten besser formulieren als die Schreckliche Ilse: »Reagans Südafrikapolitik ist übrigens nicht gescheitert ... Sie blieb erfolglos, weil hinter Washington dessen Verbündete nicht wie ein Mann agierten.« Wenn Österreichs Rechte die Neutralität abgeschafft haben wird, kann sie der Welt zeigen, was ein echter Verbündeter ist: ein Knecht, der nicht müde wird, die Menschenverachtung seines Herrn als Menschlichkeit zu preisen.
Keine zynische Außenpolitik ohne »Stufenplan«. Deshalb schlägt auch Leitenberger »einen Stufenplan zum Abbau der Apartheid« vor, mit Stufen, auf denen man wie bisher einen Schritt vor und zwei zurück macht.
Bei solcher Verzögerung bleibt nicht aus, dass »die Zeit drängt«. »Denn der sowjetische Einfluss auf die radikalen Gruppierungen der schwarzen Bevölkerung wird dann immer mehr an Boden gewinnen und es inmitten des Chaos nur einen lachenden Dritten geben.« Zum Ausgleich wird bis dahin der Einfluss der deutschen Sprache auf die radikalen Gruppierungen der österreichischen Bevölkerung noch mehr an Boden verlieren und es inmitten des Kauderwelschs nur einen lachenden Dritten geben – vorausgesetzt, der ist rechtzeitig emigriert.
Nun existiert in Österreich nicht nur die großbürgerliche »Presse«, sondern auch das Wochenmagazin »profil«, mitbegründet vom jetzigen Herausgeber und Chefredakteur Lingens mit der Absicht, kritischen Journalismus, wenn schon nicht selbst zu schreiben, so doch zu ermöglichen. Die Entwicklung dieses Herausgebers ist insofern interessant, als sie sich parallel zum Niedergang Österreichs vollzieht, strikt nach dem Karl Kraus’schen Gesetz, dass der Journalismus keiner Katastrophe gewachsen, weil jeder verwandt ist. »Ich lese immer wieder Kommentare, die es bedauern, dass die beiden Großparteien immer weniger solche grundsätzlichen Unterscheidungen kennen. Jeder Publizist, der etwas auf sich hält, erhebt die Forderung, sie mögen sich ›profilieren‹. Warum eigentlich? In Wirklichkeit ist die Ähnlichkeit der politischen Zielsetzungen der beiden Großparteien doch etwas Erfreuliches. Sie besagt, dass es in Österreich in sehr weiten Bereichen Übereinstimmungen bezüglich der Wertvorstellungen gibt.«
Niemand geht mit dem Jargon der Wende mit so viel natürlicher Anmut um wie Lingens. Er ist kein Intellektueller, der lange nachdenken muss, er schreibt instinktiv das Richtige. Indirekt, aber stolz verkündet er, dass er sich nicht mehr zu den Publizisten zählt, die etwas auf sich halten.
Früher lautete die Formel: Grundsätzliche Unterscheidungen der Parteien ist gleich Pluralismus, ist gleich Opposition und Kritik und Kontrolle, ist gleich bürgerliche Demokratie. Nun, in der Vorbereitungsphase des demokratischen Faschismus, zählt das alles nicht mehr. Lingens gibt sich auch nicht wie sein betagter Kollege von der »Presse« die Mühe, diese Veränderung mit geistigen Verrenkungen zu erklären. Macht der »Presse«-Herausgeber jede bürgerliche Bildung zur Farce, erhebt Lingens die Unbildung kurzerhand zum Prinzip.
Er bewundert die politischen Macher, vor allem die amerikanischen, weil er selbst ein Durchgreifer ist – der Zukunftstyp schlechthin. »In den USA wurde soeben ein, wie ich glaube, grandioses neues Steuergesetz beschlossen. Es sieht höchstens vier Steuerklassen vor ... Das Gesetz hat eine klare soziale Komponente, indem es die Ärmsten von jeder Steuerlast befreit.« Ich brauche also das Nachrichtenmagazin »profil«, um zu erfahren, dass Leute, die überhaupt kein Geld haben, auch keine Steuer zahlen; und dass so etwas eine soziale Großtat ist.
Lingens erhebt sich zum Chefideologen des künftigen Österreich. Als Chefredakteur gewohnt, Meinung zu monopolisieren, damit es in Österreich »Übereinstimmung bezüglich der Wertvorstellungen« gibt, schafft er die Konkurrenz per Dekret ab: »Es besteht in Österreich nicht der geringste Bedarf an Ideologen ... Was fehlt, sind nicht Ideologien, sondern Wertmaßstäbe.« Wie soll Lingens wissen, dass Wertmaßstäbe nichts anderes sind als zu Schlagwörtern simplifizierte Ideologien; er, der darauf spezialisiert ist, mit Schlagwörtern durchzugreifen. Seine Artikel haben mit denen anderer rechter Ideologen gemeinsam, dass sie sich ausnehmen wie eine einzige quälende Abschiedsvorstellung.
Sie sind lange Annoncen, in denen die Verfasser penetrant darauf aufmerksam machen, dass sie zu Höherem berufen sind als zum Verfassen von Artikeln. Doch lange wird es nicht mehr dauern, bis sie ihren Platz in der Allparteien-Einheitsregierung haben: »Worin sich die Parteien unterscheiden, das ist ihre Vorstellung vom jeweiligen Weg, der zur Verwirklichung dieser Ziele führt. Aber auch diese Unterscheidung ist Gott sei Dank nicht mehr so dramatisch.« (Lingens) Zeit also zum Kofferpacken für jeden, dem es vor diesem schwarz-braun-rosaroten Eintopf graust.
Das Nahziel der Rechten ist die Zerschlagung der verstaatlichten Betriebe. Fälschlicherweise sprechen sie von Revitalisierung und Privatisierung. Darum geht es sicher auch, vor allem aber um Zerschlagung. Gerade in den verstaatlichten Betrieben sind die Arbeiter noch so gut organisiert, dass man sie nicht mit dem Polizeiknüppel verjagen kann. Deshalb gehen Hand in Hand mit der Privatisierung nicht nur Massenentlassungen, sondern auch die Dezentralisierung der Betriebe.
Das heimische Kapital reißt sich natürlich nicht um die defizitäre Stahlindustrie, sondern um die profitablen Unternehmen. Lingens zählt sie auf: »Man könnte sofort die Tabakregie privatisieren«, das Verkehrsbüro, die Post- und Telegraphenverwaltung. »Und so weiter, und so weiter. In keinem der genannten Fälle ginge man irgendein Risiko ein.« Die Wertmaßstäbe ändern sich schneller, als man schauen kann. Bereitschaft zum Risiko, gestern Credo des freien Unternehmertums, ist heute schon passé.
Zu den »sehr weiten Bereichen«, in denen es Übereinstimmung gibt, zählt auch die Kultur. Hier machen Persönlichkeiten durch Fleiß und Tüchtigkeit auf sich aufmerksam und empfehlen sich für zukünftige Aufgaben.
Der Generalsekretär des österreichischen PEN-Clubs zum Beispiel übt sich als Schrifttumskämmerer; dass ich ihm als Übungsbeispiel dienen darf, ist mir eine große Ehre. In einem Essay von mir finden sich die Sätze: »Wir stecken in der Scheiße, gewiss. Aber nicht in unserer eigenen.«
Der Herr Generalsekretär und Schrifttumskämmerer Franz Richter äußert sich dazu in einer Wiener Zeitung namens »Die Furche«, indem er richtigstellt, was ich feststelle, und mir dabei nahelegt, was ich in Zukunft festzustellen habe. Das liest sich so: »Michael Scharang ... stellt (in einer von mir sprachlich gemilderten Form) fest: ›Wir stehen im Dreck.‹« In der »Charta des Internationalen PEN« heißt es: »Der PEN ... verwirft die Zensurwillkür überhaupt, und erst recht in Friedenszeiten.« Der Herr Generalsekretär kann für sich ins Treffen führen, dass er erstens Zensur nur ausprobiert, aber noch nicht ausübt, und dass zweitens die Friedenszeiten vorbei sind.
Zu rechnen wird auch sein mit einem Mann namens Humbert Fink, Mitorganisator des »Legasthenikertreffens in Klagenfurt« (»konkret« 8/88), wo man sich verpflichtet fühlt, einmal jährlich den Namen der Dichterin Bachmann zu schänden, bloß weil sie dort geboren wurde. Dieser Fink hat sich von Kärnten vorgerobbt bis auf den Wiener Boulevard, wo er die Zukunft der Kultur verkündet. »Kulturelle Identität« müsse man »kulinarisch verpackt ... dem Publikum mundgerecht beibringen«.
Die Zeiten des mundgerechten Servierens sind vorbei. Der Inhalt muss samt Verpackung gefressen werden, damit keiner merkt, um welchen Dreck es sich handelt. Wem das nicht passt, dem werden die Zähne eingeschlagen, neudeutsch: Dem wird mundgerecht beigebracht, wo’s langgeht.
Der Termin dafür wurde vom Herausgeber der »Presse« bereits bekanntgegeben: »Ehe der Herbst ausbricht, wird es da Zeit für Patrioten in allen Lagern.« Das noch für jene, die glaubten, ich rede von der Zukunft und nicht von der Gegenwart.
(1986)
WER NICHT ARBEITET, SOLL AUCH NICHT ESSEN
Ich frage mich, welchen Sinn dieser Spruch in unserer Gesellschaft haben kann, in einer Gesellschaft der sozialen Gegensätze, die sich außerdem von Tag zu Tag verschärfen, die Reichen reicher, die Armen ärmer werden und ein Teil der Gesellschaft überhaupt ohne Arbeit bleibt.
In einer solchen Gesellschaft klingt der Spruch, als wäre er erfunden worden zur Disziplinierung und Selbstdisziplinierung der arbeitenden Bevölkerung. Wer fest daran glaubt, dass er ohne Arbeit kein Existenzrecht hat, der wird im Unternehmer nicht nur den beinhart auf Gewinn orientierten Arbeitgeber sehen, sondern ein höheres Wesen mit der Macht, über Menschenschicksale zu entscheiden. Unter den Unternehmergöttern wäre dann Herr Kehrer im Rang eines beratenden Heiligen Geistes.
Vielleicht hat der Spruch noch einen weiteren Sinn. Man sollte sich auch einmal fragen, wie viele Reiche würden verhungern, wenn wirklich nur der essen dürfte, der auch arbeitet. Da es darüber keine statistische Erhebung gibt, kann man den Leichenberg nur schätzen.
Ganz anders schaut die Sache aus, wenn man den Spruch nicht so hinnimmt, wie er ist, sondern ihn variiert und der Realität anpasst.
Zu fragen ist dann, ob die Leute, die arbeiten, denn auch genug zu essen beziehungsweise genug zum Leben haben.
Das ist nämlich von Jahr zu Jahr weniger der Fall. Der Reallohn, liest man, ist zurzeit niedriger als 1975; die Durchschnittslöhne sind dreimal so stark belastet wie vor dreißig Jahren; kinderreiche Familien rutschen unter die Armutsgrenze; immer mehr Alte und Kranke müssen im Winter zwischen heizen und essen wählen.
Dann gibt es freilich auch eine Gruppe von Leuten, die gewiss auch arbeiten, dabei aber viel zu viel Geld verdienen, unendlich mehr, als man zum Leben braucht.
Es hat sich eine kuriose Hierarchie herausgebildet: Circa 200 Österreicher haben nach eigenen Angaben ein Jahreseinkommen von durchschnittlich zwanzig Millionen Schilling (pro Person natürlich). Das ist das Zehnfache, was die rund 40000 Spitzenmanager verdienen; die wiederum zehnmal mehr verdienen als der Durchschnittsösterreicher.
Das alles sind normale kapitalistische Zustände, und ich erwähne sie nur, weil diese normalen Zustände nicht mehr lange andauern, weil dieser Staat nach allen Prognosen auf eine wirtschaftliche Katastrophe zusteuert – und damit auf eine gesellschaftliche. Die Staatseinnahmen wachsen nur durch die Lohnsteuer, nicht durch die Gewinnsteuern. Horst Knapp spricht von der geringsten Gewinnsteuerbelastung seit Menschengedenken. Dadurch wachsen die Staatsschulden schneller als die Einnahmen. Sie betragen über 500 Milliarden oder über 40% des Sozialprodukts*. Die Zinsen für die Staatsschulden fressen außerdem den Wirtschaftszuwachsauf. Wird das Budget nicht saniert, fällt die Hartwährungspolitik, steigt die Inflation und werden die Importe teuer.
Besonders interessant ist, dass dank des Bankgeheimnisses das Finanzkapital für die Zinsen, die ihm zufließen, so gut wie keine Steuern bezahlt; dieses hinterzogene Geld wird vom Finanzminister wieder für hohe Zinsen als Anleihen oder Kredite aufgenommen.
Nun gut. Nach der nächsten Nationalratswahl wird das Budget wohl oder übel saniert werden müssen. Auf wessen Kosten ist klar, gewiss nicht auf Kosten der Kapitalinteressen.
Das heißt, der Verarmungsprozess wird rapid zunehmen, die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Die einzige Sorge der Sozialpartner: Wie kann man die Massen ausplündern und sie dabei ruhig halten? Viele Lösungsvorschläge [...], zum Beispiel die Diskussion um den Basislohn, dienen der Beantwortung dieser Frage.
Wie man politisch mit allfälligen Unruhen fertig wird, damit hat man Erfahrung. Man hat zwar eine parlamentarische Demokratie, regiert aber mittels der Sozialpartnerschaft weitgehend unter Ausschaltung des Parlaments. Dafür dient – bewusst oder unbewusst – die Ausschaltung des Parlaments im Jahr 1933 als Vorbild: Die Zweite Republik ist nicht viel mehr geworden als ein Ständestaat mit sozialdemokratischer Beteiligung. Was man jetzt anstrebt, neben der undemokratischen Verlängerung der Legislaturperioden, ist eine Konzentrationsregierung der drei Parlamentsparteien – praktisch eine Notstandsregierung, die von keiner Opposition gestört wird.
Ein Vorspiel dessen, was auf uns zukommt, erleben wir in diesen skandalreichen Tagen. Und damit komme ich zum letzten und für mich wichtigsten Punkt meiner Überlegungen – denn ich bin wirklich nicht hierhergekommen, um ausschließlich über ein blödes Sprichwort zu reden. Ich möchte noch etwas sagen zur aktuellen Situation: Die legale Bereicherung, wie sie in diesem Land praktiziert wird und die jeder Demokratie und jeder sozialen Gerechtigkeit Hohn spricht, ist die Voraussetzung für die illegale Bereicherung, von der zurzeit durch Zufälle ein Bruchteil an den Tag kommt.
Die Stützen dieser Gesellschaft sind von einer seuchenartigen Raffgier befallen. Ich halte das absolut für kein moralisches Problem, sondern für ein gesellschaftliches. Die Betroffenen wissen aufgrund ihres bisherigen verhängnisvollen Wirkens Bescheid, wie es um diese Gesellschaft, um diesen Staat bestellt ist. Deshalb stecken sie alles in ihre Taschen, was ihnen unter die Finger kommt.
Der nächste große Skandal wird sein, dass man die Prozesse gegen Leute, die unterschlagen haben, unterschlagen muss, weil dieses System sonst nur noch vom Gefängnis aus aufrechterhalten werden kann.
Wir tun gut daran, den alten Spruch, der uns als Motto gedient hat, zu vergessen und ein neues Sprichwort zu erfinden:
Wenn einer schon nicht arbeitet, soll er wenigstens kräftig abkassieren.
(1986)
*[Anm. des Hrsg.: Im Jahr 2024 betrug die Staatsschuldenquote 83,2% des BIP; die Prognosen für 2025 gehen von einem weiteren Anstieg auf 84,7% des BIP aus, d. h. die Staatsschuldenquote hat sich in den letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt!]
BRECHT-BOYKOTT IN ÖSTERREICH
Es ist so naheliegend wie einfallslos, wenn ein Österreicher, meldet er sich im Ausland zu Brecht zu Wort, über das Thema Brecht und Österreich spricht. In wenigen Ländern auf der Welt wurde Brecht so fanatisch abgelehnt und wurden Brecht-Aufführungen so konsequent verhindert wie in Österreich. Und da dieses Land deutschsprachig ist und die Ablehnung somit einem deutschsprachigen Schriftsteller galt, lässt sich ohne Weiteres sagen, dass Österreich in Sachen Brecht-Boykott an führender Stelle lag. Die künstlerischen Folgen sind heute noch spürbar.
Doch es ging nur ganz nebenbei um Kultur, hauptsächlich ging es um Politik. Anderswo wurde Brecht geschändet, indem man nachsichtig das Dichterische vor das Politische stellte, als ließe sich das eine vom anderen trennen; in Österreich ächtete man das ganze Werk als politisch. Ich frage mich, ob man nicht ungewollt Brecht mehr Ehre antut, wenn man ihn zum Politikum macht, zur Streitfrage und, durchs Verbot, zur Kampffrage, als ihn zum Gegenstand der literarischen Debatte zu verkleinern.
Österreich war für Brecht aus mehreren Gründen attraktiv. Er hatte zunächst ein privates Verhältnis zu Österreich: Helene Weigel, seine Frau, und Hanns Eisler, sein Freund und Mitarbeiter, waren Österreicher; und er hatte ein literarisches Verhältnis zu Österreich: Bei aller herben Kritik an ihm schätzte er Karl Kraus und nannte ihn den »ersten Schriftsteller unserer Zeit«.