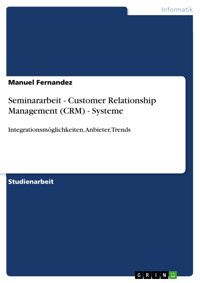36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Friedberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die anhaltende Globalisierung sind kleine und große Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren heutzutage durch sinkende Margen und hohen Kostendruck dazu gezwungen ihre traditionellen Märkte zu verlassen, neue Märkte zu erschließen und auch Ihre Produktions- und Entwicklungsstandorte zu verlagern. Dies kann auf verschiedene Arten und Weisen von statten gehen wie beispielsweise der Neugründung von Niederlassungen und Produktionsstätten in anderen geografische Regionen oder dem Aufkaufen von lokal bereits etablierten Unternehmen, um deren Infrastruktur und Kundenstamm zu übernehmen. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte & Touche1 in der Fertigungsindustrie gaben 57 Prozent der Befragten an, Teile der Produktion in günstigere Regionen ausgelagert zu haben. 29 Prozent der europäischen Unternehmen gaben an, gar keine Produktionsstätten in ihren Heimatmärkten zu betreiben. Die Komplexität solcher Vorhaben fordert eine systematische und ganzheitliche Betrachtung der Einflussfaktoren. Neben Problemstellungen des Standortes selbst gilt es auch, den hinzugewonnenen oder verlagerten Standort in das Unternehmen einzubinden und an die Strukturen der Muttergesellschaft anzupassen, im Hinblick auf die Organisation aber auch im Hinblick auf beispielsweise die verwendeten EDV Systeme und Reporting-Strukturen. Nur so kann z.B. auf der einen Seite der finanzielle bzw. wirtschaftliche Erfolg des neuen Standortes zentral gemessen werden und auf der anderen Seite der neue Standort von bereits vorhandenen und etablierten Strukturen, wie einem zentralen Einkauf, einem Rechenzentrum oder dem Controlling profitieren um Kosten zu senken. Diese Anbindung an die Muttergesellschaft kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Zum einen auf der Ebene der EDV, bei der die neue Lokationen z.B. auf ein unternehmensweit integriertes ERP-System zugreifen kann. Somit wären sämtliche Unternehmensdaten in der Muttergesellschaft bekannt und das zentrale Management kann die Daten als Entscheidungsbasis nutzen. Als nächste Ebene für das Anbinden eines Standortes ist die Aufbauorganisation zu nennen. (...) Man kann also die unternehmensweite Optimierung, Vereinheitlichung und Standardisierung von gleichartigen Prozessen als eine der wichtigen Aufgaben bei der Expansion in neue Märkte oder der Verlagerung von Produktions- und Entwicklungsstätten betrachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Vorgehensweise und Aufbau
2 Prozessmanagement in der Theorie
2.1 Prozesse
2.2 Prozessmanagement
2.3 Kennzahlensysteme
2.3.1 Einführung
2.3.2 Key Performance Indikatoren
2.3.3 Balanced Scorecard
2.4 Modelle zur Bewertung von Prozessqualität
2.4.1 Einführung
2.4.2 CMMI
2.4.3 Six Sigma
2.5 Modelle zur Optimierung von Prozessen
2.5.1 Einführung
2.5.2 Business Process Reengineering
2.5.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
3 IT Service Management
3.1 Überblick
3.2 IT Infrastructure Library
3.2.1 Einführung
3.2.2 Service Support Prozesse
3.2.3 Service Delivery Prozesse
4 Das Projekt
4.1 Einführung
4.2 Das Unternehmen
4.3 Einordnung der betrachteten Prozesse
4.3.1 Prozesse im Unternehmen
4.3.2 Prozesse nach ITIL
4.4 Ausgangssituation
4.5 Zielsetzung und Erwartungshaltung
4.6 Zeitplan
5 Aufnahme und Dokumentation des Ist-Zustands
5.1 Anforderung an die zu gewinnenden Informationen
5.2 Operative Durchführung
5.2.1 Prozesslandschaft
5.2.2 Prozessaufnahme
5.2.3 Prozessdokumentation
5.2.4 Bewertung der Prozessqualität
5.3 Schlussfolgerung
6 Analyse des Ist-Zustandes
6.1 Anforderungen an die Analyse
6.2 Operative Durchführung
6.2.1 Gegenüberstellung der Prozesse und Standorte
6.2.2 Identifikation von Schwachstellen
6.3 Schlussfolgerung
7 Erarbeitung des Soll-Zustandes
7.1 Anforderung an die Optimierung
7.2 Optimierung der vorhandenen Prozesse
7.3 Skizzierung der Soll-Prozesse
7.4 Softwareanforderungen
7.5 Schlussfolgerung
8 Entwicklung von Prozesskennzahlen
9 Ergebnis
10 Ausblick
11 Zusammenfassung
11.1 Theorie
11.2 Projekt
11.3 Fazit
12 Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 - Funktions- und Prozessorientierung
Abbildung 2 - Prozesstypen
Abbildung 3 - Vorgehensmodell zum Prozessmanagement
Abbildung 4 - Verbale Prozessbeschreibung
Abbildung 5 - grafische Prozessbeschreibung (Flussdiagramm)
Abbildung 6 - Key Performance Indikatoren
Abbildung 7 - Balanced Scorecard
Abbildung 8 - CMMI Fähigkeitsgrade
Abbildung 9 - CMMI Reifegrade
Abbildung 10 - Glockenkurve, Standardabweichung
Abbildung 11 - Vorgehensmodell BPR
Abbildung 12 - PDCA Kreis
Abbildung 13 - ITIL Bücher'
Abbildung 14 - ITIL Prozesse
Abbildung 15 - Aufbauorganisation des Unternehmens
Abbildung 16 - Projektplan
Abbildung 17 - Ist-Prozesslandschaft
Abbildung 18 - EMEA Standorte
Abbildung 19 - Flussdiagramm Ist-Prozess Lieferantenbestellung
Abbildung 20 - Bestellsysteme in EMEA
Abbildung 21 - Zentralisierung des Bestellwesens
Abbildung 22 - Soll-Prozess Lieferantenbestellung
Abbildung 23 - Datenquellen
Abbildung 24 - Schlüsselkontakte zur Prozessaufnahme
Abbildung 25 - Verrechnungsschlüssel
Abbildung 26 - Buchungssoftware
Abbildung 27 - Soll-Prozessbeschreibungen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 - Konversionstabelle Yield, Sigma, DPMO
Tabelle 2 - Vorlage zur verbalen Prozessbeschreibung
Tabelle 3 - Prozessreifegrad-Einstufung
Tabelle 4 - Ist-Reifegrade am Standort Spanien
Tabelle 5 - Gegenüberstellung von Prozessen
Tabelle 6 – Prozesskennzahlen
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Durch die anhaltende Globalisierung sind kleine und große Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren heutzutage durch sinkende Margen und hohen Kostendruck dazu gezwungen ihre traditionellen Märkte zu verlassen, neue Märkte zu erschließen und auch Ihre Produktions- und Entwicklungsstandorte zu verlagern. Dies kann auf verschiedene Arten und Weisen von statten gehen wie beispielsweise der Neugründung von Niederlassungen und Produktionsstätten in anderen geografische Regionen oder dem Aufkaufen von lokal bereits etablierten Unternehmen, um deren Infrastruktur und Kundenstamm zu übernehmen. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte&Touche[1] in der Fertigungsindustrie gaben 57 Prozent der Befragten an, Teile der Produktion in günstigere Regionen ausgelagert zu haben. 29 Prozent der europäischen Unternehmen gaben an, gar keine Produktionsstätten in ihren Heimatmärkten zu betreiben.
Die Komplexität solcher Vorhaben fordert eine systematische und ganzheitliche Betrachtung der Einflussfaktoren. Neben Problemstellungen des Standortes selbst gilt es auch, den hinzugewonnenen oder verlagerten Standort in das Unternehmen einzubinden und an die Strukturen der Muttergesellschaft anzupassen, im Hinblick auf die Organisation aber auch im Hinblick auf beispielsweise die verwendeten EDV Systeme und Reporting-Strukturen. Nur so kann z.B. auf der einen Seite der finanzielle bzw. wirtschaftliche Erfolg des neuen Standortes zentral gemessen werden und auf der anderen Seite der neue Standort von bereits vorhandenen und etablierten Strukturen, wie einem zentralen Einkauf, einem Rechenzentrum oder dem Controlling profitieren um Kosten zu senken.
Diese Anbindung an die Muttergesellschaft kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Zum einen auf der Ebene der EDV, bei der die neue Lokationen z.B. auf ein unternehmensweit integriertes ERP-System zugreifen kann. Somit wären sämtliche Unternehmensdaten in der Muttergesellschaft bekannt und das zentrale Management kann die Daten als Entscheidungsbasis nutzen. Als nächste Ebene für das Anbinden eines Standortes ist die Aufbauorganisation zu nennen. Hierbei müssen die Organisationsstrukturen der neuen Filiale an die der Muttergesellschaft ausgerichtet werden, um klare Zuständigkeiten und Verantwortungen zu erhalten und diese zentral auch transparent darstellen zu können. Eine weitere Ebene sind die Informationswege. Hierbei ist beispielsweise das Reporting zu nennen, welches eine mangelnde Aussagekraft besitzt, wenn es nicht unternehmensweit einheitlich gestaltet wird. Hierunter fallen kundenbezogene, mitarbeiterbezogene als auch finanzielle Informationen. Weitere Ebenen können die Logistik, Kommunikation und Vernetzung sein. Diese Ebenen, auf denen die verschiedensten Anpassungen und Anbindungen an eine Muttergesellschaft stattfinden können, haben als gemeinsame Basis Geschäftsprozesse.
Man kann also die unternehmensweite Optimierung, Vereinheitlichung und Standardisierung von gleichartigen Prozessen als eine der wichtigen Aufgaben bei der Expansion in neue Märkte oder der Verlagerung von Produktions- und Entwicklungsstätten betrachten.
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Dieser wissenschaftliche Text wird sich im Wesentlichen mit der Aufnahme, Bewertung, und Analyse von Ist-Prozessen sowie dem Erarbeiten von optimierten Soll-Prozessen befassen. Dabei stehen die gleichartigen Prozesse von insgesamt zwanzig Lokationen aus dem Bereich EMEA im Fokus. Die betrachteten Prozesse stehen in Beziehung mit bzw. sind Vorrausetzung für eine interne Leistungsverrechnung von IT-Kosten im Rahmen des IT-Service Managements eines Unternehmens im Finanzsektor. An den Prozessen zweier dieser Lokationen werde ich beispielhaft Durchführung und Vorgehensweise bei der Ist-Aufnahme, der Bewertung der Prozessqualität, dem Benchmarking der Prozesse, der Erarbeitung des Soll Zustandes und von Prozesskennzahlen darlegen. Der Soll-Zustand stellt dabei ein Prozess-Paket dar, welches im Anschluss als Standard für alle Lokationen gelten soll. Ebenfalls werde ich die angewandten Vorgehensweisen und Techniken theoretischen Methoden und Modellen zuordnen und ausarbeiten, worin die Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Ansätzen bestehen und inwieweit die praktische Umsetzung mit den theoretischen Vorgaben korrespondiert.
Die Bewertung des IT Service Management Modells selbst soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Ebenso wenig die Implementierung (sowie Kontrolle) der Prozesse und die Erstellung eines Pflichtenheftes für eine mögliche Software zur Unterstützung der Prozesse, da sie Teil des weiteren Projektverlaufes sind.
1.3 Vorgehensweise und Aufbau
Zunächst werde ich verschiedene Modelle und Methoden zu Prozessen, zum Geschäftsprozessmanagement, zum Steuern und Messen von Prozessen, zur Bewertung von Prozessqualität und zur Geschäftsprozessoptimierung vorstellen. Zusätzlich werde ich ein Prozessrahmenwerk für IT-Service Management im Unternehmen vorstellen, um diesem die im Praxisteil dieser Arbeit bearbeiteten Prozesse zuzuordnen.
Im Anschluss daran wird die Anwendung der Theorie anhand eines praktischen Beispiels erläutert. Das Praxisbeispiel beschreibt ein Projekt, welches die ProzessAufnahme, die Prozessdokumentation, die Bewertung der Prozessqualität sowie das Benchmarking der Prozesse umfasst. Aus den resultierenden Erkenntnissen wird ein Soll-Zustand abgeleitet, für den dann Kennzahlen zur Steuerung und Messung erarbeitet werden. Anschließend werde ich das Gesamtergebnis präsentieren, bevor ich abschließend einen Ausblick auf das weitere Vorgehen im Rahmen des Projekts gebe. Innerhalb des praktischen Teils dieser Arbeit, werde ich Bezug auf theoretische Modelle nehmen und erläutern, weshalb gerade diese zum Einsatz kommen.
2 Prozessmanagement in der Theorie
2.1 Prozesse
Ein Prozess ist in der Norm ISO 8402[2] durch folgende Eigenschaften definiert: Er besteht aus einer Menge von Mitteln und Tätigkeiten (Personal, Geldmittel, Anlagen, Einrichtungen, Techniken und Methoden). Diese Mittel und Tätigkeiten stehen in Wechselbeziehungen zueinander. Ein Prozess wandelt Eingaben in Ergebnisse um. August Wilhelm Scheer[3] definiert Prozesse als eine Abfolge von Ereignissen und Funktionen. Ein Ereignis stellt dabei den Auslöser einer Aktivität dar. Abgesehen von dieser allgemeinen Definition wird der Begriff „Geschäftsprozess", oder verkürzt „Prozess", jedoch mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Es gibt zum einen die betriebswirtschaftlich orientierte Verwendung. Dabei umfasst ein Geschäftsprozess eine zeitlich-logische Abfolge von Aktivitäten zur Erfüllung einer betrieblichen Aufgabe, wobei eine Leistung in Form von Material- und/oder Informationstransformation erbracht wird. Der Prozess selbst kann hierbei auch aus Unterprozessen bestehen und bereichs- bzw. unternehmensübergreifend sein. Zum anderen existiert eine automatisierungsbezogene Verwendung des Geschäftsprozess-Begriffes. Hierbei geht es um Abläufe in Informationssystemen, welche auch Teil eines betriebswirtschaftlichen Prozesses sein können. Gemeint ist aber nur der Teil, der in dem IT-System ausgeführt wird. Manuelle Aktivitäten werden nicht berücksichtigt. Falsch wird der Begriff verwendet, wenn eine Funktion wie das Qualitätsmanagement als ein Prozess bezeichnet wird, da dies zwar aus einer Reihe von Prozessen bestehen kann, selbst aber keinen klar definierten Ablauf darstellt.[4] Der weitere Verlauf dieser Arbeit wird sich mit Geschäftsprozessen im betriebswirtschaftlichen Sinne befassen. Diese sind Bestandteil der Ablauforganisation eines Unternehmens. Klassischerweise waren Unternehmen in einer funktionsorientierten Organisation aufgestellt. Nach und nach ist man jedoch zu der Erkenntnis gekommen, dass dadurch die Bedürfnisse der Kunden vernachlässigt werden und die Vorgänge zur Erzeugung eines Produktes nicht optimal ablaufen, da beispielsweise „Bereichsdenken" zu schlechterer Kommunikation innerhalb des Betriebes und letztlich zu längeren Lieferzeiten führt. Somit gewann die Prozessorientierung an Bedeutung, da nun auf den Kunden und die Qualität der Prozesse fokussiert werden konnte, denn Geschäftsprozesse beginnen und enden auch beim (internen) Kunden.
Abbildung 1 - Funktions- und Prozessorientierung
Die charakteristischen Merkmale der in Abbildung 1 dargestellten Funktionsorientierung sind unter anderem eine starke Arbeitsteilung, infolge dessen viele Schnittstellen und hoher Kommunikationsaufwand, tiefe Hierarchien, Bereichsdenken und als Hauptziel Kosteneffizienz. Dem gegenüber stehen bei der Prozessorientierung die Merkmale: flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, Objektbearbeitung, Transparenz und als Zielvorgabe Kundenzufriedenheit und Produktivität. Insgesamt können, wie in Abbild 2 dargestellt, drei verschiedene Typen von Prozessen im Unternehmen unterschieden werden: die Führungsprozesse, die Unterstützungsprozesse und die Kerngeschäftsprozesse. Die Führungsprozesse bestimmen dabei maßgeblich die strategische und politische Ausrichtung der Organisation. Unterstützungsprozesse sind im Gegenzug dafür verantwortlich, sämtliche Ressourcen und Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, wie beispielsweise Personal, Maschinen oder EDV-Systeme. Zu den Kerngeschäftsprozessen schließlich gehören alle Prozesse, die mit der Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung verbunden sind. In der Literatur gibt es weitere Sichten auf die Prozesse einer Organisation, wie beispielsweise dem FAU Modell, bei dem Führungs-, Ausführungs- und Unterstützungsprozesse unterschieden werden.[5]
Abbildung 2 - Prozesstypen[6]