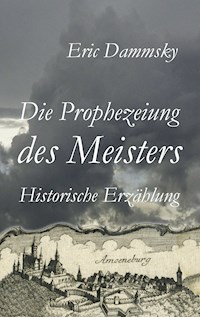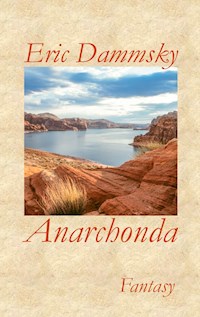
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Räuberle«, wie er von seinen Freunden und Bekannten genannt wird, kommt aus einer wohlhabenden Familie, die ihm ein angenehmes Leben ermöglicht. In ihm wühlt jedoch eine unerklärbare Sehnsucht, das hinter dem Hotel seiner Eltern beginnende, dicht bewaldete Bergland zu durchstreifen, ein großes, unerschlossenes Gebiet, aus dem immer wieder Wanderer nicht zurückkommen. Trotz des Verbots seiner Eltern betritt er den verwunschenen Landstrich. Tief im Wald trifft er auf eine junge Frau, mit deren Hilfe er den Weg in eine neue Welt findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
1.
Ich habe meinen richtigen Vornamen nie gekannt. Eltern und Freunde nannten mich von Kindesbeinen an immer nur »Räuberle«, ein Name, den ich nicht mochte und der für einen Erwachsenen geradezu lächerlich ist. Die ordentlichen und wohl erzogenen Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft bezeichneten mich abfällig als Taugenichts oder Schmarotzer. Dabei wollte ich von Anfang an nur, was alle anstreben, ein angenehmes Leben führen. Der Unterschied zwischen mir und der übrigen Bevölkerung bestand darin, dass ich es mir leisten konnte, keiner regelmäßigen Arbeit nachzugehen. Um die schönen Dinge des Lebens brauchte ich nicht zu kämpfen.
Ich wuchs in dem unbedeutenden Dorf Vogelbach auf, das seinen Namen zu Recht hatte. Das Wasser eines Bachs, der zwischen den Felsen einer Talverengung heraus sprudelte, zog sowohl einheimische als auch durchziehende Vögel magisch an. Ganze Schwärme von Kranichen und Wildgänsen ließen sich im Frühjahr und Herbst hier nieder, um von dem köstlichen Nass zu trinken, das ein Mineral enthielt, das angeblich eine heilende und stärkende Wirkung auf den Menschen hatte, aber die gefiederten Freunde regelrecht betrunken machte. Nur wenige Minuten, nachdem sie von dem Wasser getrunken hatten, torkelten sie über die Wiese, konnten nicht mehr fliegen und wurden eine leichte Beute für einen Fuchs und zwei fette Kater, die hier einträchtig im hohen Gras auf der Lauer lagen. Auch die Vogelbacher hatten die Angewohnheit, sonntags früh vor dem Gottesdienst mit bloßen Händen eine Gans zu fangen und ihr die Gurgel umzudrehen. Während die Männer nach der heiligen Messe die Gastwirtschaft besuchten, aus der sie zwei Stunden später betrunken heraus torkelten, schmorten bereits die von ihren Frauen zubereiteten Vögel im Ofen.
Das Überangebot an Fleisch hatte im Lauf von Jahrhunderten dazu geführt, dass die Bewohner des Dorfs eine auffällig rosige Gesichtshaut bekommen hatten. Die heranwachsenden Mädchen, die überall in der Gegend nur »Vogelbacher Schweinchen« genannt wurden, waren umschwärmt auf den Kirchweihfesten der umliegenden Dörfer. Ich habe mich trotz ihrer gesunden Gesichtsfarbe nie für die jungen Frauen aus meinem Dorf interessiert, da ich sie von klein auf kannte und sie mir wie Schwestern vorkamen.
Das malerische Hotel meiner Eltern lag nicht im Ort, sondern am Rand einer Wiese, die sich entlang eines Berghangs zum Waldrand hinauf zog. Es war ein schön renoviertes Fachwerkanwesen mit einem Haupthaus und zwei Nebenflügeln mit insgesamt fünfunddreißig Betten, die während der Saison im Sommer meistens ausgebucht waren. Der bereits erwähnte kristallklare Bach, der direkt am Hotel vorbei floss, war in zweierlei Hinsicht eine Attraktion. Er lieferte nicht nur frische Forellen für die Speisekarte, sondern zog die Gäste wegen seiner angeblichen Heilkräfte an. Den ganzen Tag lang schöpften sie am kleinen Brücklein das Wasser mit Bechern aus dem Bach, die sie langsam und ehrfürchtig austranken. Was sie nicht wussten war, dass meinem Freund Schnuff und mir der Gang zur Toilette oft zu weit war, wenn wir draußen herum tollten.
»Man kann sich nicht schöner entleeren als an einem rauschenden Bächlein«, pflegte mein Freund immer zu sagen.
Ich genoss es, der Sohn des Hotelbesitzers zu sein und brachte mich entsprechend in Position, wenn weibliche Gäste in meinem Alter ankamen. Direkt an den Empfang schloss sich ein kleiner Wartebereich an, der mit Tischen aus Palisander und schweren Ledersesseln möbliert war. Hier flegelte ich mich gerne in die Sitzmöbel und ließ mir von den Stubenmädchen Getränke servieren. Diese fleißigen Geschöpfe, Trulla und Theres mit Namen, hatten nur mein Wohlbefinden im Sinn. Die Erfüllung meiner Wünsche war ihnen keine Last, sondern eine jede wollte dem Junior des Hauses besonders gut gefallen. Sie sorgten dafür, dass ich ein besonderes Essen bekam, anstatt der Allerweltsgerichte, die auf der Speisekarte angeboten wurden. Es ging so weit, dass ich sie abends herbei rief, um mich auszukleiden. Ein Prinz hätte nicht besser leben können. Trotzdem war ich unzufrieden. Eine tiefe Sehnsucht wühlte in mir, aber ich wusste nicht nach was. Mein Freund Schnuff war unkomplizierter und mir in einem Punkt weit voraus. Er verfügte über viel Geld, viel mehr als das wenige Taschengeld, das wir wöchentlich bekamen. Er besaß sogar richtige Goldtaler und brüstete sich damit, schon Affären mit älteren Frauen gehabt zu haben.
Jeder im Ort wusste, woher Schnuff sein Geld hatte. Es lag an seiner Nase. Er hatte einen Geruchssinn wie ein Bluthund oder ein Trüffelschwein, den er von einem berühmten Urururgroßvater geerbt hatte. So wie sein Vorfahr, konnte Schnuff Trüffeln erschnüffeln, die er ausgerechnet meinem Vater verkaufte, der damit edle Speisen noch weiter verfeinerte. Die Trüffeln waren so teuer, dass man sie mit Gold hätte aufwiegen können. Schnuff musste sich nicht einmal bücken, um Witterung von den unterirdischen Knollen zu bekommen. Sobald der ihm bekannte Duft von seiner Nase erfasst wurde, ging er auf die Knie, zog noch einmal geräuschvoll die Luft ein und grub den wertvollen Fund mit einem Schäufelchen aus, das er immer am Gürtel seiner Hose in einem Futteral mit sich trug.
Mein Freund ließ mich zu einem gewissen Maß an seinem Reichtum teilhaben. Ich bekam zwar kein Geld von ihm, musste aber für den Whiskey nichts bezahlen, den er in der nahegelegenen Stadt kaufte und den wir gemeinsam tranken. Zwar gab es auch an der Hotelbar jede Menge hochprozentige Getränke, die jedoch hinter einer Glasscheibe unter Verschluss waren. In diesem Punkt achteten meine Eltern sehr darauf, dass ich keinen Zugang zu Schnaps und Likören hatte, so wenig sie mich auch sonst erzogen.
Die »Macht des Geldes« war Schnuff früh bewusst. In der Schule kaufte er sich gute Noten, indem er die Lehrer bestach. Wenn er sich mit einer Droschke in die Stadt fahren ließ, im eleganten Anzug mit einer rosa Nelke am Revers und einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf, wusste ich, dass er die Damen eines bekannten Etablissements besuchte. Mir gegenüber erwähnte er einmal, dass eine Nacht mit diesen exotischen Schönheiten eine Trüffelknolle koste.
Hinter dem Hotel meiner Eltern begann ein großer, undurchdringlicher Wald, der mich schon als Kind fasziniert hatte. Meine Eltern hatten mir strikt verboten, ihn zu betreten und ich hatte mich daran gehalten, auch wenn ich als heranwachsender Jüngling den Eindruck bekam, dass sie die Gefahren weit übertrieben.
»Was willst du in diesem langweiligen Wald?«, fragte Schnuff, als ich ihn bat, mich auf einer Wanderung in das verbotene Gelände zu begleiten.
»Für mich ist es dort alles andere als langweilig«, antwortete ich trotzig, »der Wald birgt ein sagenhaftes Geheimnis.«
Immer wieder waren Wanderer nicht zurückgekommen, die im Hotel meiner Eltern gewohnt hatten. Die Vogelbacher verboten ihren Kindern strikt, auch nur einen Schritt in die wild wuchernden Gehölze zu setzen.
Eine Randzone von etwa zehn Meilen Breite wurde bewirtschaftet. Dort wurden Bäume gefällt und Unterholz abgefahren. Die Wege waren gut begeh- und befahrbar. Ein schmaler Pfad kennzeichnete die Grenze zwischen dem gepflegten Forst und dem Urwald. Kein Förster oder Waldarbeiter hätte jemals diese Linie überschritten. Wenn man nach den Gründen fragte, bekam man ausweichende Antworten. Niemand wollte zugeben, dass er Angst vor einem geheimnisvollen »Etwas« hatte, das dort angeblich hauste.
»Gib es zu«, stachelte mich mein Freund an, »dort gibt es etwas Wertvolles und du hast herausgefunden was es ist, Trüffeln werden es nicht sein, die kann nur ich erschnüffeln. Ist es vielleicht ein Goldschatz?«
Ich schüttelte den Kopf. Wie konnte jemand nur so materialistisch denken wie Schnuff.
Wenn er nicht mitkommen wollte, musste ich allein gehen. Vielleicht würde mich auch eines der Dienstmädchen begleiten. Ich entschied mich dafür, zuerst die kräftigere der beiden zu fragen, die rothaarige Trulla, die sofort einwilligte. Später sollte sich herausstellen, dass es die falsche Wahl gewesen war. Schon am folgenden Sonntag brachen wir vor Sonnenaufgang auf. Trulla trug den Rucksack mit unserer Verpflegung, die im Notfall für drei Tage gereicht hätte, auch wenn wir nur einen Tagesausflug geplant hatten. Ich hatte einen Kompass mitgenommen, der uns helfen sollte, wieder zurückzufinden. Als wir gerade losmarschieren wollten, tauchte plötzlich Schnuff auf. Er hatte sich doch noch zum Mitkommen entschieden.
»Das will ich jetzt doch sehen, nach was du im Wald suchst«, versuchte er mich zu provozieren.
Wir spazierten in guter Stimmung los und betraten den Forst über eine Schneise, von der aus wir einem breiten Weg folgten, der genau nach Norden verlief. Ich konnte hören, wie Schnuff immer wieder geräuschvoll Luft durch die Nase einzog. Seine Stirn legte sich in Falten.
»Hier riecht es nicht nach Trüffeln, sondern modrig und brackig«, flüsterte er, »meine Nase signalisiert mir die Nähe von viel Wasser, ein großer See vielleicht.«
»Hier gibt es keinen See«, antwortete ich.
Immer wieder blieb er stehen und blickte angespannt nach vorne. Da ein leichter Wind aus Nordnordost blies, bekam er vor allem die Witterungen aus dem verwunschenen Gelände, auf das wir zügig los marschierten.
Nach etwa drei Stunden kam das Ende des bewirtschafteten und gepflegten Bereichs. Vor uns breitete sich ein Chaos aus. Umgestürzte Bäume lagen kreuz und quer. Der Waldboden war übersät mit morschem Holz, auf dem dichtes, grün leuchtendes Moos und riesige, bunte Baumpilze wuchsen. Uralte Wege waren völlig überwuchert und nicht mehr begehbar. Überall reckten sich große Schattenpflanzen nach oben. Die Farne waren bis zu acht Fuß hoch. In tiefen, schlammigen Löchern stand das Wasser und erschwerte das Weiterkommen.
Wir ließen uns dadurch nicht aufhalten und versuchten, einen Weg durch den Hochwald zu finden, der durch den Dauerschatten seiner mächtigen Baumkronen weniger Bewuchs am Boden zuließ. Ich überprüfte den Kompass und bemerkte, dass die Nadel plötzlich wild hin und her schwang. Trulla lachte triumphierend:
»Ich habe ein rotes Wollknäuel mitgenommen und schon die ganze Zeit alle hundert Fuß einen Baumstamm oder Ast gekennzeichnet. So können wir den Weg zurück leicht finden.«
Meine Blicke kreuzten sich mit denen von Schnuff, soviel weise Voraussicht hätten wir der Magd nicht zugetraut.
Es war sehr anstrengend, sich durch das Unterholz voranzukämpfen. Wir wollten jedoch nicht aufgeben. Nach zwei weiteren Stunden erreichten wir zu unserer großen Überraschung den ausgetretenen Pfad, den wir bereits kannten. Es dauerte nicht lang und wir fanden einen der Wollfäden. Wir waren im Kreis gelaufen.
Schnuff fing fürchterlich zu fluchen an, während sich die dicke Trulla auf einen Baumstamm setzte und uns mitteilte, dass sie zu erschöpft sei, um auch nur einen Schritt weitergehen zu können. Wir wollten auf keinen Fall von der Nacht überrascht werden und versuchten, Trulla unterzuhaken und zu schleppen, ein Unterfangen, das wir schnell wieder aufgeben mussten. Die junge Magd war schwer wie eine Mastgans, entglitt uns mehrmals und fiel wie ein nasser Sack auf den glücklicherweise weichen Waldboden. Es wurde dämmrig und wir entschlossen uns, im Wald zu übernachten. Schnuff sammelte trockenes Holz und ich fachte ein kleines Feuer an. Es sollte uns in der kalten Nacht wärmen, aber auch Wölfe fernhalten, die in kleinen Rudeln durch die wildreiche Gegend streiften.
Ohne es zu merken, hatten wir unseren Lagerplatz einige Fuß innerhalb des verbotenen Gebiets gewählt, da hier viel mehr trockenes Holz für unser Feuer herum lag. Es wurde dunkel und jeder versuchte, zwischen Moos, Erde, Steinen und abgestorbenen Ästen eine einigermaßen bequeme Schlafstellung nahe am Feuer einzunehmen. Nach einigen Versuchen benutzten wir schließlich Trullas Bauch und Busen als Kopfkissen. Mit einer Picknickdecke aus ihrem Rucksack deckten wir uns zu und waren bald eingeschlafen.
Ich hatte einen eigenartigen Traum. Mitten im Wald kam mir ein wunderschönes Mädchen entgegen, das mich umarmte, auf mein Ohr küsste und dann sogar ihre Zunge in meinen Gehörgang steckte. Ich dachte noch im Schlaf, dass die Fremde zu weit gegangen sei, als ich aufwachte und feststellen musste, dass ich überhaupt nicht geträumt hatte, sondern ein Wildschwein dabei war, schmatzend mein Ohr zu verspeisen. Mein bestialischer Schrei vertrieb das Tier augenblicklich. Die Hälfte meines Ohrs war jedoch weg. Trulla legte einen notdürftigen Verband an und tröstete mich damit, dass man die Ohrmuschel nicht wirklich brauchen würde. Ich könne dankbar sein, dass das Wildschwein nichts anderes abgefressen habe.
In diesem Moment sah ich die junge Frau aus meinem Traum zwanzig Fuß entfernt bewegungslos im Wald stehen. Das Lagerfeuer beleuchtete ihr schönes Gesicht mit züngelnden Lichtreflexen von Weiß über Gelb bis Rot. Sie betrachtete uns mit einer Mischung aus Furcht und Neugierde. Auch Schnuff hatte sie entdeckt und war sofort auf sie zugegangen, während ich noch über meinen Traum nachdachte. Er zog einen Goldtaler aus der Tasche und ließ ihn auf seinem Handrücken tanzen. Das zeigte Wirkung. Die junge Frau wollte ganz genau sehen, wie der Trick funktionierte und ging auf meinen Freund zu. Blitzschnell streckte sie ihre Hand nach der Goldmünze aus, aber Schnuff war schneller. Mit einer atemberaubenden Schlenkerbewegung ließ er den Taler über Ober- und Unterarm wieder in seine Hosentasche kullern.
Die Fremde gab sich noch nicht geschlagen. Wie eine Furie fiel sie über meinen Freund her und versuchte, den Goldtaler aus seiner Hosentasche zu ziehen. Schnuff genoss diese Attacken, bei denen ihre spärliche Bekleidung aus Bast nur so flog, dass es Trulla Angst und Bang wurde und sie sich selbst und mir eine Hand vor die Augen hielt, wobei sie ständig »Hugo lass sein!« rief. Ich wusste nicht, wen sie mit Hugo meinte, Theres erzählte mir aber einige Tage später, dass Trulla einen Mann dieses Namens gehabt habe, der einmal einen anderen Kerl verprügelt habe und nicht mehr damit aufhören konnte, auf ihn einzuschlagen. Dabei habe Trulla den bewussten Satz geschrien, den sie seitdem bei Aufregungen immer von sich gab.
Das Waldmädchen, wie ich sie spontan taufte, hatte sich beruhigt und an unser Feuer gesetzt. Trulla gab ihr ein Stück Schokolade, das sie genussvoll aß. Mit dem Finger deutete sie auf sich und sagte »Savannah«. Wir nahmen an, dass dies ihr Name sei und ließen zu ihrer Begrüßung mehrmals eine Flasche mit Whiskey kreisen, die Trulla mitgeschleppt hatte. Unsere neue Bekannte trank den hochprozentigen Schnaps, ohne irgendeine Wirkung zu zeigen. Ich beobachtete dies schadenfroh, da Schnuff mit Sicherheit gehofft hatte, das Mädchen erst betrunken und dann gefügig zu machen.
Sie blieb nur kurz und verschwand wieder im Dunkeln. Vorher bedeutete sie uns noch wild fuchtelnd, dass der Bereich jenseits des Pfads für uns verboten sei. Wir befolgten ihren Rat, verlegten unser Feuer, betteten unsere Köpfe wieder auf Trullas Weichteile und waren bald eingeschlafen.
2.
Savannah ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte kein Schweinchengesicht, sondern edle, klassische Gesichtszüge. Ihre Hautfarbe war nicht das Vogelbacher Schweinehinternrot, sondern reines Elfenbein. Was machte sie nur allein in dieser Wildnis? Das musste ich herausbekommen. Bevor ich aber wieder in den Wald aufbrechen würde, wollte ich wissen, warum es so gefährlich sein sollte, den Grenzpfad zu überschreiten.