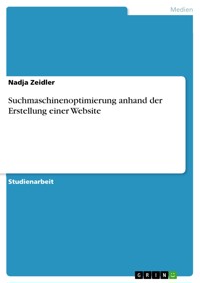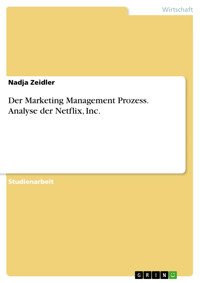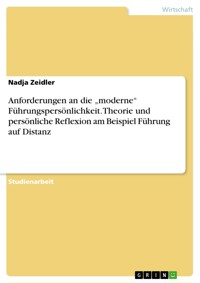
Anforderungen an die „moderne“ Führungspersönlichkeit. Theorie und persönliche Reflexion am Beispiel Führung auf Distanz E-Book
Nadja Zeidler
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,7, Hochschule für angewandtes Management GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Unternehmen sehen sich einer Reihe von Trends ausgesetzt, die sich in den kommenden Jahren entscheidend auf die Organisation, Mitarbeiter und Führungskräfte auswirken werden. Die Globalisierung, der demographische Wandel und die Digitalisierung führen zu veränderten Arbeitsmodellen, welche sich wiederum auf das Unternehmensumfeld und die Führung auswirken. Die globale Ausdehnung der Märkte hat zur Folge, dass die länder- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit unter Einbeziehung kulturell heterogener Teams an Bedeutung gewinnt. Durch die wachsende und alternde Weltbevölkerung nimmt auch die weltweite Rekrutierung von Mitarbeitern zu, um den Fachkräftemangel im eignen Land entgegenzuwirken. In Folge der Digitalisierung ist die Zusammenarbeit über physische Grenzen hinweg möglich und kann von jedem Ort auf der Welt erfolgen. Die Führung solcher Teams stellt eine Herausforderung für die Führungskräfte dar und entwickelt sich zu einer entscheidenden Kompetenz, die Führungskräfte besitzen sollten. Die physische Abwesenheit der Mitarbeiter sowie die digitale Kommunikation erschweren den direkten Austausch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Dennoch kommt dem Teamleiter eine Schlüsselrolle bei der Führung von virtuellen Teams zu. Er muss Vertrauen aufbauen und das Team motivieren. Auch das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern ist ein essentieller Faktor, der die Zusammenarbeit innerhalb des Teams stark beeinflussen kann. Ebenso wichtig sind sprachliche interkulturelle Kompetenzen. Das Unternehmensumfeld muss dafür die nötigen Strukturen der Informations- und Kommunikationstechnologien schaffen sowie die Mitarbeiter gezielt für die virtuelle Zusammenarbeit sensibilisieren und schulen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmungen
2.1 Virtuelle Teams
2.2 Präsenzteams vs. Virtuelle Teams
3. Virtuelle Teamarbeit
3.1 Die Entstehung virtueller Teams
3.2 Chancen und Herausforderungen
3.3 Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams
3.4 Die Rolle der Führung
3.4.1 Bedeutung von Führung
3.4.2 Aufgaben virtueller Führungskräfte
3.4.3 Bedeutung des Führungsstils
4. Persönliche Reflexion und Fazit
5. Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Erfolgsfaktoren virtueller Teams
Abbildung 2: Phasen und Aufgaben des Managements virtueller Teams
Abbildung 3: Führungsfähigkeiten eines "Virtual Managers"
Abbildung 4: Führungsansätze im Vergleich
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Unternehmen sehen sich einer Reihe von Trends ausgesetzt, die sich in den kommenden Jahren entscheidend auf die Organisation, Mitarbeiter und Führungskräfte auswirken werden. Die Globalisierung, der demographische Wandel und die Digitalisierung führen zu veränderten Arbeitsmodellen, welche sich wiederum auf das Unternehmensumfeld und die Führung auswirken. Die globale Ausdehnung der Märkte hat zur Folge, dass die länder- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit unter Einbeziehung kulturell heterogener Teams an Bedeutung gewinnt. Durch die wachsende und alternde Weltbevölkerung nimmt auch die weltweite Rekrutierung von Mitarbeitern zu, um den Fachkräftemangel im eignen Land entgegenzuwirken. In Folge der Digitalisierung ist die Zusammenarbeit über physische Grenzen hinweg möglich und kann von jedem Ort auf der Welt erfolgen. Die Führung solcher Teams stellt eine Herausforderung für die Führungskräfte dar und entwickelt sich zu einer entscheidenden Kompetenz, die Führungskräfte besitzen sollten. Die physische Abwesenheit der Mitarbeiter sowie die digitale Kommunikation erschweren den direkten Austausch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Dennoch kommt dem Teamleiter eine Schlüsselrolle bei der Führung von virtuellen Teams zu. Er muss Vertrauen aufbauen und das Team motivieren. Auch das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern ist ein essentieller Faktor, der die Zusammenarbeit innerhalb des Teams stark beeinflussen kann. Ebenso wichtig sind sprachliche interkulturelle Kompetenzen. Das Unternehmensumfeld muss dafür die nötigen Strukturen der Informations- und Kommunikationstechnologien schaffen sowie die Mitarbeiter gezielt für die virtuelle Zusammenarbeit sensibilisieren und schulen.
Auf die Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen virtueller Teams sollen in der vorliegenden Arbeit näher eingegangen und die Merkmale virtueller Teams vorgestellt werden. Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Arbeit in virtuellen Teams zu geben und diesen mit einer persönlichen Reflexion abzuschließen.
2. Begriffsbestimmungen
Die Begriffe „virtuell“ und „Team“ werden heutzutage im alltäglichen Sprachgebrauch ganz geläufig gebraucht. Jedoch ist damit nicht immer dasselbe gemeint. Insbesondere die Abgrenzung einer Gruppe zu einem Team wird nicht immer trennscharf gezogen. Daher sollen im nachfolgenden Kapitel diese Begriffe definiert und voneinander abgegrenzt werden.
2.1 Virtuelle Teams
Um zu verstehen, was mit virtuellen Teams gemeint ist, sollen zunächst die Begriffe „virtuell“ und „Team“ näher betrachtet werden.
Zum Begriff „Team“ finden sich in der Literatur verschiedene Definitionen (s. Hackman (1987) oder Sundstrom, DeMeuse und Futrell (1990)). Meist werden Teams durch drei bis fünf Merkmale charakterisiert. Dies wird beispielsweise an der Definition von Foster (1978) deutlich:
„Ein Team in einer Unternehmung ist eine kleine, funktionsgegliederte Arbeitsgruppe mit gemeinsamer Zielsetzung, verhältnismäßg [!] intensiven wechselseitigen Beziehungen, einer spezifischen Arbeitsform, einem ausgeprägten Gemeinschaftsgeist und damit einer relativ starken Gruppenkohäsion.“[1]
Weitere Definitionen, wie die von Thompson (2004) verdeutlichen diese Auffassung:
„Ein Team ist eine Gruppe von Individuen, die wechselseitig voneinander abhängig und gemeinsam verantwortlich sind für das Erreichen spezifischer Ziele für die Organisation.“[2]
Im Gegensatz dazu ist eine Gruppe nach Rosenstiel (2000) „eine Mehrzahl von Personen in direkter Interaktion, über eine längere Zeitspanne bei Rollendifferenzierung und gemeinsamen Normen, verbunden durch ein Wir-Gefühl.“[3]
Aus der Gegenüberstellung der beiden Definitionen wird deutlich, dass in der Gruppendefinition die gemeinsame Zielsetzung des Teams fehlt.
Der Begriff „virtuell“ lässt sich aus dem lateinischen Wort „virtus“ ableiten und bedeutet Kraft, Tüchtigkeit oder Mannhaftigkeit.[4] Dem Duden nach bedeutet virtuell im heutigen Sprachgebrauch „als Möglichkeit vorhanden“ oder „nicht echt, aber echt erscheinend“. Nach Lipnack & Stamps sind virtuelle Teams jedoch durchaus echt und können mit Teams im konventionellen Sinn verglichen werden.[5] Die Unterschiede werden in ihrer Definition deutlich. Diese soll für die vorliegende Arbeit als Grundlage dienen:
„Ein virtuelles Team ist – wie jedes andere Team – eine Gruppe von Menschen, die mittels voneinander abhängiger – interdependenter – Aufgaben, die durch einen gemeinsamen Zweck verbunden sind, interagieren. Im Gegensatz zum konventionellen Team arbeitet ein virtuelles Team über Raum-, Zeit- und Organisationsgrenzen hinweg und benutzt dazu Verbindungsnetze, die durch Kommunikationstechnologien ermöglicht werden.“[6]
Aus dieser Definition geht hervor, dass virtuelle Teams die Merkmale klassischer Teams besitzen, jedoch dezentral organisiert sind, zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten und vorwiegend mit Hilfe von elektronischen Kommunikationstechnologien in Verbindung stehen.
Ein virtuelles Team kann dabei innerhalb eines Landes bestehen oder über Ländergrenzen hinweg agieren.[7] Bei ersterem ist häufig von Telearbeit die Rede, sofern es sich um Teamarbeit innerhalb des gleichen Unternehmens handelt.[8] Bei letzterem kommen kulturelle Unterschiede erschwerend hinzu.
2.2 Präsenzteams vs. Virtuelle Teams
Aus der vorausgegangenen Definition lassen sich Merkmale ableiten, die für virtuelle Teams gelten. Die Unterschiede zu Präsenzteams sollen in nachfolgender Tabelle zusammenfassend dargestellt werden:
Tabelle 1: Unterschiede Präsenzteams vs. Virtuelle Teams
Quelle: (App, 2013)
Wie jedes Präsenzteam durchläuft ein virtuelles Team verschiedene Phasen. Nach Tuckmann (1965) bestehen diese aus folgenden vier:
1. Forming
2. Storming
3. Norming
4. Performing[9]
Bei virtuellen Teams können sich diese Phasen verlängern oder des Öfteren wiederholen. Insbesondere bei einem häufigen Wechsel der Teammitglieder kommt es immer wieder zu einer neuen Forming-Phase, in der sich das Team neu organisieren und ausrichten muss.
Die Performing-Phase, in der das Team am produktivsten ist kann unter Umständen nie erreicht werden. Daher ist es wichtig, dass die Führungskraft sich intensiv mit dem Teamprozess beschäftigt und versucht das Team in die richtigen Bahnen zu lenken.
3. Virtuelle Teamarbeit
3.1 Die Entstehung virtueller Teams
Durch aktuelle Trends verändern sich das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingungen ständig. Dies hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und die Strukturierung von Unternehmen. Folgende Gründe können als Hauptursachen für die Entstehung virtueller Teams gesehen werden:
Globalisierung: Unternehmen streben nach Wachstum und wählen dafür oft eine Internationalisierungsstrategie. Um in ausländische Märkte zu expandieren sind oft Kenntnisse des Marktes und der dortigen Regularien notwendig. Aus diesem Grund entsenden Unternehmen entweder Mitarbeiter in das jeweilige Land oder rekrutieren dort ansässige Fachkräfte.
Demografischer Wandel: Durch den demografischen Wandel entsteht ein zunehmender Fachkräftemangel, der durch die Zuwanderung von Ausländern abgeschwächt werden kann. Mithilfe von virtuellen Teams ist es jedoch möglich die standortunabhängige Zusammenarbeit zu ermöglichen, sodass ein Umzug für ausländische Arbeitskräfte nicht notwendig ist.
Digitalisierung: Durch die Verbreitung des Internets sind neue Kommunikationstechnologien entstanden, die die Zusammenarbeit über lokale und globale Grenzen hinweg vereinfachen. In Bezug auf die virtuelle Kooperation sind digitale Medien unerlässlich. Da kein bzw. kaum persönlicher, direkter Kontakt besteht, sind die Teammitglieder auf den Austausch u.a. über Video-Konferenzen, Chats und E-Mail angewiesen. Die Entwicklung dieser Technologien hat die virtuelle Zusammenarbeit in der heutigen Form erst ermöglicht.[10]
3.2 Chancen und Herausforderungen
Aus der Zusammenarbeit über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg ergeben sich Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter. Dennoch dürfen auch die Herausforderungen nicht außer Acht gelassen werden. Diese sollen im Folgenden aufgezeigt werden.
Chancen
Die Teammitglieder können nach fachlicher Qualifikation ausgewählt werden und sind nicht an einen Standort gebunden. Dadurch kann ggf. schnell auf Fachpersonal zurückgegriffen werden, wenn das notwendige Know-how nicht im Unternehmen vorhanden ist.
Sofern Fachkenntnisse zu einer regionalen oder rechtlichen Thematik in einem bestimmten Land benötigt werden, können Unternehmen durch virtuelle Zusammenarbeit ihre Teams durch jeweilige Fachkräfte erweitern. Auch die unterschiedlichen Vorlieben der jeweiligen Länder können bei der Gestaltung neuer Produkte berücksichtigt werden.[11]
Durch digitale Kommunikationsmedien können Zeit und Reisekosten eingespart werden. Die Kommunikation kann ohne Zeitverzögerung erfolgen, wodurch sich gegenüber den Wettbewerbern ein Time-to-Market-Vorteil ergeben kann.[12]
Mithilfe der neuen Kommunikationstechnologien kann sichergestellt werden, dass alle Dokumente und Nachrichten, die in digitaler Form vorliegen, auch nachträglich nachvollzogen werden können. Ebenso kann die Informationsweitergabe schneller und direkt erfolgen.
Der Unternehmensstandort kann durch die standortunabhängige Arbeit der Mitarbeiter ggf. verkleinert werden. Dadurch sinken die Kosten für Büroräume sowie die Kosten für die Ausstattung der Büroarbeitsplätze. Ebenso kann das Potential von Arbeitskräften deutlich ausgeweitet werden. Die Akquisition kann deutschlandweit oder international erfolgen, wodurch die Rekrutierung effizienter wird.[13]
Virtuelle Teams stehen vor denselben Herausforderungen wie Präsenzteams, z.B. Schaffung einer klaren Zielsetzung, der richtigen Auswahl der Teammitglieder oder Vertrauensbildung. Darüber hinaus ergeben sich aus der virtuellen Zusammenarbeit zusätzliche Herausforderungen, die zwingend beachtet werden müssen:
Eine der größten Herausforderungen stellt die Vertrauensbildung zwischen Teamleiter und Team sowie unter den Teammitgliedern dar. Durch die fehlende Face-to-face-Kommunikation, ist es schwieriger Vertrauen aufzubauen, welches jedoch für eine reibungslose Zusammenarbeit essentiell ist.
Aufgrund der selteneren informellen Kommunikation dauert es länger bis sich ein Vertrauensverhältnis und das damit einhergehende „Wir-Gefühl“ aufbauen.
Sofern sich persönliche Treffen nicht vermeiden lassen, steigen insbesondere bei international zusammengesetzten Teams die Reisekosten sowie der Zeitaufwand.
Durch die Abhängigkeit von IuK-Technologien ist die Kommunikation erschwert und Nachrichten können, insbesondere in Mails oder Chats, falsch verstanden werden. die informelle Kommunikation ist durch die fehlenden indirekten Kommunikationskanäle (Körpersprache, Gestik, Mimik, Tonfall etc.) erschwert. Dadurch kann es zu Spannungen zwischen den Teammitgliedern kommen.
In der Zusammenarbeit kann es zu unterschiedlichen Wissensständen kommen, die durch die mangelnde soziale Präsenz und mangelnder Informations- und Nachrichtenzusammenhänge entstehen können.
Der Austausch in virtuellen Teams erfolgt oftmals über E-Mails, die u.U. auch inflationär verwendet werden. Dadurch kann es für die einzelnen Teammitglieder zu einer Informationsüberlastung kommen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Menge an Nachrichten die Kapazitätsgrenzen der Einzelnen übersteigen kann und somit möglicherweise Nachrichten übersehen oder gar nicht gelesen werden.[14]
Mitglieder des Teams, die einen geringen Abstimmungsbedarf aufgrund ihrer Aufgabe haben, werden möglicherweise kaum in das Team integriert.
Die Arbeitszeiten und Zielerreichung können schwerer kontrolliert werden.[15]
Erschwerend kommen Zeitdifferenzen hinzu. Diese können sich nicht nur aus den unterschiedlichen Zeitzonen der jeweiligen Teammitglieder ergeben sondern auch aus den verschiedenen Arbeitszeiten und nationalen Feiertagen. Telefongespräche und Video-Konferenzen sind damit schwieriger zu koordinieren.
In interkulturellen Teams kann es darüber hinaus zu Missverständnissen kommen, die aus Ethnozentrismus und Stereotypen erwachsen.[16] Auch die fremdsprachliche Kommunikation kann zu Fehlinterpretationen von Nachrichten und damit zu Konflikten führen.
Die zuvor beschriebenen Herausforderungen müssen so gut wie möglich reduziert werden. Dabei können folgende Aspekte hilfreich sein:
feste Kommunikationsregeln und Netiquette in E-Mails. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten sollten alle Teammitglieder diese in einem von allen zugänglichen Kalender eintragen und Abwesenheiten allen Teammitgliedern rechtzeitig mitteilen.
Kommunikations- und Vertreterregelungen können helfen dringende Entscheidungssituationen auch bei Abwesenheit des jeweiligen Entscheiders zu lösen.
3.3 Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams
Zunächst müssen die Rahmenbedingungen für virtuelle Teamarbeit abgesteckt werden. Ob diese gegeben sind, kann von vier Faktoren abhängig gemacht werden: 1. Aufgaben, 2. Mitarbeiter, 3. Organisation und 4. Arbeitsumfeld und Instrumente. Im Folgenden soll insbesondere auf die ersten zwei eigegangen werden:
Aufgaben:
Nicht jede Aufgabe eignet sich für die Bearbeitung in virtuellen Teams. Nach Konradt und Hertel sind Arbeiten umso eher dafür geeignet je,
„geringer der manuell-handwerkliche Teil ist;
Geringer die physikalischen und apparativen Anforderungen ausfallen;
Besser die Teilbarkeit einzelner Aufgaben und Aufgabenpakete gelingt, zum Beispiel hinsichtlich infrastruktureller Ressourcen, Produkte oder Produktlinien und Dienstleistungen;
Klarer eine Arbeitsleistung definiert und gemessen werden kann;
Mehr die Aufgabe ohnehin die Erzeugung und Weiterverarbeitung von Daten in digitaler Form erforderlich macht.“[17]
Mitarbeiter:
Neben fachlichen Fähigkeiten sind weitere Kompetenzen der Teammitglieder gefordert, um das Team erfolgreich zu machen. In jedem Fall müssen die Mitarbeiter selbständig arbeiten können und über Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Zudem ist die Fähigkeit zur Selbstmotivation und Flexibilität gefordert.[18] Vertrauen aufzubauen spielt hier eine wichtige Rolle. Fehlt dieses, kann es zu Missverständnissen, Misstrauen und Konflikten kommen, Daher sollten diese über interkulturelle und sprachliche Kompetenzen verfügen, um eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen.[19]
Weitere Erfolgsfaktoren wurden in einer Studie der Hay Group zusammengetragen. Diese können der nachfolgenden Grafik entnommen werden.
Abbildung 1: Erfolgsfaktoren virtueller Teams
Quelle: https://www.haygroup.com/downloads/de/Ergebnisse_Virtuelle-Teams.pdf
Neben der Auswahl der passenden Teammitglieder müssen dazu zunächst - wie für Präsenzteams auch - die Ziele, Prozesse und Rollen der Teammitglieder definiert werden. Eine gemeinsame Zielsetzung ist für das Arbeitsergebnis essentiell. In virtuellen Teams besteht die Herausforderung darin, dass sich die Teammitglieder nur über IuK-Technologien unterhalten können und der zwischenmenschliche Austausch während Pausen, auf den Fluren oder auf dem Weg zur Arbeit fehlt. Die Vorbereitung der Teammitglieder durch den Teamleiter ist daher eine wichtige Voraussetzung. Die Ziele sollten „SMART“ (spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch, terminiert) gesetzt sein, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und um den Erfolg am Ende bewerten zu können. Die sich daraus ergebenden notwendigen Arbeitsschritte müssen den Teammitgliedern zugewiesen werden. Eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung ist daher unumgänglich. Die Transparenz sorgt dafür, dass alle Teammitglieder die Ziele, Aufgaben und Prozesse verstehen und Ergebnisse erzielt werden können.[20] Daher ist der Teamleiter in der Verantwortung die Voraussetzungen für eine reibungslose Zusammenarbeit zu schaffen. Des Weiteren kommen dem Vorgesetzten weitere wichtige Aufgaben zu. Wie bereits erwähnt ist eine der größten Herausforderungen in virtuellen Teams der Aufbau von Vertrauen. Dem Vorgesetzten kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn dieser muss dazu in der Lage sein, ein Vertrauensverhältnis unter den Teammitgliedern herzustellen und zu erhalten (siehe Kapitel 3.4).
Die Organisation selbst muss die Grundlagen schaffen, um die virtuelle Teamarbeit zu ermöglichen. Zunächst muss die Personalpolitik diese Arbeitsform unterstützen und honorieren. Mitgliedern virtueller Teams müssen die gleichen Chancen zur Weiterentwicklung und Beförderung offen stehen, wie Mitgliedern von Präsenzteams. Des Weiteren müssen die Bemühungen und Erfolge der Teammitglieder angemessen belohnt werden. Da der Teamleiter die Mitglieder nicht ständig sieht, ist es wichtig, dass die Erfolgsmessung ergebnisbezogen ist und nicht die dafür geleistete Arbeitszeit und Bemühungen herangezogen werden.[21] Auch die Bereitstellung und das reibungslose Funktionieren von IuK-Technologien muss das Unternehmen gewährleisten. Die Zusammenarbeit und Kommunikation über diese Medien ist für virtuelle Teams essentiell. Daher sind ein rund um die Uhr verfügbarer technischer Support sowie Schulungen zu den bereitgestellten Systemen unerlässlich.
3.4 Die Rolle der Führung
Der Rolle der Führung kommt in virtuellen Teams eine bedeutende Rolle zu. Der Teamleiter trägt nicht nur die Verantwortung für die Ergebnisse des Teams, sondern muss auch dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit trotz fehlender Präsenz funktioniert. Im Folgenden soll der Aspekt der Führung näher betrachtet werden.
3.4.1 Bedeutung von Führung
Der Führungsbegriff ist in der Literatur nicht einheitlich definiert. Je nach Auffassung finden sich verschiedene Führungsbegriffe.[22] Des Weiteren wird häufig zwischen Führung und Management unterschieden. Nach Kotter (2008) umfasst das Management das Organisieren, Planen und Kontrollieren. Die Aufgabe der Führung hingegen ist es eine Richtung und Visionen vorzugeben, zu motivieren und zu inspirieren. Nach seiner Auffassung benötigt jedes Unternehmen sowohl Manager als auch Leader, da beide Typen unterschiedliche Aufgaben innehaben.[23] Andere Autoren trennen die beiden Begriffe nicht. Bea (2011) beschreibt vier Funktionen der Führung, die nach den Aussagen von Kotter Management und Leadership umfassen:
1. Ziele vorgeben – diese bilden die Leitlinien für Führende und Ausführende.
2. Koordinieren – verschiedene Elemente des Unternehmens müssen aufeinander abgestimmt werden und durch den Leiter koordiniert werden.
3. Motivieren – nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch der Leistungswille ist wichtig für die Erfüllung der Aufgaben. Daher ist es wichtig, dass Führungskräfte die Mitarbeiter motivieren.
4. Repräsentieren – nach außen hin vertritt die Führungskraft das gesamte Team.[24]
Zudem haben sich in den letzten Jahren die Anforderungen an Führungskräfte gewandelt. Dies ist nach Laufer (2005) auf vier Hauptursachen zurückzuführen: 1. Komplexere, sich schnell ändernde Arbeitsprozesse, 2. Sich wandelnde Wertvorstellungen, 3. Geändertes Mitarbeiterverständnis, 4. Wachsende Führungsbereiche. In der heutigen Wissensgesellschaft ist es notwendig, über Neuerungen auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Täglich ergeben sich, insbesondere auch durch den technischen Fortschritt, Veränderungen, wodurch eine ständige Erweiterung hinsichtlich des Know-hows vorgenommen werden muss. Zudem haben viele Führungskräfte die Aufgaben, die ihre Mitarbeiter ausführen, selbst gar nicht erlernt. Dadurch sind die Team- und Abteilungsleiter auf das Wissen ihrer Mitarbeiter angewiesen. Das Wissen muss ständig erneuert werden, um wertvolle Potentiale nicht an Wettbewerber zu verlieren. Auch die Wertvorstellungen haben sich geändert. Sowohl bei den Geführten als auch bei den Führenden nehmen eine möglichst ausgewogenen Work-Life-Balance und die eigene Verwirklichung eine immer höhere Stellung ein. So müssen sich Führungskräfte auch an neue Anforderungen ihres Personals anpassen und diese respektieren.[25] Dieser Aspekt spielt eine der wichtigsten Rollen im Hinblick auf die veränderten Führungsanforderungen. Mitarbeiter fordern zunehmend flachere Hierarchien und die Begegnung auf Augenhöhe mit den Leitern. Insbesondere die jüngere Generation lehnt den autoritären Führungsstil ab. Zudem steht die Persönlichkeitsentwicklung und die Gestaltungsfreiheit im Vordergrund.[26] Da die Größe der Teams und somit die Anzahl der zu führenden Personen aus Kosteneinsparungen oder einem Mangel an geeignetem Führungspersonal zunimmt, steigt auch die Verantwortung der Führungskräfte.[27]
Wie aus den vorhergehenden Ausführungen deutlich wird, sind die Anforderungen an Führungskräfte heutzutage deutlich höher als dies in früheren Generationen der Fall war. Durch geänderte Wertvorstellungen und Einstellungen der aktuellen Arbeitnehmer, wird es für Leader zunehmend schwieriger, die an sie gerichteten Ansprüche zu erfüllen.
In Hinblick auf die Leiter virtueller Teams, ergeben sich zusätzliche Aufgaben, die im Folgenden beschrieben werden sollen.
3.4.2 Aufgaben virtueller Führungskräfte
Leader virtueller Teams, sehen sich nicht nur den zuvor beschriebenen Änderungen und neuen Anforderungen gegenüber. Sie müssen darüber hinaus weitere Kompetenzen mitbringen, um diese besondere Form von Teams erfolgreich führen zu können. Neben den allgemeinen Anforderungen, wie bspw. strategische Denkfähigkeit, sind weitere Kompetenzen in virtuellen Teams von besonderer Bedeutung. Essentiell ist es eine Kultur des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen, die die Voraussetzung für die Zusammenarbeit darstellt. Auch der Umgang mit verschiedenen Generationen und Kulturen wird eine immer wichtigere Rolle spielen.[28] Führungskräfte von virtuellen Teams stehen vor denselben Herausforderungen wie Leiter von Präsenzteams. Jedoch kommt für erstere der nicht bzw. kaum vorhandene physische Kontakt erschwerend hinzu. Teamleiter stehen vor der Herausforderung die Stimmung und Anforderungen des Teams auch über die Distanz hinweg zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.[29]
Aus der Management-Perspektive können die Aufgaben, die im Zusammenhang mit virtuellen Teams stehen, in fünf Phasen unterteilt werden, wie folgender Abbildung entnommen werden kann:
Abbildung 2: Phasen und Aufgaben des Managements virtueller Teams
Quelle: (Konradt & Hertel, 2002), S.47
Die Betrachtung erfolgt hierbei auf der Managementebene. Aus Sicht der Autorin sind die darin beschriebenen Aufgaben (ausgenommen der Auswahl der Teamleiter) ebenso Aufgaben der Führungskraft und werden daher als solche aufgefasst. Die Begrifflichkeit des Managements soll aus diesem Grunde außen vor gelassen werden. Viele der in der Abbildung genannten Punkte zahlen auf den Aspekt der Vertrauensbildung ein (z.B. Kick-off Veranstaltung, Regelwerke, Förderung von Vertrauen). Dies lässt die Wichtigkeit dieses Punktes erahnen. Auch bei Malhotra et al., die sechs Faktoren nennen, die für die effektive Führung virtueller Teams notwendig sind, steht Vertrauen an erster Stelle:
„1) establish and maintain trust through the use of communication technology; 2) ensure that distributed diversity is understood and appreciated; 3) manage virtual work-life cycle (meetings); 4) monitor team progress using technology; 5) enhance visibility of virtual members within the team and outside in the organization; and 6) enable individual members of the virtual team to benefit from the team.”[30]
Folgende Ansätze können dazu dienen Vertrauen und damit eine Teamidentität aufzubauen:
Sofern möglich, sollte zu Beginn der Zusammenarbeit ein Kick-Off Termin stattfinden, zu dem sich alle Teammitglieder an einem Ort treffen. Durch ein solches Treffen, können soziale Kontakte geknüpft werden und die Mitglieder erfahren mehr über den Hintergrund des anderen. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Vertrauensbildung.[31] Ist dies nicht möglich kann es helfen, einen Steckbrief aller Teammitglieder online zu stellen, damit diese mehr über die Erfahrungen, Ausbildung und Hobbies der anderen erfahren.[32]
Es sollten Regeln geschaffen werden, nach denen Ergebnisse oder Informationen geteilt werden. Zum einen kann damit verhindert werden, dass zu viele Informationen weitergegeben werden und es zu einem sog. „information overload“ kommt. Zum anderen ist klar geregelt, wie, wann und wie häufig Mitteilungen zu verfassen sind. Zudem kann eine Netiquette für den Austausch über elektronische Medien festgelegt werden.[33]
Die Führungsrolle wandelt sich dahingehend, dass die Führungskraft stärker die Rahmenbedingungen im Blick haben muss und die strategischen Anforderungen laufend kontrollieren und organisieren muss. Neben klassischen Aufgaben, wie der Teamentwicklung und Stärkenentwicklung des Einzelnen, liegt der Fokus auch auf der Organisation und Administration der Aufgaben und Ergebnisse. „Die Führungsaufgabe muss also auf die beständige Förderung der nutzbringenden Potenziale der Teammitglieder gerichtet sein.“[34] Daher muss der Leiter eines virtuellen Teams verschiedene Fähigkeiten mitbringen, die in der folgenden Abbildung dargestellt werden.
Abbildung 3: Führungsfähigkeiten eines "Virtual Managers"
Quelle: (Riermeier, 2016)
Für den Erfolg des Teams kommt es auch entscheidend auf den Führungsstil an. Dieser Einfluss soll nachfolgend näher betrachtet werden.
3.4.3 Bedeutung des Führungsstils
Dem Führungsstil kommt bei der virtuellen Führung ebenso eine wichtige Rolle zu. Denn die Führung in Präsenzteams gestaltet sich deutlich anders als in virtuellen Teams. Wie bereits beschrieben, werden von der Führungskraft neben den allgemeinen Anforderungen zusätzliche Kompetenzen gefordert. Eine davon ist die Auswahl und die Anpassung des eigenen Führungsstils an die Gegebenheiten des virtuellen Teams.
Einige der am weitesten verbreiteten Führungsstile und ihre Anwendbarkeit in virtuellen Teams sollen nachfolgend vorgestellt werden.
Autoritärer Führungsstil
Bei der autoritären Führung liegt die Entscheidungsmacht beim Führenden. In der Theorie wird zwischen fünf Arten von Macht unterschieden:
„Legitimate Power - die Möglichkeit der Führungskraft, ihre Mitarbeiter zu beeinflussen, und die Verpflichtung der Mitarbeiter, diesen Einfluss zu akzeptieren.
Reward Power - die Möglichkeit der Führungskraft, ihre Mitarbeiter zu belohnen.
Coercive Power - die Möglichkeit der Führungskraft, ihre Mitarbeiter zu bestrafen.
Expert Power - das Wissen der Führungskraft über ein bestimmtes Gebiet.
Referent Power - die Identifikation des Mitarbeiters mit der Führungskraft.“[35]
Vorteile der autoritären Führung sind die hohe Entscheidungsgeschwindigkeit[36] und die klare Rollenverteilung. „Nachteilig ist hingegen die die mangelnde Motivation, Selbständigkeit und Entwicklungsmöglichkeit der Mitarbeiter sowie die Gefahr von Fehlentscheidungen, die möglicherweise von quantitativ oder qualitativ überforderten Vorgesetzten getroffen werden.“[37]
Für die virtuelle Führung ist dieser Führungsstil eher nicht geeignet. Da das Team nicht vor Ort ist, sind die Arbeitsergebnisse und Fortschritte nur schwer kontrollierbar. Virtuelle Führung basiert auf Vertrauen und einem hohen Maß an Selbstorganisation. Diese Aspekte stehen im Widerspruch mit dem autoritären Ansatz.
Struktureller Führungsstil
„Strukturelle Führung gestaltet Kultur, Strategie, Organisation sowie die qualitative Personalstruktur von Unternehmen oder Teams nach möglichst klaren Prinzipien.“[38] Die Führungskraft setzt Ziele, die von den Geführten in Aufgaben umgewandelt und umgesetzt werden.[39] Dieser Führungsansatz kann für virtuelle Teams zielführend sein. Nach der Untersuchung von Hoch & Kozlowski dauert es jedoch länger bis eine höhere Teamperformance erreicht wird und diese reicht nicht an die von Präsenzteams heran (vgl. Abb. 4).[40]
Partizipativer Führungsstil / geteilte Führung
Pearce & Conger definieren geteilte Führung („shared leadership“) „as a dynamic, interactive influence process among individuals in groups for which the objective is to lead one another to the achievement of group or organizational goals or both. This influence process often involves peer, or lateral, influence and at other times involves upward or downward hierarchical influence.”[41] Die Verantwortung wird dabei unter den Teammitgliedern aufgeteilt. Für virtuelle Teams eignet sich dieser Ansatz besonders, da die Aufgaben innerhalb des Teams verteilt werden und somit jedes Teammitglied die Verantwortung für seinen Bereich trägt.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Untersuchungsergebnisse der Studie von Hoch & Kozlowski und die Einwirkung des Führungsstils auf die Teamperformance in virtuellen Teams und Präsenzteams.
Abbildung 4: Führungsansätze im Vergleich
Quelle: (Riermeier, 2016)
Obwohl in der Literatur zwischen unzähligen Führungsstilen unterschieden wird, finden sich nur wenige Hinweise darauf, welcher Führungsstil bei virtuellen Teams am geeignetsten ist. Konrad Fassnacht geht in seinem Lernskript auf die delegativen und partizipativen Managementkonzepte ein, die sich am erfolgversprechendsten erwiesen haben. Deren Ansatzpunkt besteht darin, dass die Aufgaben den Mitarbeitern übertragen werden und selbständig durchgeführt werden.[42] Auch die Untersuchung von Hoch und Kozlowski sieht den geteilten Führungsansatz als den mit dem höchsten Potential an.[43]
Im Kontext der virtuellen Führung taucht immer wieder der Begriff „E-Leaderhip auf“. Avolio und Kahai definieren diese Form der Führung „as a social influence process mediated by AIT[44] to produce a change in attitudes, emotions, thinking, behavior and/or performance with individuals, groups and/or organizations.”[45] Auch hier wird die Meinung vertreten, dass der Führungsstil über die Zeit hinweg zu einer geteilten Führung entwickeln kann.[46]
4. Persönliche Reflexion und Fazit
Virtuelle Teamarbeit stellt Führungskräfte und Teammitglieder vor verschiedene Herausforderungen. Die Zusammenarbeit kann durch die fehlende soziale Präsenz, kulturelle Unterschiede, Zeitdifferenzen und die Abhängigkeit von Technologien deutlich erschwert werden. Nichtsdestotrotz bietet die virtuelle Kollaboration viele Vorteile, die aus Sicht der Autorin in Zukunft immer wichtiger werden. Durch die zunehmende Globalisierung ist eine Vernetzung globaler Teams für Unternehmen unausweichlich. Die Erschließung neuer Märkte kann durch den Zusammenschluss international agierender Teammitglieder wesentlich einfacher erfolgen. Der Zugang zu ausländischen Märkten wird durch die Kenntnisse der Mitarbeiter vor Ort vereinfacht. Ebenso kann die Gestaltung der Produkte an den Geschmack und die Vorlieben der Bewohner des Landes angepasst werden. Das dazu nötige Know-how muss nicht erst aufgebaut, sondern kann durch das Teammitglied eingebracht werden.
Doch nicht nur für internationale Teams wird aus Sicht der Autorin die virtuelle Zusammenarbeit in Zukunft eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. Auch die nationale Zusammenarbeit wird sich verändern. Nachdem jahrelang eine größtmögliche Mobilität von Arbeitskräften gefordert wurde, könnte sich dieser Aspekt durch den Einsatz von IuK-Technologien wieder wandeln. Durch diese Entwicklung werden insbesondere Pendler entlastet, die aus bestimmten Gründen nicht umziehen können oder wollen. Dank der Einsparung der Zeit auf dem Weg zur Arbeit erhöht sich der Freizeitwert für diese spürbar. Die Work-Life-Balance ist dadurch deutlich ausgeglichener. Denkt man diesen Aspekt weiter, können dadurch Straßen entlastet und die Umwelt durch weniger Treibhausgase geschont werden. Doch nicht nur für Arbeitnehmer bietet diese Entwicklung Vorteile. Sondern auch Arbeitgeber können von der virtuellen Zusammenarbeit profitieren. Für Unternehmen, die ihren Sitz nicht in einem Ballungsgebiet haben, ist es oftmals schwierig geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Die Attraktivität des Standortes ist für viele Arbeitnehmer ein wichtiger Entscheidungsgrund sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Aufgrund der Tatsache, dass ein Umzug durch virtuelle Teamarbeit nicht zwingend erforderlich ist, ergeben sich für Unternehmen neue Arbeitnehmerpotentiale, die ihnen sonst womöglich nicht zur Verfügung gestanden hätten. Insbesondere in Branchen, in denen es nicht notwendig ist, dass die Zusammenarbeit am physikalisch gleichen Ort erfolgt, ist dieser Aspekt leicht umsetzbar. Ebenso profitieren Unternehmen mit vergleichsweise unattraktivem Standort bei Aufgabenbereichen mit stark umkämpften Fachkräften wie beispielsweise in der IT-Branche. Nach Meinung der Autorin, ist dies ein immer wichtiger werdender Punkt. Durch den Fachkräftemangel nimmt der „War for Talents“ weiter zu. Diese können sich aussuchen, bei welchem Unternehmen und an welchem Ort sie arbeiten wollen. Da der Zulauf in den Metropolen Deutschlands, wie München, Berlin oder Hamburg in den letzten Jahren immer größer wird, fehlen vor allem in den ländlichen Regionen Arbeitskräfte. Durch den Einsatz von IuK-Technologien sowie der Bildung virtueller Teams, kann dieser Entwicklung aus Sicht der Autorin zum Teil entgegengewirkt werden.
Bislang ist diese in Deutschland jedoch noch wenig zu beobachten. Viele Unternehmen halten häufig an alten Strukturen fest und sind skeptisch gegenüber diesen neuen Arbeitsformen. Dies erschwert es nicht nur Arbeitnehmern, die teilweise weite Strecken pendeln müssen, sondern auch den Unternehmen selbst, Potentiale für neue Fachkräfte zu erschließen.
Wünschenswerte wäre daher ein Umdenken in den Köpfen der Unternehmens- und Personalentscheider. Ein schrittweises Vorgehen könnte helfen, sich mit den neuen Arbeitsformen vertraut zu machen.
In Deutschland fehlen laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens PAC unter 152 Führungskräften in kleinen, mittleren und großen Unternehmen die notwendigen Rahmenbedingungen für virtuelle Zusammenarbeit. Die angeführten Gründe sind fehlende bzw. eingeschränkte mobile Nutzungsmöglichkeiten, Überforderung mit der Anwendung und Probleme mit der Integration der Vielzahl an Anwendungen. Jedoch finden 70% der befragten, dass diese Kooperationsform an Bedeutung gewinnt. Der Großteil ist davon überzeugt, dass sich aus einer effektiven Zusammenarbeit enormes Verbesserungspotential in Bezug auf Abläufe und Prozesse sowie dem Innovationspotential ergeben würde.[47] Aus diesen Aussagen lässt sich ableiten, dass zwar der Wunsch nach virtueller Zusammenarbeit in Deutschland gegeben ist, jedoch noch deutliche Hürden bestehen, dieses Vorhaben in die Realität umzusetzen. Trotz der Investitionen in sogenannte Cloud-Lösungen haben es viele deutsche Unternehmen verpasst die Mitarbeiter auf diese Form der Arbeit vorzubereiten. Aus dieser verzögerten Entwicklung können sich Wettbewerbsnachteile entstehen, da ausländische Unternehmen ihre Ausrichtung auf virtuelle Kollaborationen bereits früher fokussiert und erfolgreich umgesetzt haben. Da viele Führungskräfte in Deutschland das Potential virtueller Teams bereits erkannt haben, bleibt zu hoffen, dass diese die Entwicklung und den Ausbau weiter vorantreiben und die Unternehmen für die Zukunft rüsten.
Für die Führungskräfte stellt diese Entwicklung eine große Herausforderung dar. Neben den allgemeinen Führungsaufgaben, wie beispielsweise der Motivation von Mitarbeitern, der Delegation von Aufgaben oder der Entwicklung der Teammitglieder, kommen weitere Anforderungen auf sie zu. Die wichtigste Aufgabe ist dabei Vertrauen aufzubauen und zu motivieren. Dafür müssen sie auch über die Distanz hinweg Bedürfnisse erkennen, klare Ziele setzen, Feedback geben können und selbst eine hohe Vertrauensbereitschaft besitzen. Dabei kann es vorkommen, dass u.U. nicht nur Präsenzteams, sondern auch virtuelle Teams gleichzeitig zu führen sind. In diesen beiden Fällen müssen ggf. unterschiedliche Führungsstile zum Tragen kommen. Daher bedarf es einer entsprechenden Vorbereitung und Ausbildung der Teamleiter. Somit kann eine adäquate Betreuung aller Teammitglieder sichergestellt werden.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Anforderungen an Führungskräfte virtueller Teams von denen von Präsenzteams unterscheiden. Da die Teammitglieder virtueller Teams von sich aus viel selbständiger arbeiten müssen als Mitarbeiter vor Ort stellt sich die Frage, ob es überhaupt der Führung bedarf. So wird Führung zum einen in der Literatur unterschiedlich definiert. Zum anderen gibt es in unterschiedlichen Kulturen verschiedene vorherrschende Führungsstile, die ggf. auch von dem jeweiligen Teammitglied erwartet werden. Die Führungskraft steht also vor folgenden Fragen: Ist Führung in einem virtuellen Team überhaupt notwendig? Welcher Führungsstil ist angebracht? Sind kulturelle Erwartungen hinsichtlich des Führungsstils vorhanden und wie können diese befriedigt werden? Nach Meinung der Autorin sind dies sehr relevante Aspekte, die zum Erfolg des virtuellen Teams beitragen. Die Frage, welche Eigenschaften die Führungskraft eines virtuellen Teams mitbringen sollte, kann aus Sicht der Autorin wie folgt beantwortet werden: Da Vertrauen das höchste Gut der Teamentwicklung ist, sollte die Führungskraft zum einen empathisch sein, um auf die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder und des Teams als Ganzes eingehen zu können. Zum anderen ist es wichtig, dass die Führungskraft Verantwortung abgeben kann und darauf vertraut, dass die Mitglieder ihre Aufgaben selbstverantwortlich bearbeiten. dieses Vertrauensverhältnis sollte sich auch im Führungsstil spiegeln. Ein hohes Maß an Kontrolle kann nach Meinung der Autorin nicht zielführend und erfolgversprechend sein. Der in der Literatur vorgefundene Ansatz der geteilten Führung ist auch aus Sicht der Autorin geeignet, um das beste Ergebnis zu erzielen. In der Umsetzung sollte jedes Teammitglied einen Aufgabenbereich zugewiesen bekommen, für den es die Verantwortung trägt. In der Abstimmung entstehen somit kaum Interessenskonflikte. Der Leiter des Teams hat dabei vorwiegend koordinierende und motivierende Aufgaben. Mitarbeiter motivieren zu können ist ebenfalls eine wichtige Eigenschaft, über die die Führungskraft eines virtuellen Teams verfügen sollte. Der fehlende (Sicht-) Kontakt, kann u.U. zu einer geringeren Motivation führen worunter die Arbeitsergebnisse leiden können. Aus diesem Grund muss die Führungskraft das Ziel der Zusammenarbeit in einer Vision darstellen, die immer wieder in die Erinnerung der Teammitglieder gerufen werden sollte. Das Wissen, warum etwas gemacht wird, hilft oft schon, um einen neuen Motivationsschub zu bringen.
Abschließend lässt sich sagen, dass Führungskräfte offen sein sollten, für neue Formen der Zusammenarbeit, Einfühlungsvermögen besitzen sollten – auch über räumliche Grenzen hinweg, ihren Teammitgliedern Vertrauen entgegen bringen sowie Vertrauen unter den Mitarbeitern schaffen sollen. Dies sind mitunter die wichtigsten Aspekte für die virtuelle Zusammenarbeit.
5. Literaturverzeichnis
Akin, N., & Rumpf, J. (2013). Führung virtueller Teams. HayGroup.
App, S. (2013). Virtuelle Teams. Haufe Lexware.
Avolio, B. J., & Kahai, S. (2003). Placing the "E" in E-Leadership. In S. E. Murphy, & R. E. Riggio, Th Future of Leadership Development (S. 49-70). Mahwah: Lawrence Earlbaum.
Bea, F. X., & Schweitzer, M. (2011). Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Bd. 2: Führung. Stuttgart: UTB.
Duarte, D. L., & Snyder, N. T. (2001). Mastering Virtual Teams. San Francisco: Jossey Bass.
Eichenberg, T. (2007). Distance Leadership. Springer Verlag.
Enste, D. H., Eyerund, T., & Knelsen, I. (kein Datum). Führungsstile und gesellschaftliche Megatrends im 21. Jahrhundert. Roman Herzug Institut.
Fassnacht, K. (2010). Grundlagen virtueller Teamarbeit. FCT Akademie GmbH.