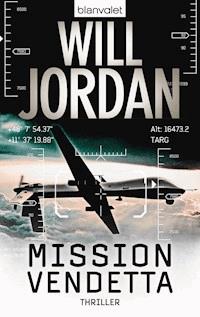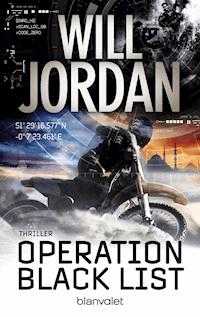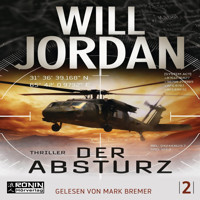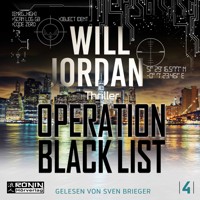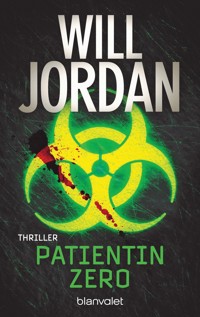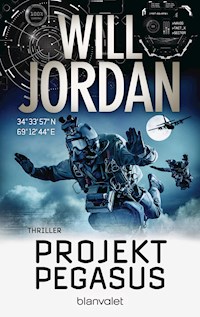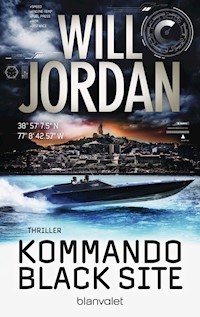9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ryan Drake Series
- Sprache: Deutsch
Das unglaubliche Finale des erfolgreichen CIA-Krachers: unerwartete Wendungen und ein nie dagewesenes Action-Feuerwerk!
Der ehemalige CIA-Operator Ryan Drake ist fest entschlossen, die finsteren Machenschaften des Circles zu beenden. Dazu kommt, dass sein Erzfeind Marcus Cain ebenfalls ein Mitglied dieser Geheimgesellschaft ist. Ohne sein Team – auf sich gestellt – hat Drake kaum eine Chance auf Erfolg. Aber er wird lieber sterben, als Cain und den Circle davonkommen zu lassen. Doch kurz bevor Drake sein Ziel erreicht hat, erhält er neue Informationen, die alles in Frage stellen, woran er glaubt. Ist es möglich, dass all seine Pläne auf Lügen basieren?
Die komplette Action-Serie um CIA-Operator Ryan Drake:
1. Mission: Vendetta
2. Der Absturz
3. Gegenschlag
4. Operation Blacklist
5. Codewort Tripolis
6. Das CIA-Komplott
7. Kommando Black Site
8. Projekt Pegasus
9. Angriffsziel Circle
Alle Bücher sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Der ehemalige CIA-Operator Ryan Drake ist fest entschlossen, die finsteren Machenschaften des Circles zu beenden. Dazu kommt, dass sein Erzfeind Marcus Cain ebenfalls ein Mitglied dieser Geheimgesellschaft ist. Ohne sein Team – auf sich gestellt – hat Drake kaum eine Chance auf Erfolg. Aber er wird lieber sterben, als Cain und den Circle davonkommen zu lassen. Doch kurz bevor Drake sein Ziel erreicht hat, erhält er neue Informationen, die alles infrage stellen, woran er glaubt. Ist es möglich, dass all seine Pläne auf Lügen basieren?
Autor
Will Jordan lebt mit seiner Familie in Fife in der Nähe von Edinburgh. Er hat einen Universitätsabschluss als Informatiker. Wenn er nicht schreibt, klettert er gerne, boxt oder liest. Außerdem interessiert er sich sehr für Militärgeschichte.
Die Ryan-Drake-Romane bei Blanvalet:
1. Mission: Vendetta
2. Der Absturz
3. Gegenschlag
4. Operation Blacklist
5. Codewort Tripolis
6. Das CIA-Komplott
7. Kommando Black Site
8. Projekt Pegasus
9. Angriffsziel Circle
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag
und www.facebook.com/blanvalet
WILL JORDAN
ANGRIFFSZIEL
CIRCLE
Thriller
Aus dem Englischen
von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Something to die for (Ryan Drake 9)« bei Canelo, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Will Jordan
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Coverdesign: © Johannes Frick unter Verwendung
von Motiven von Colin Anderson Productions pty ltd/DigitalVision/
Getty Images und iStock.com (© LeoPatrizi, © Tetiana Lazunova, © Pixtum)
HK · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-26648-6V001
www.blanvalet.de
Für alle, die an mich geglaubt haben
Abbottabad, Pakistan – 1. Mai 2011
Es war eine ruhige Nacht mit einer leichten Brise bei sternklarem Himmel in der Vorstadt von Abbottabad im Nordosten Pakistans. Schwach schimmerte das Mondlicht und warf seinen fahlen Schein auf eine anmutige Landschaft mit kleinen bebauten Feldern, schnell fließenden Flüssen und frühlingshaft blühenden Bäumen. Die Straßen waren menschenleer, die Fensterläden geschlossen, und die Bewohner lagen in tiefem Schlaf.
Die meisten Anwesen in diesem Bezirk hatten eine stattliche Größe und eine solide Bausubstanz. Sie gehörten Akademikern, wohlhabenden Händlern und reichen Unternehmern. Es war eine beliebte, begehrte und dennoch ziemlich unauffällige Gegend.
Doch etwas war seltsam in dieser langweilig gleichförmigen Vorstadt. Am Ende eines Feldwegs und etwas abseits von den Nachbarn gelegen, fiel ein Anwesen aus der Reihe. Es bestand aus mehreren kleineren, über ein weitläufiges, dreieckiges Grundstück verstreuten Gebäuden. Sie waren alle aus denselben Materialien gebaut und ähnelten den Häusern auf den Nachbargrundstücken weitestgehend.
Aber es waren die Details, durch die sich die Gebäude unterschieden. Die zur Abwehr von Dieben mit Stacheldraht versehenen Außenmauern waren höher, als man es üblicherweise für nötig hielt; sie erreichten stellenweise fünfeinhalb Meter.
Auch das Hauptgebäude war größer als üblich, selbst bei Großfamilien, wie sie für die pakistanische Kultur typisch sind. Vor wenigen Jahren war ein zweites Stockwerk mit einem separaten Balkon aufgesetzt worden. Die Besitzer schienen großen Wert auf Privatheit zu legen. Das Hauptgebäude hatte nur wenige Fenster, und die, die es gab, wurden selten geöffnet.
Die Bewohner verließen das Anwesen nur sporadisch und nahmen nicht am Leben der Gemeinde teil. Sie redeten nicht mit den Nachbarn, ließen ihre Kinder nicht zum Spielen nach draußen und keine Fremden herein.
Das Waziristan Haveli, wie man das Anwesen hinter vorgehaltener Hand nannte, war einer jener Orte, die Spekulationen und Klatsch anheizten. In der Nachbarschaft wurde von dunklen Geschäften, illegalem Drogenhandel und Geldwäsche gemunkelt. Manche verstiegen sich sogar zu der wilden Theorie, dass das Anwesen einem berühmten Schauspieler oder Prominenten als diskreter Rückzugsort diente.
Doch alle Spekulationen brachten nichts. Die Bewohner von Waziristan Haveli mochten unnahbar und geheimnisvoll sein, aber sie ließen sich nichts zuschulden kommen, nichts, was ihre Nachbarn gegen sie aufgebracht hätte.
Sollen sie doch in Ruhe hinter ihren hohen Mauern leben, wenn sie das wollen, lautete das philosophische Urteil der Männer in den örtlichen Teestuben. Jeder hat das Recht auf Privatsphäre. Und solange er keinen Ärger macht, geht es keinen was an.
Keiner von ihnen hat wissen können, dass Waziristan Haveli, noch bevor die Nacht zu Ende ging, einer der bekanntesten und berüchtigtsten Orte der Welt werden würde.
Es begann mit einem leisen, rhythmischen Klopfen aus nordwestlicher Richtung, das zunächst fast unhörbar war und sich unter die Geräusche der nahen Schnellstraße mischte. Doch anstatt allmählich leiser zu werden, bis die Nacht es vollends verschluckte, wurde das Geräusch zunehmend lauter.
Ein streunender Hund, der ganz in der Nähe in einem ausgetrockneten Abwasserrohr geschlafen hatte, regte sich und blickte in den Nachthimmel hinauf, als plötzlich zwei große schwarze Schatten mit heulenden Turbinen über ihn hinwegrauschten und einen Luftsog verursachten, der Staub und herumliegenden Abfall aufwirbelte. Der Hund zog erschrocken den Schwanz ein, kläffte ängstlich und huschte in die Nacht hinaus.
Die beiden schwer bewaffneten Black-Hawk-Transporthelikopter waren mit Tarnvorrichtungen versehen, die ihre Geräuschemissionen und ihr Radarprofil minimierten. Über Waziristan Haveli verringerten sie die Flughöhe. Einer ging über dem größeren Hof in Position, während sich der andere anschickte, im entfernteren nordöstlichen Winkel des Grundstücks zu landen.
Im ersten Black Hawk befand sich ein zwölfköpfiges, schwer bewaffnetes Team von US-SEALs, das sich für ihren Einsatz fertig machte. Die Männer hatten sich wochenlang unermüdlich auf diesen Moment vorbereitet, und sie kannten jedes Detail des ausgefeilten Angriffsplans auswendig.
Die Lukentür zur Passagierkabine wurde aufgeschoben, und Seile für den Schnellabstieg wurden abgeworfen. Die ersten Männer gingen in der Ausstiegsluke auf Position, um sich abzuseilen. Von da an ging alles schief.
Die Abwinde der mächtigen Hauptrotoren der Black Hawks wirbelten im Hof Unmengen von Staub auf. Normalerweise wäre das unproblematisch gewesen, aber die hohen Schutzmauern des Anwesens verhinderten, dass sich die Abwinde verteilen konnten, wodurch ein gefährlicher Luftwirbel entstand, der den Black Hawk nach unten zog.
Der Pilot versuchte, die Höhe zu halten, als das Heck des Helikopters nach Backbord schwenkte und an die Außenmauer schlug. Ein heftiger Knall ließ den Rumpf erzittern, und eines der Heckrotorblätter wurde glatt abgetrennt. Durch die plötzliche Veränderung der komplexen dynamischen Kräfte, die ihn in der Luft hielten, aus dem Gleichgewicht gebracht, begann der Hubschrauber gefährlich zu schlingern. Sirenen heulten auf, und die Männer in der Mannschaftskabine klammerten sich an die Haltegurte, um nicht aus der offenen Luke geschleudert zu werden.
Dem Piloten blieben nur wenige Sekunden für die einzig mögliche Reaktion. Er schob den Steuerknüppel ganz nach vorn, um den beschädigten Hubschrauber zu einer halbwegs kontrollierten Bruchlandung zu zwingen. Der Aufprall zerstörte eine der Landekufen und ließ den Hubschrauber in einem ungünstig schiefen Winkel aufsetzen, doch er wurde dabei wenigstens nicht zerrissen.
Und auch die Männer in seinem Innern nicht, was noch wichtiger war.
Vom Absturz durchgerüttelt und schockiert, fasste sich der Sturmtrupp eiligst, sprang aus dem zerstörten Hubschrauber und rückte über den offenen Hof vor, um die Mission trotz des missglückten Starts durchzuziehen. In den umliegenden Gebäuden gingen Lichter an, weil die Bewohner, vom Krach und der Unruhe geweckt, aus ihren Betten stolperten und das Spektakel begafften.
Die SEALs beachteten sie nicht weiter, schwärmten mit angelegten und schussbereiten Waffen vor dem Gebäude aus. Eine zweite Einheit löste sich, um ein kleineres Gebäude auf der Südseite des Hofes zu stürmen, während Teams aus dem anderen Hubschrauber rasch die inneren Verteidigungsmauern überwanden. Gleichzeitig rückte die Hauptmacht auf die zentrale, zweigeschossige Residenz vor.
Dort sollte sich ihre Zielperson aufhalten.
An der Tür wurden Sprengladungen befestigt, die eine knappe Sekunde später lautstark detonierten. Die Druckwelle zerschmetterte die Fenster bis zu den oberen Stockwerken.
»Achtung: Flash!«, schrie der Teamführer und schleuderte eine Blendgranate durch die qualmende Türöffnung. Dann ging er in Deckung.
Der Explosionsblitz der Granate wurde von einem ohrenbetäubenden Knall begleitet, der das Haus in seinen Grundfesten zu erschüttern schien.
»Los! Los!«
Der erste, aus drei Männern bestehende Sturmtrupp ging sofort hinein, ihre Nachtsichtgeräte tauchten das dunkle Innere in ein gespenstisches Grün. Durch ihre Venen pumpte jetzt eine Überdosis Adrenalin, das ihre Sinne schärfte, während sie weiter ins Haus vordrangen.
Das war der wichtigste Einsatz ihres Lebens.
Erste Tür rechts. Ein einziger fester Tritt, dann krachte sie auf. Eine Frau und zwei Kinder schrien vor Angst.
»Runter!«, brüllte einer der SEALs. »Runter auf den Boden!« Es waren Zivilisten. Unbewaffnet. Sie stellten keine Bedrohung dar, trotzdem stieß einer der SEALs die Frau zu Boden und fesselte ihr die Hände auf den Rücken. Auch Zivilisten konnten eine Handgranate werfen oder eine Sprengstoffweste zünden.
»Der Raum ist gesichert! Nach oben!«
Das Team stürmte weiter. Aus den anderen Räumen drangen Schreie und Rufe. Überall Chaos und Verwirrung. Die Luft war geschwängert von ätzendem grauem Qualm.
Plötzlich dröhnte zu ihrer Linken das ohrenbetäubende Knattern von Automatikwaffen, und eine Tür zersplitterte, weil sie von einer Salve 7,62mm-Geschosse aus einer Kalaschnikow durchschlagen wurde. Der nächste SEAL ließ sich instinktiv auf die Knie fallen und entging so dem tödlichen, aber ungenauen Dauerfeuer. Der heftige Rückstoß der AK-47 verriss den Gewehrlauf, was die Projektile oft nach oben lenkte.
Als Reaktion folgten Feuerstöße aus zwei HK416-Sturmgewehren, bei denen es solche Probleme nicht gab. Man hörte einen Schrei und einen schweren Schlag, als ein Körper zu Boden ging.
Die SEALs verschafften sich gewaltsam Einlass und fanden einen Mann mittleren Alters mit einem langen Bart, der ausgestreckt auf dem Boden lag. Blut aus drei Schusswunden befleckte sein weißes Nachtgewand. Er versuchte vergeblich, nach seiner heruntergefallenen Waffe zu greifen.
Ein zweiter Feuerstoß machte seinen Bemühungen ein Ende.
»Tango ausgeschaltet!«
Der restliche Sturmtrupp drang über die Haupttreppe in das Obergeschoss vor. Der Puls der Männer hämmerte, ihre Körper waren wie elektrisiert. Sie waren ganz nah dran. Der Mann, den sie so lange gejagt hatten, war jetzt nur noch wenige Meter entfernt.
Leise tappende Schritte auf dem oberen Treppenabsatz ließen sie erstarren. Sie warteten und lauschten, richteten die Waffen auf die verschlossene Tür am oberen Treppenabsatz.
Dann öffnete sich die Tür ganz langsam, und sie sahen eine große, schlanke Gestalt in einem weiten Nachthemd. Der grau gesträhnte Bart reichte dem Mann bis zur Brust, sein ausgedünntes Haar war zerwühlt. Er spähte zur Treppe, und einen Wimpernschlag lang blieb sein Blick auf dem SEAL-Team unten haften.
Dann ging alles so schnell, dass alle Beteiligten später Schwierigkeiten hatten, den genauen Ablauf zu schildern. Der Anführer des SEAL-Teams legte in dem Moment das Sturmgewehr an, als sich die Zielperson ins Zimmer zurückziehen wollte, und stieß ein einziges Wort aus:
»Kontakt.«
Gleichzeitig gab er eine kurze Salve ab. Die Waffe ratterte an seiner Schulter, und die Tür barst in einem Schauer von Holzsplittern.
Sie hörten den schweren Schlag, mit dem ein Körper auf die Bodendielen fiel, und gleichzeitig Schreie von Frauen.
»Tango ausgeschaltet!«
»Rauf da! Los!«
Das Dreierteam hastete die Treppe hinauf und drang oben in das Zimmer ein. Sie mussten die Tür aufdrücken, weil der Verwundete dahinter lag und sie mit seinem Gewicht blockierte. Im Inneren stießen sie auf zwei Frauen, die bei der Zielperson kauerten, schrien und klagten. Es waren die Ehefrauen, die ihren sterbenden Gatten beweinten.
»Auf den Boden! Runter jetzt!«
Da sprang eine der Frauen hoch und sprang auf das Team zu. Ein einzelner Schuss knallte, sie stürzte und schrie vor Schmerz. Aus einer Wunde an ihrem Oberschenkel sickerte Blut.
Vorwärts stürmend packte einer der SEALs die andere Frau und schleuderte sie zur Seite. Jetzt konnte das Team zum ersten Mal einen richtigen Blick auf die Zielperson werfen. Der Mann, dessen Gesicht sie über ein Jahrzehnt lang in unzähligen Nachrichtensendungen und auf Websites gesehen hatten. Der Mann, der für den Tod von Tausenden ihrer Landsleute verantwortlich war.
Jetzt lag er ausgestreckt vor ihnen auf dem Boden, aus seinem Nachthemd sickerte Blut, seine Atmung war ein kurzes, ersticktes Keuchen, das Gesicht schmerzverzerrt. Er hatte den Blick eines in die Ecke getriebenen Tieres. Diese Männer waren nur seinetwegen gekommen.
Einen kurzen, unheimlichen Moment lang schien die Zeit stillzustehen. Die drei SEALs starrten auf ihre Zielperson und waren von der Kraft und der Bedeutung dieses Augenblickes überwältigt. Alles, wofür sie trainiert, alles, worauf sie sich vorbereitet hatten, fand hier seine Erfüllung.
Es war der wichtigste Moment ihres Lebens.
Dauerfeuer dröhnte durch den Raum, als zwei der SEALs gleichzeitig das Feuer eröffneten. Der Mann auf dem Boden zuckte und krümmte sich, als die Kugeln seinen Körper zerrissen. Ein letztes Keuchen, dann rührte er sich nicht mehr.
Die Männer senkten die Waffen, kräuselnd stieg Qualm aus den Gewehrmündungen. Keiner von ihnen sagte ein Wort. Sie hatten gerade Geschichte geschrieben.
Der Leiter des Stoßtrupps ergriff jetzt die Initiative, schaltete das Funkgerät ein und gab ruhig die chiffrierte Meldung durch, die sie für diesen Augenblick einstudiert hatten.
»Für Gott und Vaterland – Geronimo, Geronimo, Geronimo.«
Ihre Mission war erfüllt. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, der meistgesuchte Mensch auf Erden, war tot.
TEIL EINS
WOFÜR ZU
LÜGEN LOHNT
Manchmal lügen die eigenen Ängste mehr
als alles andere auf der Welt.
Rudyard Kipling
1
Nordwales, Vereinigtes Königreich – zwei Monate zuvor
Ryan und Jessica Drake standen beide sprachlos und wie angewurzelt da. Ringsum hielt alles erwartungsvoll den Atem an, selbst der Wind schien sich zu legen, als Bruder und Schwester einander gegenüberstanden und sich musterten.
Fast zwei Jahre waren vergangen, seit Drake zum letzten Mal an dieser Schwelle gestanden hatte. Zwei Jahre, seit er seine Schwester in dem Wissen zurückgelassen hatte, dass er sie wahrscheinlich niemals wiedersehen würde. Er hatte sich eingeredet, dass es zu ihrem eigenen Schutz geschehe, und dass er ihr bereits genug zugemutet habe. Dass sie ihm, wo er hinging, nicht folgen könne.
Und doch – jetzt war er hier. Nach all den Schlachten, die er geschlagen, den Feinden, die er überwunden, den Freunden, die er verloren, und den schrecklichen Geheimnissen, die er aufgedeckt hatte, war er wieder da.
Unwillkürlich betrachtete er die Frau, die, solange er denken konnte, ein Teil seines Lebens gewesen war, und verglich das Gesicht vor ihm mit jenem in seiner Erinnerung.
Körperlich hatte sie sich kaum verändert. Ihr dunkles Haar war kürzer geschnitten und anders gestylt, außerdem war sie nach einem Winter voller kalter Tage und langer Nächte ziemlich blass. Aber sie hatte immer noch jene schlaksige Figur, die über ihren athletischen Körperbau hinwegtäuschte, dieselben Gesichtszüge, die ihn von Jahr zu Jahr stärker an ihre Mutter erinnerten, und dieselben Augen, deren Farbe und Form seinen eigenen Augen glich.
Ihr Äußeres mochte unverändert geblieben sein, doch was hinter ihnen lag, hatte die beiden Geschwister verändert.
Die Sekunden dehnten sich, die Stille wurde angespannt und belastend. Um die Beklemmung zu überwinden, wagte sich Drake vor.
»Jessica, ich …«
Als er sah, wie sie ausholte, versteifte er sich; der Schlag klatschte ihm heftig ins Gesicht und war fester als erwartet. Danach brannte seine Wange.
Er versuchte nicht, den Schlägen auszuweichen oder ihnen zu entkommen, und ebenso wenig, sie davon abzuhalten, mit den Fäusten um sich zu schlagen, als es plötzlich aus ihr herausplatzte und sie ihn in einem Wutanfall überall zu schlagen und boxen versuchte, wo sie ihn treffen konnte. Stattdessen erduldete er die Schläge, denn er wusste, dass sie das alles herauslassen musste. Irgendwann hatte sie sich verausgabt und sank ihm schluchzend und zitternd in die Arme.
Drake sagte kein Wort. Das hatte Zeit. In diesem Moment reichte es, sie weinen zu lassen.
Einige Zeit später saß Drake am Küchentisch und betrachtete das schwache Licht der Februarsonne durch den Dampf, der kräuselnd aus seinem Tee aufstieg. Der Tisch, an dem er saß, war alt, schwer und solide. Es war ein schlichtes, unbehandeltes Möbelstück einfacher Machart.
In solcher Umgebung und mit solchen Möbeln war er aufgewachsen. Es hätte ihm vertraute Geborgenheit vermitteln sollen, aber stattdessen fühlte es sich fremdartig und unnatürlich an.
Auf der gegenüberliegenden Tischseite lag eine Zeitung mit Aufmacherfotos vom Bürgerkrieg, der gerade in Libyen ausbrach. Der sogenannte Arabische Frühling hatte sich inzwischen im größten Teil Nordafrikas ausgebreitet und drohte bis in den Nahen Osten hinein mit Umsturz. Die Aufnahmen waren eine erschreckende Erinnerung an die Mission, die Drake hierhergeführt hatte.
»Ich dachte, du wärst tot.«
Drake hob den Blick und sah Jessica an. Sie lehnte sich auf der anderen Seite des Zimmers an den Küchentresen. Ihre Finger umklammerten den Becher. Sie war blass, die Augen gerötet vom Weinen. Es waren die ersten Worte, die sie gesprochen hatte, seit sie an der Türschwelle endlich von ihm abgelassen hatte und hineingegangen war. Sie hatte Platz und Abstand gebraucht, um das Problem klarer sehen zu können.
Das Problem war in diesem Fall er selbst.
»Ich weiß.«
»Ich habe um dich getrauert. Habe mir eingeredet, dass du nicht mehr lebst.« Sie stockte und fasste sich wieder, weil ihre Stimme zu brechen drohte. »Ich habe mich gezwungen, es zu akzeptieren, obwohl es so wehtat. Das war besser, als zu fürchten, dass du noch lebst, und mich immer wieder zu fragen, wo du bist und was du gerade durchmachst.«
»Jess, ich …«
»Die Dinge, die sie über dich in den Nachrichten gesagt haben … Die Autobombe in Washington. Diese Fabrik in Brasilien …«
»Das war ich nicht«, sagte Drake entschieden.
Natürlich steckte hinter der Geschichte noch viel mehr, als er ihr sagen konnte, doch was er sagte, war nicht gelogen.
»Aber du hattest etwas damit zu tun.«
Er seufzte. »Ja.«
Jessica betrachtete ihn stumm mit besorgter Miene. Sie verstand, dass ihr Bruder in einer dunklen Welt lebte, und sie wusste, weshalb er zwei Jahre zuvor hatte untertauchen müssen. Sie war sogar selbst einmal ins Kreuzfeuer geraten.
»Was zur Hölle ist dir passiert, Ryan?«
Drake schüttelte den Kopf. »Das ist eine lange Geschichte.«
»Ich habe viel Zeit«, sagte sie und wies mit einer Geste auf ihre isolierte Umgebung.
»Aber ich nicht.«
Er konnte buchstäblich spüren, wie der Hoffnungsfunke in ihr erlosch und sie sich wieder verschloss. »Warum bist du dann hier?«
»Freya.«
Er brachte es nicht über sich, das Wort »Mutter« zu verwenden.
»Was ist mit ihr?«
»Sie hat dabei eine Rolle gespielt«, erklärte er. »Diese Sache, in die wir alle verstrickt sind – Cain, Anya, die Agency, das alles; sie hat für die Leute gearbeitet, die dahinterstecken. Deshalb wurde sie umgebracht.«
Jessica drückte den Rücken durch; was sie hörte, ging ihr sichtlich nahe. Freyas Ermordung vor zwei Jahren hatte einendunklen Schatten über ihr ohnehin problematisches Leben geworfen und ihr das einzig verbliebene Elternteil genommen. Dabei hatte sie keinen Hinweis auf die Identität des Mörders oder sein Motiv.
»Wie meinst du das? Wer hat sie umgebracht, Ryan?«, fragte sie jetzt in einem härteren Ton.
Drake sah seine Schwester an. »Bist du sicher, dass du das hören willst?«
»Meine Mutter ist tot. Mein Bruder ist auf der Flucht vor der Polizei, der CIA und Gott weiß, wem sonst noch. Und jeden Morgen beim Aufwachen frage ich mich, ob ich die Nächste sein werde. Also ja. Ja, ich will die Scheiße hören.«
Drake kannte seine Schwester so gut, dass er ihrem Urteil traute. Er war auf ihre Kooperation angewiesen, und dazu konnte er sie unmöglich bewegen, solange er sie im Ungewissen ließ.
»In den amerikanischen Geheimdiensten gibt es so etwas wie … eine Verschwörung. Eine Geheimgesellschaft, eine Schattenorganisation … wie auch immer man das nennen will. Wir hatten sie meist als der Zirkel oder der Kreis bezeichnet, aber sie selbst nennen sich Circle. Dieser Circle ist wie ein Krebsgeschwür, er breitet sich in den Geheimdiensten, dem Militär, sogar in der Regierung aus. Jeder, der sich ihm in den Weg zu stellen versucht, wird eliminiert.«
Jessica kniff die Augen zusammen. »Warum? Was wollen diese Leute?«
Drake spreizte die Finger. »Geld? Macht? Einfluss? Alles das oder nichts davon. Noch ist niemand dicht genug an sie herangekommen, um es herauszufinden. Aber ihre Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt«, fuhr er fort. »Sie können Kriege und Revolten vom Zaun brechen und ganze Regierungen stürzen …«
»Ryan, weißt du eigentlich, wie sich das anhört?«
Drake griff sich die Zeitung vom Tisch und hielt sie mit der Vorderseite, auf der die erschreckenden Kriegsfotos abgebildet waren, in ihre Richtung.
»Sieh doch selbst«, forderte er sie auf. »Ich war in Tunesien, als alles anfing. Ich habe sogar einen ihrer Agenten verhört. Die haben das angezettelt. Sie hatten es jahrelang geplant, haben die Mosaiksteinchen zusammengesetzt und auf den richtigen Moment gewartet. Und wenn sie heute so etwas abziehen können, wie soll das dann erst weitergehen?«
Die unermessliche Komplexität der Planung und Vorbereitung, die man für so etwas benötigte, war fast unglaublich. Schon in einem einzigen Land einen Staatsstreich einzufädeln erforderte immense Anstrengungen, aber auf einem halben Kontinent zeitgleich Revolten auszulösen – das war eine ganz andere Dimension.
Jessica grübelte über dieselbe Sache nach, wenn auch aus einem anderen Blickwinkel. »Wenn das alles stimmen würde, was du sagst, hätte es längst jemand entdeckt. Jemand hätte es an die Öffentlichkeit gebracht und online veröffentlicht. Man kann nicht alle zum Schweigen bringen.«
»Das brauchen sie nicht. Hast du eine Ahnung, wie viele verrückte Verschwörungstheorien im Umlauf sind? Wie viele Spinner ihre Zeit damit verbringen, über so etwas zu spekulieren und zu schwadronieren?«
»So wie du, meinst du?«
Drake sah sie missbilligend an. »Wenn sie die richtigen Leute kontrollieren, können sie auch den Informationsfluss im Internet beeinflussen. Sie können dafür sorgen, dass nur ihre Version der Wahrheit verbreitet und bestätigt, aber alles andere abgewürgt oder zum Schweigen gebracht wird.«
»Woher weißt du das?«
Drake sah seiner Schwester in die Augen. »Ich habe für die CIA gearbeitet, Jess. Die Wahrheit ist den Leuten inzwischen völlig egal – sie wollen nur die Bestätigung für das, was sie sowieso schon glauben. Gib sie ihnen, dann erledigt sich der Rest ganz von allein.«
Wie eine Tierherde brauchte man sie nur zum richtigen Zeitpunkt und an der richtigen Stelle ein wenig aufzustacheln, um sie auf Trab zu bringen.
Jessica schüttelte den Kopf und ließ es fürs Erste auf sich beruhen. »Willst du mir ernsthaft erzählen, dass Mom … unsere Mutter, Freya Shaw, zu dieser Gruppe gehört hat?«
Drake warf seiner Schwester einen durchdringenden Blick zu. Er verstand ihre Wut und ihre Zweifel. Die hatte er damals auch gehabt. Aber das bedeutete nicht, dass er sich irrte.
»Ja.«
»Warum?«
»Ich bin hier, um das zu erforschen.«
Jessica stellte ihren Becher ab und verschränkte die Arme. »Und weiter?«
Drake griff in seine Manteltasche, nahm einen Gegenstand heraus und legte ihn mit einem hörbaren Klack auf den Tisch. Es war ein ungewöhnlicher Schlüssel mit drei Bärten anstatt einem. An drei Seiten waren sorgfältig Zahlenreihen eingraviert.
»Sehr hübsch«, bemerkte Jessica trocken. »Was schließt man damit auf?«
»Das will ich herausfinden. Es gab keine Anweisungen, wo man ihn benutzen sollte. Keine Karte, keine Wegbeschreibung, gar nichts. Nur ihren Brief an mich.«
Das kurze Schreiben, das seine Mutter kurz vor ihrem Tod verfasst hatte, war eher so etwas wie eine an ihn gerichtete persönliche Bitte um Verzeihung und der Versuch, einen Schlussstrich zu ziehen, als eine wie auch immer geartete Handlungsanweisung. Es erwähnte weder Orte noch Personen, die er aufsuchen konnte. Zumindest hatte er das angenommen.
»Die Antwort war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase, aber ich habe die Verbindung nicht erkannt«, sagte er und hielt ihr den Schlüssel hin, damit sie ihn sich ansehen konnte. Jessica kam zögernd quer durch das Zimmer näher, stellte sich neben ihn und untersuchte den ungewöhnlichen Gegenstand.
»Was glaubst du, bedeuten die Zahlen?«
»Das ist ein Code. Und um ihn zu lesen, braucht man die richtige Chiffre.« Drake sah sie an. »Hast du den Brief noch, den sie mir hinterlassen hat?«
In der Annahme, dass das Dokument nur einen sentimentalen Wert besaß, hatte Drake es bei seiner Abreise in der Obhut seiner Schwester gelassen. Erst kürzlich hatte er begriffen, dass das eine falsche Entscheidung gewesen war, weil er nicht erkannt hatte, dass beide Gegenstände benötigt wurden. Dieser Irrtum hatte ihn sehr viel Zeit gekostet.
Doch jetzt stand er vielleicht kurz davor, seine Antworten zu finden.
Jessica erwiderte nichts. Stattdessen wandte sie sich abrupt ab, ging ans Küchenfenster und starrte zu den Hügeln hinaus.
»Sag doch was, Jess«, hakte er nach. »Wo ist das Problem?«
»Es tut mir so leid, Ryan«, sagte sie ganz leise. »Aber er ist weg.«
Drake konnte kaum fassen, was er hörte. »Wie bitte?«
»Ich habe ihn verbrannt!«, gestand sie.
»Warum hast du das getan?«
Sie wandte sich zögernd ihrem Bruder zu. »Das habe ich doch gesagt. Ich dachte, du bist tot. Ich habe es mir eingeredet. Der Brief war das Letzte, was du mir gegeben hattest. Das Letzte, was mich noch an dich erinnerte. Den Brief zu verbrennen war meine Art … dich loszulassen.«
Drake sackte in seinem Stuhl zusammen.
»Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du kommst und danach suchst«, versuchte seine Schwester ihre Handlungsweise zu rechtfertigen. »Ich dachte, es wäre vorbei. Ich dachte, du wärest tot.«
Ihre Worte erreichten Drake fast nicht mehr.
»Dann war alles umsonst«, sagte er leise.
Man brauchte den Schlüssel und den Brief, um die letzte Botschaft seiner Mutter zu dechiffrieren. Ohne das eine war das andere nutzlos.
Er spürte ihre Finger auf seiner Hand, hörte den Schmerz und das Bedauern in ihrer Stimme, als sie sagte: »Es tut mir so leid, Ryan.«
Drake schüttelte den Kopf. »Es ist nicht deine Schuld«, beruhigte er sie schließlich. »Ich habe dir schon genug zugemutet. Das hier geht auf meine Kappe.«
»Aber ohne den Brief … Was willst du jetzt tun?«
Drake ließ sich mit der Antwort Zeit. Dann stand er plötzlich auf. »Steht Dads Auto noch in der Garage?«
Jessica verzog ihr Gesicht, mit dieser Frage hatte sie nicht gerechnet. »Ja, schon …«
Er nickte. »Komm mit.«
2
Abbottabad, Pakistan
Bashir Shirani stieg langsam und vorsichtig die steile Innentreppe hinauf; bei jedem Schritt klapperten leise die Tassen und die Teekanne auf seinem Tablett.
Der Herr, der Mann, um den sich der gesamte Haushalt drehte, war ein Gewohnheitsmensch. Jede Abweichung und jede Verzögerung verärgerten ihn maßlos. Weil er als Neuzugang unter den Mitarbeitern mit der Aufgabe betraut worden war, ihm aufzuwarten, wollte Shirani unter keinen Umständen sein Missfallen erregen.
Als er unten schnelle Schritte und Gelächter hörte, blickte sich der junge Mann um und sah zwei Knaben am Treppensockel, die den kurzen Flur entlanggelaufen kamen. Sie schrien und lachten auf dem Weg nach draußen in den Hof. Der Herr hatte in seinem Leben über zwanzig Kinder gezeugt, von denen neun in diesem Anwesen lebten. Einige von ihnen waren jung und großspurig und schreckten nicht davor zurück, den Bediensteten ihres Vaters Streiche zu spielen.
Glücklicherweise waren sie heute mehr an ihren eigenen Spielen als daran interessiert, ihn zu piesacken, und er setzte seinen Aufstieg fort.
Die beiden oberen Stockwerke des Haupthauses waren dem Herrn und seiner großen Familie vorbehalten, obwohl sein Herr dort auch oft Zusammenkünfte mit seiner Entourage abhielt. Als Shirani oben an der Treppe angelangt war, hörte er Frauenstimmen aus einem der Zimmer, die vor ihm lagen. Es klang, als besprächen zwei Ehefrauen des Herrn – er hatte insgesamt drei – irgendwelche häuslichen Angelegenheiten. Es könnten Siham und Khairiah sein, weil sie beide am längsten bei ihm waren und dazu neigten, mehr Zeit miteinander zu verbringen.
Seine Vermutung wurde bestätigt, als er das zentrale Wohnzimmer im Obergeschoss betrat. Da waren Siham und Khairiah, die sich leise unterhielten, während sie frisch gewaschene Laken aufzogen – eine triviale Routinearbeit, die sie schon tausendmal verrichtet hatten.
Shirani bewunderte sie irgendwie. Der Herr hatte mehr als die Hälfte seines Lebens mit ihnen verbracht; sie waren mit ihm durch die Welt gereist und trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren loyal und standhaft geblieben. Sie waren nicht mehr jung und hatten kein friedliches Leben hinter sich – was ihren faltigen Gesichtern und dem ergrauenden Haar deutlich anzusehen war. Trotzdem hatten sie sich arrangiert, weitergemacht und getan, was von ihnen erwartet wurde.
»As-salāmu‘alaykum«, sagte Shirani und verbeugte sich respektvoll vor den beiden.
In der islamischen Kultur erwartete man von Frauen, sich Männern gegenüber bescheiden und respektvoll zu verhalten, insbesondere in der Öffentlichkeit. Aber in den eigenen vier Wänden galten andere Regeln. Männer hatten in Familienangelegenheiten zwar das letzte Wort, aber es wurde allgemein akzeptiert, dass Frauen zu Hause das Regiment führten. Und das war nirgendwo offensichtlicher als hier in Waziristan Haveli.
»Wa‘alaykumu s-salām«, erwiderte Khairiah, wie es Sitte war.
»Ich habe Tee gebracht, falls er ihn möchte.«
Man hatte Shirani ausdrücklich eingeschärft, bei seinem Herrn niemals etwas vorauszusetzen. Mahlzeiten und Erfrischungen sollten angeboten oder vorgeschlagen werden, doch niemals so, dass er sich verpflichtet fühlen musste. Das hätte als große Respektlosigkeit gegolten.
Khairiah nickte eher desinteressiert und deutete zur Tür auf der anderen Seite, die in das Privatgemach des Herrn führte.
»Er ist da drin.«
Als er die Tür erreicht hatte, machte Shirani eine kleine Pause, um sich zu sammeln, dann klopfte er leise.
»Herein«, rief eine sanfte Männerstimme.
Shirani öffnete die Tür und trat ein.
Er gelangte in ein Zimmer, das klein und nur sparsam möbliert, jedoch mit verwegen angeschlossenen Elektrogeräten vollgestellt war. Der Raum war völlig schmucklos und ohne jeden Zierrat. Der Herr mied trotz seiner vom Wohlstand geprägten, privilegierten Herkunft jede Form von Luxus und zog eine einfache und asketische Lebensweise vor.
Sein privater Arbeitsbereich war, wie der Großteil des restlichen Hauses, spärlich mit Kunstlicht beleuchtet. Es gab nur ein kleines Fenster, das stets geschlossen und abgedunkelt war.
Dieses bescheidene Zimmer war das Refugium des Herrn und diente als Arbeitszimmer, als Büro, als Konferenzraum und manchmal auch als Aufnahmestudio, wenn er Botschaften an seine Gefolgschaft formulierte. Shirani hatte es nie selbst erlebt, aber gerüchteweise gehört, dass Letzteres mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. Der Herr war keine charismatische Persönlichkeit, auch kein begnadeter Redner, und sprach deshalb seine knappen Botschaften oft stockend in die Kamera. Er legte dabei häufig Pausen ein, stolperte über seine eigenen Worte und verlor manchmal den Faden, weshalb oft viele Versuche nötig waren, bis er sich mit dem Ergebnis zufriedengab.
Jetzt saß er mit einer Decke über den Schultern auf einem niedrigen Sessel im Zentrum dieses zusammengewürfelten Arbeitsbereiches, und seine Aufmerksamkeit war auf einen alten Fernseher in der Ecke gerichtet. Auf dem Anwesen gab es keine Festnetzverbindungen und keinen Internetanschluss, aber man konnte Satellitenfernsehen empfangen. Im Fernseher liefen die Nachrichten von Al Jazeera. Es ging um den aufkeimenden Bürgerkrieg in Libyen.
»As-salāmu‘alaykum«, begann Shirani den traditionellen Gruß. Dann machte er eine Pause und wartete auf die Erwiderung.
Sie blieb aus. Der Herr löste den Blick nicht vom Fernseher, der Neuankömmling war für ihn offenbar uninteressant.
»Ich habe Tee gebracht, Herr«, fuhr er fort. »Falls Sie möchten.«
Jetzt endlich bekam er eine Reaktion.
»Bemerkenswert, oder?«, murmelte der Herr mit sanfter und ruhiger, fast schwacher Stimme.
Shirani hob fragend die Brauen. »Herr?«
Die Decke bewegte sich, der Herr drehte den Kopf und sah ihn an. Shirani blickte in das bekannte Gesicht, das man weltweit auf unzähligen TV-Monitoren, Websites und Postern gesehen hatte. Die lange, betonte Nase, dunkle, tief liegende Augen, die hohe Stirn, der buschige Bart.
Ein Mann, den die meisten Menschen in der westlichen Welt am liebsten tot sehen würden.
Aber Shirani fragte sich, wie viele von ihnen den Mann, der hier vor ihm saß, überhaupt erkennen würden. Sein Bart und das Kopfhaar waren schon lange ergraut – doch er war immerhin eitel genug, beides für seine Video-Aufzeichnungen zu färben. Die Augen und die Wangen waren eingefallen, tiefe Falten hatten sich ins Gesicht und die Stirn gegraben. Er war von jeher schlank und groß gewesen, hatte aber während seiner selbst auferlegten Isolation Gewicht verloren und sah blass und kränklich aus. Seit fast einem Jahrzehnt jagte und hasste man ihn, und der Herr war vorzeitig gealtert und gebrechlich geworden.
»Die Lage in Libyen«, sagte er und deutete auf den Fernseher, der den Diktator Oberst Gaddafi zeigte, wie er in Tripolis zu einer Menschenmenge sprach. »Es ist nicht zu glauben: Dieser alte Narr macht ausgerechnet mich für den Aufstand in seinem Land verantwortlich. Er behauptet, ich hätte die Jugend seines Landes mit Waffen und Drogen versorgt und gegen ihn aufgehetzt. Ha!« Er schnaubte sarkastisch. »Wie siehst du das, Junge?«
Shirani unterdrückte den Impuls, zu schlucken und vor dem durchdringenden Blick zurückzuschrecken. Plötzlich wirkte der Herr nicht mehr wie ein gebrechlicher alter Mann, der sich unter eine Decke kuschelte. Jetzt sah er in ihm die mächtige, einschüchternde Persönlichkeit, die in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft hatte, den Kopf hinter den Anschlägen, die das Selbstvertrauen und die Arroganz der Amerikaner für alle Zeiten erschüttert hatten. Der Mann stand seit über einem Jahrzehnt an der Spitze eines weltumspannenden Dschihads gegen den westlichen Imperialismus.
Und jetzt wollte dieser Mann wissen, was er dachte.
»Ich glaube, die Probleme in Libyen sind hausgemacht«, sagte er vorsichtig.
»Ganz genau, Junge. Genau«, erwiderte der Herr und sank, zufrieden mit der Antwort, in seinen Sessel zurück. »Gaddafi ist nur auf seine Hurereien konzentriert und zu eitel, um sein eigenes Volk wahrzunehmen. Wenn man bedenkt, dass so ein Mann es wagt, sich als Muslim zu bezeichnen.« In diesem Moment schien in seinem Blick ein Feuer aufzulodern. »Ein Trottel ist er. Er hat sich das eigene Grab geschaufelt und wird bald darin liegen, glaube ich.«
Er hielt inne, als hätte ihn seine Tirade erschöpft, dann blickte er auf das Tablett in Shiranis Händen. »Du hast Tee gebracht?«
»Das habe ich, Herr.«
Er nickte. »Gut, gut. Dann lass uns trinken, bevor er kalt wird.«
Shirani stellte das Tablett auf einen kleinen Tisch neben dem Sessel und goss ihm eine Tasse ein. Dabei zitterte seine Hand ein wenig, was nicht unbemerkt blieb.
»Bist du nervös, Junge?«
Shirani wich seinem Blick aus. »Es ist … eine große Ehre, Ihnen persönlich zu begegnen.«
»Und machst du dir Sorgen, dass ich dich töten lasse, falls du etwas Falsches sagst?«
Shirani warf ihm einen erschrockenen Seitenblick zu. Doch seine dunklen Augen sahen ihn jetzt nicht mehr so bohrend und brennend an. Es lag ein Anflug von Wärme und Belustigung in seinem Blick.
»Aber wenn du jetzt nicht aufhörst einzuschenken, werde ich etwas unternehmen müssen.«
Shirani blickte nach unten und sah entsetzt, dass der Tee schon über den Rand der Tasse strömte. Er schnappte erschrocken nach Luft und zog die Kanne weg.
»Entschuldigung, Herr«, stieß er hervor und senkte unterwürfig das Haupt. »Vergeben Sie mir.«
»Da ist nichts zu vergeben«, beruhigte ihn der Herr. »Ich bin ein alter Mann, der wenig zu tun hat. Ich muss mir mein Vergnügen holen, wo ich es finde.«
Er hob die übervolle Tasse an die Lippen, nahm einen Schluck und nickte wohlwollend.
»Der Tee ist gut.«
»Freut mich, dass er Ihnen schmeckt, Herr.« Shirani zögerte. »Kann ich sonst etwas tun?«
Der ältere Mann lächelte und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, für den ersten Tag habe ich dir genug zugemutet. Du kannst jetzt gehen.«
Shirani verbeugte sich wieder und war dankbar, das Zimmer verlassen zu dürfen, als der Herr noch einmal das Wort an ihn richtete.
»Wie heißt du, Junge?«
»Shirani. Bashir Shirani.«
»Shirani.« Er ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. »Ein guter paschtunischer Name. Aus Khost, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete Shirani überrascht.
Der Herr nickte. »Gute Kämpfer kommen aus Khost. Im Krieg habe ich viele gekannt. Sie starben wie Männer.«
Danach sagte er nichts mehr, richtete die Aufmerksamkeit wieder auf den Fernseher und machte es sich in seinem Sessel bequem.
Keiner der beiden wusste, dass das Areal in diesem Moment verdeckt observiert wurde. 30.000 Fuß über ihnen kreiste mit knapp 200 Meilen pro Stunde eine einzelne unbemannte MQ-9-Reaper-Drohne.
An den Tragflächenpylonen hingen zwei klobige, lasergesteuerte 500-Pfund-Paveway-II-Bomben – bereit, auf Knopfdruck eingesetzt zu werden, und präzise genug, um in einen Brunnenschacht zu treffen. Jede davon hatte genug Sprengkraft, um das in eine Festung verwandelte Haus in einen qualmenden Trümmerhaufen zu verwandeln.
Trotzdem legte es Josh Irvine, der Pilot des Flugkörpers, der Hunderte Meilen entfernt im Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan in einem klimatisierten Bodenkontrollzentrum saß, nicht darauf an, seine Nutzlast abzuwerfen. Stattdessen lehnte er sich locker in seinem Bürosessel zurück, trank einen Schluck Kaffee aus dem dampfenden Becher neben ihm und behielt dabei den Live-Stream des ausgefeilten multispektralen Zielsystems der Drohne im Auge.
Seine Arbeit erschöpfte sich nicht darin, die Reaper zu lenken, er musste außerdem akribisch alles aufzeichnen, was sie sah. Routine – das war ihnen schnell klar geworden – hatte dort unten eine große Bedeutung. Jeden Tag zur selben Zeit kam jemand mit einem leeren Teetablett aus dem Haus. Der Mann, der dort bedient wurde, war eindeutig ein Gewohnheitstier.
Irvine konnte ihn sich in diesem Moment fast bildlich vorstellen. Wie er an seinem Tee nippte und sich in seinem Betongefängnis sicher wähnte. Er warf einen Blick auf die Kontrollkonsole, die im Zentrum seines Drohnenterminals montiert war. Die Reaper kreiste auf Autopilot über dem Zielgebiet, ihre Hightech-Kameras und -Sensoren richteten sich unablässig neu aus, um das bestmögliche Bild zu liefern. Nur der Waffeneinsatz musste manuell ausgelöst werden. Diese Aufgabe wollte man keinem Computer anvertrauen.
Es wäre so einfach, dachte er. Ein einziger Knopfdruck, und tausend Pfund hochexplosiven Sprengstoffs würden diesen Ort in Schutt und Asche legen. Nach knapp 40 Sekunden hätten die Bomben ihr Ziel getroffen.
Luftwaffenoffizier Josh Irvine könnte als der Mann, der Osama bin Laden tötete, in die Geschichte eingehen.
Genug, dachte er und nahm den nächsten Schluck Kaffee. Allzu lange über solche verlockenden Chancen nachzudenken war für einen Mann in seiner Position gefährlich. Sein Job waren Beobachtung und Protokollierung. Sie würden so etwas unter keinen Umständen einer intelligenten Bombe überlassen, nach deren Einsatz keine Identifizierung möglich war, weil sie nichts übrig ließ. Getötet wurde, wenn der Moment gekommen war, und dann aus nächster Nähe und von Angesicht zu Angesicht.
Und es dauerte nicht mehr lange. Das spürte er.
3
Washington, D.C. – 20. Juni 1989
Es war ein warmer, diesiger Sommerabend in der Hauptstadt. Marcus Cain fuhr in östlicher Richtung auf der Constitution Avenue. Er blickte nach links, konnte in der Entfernung gerade noch die Säulen und Giebel des Weißen Hauses erkennen und fragte sich, was in jenem großartigen Gebäude vor sich gehen mochte, welche Staatsangelegenheiten oder diplomatischen Probleme dort gerade diskutiert wurden.
Als neuer Chef der streng geheimen CIA-Abteilung für Sonderkommandos kannte Cain besser als die meisten anderen die Bedeutung und Risiken der Geheimnisse, die dieses Land hütete, und von denen nur wenige jemals den Präsidentenschreibtisch kreuzten. Manche Dinge waren zu brisant, um sie einem der Amtsinhaber anzuvertrauen, die alle paar Jahre wechselten.
Heute hatte Cain jedoch anderes in Washington zu erledigen. Er war schlicht und einfach vorgeladen worden – Treffpunkt, Datum und Uhrzeit. Mehr wurde ihm nicht mitgeteilt. Er hatte das erwartet, selbstverständlich. Wenn man einen Pakt mit dem Teufel eingeht, wird er früher oder später seinen Tribut einfordern.
Am vereinbarten Treffpunkt angelangt, war Cain von der Wahl des Ortes ehrlich verblüfft. Heimliche Treffen arrangierte man normalerweise in Tiefgaragen, unter Highway-Überführungen oder irgendwo draußen in der Wildnis, fernab von allen neugierigen Blicken. Aber nicht in markanten Stadtvillen kaum eine Meile vom Weißen Haus entfernt.
Er parkte und nahm sich einen Moment Zeit, ließ den Blick über die Fassade schweifen und bewunderte die vornehm-zurückhaltende, aber elegante Architektur, die symmetrisch angeordneten Fenster im Obergeschoss und das ungewöhnlich große und beeindruckende Portal.
Hier wohnte niemand.
Er ging zur Tür, entdeckte die Gegensprechanlage an der Seite und drückte auf den Summer.
»Guten Abend«, meldete sich kurz und knapp eine Frauenstimme. »Darf ich um Ihren Namen bitten?«
»Marcus Cain«, erwiderte er. »Ich werde erwartet.«
Nach einer kurzen Pause meldete sich die Stimme wieder. »Bitte treten Sie ein.«
Man hörte ein Summen, und es klickte, als die Tür elektronisch entriegelt wurde. Cain nahm sich einen Augenblick Zeit, um sich zu sammeln, dann ging er neugierig und erwartungsvoll hinein.
Er betrat ein Refugium mit getäfelten Wänden, tropischen Kübelpflanzen, geschmackvollen Kunstgegenständen und antiken Möbeln, die sicher kostspieliger waren als seine gesamte Einrichtung. Man konnte unschwer erkennen, um was es sich bei diesem Ort wirklich handelte – einen diskreten Klub nur für Mitglieder, der bewusst so gestaltet worden war, dass er von außen harmlos und unscheinbar wirkte.
Klubs wie diesen gab es überall in den Vereinigten Staaten, insbesondere in den älteren Städten an der Ostküste, aber Cain hatte selbst noch keinen betreten. Er war nicht reich oder bedeutend genug, und er hatte auch keinen berühmten Familiennamen, aufgrund dessen ihm eine Mitgliedschaft angeboten würde.
»Willkommen im L’Infini, Mister Cain.«
Cain richtete den Blick auf die attraktive blonde Frau, die hinter dem Empfangstresen stand. Sie lächelte ihn an, höflich und professionell, und ihr Blick war im Gegensatz dazu taxierend kühl.
»Sie sind zum ersten Mal bei uns?«
»Korrekt«, räumte er vorsichtig ein. »Ich bin hier verabredet.«
»Selbstverständlich. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen und Ihnen den Weg weisen.«
»Ich finde mich zurecht.«
Die junge Frau öffnete den Mund für eine Antwort, doch sie wurde von einer anderen Stimme unterbrochen, die von dem hohen Torbogen kam, durch den es in den Restaurantbereich weiterging.
»Marcus. Schön, dass Sie gekommen sind.«
Cain wandte dem Mann seinen Kopf zu und musterte ihn kurz. Er wirkte wie Mitte vierzig, war durchschnittlich groß und weder übergewichtig noch sonderlich athletisch. Sein hellbraunes Haar, das sich am Scheitel bereits etwas ausdünnte, war von der hohen Stirn nach hinten gekämmt. Sein schmales, fast zartes Gesicht zeigte vorzeitige Alterserscheinungen; attraktiv hätten den Mann wohl nur wenige genannt. Aber er kam mit einem selbstbewussten und entspannten Lächeln näher und streckte Cain die Hand hin.
»Ich habe Sie hoffentlich nicht warten lassen?«
»Ganz und gar nicht«, sagte Cain beim Händeschütteln. »Ich glaube … wir sind uns noch nicht begegnet?«
»Das glaube ich auch«, pflichtete der Mann bei. »Ich bin James.«
»Nur James, hm?«
»Nur James. Vornamen sind mir immer am liebsten. Identität ohne Erwartungen.« Er lächelte noch einmal, und damit war die Sache für ihn anscheinend erledigt. »Wie dem auch sei, ich schätze, dass Sie mir ein paar Fragen stellen wollen.«
»Das schätzen Sie ganz richtig ein.«
Er deutete in die Richtung, aus der er gekommen war. »Folgen Sie mir, dann können wir uns unterhalten.«
James führte ihn durch Räumlichkeiten, die wie der Restaurantbereich des Klubs aussahen. Sein aufrechter und gelassener Gang ließ Cain an einen blaublütigen Lord denken, der es gewohnt war, sich diszipliniert und würdevoll zu benehmen.
Über dem Speisebereich lag eine Geräuschkulisse aus Gesprächsfetzen, klirrenden Gläsern und klapperndem Besteck. Reich verzierte Säulen aus italienischem Marmor strebten zum Deckengewölbe, von dem drei aufwendige Kronleuchter hingen. Cain ließ im Vorübergehen den Blick über die Gesichter schweifen und erkannte ein paar Kongressabgeordnete, einen Senator und sogar einen US-Botschafter.
»Nett haben Sie es hier, James«, sagte Cain, während ihn sein Gastgeber eine kurze Treppe hinaufführte. »Ich bin anscheinend in guter Gesellschaft.«
»Die Mitgliedschaft im L’Infini ist … recht elitär. Diskretion und Exklusivität sind heutzutage nicht so leicht zu haben.«
Er wurde in einen Privatsalon weitergelotst. Das Dekor war so opulent und geschmackvoll wie im großen Speisesaal, und die Getränkebar hätte viele professionelle Cocktailbars vor Neid erblassen lassen. Ein Ort für die Crème de la Crème.
»Sie haben um dieses Treffen gebeten«, sagte Cain und wandte sich zu seinem Gastgeber. »Jetzt bin ich hier. Was kann ich für Sie tun?«
»Sie können sich entspannen und einen Drink nehmen, Marcus«, schlug ihm eine andere Stimme vor. »Das ist doch kein Verhör. Also sollten wir uns auch nicht so benehmen.«
Cain fuhr herum und sah eine Frau aus einer Türöffnung auf der anderen Seite des Raumes treten. Sie war groß, wohlproportioniert und trug ein schmales schwarzes Abendkleid, das hervorragend mit der eleganten Umgebung harmonierte. Sie sah ihn mit demselben wissenden, gefährlich entwaffnenden Lächeln an wie schon an jenem Abend ihres ersten Kennenlernens.
Freya Shaw. Die Frau, die ohne Vorwarnung mit einem Angebot in sein Leben getreten war, das er nicht hatte ablehnen können. Es war ein Angebot, das alles verändert hatte.
»Danke, dass Sie ihn hereingeleitet haben, James«, sagte sie und nickte Cains Begleiter zu.
»Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie sich bald wieder blicken lassen«, sagte Cain, der sich schnell wieder gefasst hatte.
Ihr entwaffnendes Lächeln behielt sie bei, als sie mit subtil, aber einladend schwingenden Hüften zu ihm schlenderte. Trotz aller Vorbehalte konnte Cain zumindest nicht abstreiten, dass Freya eine hinreißend attraktive Frau war. Zweifellos war ihr diese Tatsache durchaus bewusst, und sie nutzte sie zu ihrem Vorteil.
»Wie das sprichwörtliche Unkraut, das nicht vergeht?«
»Das haben Sie gesagt, nicht ich.«
Sie blieb ein kleines bisschen näher vor ihm stehen als nötig und sah ihm in die Augen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet. Er konnte ihr Parfüm riechen und bildete sich ein, auch ihre Körperwärme zu spüren.
»Ich bin nicht so schlimm, wie Sie glauben … Nur wenn es sein muss.« Ihre Augen funkelten gefährlich. »Verraten Sie mir jetzt, was Sie trinken möchten?«
»Ich habe nicht viel Zeit.«
»Ach, kommen Sie«, sagte sie, hob die Hand und richtete ihm sanft den Kragen. »Sie wollen mich doch nicht alleine trinken lassen, oder?«
»Bourbon. Auf Eis«, sagte er schließlich.
Sie knipste ihr Lächeln wieder an. »Machen Sie zwei, James.«
James, der sich hinter dem Tresen aufgebaut hatte, inspizierte die Flaschen, wählte einen Woodford Reserve cask strength und schenkte zwei Gläser auf Eis ein.
»Meinen Sie nicht, wir sollten unter vier Augen weitermachen?«, schlug Cain vor, als Shaw die beiden Gläser von James übernahm. »Nichts für ungut, James.«
»Nicht doch, Marcus.«
»Ich würde für James die Hand ins Feuer legen«, erklärte sie. »Ich kann Ihnen versichern, dass wir hier ganz offen reden können.«
Sie reichte ihm ein Glas, und er nahm es zögernd.
»Wenn das so ist … Was wollen Sie?«, fragte Cain. »Ich vermute, dass Sie mich nicht zum Tanztee herbestellt haben.«
»Und wenn es so wäre?«
»Mit Tanzen habe ich es nicht so.«
Sie tat, als schmolle sie. »Aber ich. Was für ein Jammer.«
»Genug. Warum bin ich hier?«
»Erzählen Sie mir von Anya«, forderte Shaw ihn auf.
Anya. Die junge Frau, die er für die Agency rekrutiert, die in Afghanistan gekämpft und ihr Leben riskiert hatte. Sie hatte ihn gefesselt, in einer Art und Weise, wie er es niemals erwartet hätte. Die Frau hütete ein zerstörerisches Geheimnis, für das man sie beide fast umgebracht hätte.
»Was ist mit ihr?«
»Ist sie als Operateurin einsatzfähig?«, fragte Shaw und machte hinter jedem Wort eine kleine Pause.
»Sie ist auf dem Weg … der Besserung.«
Sie war von den Sowjets gefangen genommen, verhört und brutal gefoltert worden, aber schließlich unter entsetzlichen Bedingungen über die Grenze nach Pakistan geflüchtet. Anya hätte sterben sollen. Und sie wäre tatsächlich fast gestorben. Nur ihre angeborene Zähigkeit und ihr eiserner Überlebenswille hatten sie durchkommen lassen.
»Aber sie ist nicht wieder im aktiven Dienst, oder?«, hakte Shaw nach.
Beide kannten die Antwort. Seit ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten hatte sich Anya weitgehend von der Agency ferngehalten und sich nur widerwillig zu psychologischen und medizinischen Untersuchungen blicken lassen.
»Sie hat eine Menge durchgemacht. Das braucht Zeit.«
»Sie hat ein Kriegstrauma«, sagte Shaw in einem kühleren und geschäftsmäßigeren Tonfall. »So nennt man das doch in Ihrer Branche, oder? Sie hat was abbekommen und ist jetzt ängstlich. Ein Soldat, der nicht kämpft, ist eigentlich gar kein Soldat.«
»Woher wollen Sie wissen, was es heißt, Soldat zu sein?«, fragte er. »Wann haben Sie zum letzten Mal Ihr Leben für etwas riskiert?«
Falls er gehofft hatte, sie mit dieser deutlichen Spitze zu treffen, wurde er enttäuscht. Shaw zeigte sich unbeeindruckt.
»Man kann auf viele Arten kämpfen. Und nicht immer sind Waffen im Spiel«, sagte sie kryptisch. »Wie dem auch sei – ich habe den perfekten Job, um Anya wieder aufs Spielfeld zu bringen.« Sie nahm einen Ordner, der am Ende der Theke lag, und zeigte ihn Cain. »Dieses Foto wurde vor zwei Tagen in der Ukraine aufgenommen. Erkennen Sie den Mann?«
Cain betrachtete das Schwarz-Weiß-Bild. Es war ein Mann Anfang vierzig, aus großer Entfernung fotografiert und dennoch deutlich zu erkennen. Cain kannte jedes Mitglied von Anyas Einheit so gut, als wäre es seine eigene Familie.
»Luka«, sagte er ruhig. Der ehemalige Anführer von Anyas Kommandotruppe, den niemand mehr gesehen hatte, seit die Einheit in Afghanistan in den verheerenden Hinterhalt geraten war. »Woher haben Sie das?«
»Wir können fast jeden finden«, erklärte Shaw und kostete den Augenblick aus. »Dieser Mann hat seine Freilassung aus den Händen der Sowjets gegen Anya und ihre Einheit eingetauscht. Er ist ein ungelöstes Problem, und wer eignete sich besser als Anya dafür, den Fall abzuschließen?«
»Sie standen sich nahe, die beiden«, warnte Cain. Luka war für Anya wie ein Bruder gewesen. »Sie verlangen von ihr, einen Mann zu töten, an dessen Seite sie gekämpft hat.«
»Ich verlange von ihr, den Verräter zu bestrafen, der sie alle ans Messer geliefert hat«, korrigierte ihn Shaw. »Was könnte besser dazu geeignet sein, ihr die Dämonen auszutreiben?«
Cain antwortete darauf nicht. Es war ein Test. Es ging um Loyalität – sowohl Anyas als auch seine eigene.
»Holen Sie sie für diesen Auftrag ins Boot, Marcus«, befahl Shaw. »Holen Sie sie zurück und schicken Sie sie an die Front, wo sie hingehört.«
»Und wenn ich das nicht kann?«
Shaws Mundwinkel zuckte zu einem halben Lächeln, als sie sich ihre Reaktion überlegte. »James, nehmen Sie Ihre Waffe und richten Sie sie auf Mister Cains Kopf.«
James zog blitzartig eine Waffe aus der Innentasche seines Anzugjacketts und zielte damit so beiläufig auf Cain, als richtete er eine Fernbedienung auf einen Fernseher.
»Was soll das hier werden?«, herrschte Cain. Weil er selbst keine Waffe mitführte, war er so gut wie wehrlos.
»Ich will etwas klarstellen«, erwiderte Shaw und sah ihn drohend an. Hinter ihrer Schönheit schimmerte jetzt ein Kern aus kaltem Stahl. »Wissen Sie, was James’ wichtigster Charakterzug ist? Loyalität. Wenn ich jetzt von ihm verlangte abzudrücken, würde er es unverzüglich tun und mir danach, ohne mit der Wimper zu zucken, den nächsten Drink eingießen.« Sie sah zu ihm hinüber. »Stimmt das, James?«
»Ein Wort genügt«, erwiderte James. »Nichts für ungut, Marcus.«
»Um das klarzustellen«, fuhr Shaw fort, »wir wollen, dass Anyas Einheit für unser Team spielt. Aber die Männer kämpfen nicht ohne Anya, und Anya kämpft nicht ohne Sie, Cain. Wenn Sie mit ihr nicht fertigwerden, dann … hat es eigentlich auch keinen Sinn, sich noch mit Ihnen abzugeben, oder?«
Falls bei Cain irgendwelche Zweifel darüber bestanden haben sollten, wie skrupellos Freya Shaw sein konnte, verpufften sie in diesem Moment. Sie würde ohne zu zögern und ohne jedes Mitgefühl seinen Tod befehlen.
»Ist das die übliche Art, wie Sie Ihre ›Geschäfte‹ erledigen?«, fragte er höhnisch.
»Es ist mir lieber, wenn meine Beziehungen beiden Seiten von Nutzen sind. Aber wenn etwas klargestellt werden muss, dann ziehe ich es vor, es nur einmal sagen zu müssen.«
Cain kippte den letzten Schluck seines Bourbons, ohne den wütenden Blick von ihr zu lassen.
»Ich rede mit ihr.«
Shaws Lächeln kehrte zurück; es war so verführerisch und entwaffnend wie immer.
»Ich wusste, dass Sie mich verstehen, Marcus.«
Washington, D.C. – 27. Februar 2011
Die schmale Landzunge, die zwischen dem schlammtrüben, träge strömenden Fluss auf der einen und der kabbeligen Weite des Tidal Basins auf der anderen Seite aus dem Nordufer des Potomacs herausragte, war ganz sicher nicht die vorteilhafteste Umgebung für die Franklin-Delano-Roosevelt-Gedenkstätte. Die meisten Touristen zogen es vor, sich auf die berühmteren und leichter zugänglichen Gedenkstätten entlang der National Mall zu konzentrieren, weshalb dieses Monument für den 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten relativ wenig Besucher zu verzeichnen hatte.
Diese Ausgangslage wurde heute durch das ungünstige Wetter noch verschärft, denn es war kalt und windig. Der stahlgraue Himmel verhieß Regen. Die entlaubten Baumkronen schwankten und knarrten im böigen Wind.
Wirklich eine Schande, dachte Marcus Cain. Verglichen mit dem überladenen Pomp der meisten Regierungsgebäude und Denkmäler in Washington, D.C., hatten die plätschernden künstlichen Wasserfälle und die grob behauenen Steinblöcke eine zurückhaltende und beruhigende Eleganz. Die Steinquader bildeten die vier »Außenräume« der Gedenkstätte – die jeweils eine andere Epoche der langen Karriere Roosevelts im Staatsdienst symbolisierten.
Cain legte vor der steinernen Statue Roosevelts einen Halt ein. FDR war sitzend dargestellt, um die Lähmung zu kaschieren, die einen Großteil seines letzten Lebensabschnitts überschattet hatte. Cain dachte über das Zitat nach, das neben dem Präsidenten in die Wand graviert war:
Diejenigen, die eine Regierungsform einführen wollen, welche auf der Maßregelung aller menschlichen Wesen durch eine Handvoll individueller Herrscher beruht … nennen es eine neue Ordnung. Aber das ist weder neu noch eine Ordnung.
Wie vorausschauend diese Worte jetzt wirken, dachte Cain.
Das Geräusch von Schritten auf dem Granitsockel verriet ihm, dass sich jemand näherte. Cain blickte sich nicht um. Das war nicht nötig.
Der Mann hieß Richard Starke, war der Direktor der National Security Agency NSA und seit fast zwanzig Jahren Cains Hauptansprechpartner beim Circle. Dieser Mann hielt zurzeit den Schlüssel für seinen Aufstieg in die oberste Führungsebene der Organisation in den Händen.
Es war Starkes Idee gewesen, sich hier zu treffen und den üblichen Treffpunkt in dem einsamen Parkgelände weit draußen vor der Stadt zu meiden. Der heutige Tag war nicht wie alle anderen, das wusste Cain. Der Ortswechsel signalisierte veränderte Bedingungen – für sie beide.
»Ich erkläre Ihnen, wie es weitergeht«, erklärte Starke übergangslos. »Sie werden nachher einen Anruf vom Direktor der National Intelligence erhalten, der Sie darüber in Kenntnis setzen wird, dass er Sie dem Präsidenten offiziell als CIA-Direktor empfiehlt.«
Cain spürte, wie sein Herz bei jedem Wort schneller schlug.
»Etwa 30 Minuten später nehmen Sie einen Anruf aus dem Weißen Haus entgegen. Der Präsident wird bestätigen, dass er im Senat einen Antrag auf Einleitung des Prüfungsverfahrens einbringen wird. Er wird Ihnen gratulieren. Sie geben sich bescheiden und fragen, ob er es wirklich mit Ihnen versuchen will. Er wird betonen, dass Sie sein Mann sind, dass er darauf vertraut, im Senat die Stimmen zu bekommen, die er zu Ihrer Bestätigung braucht. Zum Schluss wird er Ihnen für Ihre jahrelangen Dienste danken. Sie antworten, dass Sie sich geehrt fühlen und dem Direktorenamt alle Ehre machen wollen. Danach halten Sie höflich den Mund und warten, bis er auflegt.«
Als er ans Ende seiner Liste knapper Instruktionen gelangt war, drehte sich der NSA-Direktor um und musterte den Mann, der neben ihm stand.
»Irgendwelche Unklarheiten?«
»Ich glaube, das kriege ich hin«, sagte Cain und achtete auf einen absolut neutralen Tonfall. Ihm war sehr wohl bewusst, dass seine Berufung zum Direktor nicht das war, was dieser Mann sich gewünscht hatte. Obwohl er Starke hatte zwingen können, seinen eigenen Willen zurückzustellen, blieb der Mann ein ernst zu nehmender Feind. Es wäre kontraproduktiv, am Vorabend seines größten Triumphes hämisch zu werden.
»Gut.« Nach einer Pause fügte Starke hinzu: »Ihnen ist natürlich klar, dass alles auf Ihrer Zusicherung beruht, Ihr Versprechen einzuhalten?«
»Das ist mir klar.«
»Falls Ihre Zielperson entwischen sollte, wäre es mit der Unterstützung des Präsidenten auch vorbei.«
»Er wird nicht entkommen, Richard«, versprach Cain. Dafür wollte er sorgen – selbst wenn er dafür persönlich nach Pakistan reisen und Bin Ladens Gefangennahme überwachen müsste. »Unsere Informationen sind hieb- und stichfest.«
Starke atmete langsam aus, sein Atem kondensierte in der kalten Luft, als er über das Tidal Basin hinweg bis zu den hoch aufragenden Säulen des Lincoln-Memorials blickte. Die beiden Männer wurden von Personenschützern bewacht, die genug Abstand hielten, damit die beiden miteinander reden konnten, ohne Lauscher befürchten zu müssen.
»Das hier ist unser letztes Treffen, Marcus.«
Da sah Cain ihn an – der Satz hatte überraschend endgültig geklungen. Er spürte die Verbitterung und die Vorbehalte des sonst so unerschütterlichen Mannes. Starke war fast zwei Jahrzehnte lang sein Verbindungsmann zum Circle gewesen. Sämtliche Kommunikation mit dem unverändert anonymen Führungszirkel an der Spitze der riesigen Pyramide hatte seiner Kontrolle unterlegen und war von ihm als Mittler abhängig gewesen. Wenn Starke jetzt abgezogen wurde, konnte es nur eines bedeuten.
»Mit wem arbeite ich künftig zusammen?«
»Nächstes Mal wird man sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.«
Als er den Sinn dieser Worte begriff, stockte Cain tatsächlich kurz der Atem. Jetzt war es also endlich so weit. Nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte lang ihre Wünsche befriedigt, ihre Vorgaben erfüllt und ihre Schlachten geschlagen hatte, sollte er dem Führungszirkel endlich persönlich begegnen.
»Wann?«
»Man wird Sie instruieren, wenn die Zeit gekommen ist«, antwortete Starke kryptisch.
Cain ahnte, dass ihm Starke nicht mutwillig Informationen vorenthielt, sondern lediglich wiedergab, was man ihm aufgetragen hatte. Dieser Moment bedeutete eine erdrutschartige Verschiebung der Macht- und Autoritätsverhältnisse zwischen den beiden Männern. Cains Einfluss wuchs und gleichzeitig wurde Starke gezwungen, beiseitezutreten und ihm Platz zu machen.
»Ich würde Ihnen raten, sich zu diesem Treffen nicht zu verspäten.«
»Haben Sie jemals erlebt, dass ich zu spät gekommen bin, Richard?«
Starke blieb ihm die Antwort schuldig, aber Cain erwartete eigentlich auch nichts anderes von ihm. Unterdessen schlug er den Mantelkragen hoch, blickte sich um und wollte gehen.
»An dieser Stelle trennen sich vermutlich unsere Wege.«
Zwanzig Jahre und zahllose Vier-Augen-Gespräche hatten für Cain nicht gereicht, um ein weitergehendes persönliches Interesse an Richard Starke zu entwickeln. Deshalb hatte er unterm Strich nichts dagegen einzuwenden, wenn der Mann aus seinem Leben verschwand. Was nichts daran änderte, dass es das Ende einer langjährigen Arbeitsbeziehung war. Cain spürte die Dimension dieses Augenblicks und streckte ihm die Hand hin.
»Man sieht sich«, sagte er, weil er keine Lust hatte, ihm etwas Tiefschürfenderes mit auf den Weg zu geben.
»Ebenso.« Starke nahm seine Hand. Doch anstatt sie danach gleich wieder loszulassen, packte er fest zu und beugte sich leicht vor. »Ich gehe nie mit Ratschlägen hausieren, aber Sie bekommen heute einen gratis. Hüten Sie sich vor unerledigten Problemen.«
Cain zog eine Augenbraue hoch; die eindringliche Miene des Mannes verunsicherte ihn. »Unerledigte Probleme?«
»Drake und Anya. Mit denen haben Sie noch nicht abgerechnet.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass die beiden erledigt sind«, erwiderte Cain, der schnell zu seiner Selbstgewissheit zurückfand. »Unter einem Berg in Afghanistan begraben. Die findet keiner mehr.«
Trotz der selbstsicheren Worte waren für den neuen CIA-Direktor längst nicht alle Zweifel ausgeräumt. Es war tatsächlich ein unerledigter, neuralgischer Punkt.
Starke sah ihm sekundenlang tief in die Augen, bevor er ihn wieder losließ – ein untypisch offensives Verhalten für den wortkargen Mann.
»Ich wiederhole: Hüten Sie sich vor unerledigten Problemen. Die haben die Angewohnheit, zurückzukehren und wehzutun.« Nach dieser letzten Warnung wandte er sich ab und entfernte sich. »Leben Sie wohl, Marcus. Viel Glück.«
»Jetzt brauche ich kein Glück mehr«, erwiderte Cain tonlos und konzentrierte sich wieder auf die Gedenkstätte vor ihm. Er blieb eine Weile stumm und reglos sitzen, die Gedanken so düster und aufgewühlt wie der dunkel bewölkte Himmel.
Als sein Entschluss stand, fischte er sein Handy aus der Manteltasche und wählte eine Nummer. Der Angerufene ließ nicht auf sich warten.
»Hawkins.«
»Jason, ich habe einen Job für Sie«, begann Cain. »Sie müssen einem alten Freund einen Besuch abstatten.«
4
Nordwales, Vereinigtes Königreich.
Drake hatte vor vielen Jahren seinen Vater verloren. Der Nachlass war später größtenteils verkauft oder verschenkt worden. Seine Mutter hatte jedoch – ohne dass ihre Kinder davon erfuhren – etwas aufbewahrt. Hatte es über viele Jahre gehütet und akribisch in Schuss gehalten. Vielleicht als Geschenk für ihren Sohn, als Friedensangebot womöglich. Aber sie war nie dazu gekommen, es ihm zu überreichen.
Und da stand es unter einer Staubschutzplane hinter den soliden Steinmauern der heimischen Garage: Die Plane schmiegte sich an die schlanke, kurvige Form. Ein schlafendes Ungetüm wartete darauf, zum Leben erweckt zu werden.
Drake ergriff die Plane, schlug sie zurück und enthüllte die anmutigen, eleganten Kurven eines klassischen Sportwagens, eines 1967-er Austin-Healey 3000, dessen makellose dunkelgrüne Lackierung im Licht der elektrischen Deckenleuchten schimmerte.
Jessica hatte sich nie für Autos begeistert, doch selbst sie konnte dem Fahrzeug etwas abgewinnen, das so still vor ihnen stand. Es war so unzertrennlich mit ihrem Vater verknüpft, dass es ganz von seinem Geist durchdrungen zu sein schien. Sie hatte immer noch das Bild von ihm hinter dem Lenkrad vor Augen, wenn er begeistert wie ein kleiner Junge strahlte, sobald er den Motor startete.
Ihrem Bruder, der neben ihr stand, ging bestimmt etwas Ähnliches durch den Kopf. Verglichen mit der Beziehung zu ihrer distanzierten und abwesenden Mutter war Ryans Verhältnis zu seinem Vater hitzig und temperamentvoll gewesen. Zwei grundverschiedene Männer, deren Persönlichkeiten niemals wirklich harmonierten und deren Lebenswege sehr weit auseinandergedriftet waren.