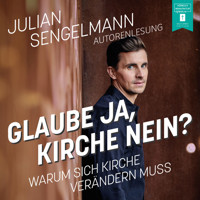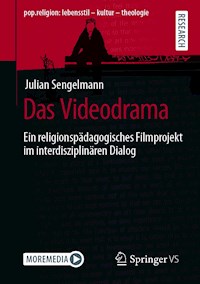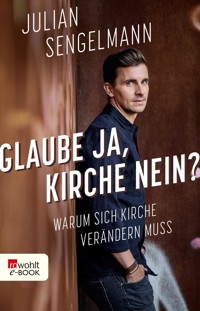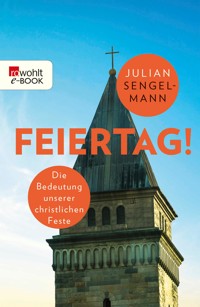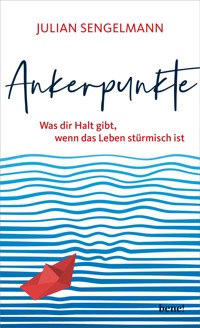
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Ankerpunkte« – das sind die Schätze christlicher Tradition und Weisheit, hilfreiche Rituale, gute Gewissheiten, besondere Orte und schöne Momente. Hoffnungsvolle Perspektiven einer Gemeinschaft im Zeichen der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens. Der Theologe Julian Sengelmann teilt in seinem Buch wunderbare Geschichten als auch praktische Tipps und lädt dazu ein, sich auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise zu begeben. Gerade das brauchen wir in Zeiten, in denen sich vieles rapide verändert und Sorgen überhand zu nehmen drohen. Was kommt, was geht, was bleibt? Woran können wir (uns) festhalten? Und warum lohnt es sich, die Hoffnung nicht aufzugeben? Auf diese Fragen gibt Julian Sengelmann mit seinem Buch »Ankerpunkte« Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Julian Sengelmann
Ankerpunkte
Was dir Halt gibt, wenn das Leben stürmisch ist
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Woran wir unser Leben festmachen können
Gerade in Zeiten, in denen sich vieles rapide verändert und Sorgen überhandzunehmen drohen, brauchen wir mehr denn je »Ankerpunkte«: Schätze christlicher Tradition und Weisheit, hilfreiche Rituale, gute Gewissheiten, besondere Orte und schöne Momente. Ermutigende Perspektiven einer Gemeinschaft im Zeichen der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens. Der Theologe und Fernsehmoderator Julian Sengelmann teilt in diesem Buch sowohl wunderbare Geschichten als auch praktische Tipps und lädt dazu ein, sich auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise zu begeben.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bene-verlag.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
365 gute Gründe gegen die Angst. Und einen dafür.
Apokalypse: now?
Angst! Wer, wie, was, warum?
Bibelblick: Fürchte dich nicht
»Fürchte dich nicht« versus »Alles wird gut«
Mach jeden Tag etwas, das dir Angst macht: Singe!
Als mein Vater seinen toten Freund traf
Das Gehirn ist ein komisches Ding
Sterben für Anfänger
Bleiben Sie nicht sprachlos
Trauer
Unsere Zeit auf Erden ist endlich
Die Zeit und das Leben
Zum Abschluss
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? WTF?!
Was verdoppelt sich, wenn man es teilt?
Die Schuhe anderer Leute
Holy Shit!
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum …?
Bibelblick
Dein Gott …
Liebe deinen Nächsten …
… wie dich selbst.
Vergebung ist eine Freiheitskämpferin
Vergebung versus Entschuldigung
Vergebung ist irrational
Was, wenn nicht?
Vergebung ist ein Dreier
Zum Schluss
Beten – das heißt vor allem in Kontakt kommen
Beten für Anfänger
Am Anfang war das »Du«?
Von gemeinsamen Traditionen und antiken Playlists
Wo wir Gott finden können
Wenn Gott nicht bewiesen werden kann, ist er dann ein Hirngespinst?
Ich finde Gott auch im Zweifel
Ich finde Gott im Geist
Ich finde Gott in Gnade
Gnade ernst zu nehmen, heißt auch zu erkennen, dass wir genug haben und genug sind.
Was darf ich noch hoffen?
Hoffnung versus Optimismus und Zuversicht
Hoffnung ist aktiv
Hoffnung? Jetzt erst recht!
Hoffnung als Ausdruck menschlicher Resilienz
Die Menschheitsgeschichte als Geschichte überwundener Krisen
Hoffnung in Gemeinschaft
Die spirituelle Dimension der Hoffnung
Von der Hoffnungslosigkeit
Moderne Angstquellen und ihre Transformation
Angst vor dem Klimakollaps
Angst vor gesellschaftlicher Spaltung
Angst vor technologischer Überwältigung
Angst vor wirtschaftlicher Unsicherheit
Zehn Hoffnungssätze, die mietfrei in meinem Kopf wohnen:
Die Verbindung von Hoffnung und Handeln
Hoffnung als gemeinsame Praxis
Hoffnung als Kompass
Neun gute Gründe, an Wunder zu glauben
Der blinde Fleck der Vernunft
Das wundersam Alltägliche
Die Hoffnung als Überlebenselixier
Unvollständig ohne Wunder
Die Zeugnisse der Verwandelten
Die Wunder der Gemeinschaft
Die Musik des Unsichtbaren
Das Wunder des Widerständigen
Die wundersame Weisheit der Offenheit
Spiritualität und Wunder
Zum Abschluss: Wunder und ein Plädoyer für kindliches Staunen als Erwachsene
Staunen ist ein Gegengift zur Erschöpfung
Die Wiederverzauberung der Welt
Ein Tor zur Kreativität
Staunen verbindet mit … allem
Radikales Staunen
Staunen hilft, kindliche Offenheit zu bewahren
Von TikTok-Algorithmen, Pilgerreisen und der Einsamkeit in der Community
Erreichbar sein …
Homeoffice: Himmel oder Hölle?
»Das Internet ist für uns alle Neuland«
Drei Tipps, um sich vor Social Media zu schützen
Das sind die Träume anderer Menschen – nicht Ihre
Social Media ist eine »kollektive Illusion«
Woran denken Sie gerade?
Hineni
Übung: Pilgern für Anfänger
Pilgern ist eine Form von Achtsamkeit
Rechne mit allem! Auch mit dem Guten.
»Have you heard the news today?«
Die gute Nachricht kommt in eine Welt voller schlechter Nachrichten
»Man muss den Tag auch mal vor dem Abend loben.«
Danke
Für Maxi & Leni
Vorab: Gott ist für mich geschlechtslos. Als Anrede nutze ich als Zeichen dafür wechselnde Namen und Beschreibungen. Das spiegelt sich unter anderem auch in den Gebeten, die in diesem Buch geteilt werden. Für den Fließtext verwende ich aus Gründen der Lesbarkeit nur eine Form.
Prolog
© Shutterstock.com/Tancha
»Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh!«, sagt der unverschämt gut aussehende Sprecher der legendären Institution Das Wort zum Sonntag gerade in der ARD. »Recht hat er!«, denke ich mir, und: »Moment mal… den Mann und den Satz kenne ich doch?!« Und jetzt hat er meine volle Aufmerksamkeit, während er weiterspricht: »Wie mein alter Kumpel Julian neulich bei einem Essen zu mir sagte. Und damit viele Grüße nach Hamburg.«
Die letzten fünfeinhalb Jahre waren heftig. Von den ersten Gerüchten, es gäbe eine sich schnell ausbreitende Seuche, die eventuell von Fledermäusen stammt, die auf einem illegalen Markt in Wuhan gekauft und gegessen wurden, bis zu dem Moment, als wir alle von heute auf morgen auf einmal zu Hause bleiben sollten. Als wir uns nicht mehr die Hand geben und auch nicht mehr umarmen sollten. Als wir auf einmal nur noch eine Bezugsperson haben durften und manche von uns als »systemrelevant« bezeichnet wurden. Zunächst galten die Bestimmungen für ein paar Wochen, dann auf einmal für mehrere Monate. Am Ende dauerte es fast zwei Jahre, bis so etwas wie Normalität zurückkehrte.
Ostern wurde abgesagt, Masken, die uns vor einer Infektion schützen sollten, gab es nicht, Desinfektionsmittel, Nudeln und Klopapier waren Mangelware. Erstmals standen wir in Deutschland vor leeren Supermarktregalen. Erschöpfung und Verzweiflung trafen auf eine Kommunikation, die nicht funktionierte, und als endlich ein Impfstoff entwickelt wurde, war der Graben zwischen den Fronten aus »Schlafschafen« und »Coronaleugnern« schon so tief, dass er bis heute nicht wieder geschlossen werden konnte. Spätestens seit dieser Zeit ist der Ton schärfer geworden und die Lager sind gespalten.
Dann passierte etwas anderes: Zwischen Meldedaten für die ersten reglementierten Treffen, ritualisiertem Warten auf neue Verordnungen, Impfungen und Testcentertermine fiel Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein. Von einem Tag auf den anderen herrschte Krieg in Europa.
Wir haben das alles nicht aufgearbeitet. Wir sind von einer Katastrophe in die nächste gerutscht. Und wenn wir uns umschauen, stellen wir fest: Es ist definitiv noch nicht vorbei. Vieles ist unsicher geworden. Wir leben in einer herausfordernden Zeit: immer neue Schreckensnachrichten über Krieg und Vertreibung, die immer deutlicher werdende Bedrohung durch eine Klimakatastrophe, eine erstarkende Rechte, die Nachwehen der Pandemie, mediales Dauerfeuer in verkürzten und sich hochschaukelnden apokalyptischen Szenarien, Iran, der Nahe Osten, Amerika …
Kurzum: Erschreckend viel macht gerade unglaublich große Angst.
Die letzten fünfeinhalb Jahre waren für meine Familie und mich auch auf anderer Ebene eine Abfolge von Ereignissen und Katastrophen, die wir – auch aus Hilflosigkeit – gerne als »griechische Tragödie« bezeichnen. Zwei Menschen aus unserer Familie haben sich das Leben genommen, ein anderer ist – viel zu jung – an einer furchtbaren Krankheit gestorben. Ein Freund ist einfach tot zusammengebrochen. In meiner Familie gab es Schlaganfälle und Herzinfarkte und über mehrere Monate den Verdacht einer schlimmen Krankheit. Wir mussten uns um pflegebedürftige Eltern kümmern und haben bei alldem beinah den Glauben daran verloren, dass es irgendwann wieder bergauf gehen kann.
Als norddeutscher Protestant bin ich von Haus aus ein skeptischer Pessimist. Das hat es in diesen fünf Jahren nicht einfacher gemacht. Aber irgendwann wollte ich mich selbst zu mehr Hoffnung und Zuversicht zwingen. Ich wollte lernen, wie das geht – vor allem in diesen komplizierten Zeiten. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und mich gefragt:
Was kommt, was geht, was bleibt?
Woran können wir (uns) festhalten?
Und warum lohnt es sich, die Hoffnung nicht aufzugeben?
In diesem Buch geht es um diese großen Fragen, die uns seit Jahrtausenden umtreiben und die wir manchmal viel zu schnell abtun. Um Hoffnungsperspektiven, gute Gewissheiten, besondere Orte und schöne Momente. Um konkrete und – hoffentlich – hilfreiche Rituale, die teilweise seit Jahrhunderten von Menschen praktiziert werden, um in Krisenzeiten Halt zu finden. Und um die Erkenntnis, dass wir zwar wunderbar, individuell und digital vernetzt sind, uns aber trotzdem häufig furchtbar einsam fühlen. Es geht um den Schatz von Tradition und die Weisheit mancher biblischer Geschichten. Respektvoll betrachtet im Licht aktueller Entwicklung – aber auch durchaus an mancher Stelle kritisch beleuchtet. Es geht um neue Perspektiven auf alte Traumata und darum, dass wir Angst nicht abtun, sondern ernst nehmen, damit wir wieder besser miteinander und mit uns selbst ins Gespräch kommen.
Es geht um Wundervolles und Wunder, um eine tragfähige Gemeinschaft, die wir – auch – in den christlichen Kirchen finden können. Um Gemeinschaft im Zeichen der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens. Und es geht um Geschichten, die berühren und anregen. Denn die Erkenntnis, dass wir mit unserer Angst gar nicht allein sind, ist vielleicht der erste Schritt, Halt zu finden.
Lassen Sie uns nach Ankerpunkten suchen, an denen wir festmachen können. Denn die Zeiten sind stürmisch, aber nicht hoffnungslos.
Kapitel 1
365 gute Gründe gegen die Angst. Und einen dafür.
© mr_marcom/stock.adobe.com
»Die Apokalypse ist nah! Wendet euch Jesus zu!«, schreit der Katastrophenprediger in der Fußgängerzone der Hamburger Innenstadt. Er skandiert das seit Jahren. Ich habe seinen Auftritt immer ein wenig belächelt, aber heute fühle ich zum ersten Mal, dass die Apokalypse vielleicht tatsächlich schon vor der Tür stehen könnte. Meine Gedanken schlagen in Rekordtempo Kapriolen auf einer Abwärtsspirale. Dabei wird von unsichtbarer Hand unaufhaltsam, wie mit diesem besonderen Fingernagel-an-Tafel-Geräusch, »Die Apokalypse ist nah!« in mein Hirn gekratzt. Halleluja.
Wenn es Ihnen geht wie mir und vielen Menschen, mit denen ich spreche, dann kennen Sie dieses mulmige Gefühl, das sich seit einiger Zeit in Ihren Eingeweiden breitmacht. »Etwas ist faul im Staate Dänemark«, wie Shakespeare sagen würde. Aber was eigentlich? Immer, wenn ich in Gesprächen versuche, nachzufragen, was genau dieses Gefühl des Unwohlseins eigentlich auslöst, können die Menschen es nicht benennen. Es ist etwas Unbestimmtes, meist Unlogisches. Etwas, das Angst macht. Wenn Hoffnung ein Differenzkriterium zu Angst und Apokalypse sein soll, lohnt es sich vermutlich mal, auf die unbestimmten Aggregatzustände der Angst zu schauen und zu gucken, ob das Leben nicht vielleicht ein bisschen schöner wird, wenn wir weniger davon unser Handeln und Fühlen diktieren lassen. Lassen Sie uns ganz vorne anfangen, das hilft bekanntlich.
Apokalypse: now?
Es ist nicht zu leugnen, dass wir massiven Herausforderungen und Gefahren gegenüberstehen. Die Bedrohung ist real. Und mit Sicherheit hat sie ein Ausmaß, das in so geballter Form vorher noch nicht auf die Erde und alle darauf lebenden Spezies eingeprasselt ist.
Verständlich, dass wir auf eine solche Bedrohung mit Angst reagieren.
In der Geschichte gab es immer wieder Zeiten, in denen die Menschen dachten, es wäre jetzt vermutlich die Endzeit. Immer schon gab es ein komisches und gleichzeitig irgendwie doch überzeugendes Gefühl, dass die Apokalypse jetzt tatsächlich vor der Tür stünde. Dazu finden sich in der Kunst und in der Literatur zahllose Belege. Menschen schreiben seit jeher darüber Gedichte, Lieder und Romane, Abhandlungen, Prophezeiungen und Erfahrungsberichte und schon in frühen Malereien finden sich Motive, die ein nahendes Weltende ankündigen. Die Apokalypse steht – gefühlte Wahrheit – immer schon vor der Tür.
Wenn Sie mir nicht glauben, können wir das mal durchspielen. Versuchen Sie sich mal zurückzuerinnern, wie häufig es in Ihrem bisherigen Leben solche Momente gab, in denen Sie persönlich und die Mehrheit der Menschen um Sie herum dachten, jetzt wäre es mit der bekannten Weltordnung vermutlich vorbei. Erinnern Sie sich auch an die Angst, die Sie damals hatten. Ich könnte aus dem Stegreif mindestens vier solcher Ereignisse benennen.
Ich erinnere mich, wie meine Eltern und all ihre Freunde und Freundinnen lange Zeit darum besorgt waren, dass ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Wie sie sich immer wieder bei uns zu Hause trafen und sehr ernsthaft darüber diskutierten. Dazu wurden ritualisiert Pfälzer Landwein und Flensburger Pilsener aus unserem alten Kühlschrank mit dem DDR-Aufkleber gereicht. Die Bedrohung war real und ich hatte unendliche Angst. Das ging über Wochen so. Auch damals schien die Apokalypse unausweichlich.
Wie viele andere weiß ich auch noch, wo ich gerade war, als ich hörte, dass Flugzeuge in die Twin Towers in New York geflogen seien. Kurz danach überschlugen sich weitere Schreckensmeldungen. Die Ereignisse führten zum Golfkrieg. Auch damals schien die Apokalypse nicht mehr zu verhindern.
Dieses unbestimmte Gefühl, diese abstrakte Angst, die wir heute fühlen und die wir als besonders oder eben auch besonders bedrohlich empfinden, gab es jedenfalls schon immer.
Wenn Sie sich an solche Momente Ihres Lebens erinnern, in denen Sie dachten, die Apokalypse wäre da – was hat Ihnen da Angst gemacht? Und was hat sich dann tatsächlich für Sie persönlich verändert?
Bedrohung ist real, Angst ist eine Reaktion. Und sie ist trügerisch im Kontext ihrer Zeit. Denn auch heute haben wir öfters das Gefühl, dass früher alles besser war, mindestens aber anständiger. Dass die Jugend in früheren Zeiten wohlerzogen war und Respekt vor den Älteren hatte. Aber fragen Sie mal Ihre Eltern… Wenn Sie in meinem Alter sind, erinnern Sie sich vielleicht, wie Ihre Eltern geguckt haben, als Sie in Ihrer Pubertät plötzlich anfingen, Rap zu hören und Ihre Hosen in den Kniekehlen zu tragen. Da dachten manche Erwachsene auch: Das Ende ist da!
Es gibt seit jeher Abgrenzungsphänomene zwischen den Generationen. Das muss vermutlich auch so sein. Und so sehr ich es liebe, mich in meine eigene verklärte Erinnerung an eine unbeschwerte Jugendzeit zu flüchten, so sehr weiß ich natürlich, dass früher nicht alles besser war. Früher war vielleicht mehr Lametta, wie Loriot sagen würde, aber eben auch mehr FCKW, Aids, Rassismus, nukleares Wettrüsten, Kalter Krieg und weniger Bewusstsein dafür, dass das verfluchte Lametta irgendwann als Mikroplastik in unseren Fischen und dann auch in unserem Körper landen würde.
Verklärung ist eine Facette von Angst, die geradezu danach schreit, dass Ewiggestrige, Faschisten und Reaktionäre sie ausnutzen für ihren menschenverachtenden Quatsch. Früher war nicht alles besser und der verklärte melancholische Blick auf eine Vergangenheit, nach der wir uns zurücksehnen, die es so aber vermutlich nie gab, ist menschlich, aber eben nicht hilfreich, wenn wir weniger Angst haben wollen. Denn: Wir sehen die Welt nicht, wie sie wirklich ist, sondern wie wir wirklich sind.
Das heißt auch zu verstehen, dass es immer schon – oder zumindest immer wieder – ein Gefühl von Endzeitstimmung gab. Der Glauben an eine Form von Apokalypse steckt vielleicht in der westlichen Zivilisations-DNA. Genauso wie das prophetische Beschwören des nahenden Endes, das wir alle gerne gemeinschaftlich und medial miteinander zelebrieren. Wir leben in einer gefühlten Endzeit – so wie alle vor uns auch und vermutlich nach uns ebenso. Das zu verstehen ist wichtig, weil es zwar die Herausforderungen und Bedrohungen nicht weniger akut macht, aber die Haltung, die wir dazu haben, vielleicht ein bisschen verändern kann. Natürlich nützt das den Menschen in der Ukraine genauso wenig wie denen, die in den verheerenden Feuern von Los Angeles alles verloren haben, dass wir das gelassen sehen. Auch den Menschen, die wegen des Klimawandels, der ihre Lebensgrundlage zerstört, auf der Flucht sind, bringt die Erkenntnis, dass wir seit jeher Angst vor dem vermeintlich unausweichlichen Nichts haben, nichts, weil sie tatsächlich vor dem Nichts stehen.
Aber dennoch lohnt sich das Gedankenexperiment, dass wir die Krisen, die Hoffnungslosigkeit, die Unbestimmtheit der eigenen apokalyptischen Fantasien zum einen nicht als Erste erleben – und zum anderen, dass wir die reale Bedrohung nicht lösen können, indem wir uns Sorgen machen, dass die Welt jetzt untergeht. Auch, wenn das verlockend und vor allem verständlich ist.
Übrigens heißt »Apokalypse« gar nicht »Weltuntergang«,sondern »Enthüllung«. Es ist das erste Wort der »Offenbarung des Johannes«, eines Buches in der Schriftensammlung, die wir das »Neue Testament« nennen. Und so brutal die Sprache und plastisch die Bilder darin zwar sind, hilft es zu wissen, dass besagter Johannes diese Geschichte als Hoffnungstext geschrieben hat. Denn die Christinnen und Christen zu seiner Zeit waren unterdrückt. Die Apokalypse macht deutlich, dass sich die Zeiten – nach einem realen Umsturz – fundamental ändern werden und es gerechter und freundlicher zugehen wird. Die bekannte Welt-Ordnung wird sich wandeln, damit es besser wird. Die Hoffnung liegt darin, dass alle korrupten und unterdrückenden Systeme fallen werden. Denn die Apokalypse gibt die Hoffnung nicht auf.
Das Glück im Einmachglas
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Apokalypse jetzt aber wirklich vor der Tür steht, nehmen Sie sich ein Einmachglas, eine Tupperbox, eine schöne Kiste – was auch immer Sie als »Gefäß« zur Hand haben. Es darf nur nicht zu klein sein. Und dann nehmen Sie sich bitte regelmäßig jeden Sonntag fünf Minuten Zeit – die haben Sie auf jeden Fall – und schreiben auf einen kleinen Zettel etwas Gutes, das Ihnen in der zurückliegenden Woche widerfahren ist. Schreiben Sie etwas Schönes auf, das Sie erlebt haben. Das muss nichts Großes sein. Falten Sie den Zettel zusammen und legen Sie ihn in das Einmachglas. Sie werden sich wundern, wenn Sie zu Silvester alle Zettel in die Hand nehmen und lesen, was für ein bemerkenswertes Jahr Sie hatten.
Angst! Wer, wie, was, warum?
Angst ist etwas Merkwürdiges. Genauer: Angst ist etwas Bemerkenswertes. Sie ist überall um uns und in uns spürbar, dabei häufig nicht greifbar. Sie ist indifferent und konkret, rational und absurd. Sie stört uns, ist gesamtgesellschaftlich merkwürdig verpönt und mit Schwäche konnotiert, und trotzdem wären wir als Menschheit vermutlich längst ausgestorben, wenn Angst nicht zum Kanon unserer Grundgefühle gehörte. Höchste Zeit, sie einmal näher zu betrachten, um vielleicht am Ende weniger davon zu haben oder – noch besser – sie anders benennen zu können.
Neulich war ich in einer Gemeinde im Hamburger Speckgürtel, um dort einen besonderen Gottesdienst im Freien zu feiern. Es ging um genau unsere Frage: Was ist das eigentlich mit dieser Angst und wie kann ich manches davon abschütteln? Passenderweise war mottogebender Titelsong der Veranstaltung »Shake It Off« von Taylor Swift.
Wir saßen gemeinsam am Feuer und waren miteinander im Austausch. Dann fragte ich die Runde nach Dingen, die Angst machen, und bat die Feiernden, immer, wenn eines meiner Beispiele auf sie persönlich zuträfe, aufzustehen.
»Wer hat Angst vor Skorpionen?« Blitzschnell standen fast alle auf. »Wer von euch hat denn schon mal einen Skorpion gesehen oder wurde von einem angegriffen?« Eine Person blieb stehen, alle anderen mussten lachen, weil sie verstanden, wie absurd das eigentlich war.
Ich vermute, Sie kennen das: Häufig fürchten wir uns vor Dingen, die wir weder erfahren haben noch direkt in unserem Umfeld erleben werden. Das ist spannend, denn dieses mulmige Gefühl ist ja trotzdem da.
Zunächst könnte hilfreich sein, zu wissen, dass es zwei unterschiedliche Phänomene gibt: Angst und Furcht. Die sind zwar eng miteinander verwandt, doch nicht dasselbe. Sie sind zweieiige Zwillinge. Sie ähneln sich in ihrem Gefühl und ihrer Wirkung, lassen sich aber voneinander unterscheiden. Das griechische Wort für »Angst«, thlipsis, bezieht sich auf das Gefühl der Bedrängnis oder Enge – das Gefühl, keinen Raum zu haben, um sich zu bewegen, zu atmen, zu leben oder sich frei zu entfalten. Dieses Gefühl erzeugt Angst.
»Furcht« beschreibt das erschreckende Gefühl, das entsteht, wenn etwas Unerwartetes plötzlich in unser Leben tritt und wir uns davon bedroht fühlen. Beide Begriffe beziehen sich auf etwas Bedrohliches, das mit der Zukunft zusammenhängt, sei es durch das Gefühl der Enge oder durch eine akute Bedrohung. Charakteristisch für die Angst ist, dass sie sich auf eine unbestimmte Situation bezieht. Sie ist ein ungerichteter Gefühlszustand, der eine psychosomatische Reaktion mit sich bringt.
Angst geht immer auch mit körperlichen Symptomen einher. Demgegenüber steht die Furcht, die sich auf konkrete Situationen bezieht. Angst vor Skorpionen muss daher richtigerweise als Furcht vor Skorpionen bezeichnet werden. In der Umgangssprache werden »Angst« und »Furcht« oft synonym verwendet, sind sie aber nicht.
Erkenntnis Nummer 1: Angst und Furcht sind nicht identisch. Das zu wissen und zu benennen, kann der Angst schon ein bisschen von ihrer lähmenden Macht nehmen. Denn: Es ist wichtig, dem Kind einen Namen zu geben.
Dass wir unsere Emotionen in negativ und positiv einteilen, macht unser Leben nicht besser.
Vielleicht kennen Sie den Pixar-Film Alles steht Kopf, in dem die menschlichen Basisemotionen – Freude, Traurigkeit, Angst, Wut, Überraschung, Ekel und Verachtung – durch das Nervensystem der Protagonistin wuseln. Darin wird es deutlich:
Freude klassifizieren wir als positives Gefühl. Alle anderen wollen wir spontan nicht haben. So wachsen die meisten von uns auf. Das bekommen wir von früh auf eingetrichtert und – Überraschung – das macht viel mit unserer psychischen und emotionalen Gesundheit. »Nun reg dich nicht so auf!« »Das ist total eklig!« »Fass das nicht an!« Es gibt viele solcher Sätze, die unser Leben prägen und unsere Gefühle klassifizieren. Wenn wir an uns selbst etwas anstößig finden, schämen wir uns. Scham ist eine der produktivsten und dabei giftigsten Triebfedern unserer Welt. »Du Angsthase!« ist so ein beschämender Marker für ein Defizit.
Die Konsequenz aus dieser Klassifizierung ist, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich mit ihren vermeintlich negativen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese zu benennen.
Aber wie soll man dem Kind einen Namen geben, wenn man es noch nie angeguckt hat? Häufig sind Menschen der Meinung, dass es nicht hilfreich sei, Emotionen wie »Ich bin wütend, traurig oder ängstlich« auszusprechen. Sie befürchten, das würde die jeweilige Situation verschlimmern und unangenehmer machen. Tatsächlich ist es so, dass das Ignorieren oder Unterdrücken unangenehmer Gefühle dazu führt, dass sie viel intensiver werden. Das ist ein bisschen wie mit dem »Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh« – wenn man die nicht wegmacht, läuft die sich nur über sehr, sehr viele Kilometer ab und stinkt dabei. So ist das mit unterdrückten Gefühlen auch, denn Emotionen haben eine wichtige Funktion, indem sie uns auf Bedürfnisse hinweisen oder – und das ist wichtig – uns schützen. Wir brauchen sie alle: Freude wie Traurigkeit, Überraschung wie Wut. Wenn wir diese Gefühle nicht wahrnehmen, werden sie oft lauter und können körperliche Symptome hervorrufen. Es ist daher wichtig, Gefühle zu benennen, zu akzeptieren und ihre Botschaften zu verstehen. Auch die Angst. Denn die vermeintlich unangenehmen Emotionen zeigen uns, dass bestimmte Bedürfnisse unerfüllt sind. Wenn wir lernen, diese zu erkennen und zu erfüllen, verbessert sich unser Leben.
Es gibt das schöne Bild davon, dass das menschliche Leben wie ein Gasthaus ist, in dem wir alle Emotionen, auch die unangenehmen, willkommen heißen sollten.
Gefühle zu benennen kann uns helfen, mit emotionalen Herausforderungen besser umzugehen, da es den Druck verringert. Neurowissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass Gefühle zu benennen die Aktivität der Amygdala, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, reduziert. Und mehrere Studien zeigen, dass Schüler*innen, die über ihre Ängste geschrieben haben, bessere Leistungen abrufen konnten. Wir können unsere emotionale Reaktivität verringern, wenn wir aussprechen, wie es uns geht und was wir fühlen.
Mein wunderbarer Schwiegervater hat mit dem Grundsatz »Dem Kind einen Namen geben« Ernst gemacht. Er musste im Laufe seines Lebens viele Male am Herzen operiert werden und hatte natürlich jedes Mal große Angst davor. Aber irgendwann erkannte er, dass die Angst die Tatsache, dass er operiert werden würde, nicht verändert hat. Letzteres musste so oder so passieren – völlig unabhängig davon, wie er sich damit fühlte. Durch einen Freund begann er mit Meditation und lernte, wie er mit seinen Emotionen umgehen konnte. Wenn wieder eine Operation anstand, verweilte er lange im Gespräch mit seiner eigenen Angst. Seine Angst bekam einen Namen. Er konnte sie dadurch anders wahrnehmen und ganz neu in seinem Leben verorten.
Solange wir nicht lernen, genau zu identifizieren, was Gefühl und was Gedanke ist, werden wir gefangen sein in der Spirale von Wut und Angst. Neuronal sagt uns Angst, dass da etwas los ist, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Nicht mehr und nicht weniger.
Erkenntnis Nummer 2: Selbst wenn wir die Welt in Gänze nicht ändern werden, können wir doch unsere Antwort an und auf sie ändern. Das verändert unser Leben. Und vermutlich auch die Leben anderer.