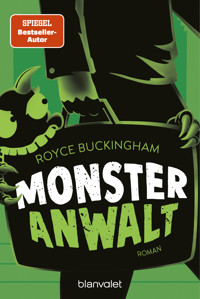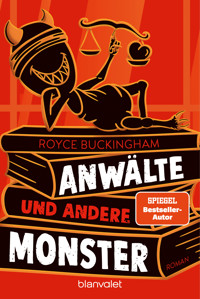
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Monsteranwalt Daniel Becker
- Sprache: Deutsch
Neue Fälle für Daniel Becker, dem Anwalt, dem die Monster vertrauen.
Monsteranwalt Daniel Becker muss nicht nur einen kiffenden Jungdrachen, der sich unversehens in Seattles Zoo wiedergefunden hat, zur Freiheit verhelfen. Er soll auch einen pummeligen Liebesgott davor bewahren, zurück nach Italien abgeschoben zu werden. Doch plötzlich findet sich Daniel selbst als Angeklagter vor Gericht wieder. Zu seinem Glück – oder Unglück? – erhält Daniel unerwartet Unterstützung von einem Vampir (die blutige, nicht die glitzernde Sorte) mit Jahrhunderten an Erfahrung als Strafverteidiger, aber auch mit ganz eigenen Zielen ...
Daniel Becker ist der Anwalt, dem die Monster vertrauen. Wie es dazu kam, erfahren Sie in »Im Zweifel für das Monster«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Monsteranwalt Daniel Becker muss nicht nur einen kiffenden Jungdrachen, der sich unversehens in Seattles Zoo wiedergefunden hat, zur Freiheit verhelfen. Er soll auch einen pummeligen Liebesgott davor bewahren, zurück nach Italien abgeschoben zu werden. Doch plötzlich findet sich Daniel selbst als Angeklagter vor Gericht wieder. Zu seinem Glück – oder Unglück? – erhält Daniel unerwartet Unterstützung von einem Vampir (die blutige, nicht die glitzernde Sorte) mit Jahrhunderten an Erfahrung als Strafverteidiger, aber auch mit ganz eigenen Zielen …
Autor
Royce Buckingham, geboren 1966, begann während seines Jurastudiums an der University of Oregon mit dem Verfassen von Fantasy-Kurzgeschichten. Sein erster Roman »Dämliche Dämonen« begeisterte weltweit die Leser*innen und war insbesondere in Deutschland ein riesiger Erfolg. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen lebt Royce Buckingham in Bellingham, Washington. Er arbeitet zurzeit an seinem nächsten Roman.
Die Monsteranwalt-Trilogie:
Im Zweifel für das Monster
Monsteranwalt
Anwälte und andere Monster
Dämliche Dämonen (die komplette Trilogie in einem Band)
Royce Buckingham
Anwälte und andere Monster
Roman
Deutsch von Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Covergestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Covermotive: © Elm Haßfurth | birbstudio.com
HK · Herstellung: fe
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-32543-5V001
www.blanvalet.de
Dies ist eine Geschichte über Liebe, Begierde und Konflikte. Die ersten beiden Punkte haben nur wenig mit dem Gesetz zu tun, der letzte aber umso mehr, denn Konflikte sind die Dämonen des Anwalts, die es zu bezwingen gilt, und ohne sie hat er keine Chance, ein Held zu sein.
Kapitel 1 Der Gott der Liebe
Hallo, ich bin Daniel Becker, Rechtsanwalt und Seniorpartner bei Monster Lawyer, LLC. Na gut, zugegeben, es ist eine Einzelkanzlei, also bin ich streng genommen der einzige Partner, aber ich werde von einem hervorragenden juristischen Team unterstützt, darunter Dennis, mein sehr vernünftiger (und extrem pelziger) Rechtsanwaltsgehilfe, eine gerissene (und gelegentlich ebenfalls pelzige) Ermittlerin und ein enthusiastischer Praktikant im Jurastudium (nicht pelzig). Martina, meine Ermittlerin, und mein Praktikant Phil begleiten mich heute Nacht, weil es sich hier um einen kniffligen Fall an einem schwierigen Schauplatz handelt. In den meisten Gerichtssälen fühle ich mich allein durchaus wohl, aber manchmal befindet sich der Gerichtssaal auf einem Berg, und es ist zwei Uhr morgens in einer Vollmondnacht.
»Cupido ist ein Halbgott, kein Monster«, sagt Phil über seine Schulter, während er vor mir den Trampelpfad hinaufstapft.
Ich beneide meinen Praktikanten um seine Jugend; wir sind auf halber Höhe des Mount Constitution, und er ist nicht einmal außer Atem. Der Aufstieg beträgt siebenhundertdreißig Meter, etwas mehr als die Hälfte der Höhe des Mount Si – meinem ersten Waldgerichtssaal. Der Serpentinenpfad hier wurde im Northwest Trail Guide mit 4,8 Sternen bewertet, aber es wird nirgends empfohlen, auf ihm im Anzug zu wandern. Seit meinem Mordfall auf dem Gipfel des Mount Si und meiner anschließenden Freiluftverhandlung hinter einem Wasserfall in Oregon habe ich dazugelernt – der Anzug steckt zusammengerollt in meinem Rucksack. Wenn ich oben angekommen bin, werde ich ihn und dazu eine Krawatte anlegen.
Phil trägt seine Dienstkleidung bereits. Er nestelt beim Gehen an dem schwarz-weiß gestreiften Schleifenband am Revers seines magentafarbenen Sakkos. Phil trägt immer irgendeine Schleife, eine Anstecknadel oder ein selbst bedrucktes T-Shirt, um etwas zu würdigen. Denn er würdigt alles. Mit der heutigen Schleife will er auf die Woche der Entlaufenen Katze aufmerksam machen, von der ich nichts mitbekommen habe, bis Phil es mir haarklein erläuterte. »Wissen Sie, wie viele Katzen jede Woche verschwinden?«, fragte er mich mit hochgezogenen Brauen. Ich wusste es nicht. Aber es sind viele. Ich habe zwar Erfahrung mit Katzen – unlängst habe ich einen ganzen Keller voller Katzen gerettet –, doch ihr allgemeines Schicksal in der Welt ist kein Rädchen in der Geschäftsmaschinerie meiner kleinen Kanzlei. Die Rettung von Katzen vor zähflüssigem, katzenfressendem Glibber und mordlustigen alten Damen ist lediglich ein zusätzlicher Dienst an der Gemeinschaft, den wir leisten.
Der unanfechtbaren Logik meines Praktikanten in Bezug auf das Konzept von Cupido habe ich nichts entgegenzusetzen. Es stimmt: Das Wesen, zu dessen Verteidigung wir diesen überwucherten Hügel hinaufsteigen, wurde als Gott verehrt, von Liebenden angebetet und war Gegenstand unzähliger romantischer, schelmischer, skandalöser und regelrecht schlüpfriger Geschichten und Gemälde. Aber dieses spezielle Geschöpf ist nicht unbedingt der allmächtige römische Liebesgott, den sich Literaturliebhaber und Kunstkenner mittlerweile als kleinen, geflügelten Jungen mit Pfeil und Bogen vorstellen und der als »Amor« oder »Cupido« beziehungsweise in der griechischen Tradition als »Eros« bekannt ist.
»Unser Mandant ist nur einer von vielen Amorinen«, fachsimpelt mein eifriger studentischer Assistent, während wir uns zur Seite drehen, um uns zwischen überhängenden Bäumen auf der einen und einem steilen Abgrund auf der anderen Seite hindurchzuschieben. Tagsüber würde Letzterer wohl niemanden umbringen, aber er ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass die Straße in den State Park nachts geschlossen wird. »In der Einzahl heißt es Amorini. ›Cupidos‹ gibt es eine Menge. Er ist nicht wie der Weihnachtsmann, der die ganze Welt allein beliefern muss.«
Phil ist im Hinblick auf Recherche meine Geheimwaffe. Ich schicke den emsigen Jungen los, um geschichtliche Ereignisse, Legenden, Mythen und sogar von Generation zu Generation weitergegebene Ammenmärchen auszugraben – einfach alles, was uns etwas über unsere übernatürlichen Mandanten verraten kann. In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit, doch Mythen sind auch voller Unsinn und Übertreibungen. Rechtlich gesehen sind das alles relevante Belege, aber keiner davon ist über jeden begründeten Zweifel erhaben. Die Wahrheit über Götter und Monster lässt sich nur ermitteln, indem man sie »von Angesicht zu Angesicht« trifft, um es mal so auszudrücken, und das ist meine Aufgabe. Phil kann gut recherchieren. Ich kann gut mit Mandanten umgehen. Obwohl Phil sehr viel über Liebe, Götter und Mythologie weiß, hat er noch nie mit Cupido gesprochen. Aber ich schon.
»Den Weihnachtsmann gibt es nicht«, erkläre ich Phil.
Er dreht sich um und gafft mich im Mondlicht an. »Was soll das, Mr. Becker? Das will ich gar nicht wissen!«
»Das hättest du mit zwölf schon lernen sollen. Und pass auf, wo du hintrittst.«
»Ich hab’s ja gelernt – ich durfte diesen traumatischen Schritt ins Erwachsenenleben in der fünften Klasse durchmachen, als Imogene Williams mir erzählte, ihr Dad habe sich nach unten geschlichen und die Kekse gegessen, die sie neben den Kamin gestellt hatte. Aber all die übernatürlichen Fälle, die wir im letzten Jahr übernommen haben, hatten mir wieder Hoffnung geschenkt. Danke, dass Sie mich erneut traumatisiert haben.«
»Tut mir leid.«
Er verdreht die Augen. »Wie dem auch sei, unser Mandant ist also weniger ein Gott als, sagen wir, ein Halbgott. Das soll keine Haarspalterei sein, aber es gibt Tausende von Amorinen, vielleicht Zehntausende.«
»Ja, doch heute Nacht vertreten wir einen, der einer ganz bestimmten Zielgruppe dient.«
»Menschen aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten?«
»Nein. Eltern mittleren Alters.«
»Haben die denn überhaupt noch romantische Beziehungen?«
Ich muss ein finsteres Gesicht verbergen. »Angeblich ja.«
»Wow! Harter Job. Kein Wunder, dass unser kleiner Liebeskrämer zu kämpfen hat.«
»Klappe, juristische Schnuppernase«, unterbricht ihn Martina und marschiert an uns beiden vorbei, um die Führung zu übernehmen. »Wir sind gleich da. Und wir riskieren alle unsere Ärsche, wenn wir dem Richter erklären, warum wir dir von dieser Welt erzählt haben, also halt den Mund und vermassle es nicht.«
Ihre spitze Nase zuckt im spärlichen Licht. Ich vertraue darauf, dass sie aufpasst, wohin wir unsere Füße setzen, und uns nicht über eine Klippe führt – sie verfügt in der Dunkelheit über gute Instinkte. Und sie hat recht – es ist nicht mehr weit. Der Gipfel liegt direkt vor uns. Der Mond ist aufgegangen und erscheint immer wieder über den hohen Silhouetten der Douglasien auf Orcas Island wie ein glänzender gelber Strandball, der bedenklich über Speerspitzen hüpft. Die Temperatur fällt. Die nächtliche Brise hier oben kriecht unter die Haut und dringt einem bis in die Knochen. Mein Schaudern ist halb der Kälte, halb meiner Angst geschuldet. Wir sind fast da. Gleich kommt mein »Auftritt«. Die Verhandlung steht unmittelbar bevor, und egal, wie gut man sich vorbereitet, man fühlt sich trotzdem nie vorbereitet. Irgendwann muss man einfach antreten und sich der Sache stellen. Es ist wie das Ablegen einer mündlichen Prüfung vor einem Professor, der dich mit Fragen löchert, nur dass da noch jemand gegen dich antritt und versucht, dich zu überlisten, dich aus der Fassung zu bringen und dir, was ziemlich oft passiert, deutlich zu verstehen gibt, dass du unmoralisch bist, weil du überhaupt atmest. Es ist ein Beruf, der von Angst dominiert wird; Rechtsanwälte leben von der Angst. Aber nicht wie mein Freund Brett Bremen, die Schreckensbestie – ein Mistkerl, der Leute erschreckt und die chemische Energie aus ihrer physiologischen Reaktion absorbiert oder so ähnlich. Nein, Rechtsanwälte nutzen Angst als Motivator, nicht als Nahrung. Die Angst, die Antwort nicht zu kennen, dumm dazustehen oder – mögen es die Götter verhüten – den Prozess zu verlieren. Diese intellektuellen Schrecken inspirieren uns dazu, hart zu arbeiten und uns vorzubereiten. Meine größte Angst ist es allerdings, einem Mandanten gegenüber zu versagen, der sich auf mich verlässt. Das ist meine ständige Sorge, das, was mich nachts wachhält, obwohl ich eigentlich mehr schlafen sollte, vor allem, wenn ich an diesen Mandanten glaube. Und ich glaube an unseren eigenwilligen Amorini … irgendwie.
Der sechzehn Meter hohe Turm auf dem Gipfel des Mount Constitution zeigt wie ein gemauerter Finger gen Himmel und wird vom zunehmenden Mond immer heller angestrahlt. Als wir auf die Lichtung stolpern, stehen wir am Fuß des Turms, dem höchsten Punkt auf den San Juan Islands. Der kahle, runde Felsvorsprung, auf dem Ellsworth Storey 1936 während der Weltwirtschaftskrise sein schlankes, steinernes Bauwerk errichtete, fällt auf einer Seite steil ab. Eine Mauer aus Felssteinen soll ahnungslose Touristen daran hindern, in die Tiefe zu stürzen. Dem Abgrund gegenüber steht ein Wall aus Bäumen, und ich vermute, dass das Dickicht lebendig wird, um uns abzuschotten, sobald die Verhandlung beginnt. Das dunkle Wasser der Salish Sea unter uns ist mit den noch dunkleren Schatten anderer, kleinerer Inseln gesprenkelt. Sie lauern im Wasser und zeigen nur ihren Rücken. Wie Schildkröten. Oder Krokodile.
»Wo ist unser Mandant?«, fragt Martina.
»Ich habe Cupido gebeten, sich hier mit uns zu treffen«, flunkere ich, während ich meine Wanderhose abstreife und auf einem Fuß hüpfe, um mir eine schwarze Socke anzuziehen. Tatsächlich hat der Amorini mir gesagt, ich solle ihn hier treffen. Obwohl ich ihm davon abgeraten und ein Treffen vor der Verhandlung in meinem Büro vorgeschlagen habe, bei dem unser gesamtes Team zugegen gewesen wäre, um seine Verteidigung vorzubereiten. Aber anscheinend lassen sich Halbgötter nicht dazu herab, sich ein Uber nach Belltown zu nehmen. Und die Botschafter romantischer Beziehungen sind nicht dafür bekannt, praktische Ratschläge von Menschen anzunehmen, nicht einmal von ihrem Anwalt.
Dann höre ich ein Rauschen in der Luft – das Schlagen von Flügeln. Ein Schatten schießt aus dem Abgrund zu unserer Rechten empor, verdeckt den Mond und schwebt drohend über uns.
Martina duckt sich. »Der Donnervogel!«, kreischt sie, und dabei ziehen sich die Knochen in ihrem Gesicht zusammen, schwanken zwischen Mensch und Ratte, während der Kampf- oder Fluchtinstinkt ihre Züge und ihren gekrümmten Körper schüttelt und bewirkt, dass sie sich um ein Haar unwillkürlich verwandelt hätte. Die Richterin, der sie ihr Leben schuldet, macht ihr immer noch schreckliche Angst. Der Vogel könnte sie jeden Moment hinrichten, und in diesem Gerichtssaal hätte er das Recht dazu.
Das fliegende Wesen landet mit ausgebreiteten Schwingen auf dem spitzen Turmdach, während sich sein mächtiger Mondschatten wie ein riesiges schwarzes Gespenst über uns ausbreitet. Als es jedoch die Flügel anlegt, kann ich endlich seine wahre Silhouette erkennen, und die ist … ziemlich pummelig.
»Zumindest ist unser Mandant pünktlich«, erkläre ich meiner Truppe.
»Aaaaaanwalt!«, singt der Amorini von der Spitze des Turms, viel zu fröhlich für jemanden, dem gleich der Prozess gemacht werden soll. Seine Stimme schallt wie eine Glocke, und bei ihrem Klang wird mir leichter ums Herz. Aber ich habe jetzt keine Zeit für ein leichtes Herz. Ich bin wegen einer ernsten Angelegenheit auf diesen Berg gestiegen.
Ich winke unserem Mandanten zu. »Ja, ich bin es, Daniel Becker. Würdest du bitte herunterkommen?«
Als unser pummeliger Mandant vom Turm tritt, habe ich kurz die Befürchtung, dass die Schwerkraft ihn einholen und als Menschen aus Fleisch und Blut entlarven wird, mit der Betonung auf Blut – schließlich besteht die Lichtung aus nacktem Fels. Aber der Halbgott befindet sich nur für einen Moment im Sturzflug, dann breitet er die Flügel aus. Natürlich tut er das. Er zieht eine Kurve und umkreist auf dem Weg nach unten gemächlich den Turm. Während seines Sinkfluges sehe ich, dass er nackt ist. Zum Glück verbergen die nächtlichen Schatten die Einzelheiten, außerdem hängt sein dicker Bauch – vielleicht ein nicht ganz so glücklicher Umstand – weit genug herunter, dass seine intimeren Körperteile darunter verdeckt sind, als er vor uns auf dem Boden landet. Sein mächtiger Leib wabbelt, als er seine breiten Füße auf den Felsen setzt.
»Hallooo«, gurrt er und wackelt mit den Augenbrauen, ohne dabei jemand Bestimmten zu meinen, vielleicht aber auch uns alle drei. Der Bogen, der über seinem Rücken hängt, ist wunderschön – schlankes weißes Holz mit elegant geschwungenen Enden, und seine aus Spinnenseide gedrehte Sehne glitzert sogar im fahlen Licht der Nacht. Sein bloßer Anblick lässt mein Herz flattern, ein angenehmes Gefühl, das ich energisch ignoriere.
»Endlich lernen wir uns persönlich kennen«, sage ich. »Das sind Martina, meine Ermittlerin, und Phil, mein Praktikant. Wir haben viel zu besprechen und nur sehr wenig Zeit. Ich wünschte wirklich, du hättest dich vor heute Nacht mit uns in meinem Büro getroffen.«
»Entspann dich und genieße den Augenblick, Rechtsanwalt Daniel. Wir stehen hier zusammen auf einem Berg, und unter uns wogt die Wasserwelt der Salish Sea auf Geheiß des lächelnden Mondes. Wir atmen die frische Nachtluft ein, inmitten des Raunens sich wiegender Bäume und …«
»Verhandlungsbeginn in zehn Minuten«, unterbricht ihn Martina und schaut mit umherhuschenden, pupillenlosen schwarzen Augen zum Himmel.
Sie hat Angst. Ich kann ihr keinen Vorwurf daraus machen, denn sie dient einer rachsüchtigen Herrin. Cupido hat keine Ahnung von der Gefahr, in der er sich befindet – in der wir alle schweben. Und er hört sich gern reden. Ich sollte dringend die Kontrolle über dieses Gespräch erlangen.
»Ich muss dir drei Fragen stellen, um deine Verteidigung vorzubereiten«, eröffne ich meinem Mandanten. »Erstens, was hast du in Italien getan, das dich zu der Flucht hierher veranlasste?«
Er seufzt und lächelt, als würde er in einer angenehmen Erinnerung schwelgen. »Da war so ein reizender katholischer Bischof, der sich offensichtlich nach einer der chronisch unbefriedigten verheirateten Frauen in seiner Gemeinde verzehrte, und deshalb …«
»… hast du sie abgeschossen, nicht wahr?« Martina schnaubt missbilligend und deutet auf seinen Bogen.
»Nein, sie war bereit und durchaus willig. Er war derjenige mit Vorbehalten, der seinem Herzen nicht nachgeben wollte.«
»Also hast du ihn abgeschossen, und er hat sein Gelübde gebrochen«, sage ich. »Verstehe. Keine weitere Erklärung nötig. Frage Nummer zwei: Welche Autorität verlangt deine Rückkehr?«
»Venus. Oh, und Mars.«
»Seine Eltern«, sagt Phil zu mir. »Die Göttin der Liebe und der Gott des Krieges.«
Klingt nach einer stürmischen Ehe.
»Ja. Ich bin ein unartiger Junge.« Der Amorini kichert. »Aber sie haben noch jede Menge anderer Kinder. Sie werden meinen kleinen Fehltritt vergessen.«
»Tja, irgendjemandem war der Vorfall wichtig genug, um den Donnervogel zu rufen und zu verlangen, dass er dich zurückschickt. Du wirst extradiert.«
»Was soll das denn heißen? Das klingt schmerzhaft.«
»Es wird eine Anhörung geben, um zu entscheiden, ob man dich zwingen wird, nach Italien zurückzukehren, oder ob du hier im Zuständigkeitsbereich des Donnervogels bleiben darfst.«
Und das hätte ich dir alles erklären können, denke ich voller Verbitterung, wenn du in mein Büro gekommen wärst, statt meinem verstaubten Online-Dating-Profil eine Reihe von kryptischen Emojis zu schicken, die Phil mir übersetzen musste. Der Schlüssel war das weinende Herz.
»Frage Nummer drei …«
Phil murmelt etwas hinter mir. »Warum sieht ein Amorini aus wie ein schwabbeliger, nackter, arbeitsloser Boomer, der in einer Bowlingbahn abhängt?«
Das ist nicht meine dritte Frage. Außerdem ist es unhöflich. »Phil, dies ist der Grund, warum du für die Recherchearbeit zuständig bist, statt direkt mit Mandanten zu arbeiten. Hör zu und lerne. Bring mich nicht dazu zu bedauern, dass ich dich mitgenommen habe.«
»Ich habe eine Frage an dich, Daniel«, meldet sich der Amorini zu Wort, und obwohl ich mich nicht erkundige, was das für eine Frage ist, plappert er munter drauflos. »Was hat Cupido während des griechisch-römischen Krieges abgeschossen?«
»Keine Ahnung; vermutlich potenzielle Liebende?«
»Eros!« Er wartet darauf, dass ich lache, was ich nicht tue. Also begeht er die Todsünde der Komik und erklärt seinen eigenen Witz. »Hast du es kapiert? Der griechische Name Eros klingt wie das englische Wort für Pfeile. Wir haben uns früher mit den griechischen Liebesgöttern um internationale Romanzen gestritten.«
»Ja, ich hab’s kapiert. Und normalerweise würde ich über einen guten, albernen Flachwitz ja auch lachen, aber ich nehme deinen Fall sehr ernst. Ernster als du offensichtlich. Du musst begreifen, dass bei dieser Richterin Tod, Verstümmelung und Schuldknechtschaft zu den üblichen Strafen zählen. Eine Rückkehr nach Italien ist die geringste deiner Sorgen. Tatsächlich wäre das der reinste Urlaub im Vergleich zu dem, was der Donnervogel mit dir machen könnte, dafür, dass du unbefugt in seinem Hoheitsgebiet tätig warst.«
»Diese Regionalgottheit kann mich nicht töten«, kontert er mit einem Anflug von Verachtung. »Ich bin ein Gott.«
»Halbgott«, meldet sich Phil erneut leise zu Wort.
»Das habe ich gehört«, sagt der Amorini. »Diesen Monat gibt es für dich keine Liebe, Praktikant Phil.«
»Ich gehöre so was von gar nicht zu deiner Zielgruppe«, blafft Phil zurück. »Und auch nicht in deinen Zuständigkeitsbereich.«
»Meine Kräfte enden weder vor dem mittleren Alter noch an der italienischen Grenze, mein Sohn.« Wieder sieht er Phil an und wackelt mit den Augenbrauen. Sie schlängeln sich wie Raupen.
»Zwei Minuten«, verkündet Martina, die den Kopf hin und her dreht und den Himmel nach einer Bewegung in den Wolken absucht.
»Letzte Frage.« Ich schiebe Phil hinter mich. »Was ist das Wichtigste, das ich der Richterin übermitteln soll?«
Der Amorini verzieht sein pausbäckiges Gesicht. Er sieht aus wie ein Mann, der nachdenklich an einer Zigarre nuckelt, und ich muss zugeben, dass ich die romantische Macht dieses Wesens nicht erkenne – ein dicker, nackter Mann, der zwischenmenschliche Anziehungskräfte in Gang setzt und die Liebesbeziehungen in der Welt beeinflusst. Das ist weder eine gute Erfindung noch die Realität.
»Diese Richterin«, sagt er schließlich, »sollte wissen, dass du einsam bist.«
»Was? Nein. So etwas meinte ich nicht. Als mein Mandant hast du ein Recht auf …«
In diesem Moment ertönt ein Donnerschlag. Mit einem gewaltigen Luftzug werden meine juristischen Weisheiten weggefegt. Dann teilen sich die Wolken, und der riesige Vogel, der über alles Übernatürliche in und um die Salish Sea waltet, fliegt zu uns herab, flankiert von Hunderten von Krähen.
Der Donnervogel landet auf dem Turm und lässt das steinerne Gebilde erbeben. Als er sich mit seinen Klauen in das hölzerne Geländer krallt und tiefe Kerben hinterlässt, danke ich den vielen verschiedenen Göttern, dass mein Mandant mit seinem nackten Hintern nicht immer noch dort oben ist. Die dunkle Wolke aus Krähen sammelt sich um ihre Gebieterin, und sie nehmen auf jeder verfügbaren Fläche des Turms Platz, bis das ganze Ding schwarz gesprenkelt ist.
»Kopf runter«, flüstert Martina. Phil ist sichtlich fasziniert, deshalb muss Martina ihm mit Gewalt den Kopf nach unten drücken, damit er die Richterin nicht gleich bei seiner ersten Anhörung brüskiert und beiläufig entzweigerissen wird.
Wenn ein Richter einen Gerichtssaal der Menschen betritt, sagt der Gerichtsdiener: »Erheben Sie sich.« Dann erweisen alle dem Richter ihren Respekt, indem sie aufstehen. Vor dieser uralten Autorität hier verneigen wir uns alle. Alle, mit Ausnahme meines Mandanten. Der ist damit beschäftigt, die uralte Autoritätsperson des Pazifischen Nordwestens fasziniert zu mustern.
»Ziemlich großer Vogel.« Er schaut zu mir und zieht die gewölbten Augenbrauen hoch.
Als der Donnervogel die Flügel anlegt, lässt der Wind nach, und das Blattwerk des Waldes schließt sich, sodass wir vom Weg abgeschottet sind. Ich hab’s ja gewusst. Wir sind auf dem Felsvorsprung unter dem Turm gefangen. Ich sage das nur ungern, aber so ist es üblich. Das Gleiche habe ich auf dem Mount Si erlebt, und langsam gewöhne ich mich daran. Jetzt warten wir demütig ab, bis unser Fall aufgerufen wird.
Der erste Prozess auf der Tagesordnung dreht sich um ein Geschöpf, das ich als Elb bezeichnen würde, allerdings erinnert es nicht an die Figuren aus dem Herrn der Ringe – lächerlich attraktive blonde Menschen mit spitzen Ohren –, sondern es handelt sich um ein drahtiges, verholztes Wesen mit einem großen Kopf, das in einem Baum in der Nähe auftaucht und den Fehler macht, höher als der Donnervogel ins Mondlicht hinaufzuklettern und einen Schatten über das riesige Vogelweibchen zu werfen. In einem übereilten – und meiner Meinung nach übertrieben formaljuristischen – Rechtsentscheid über das Verfahren verfügt die gefiederte Richterin, dass der Elb die »Autorität des Gerichts in den Schatten gestellt« habe, pflückt ihn vom Baumwipfel herunter und wirft ihn über die einige Meter entfernte Klippe. Wir alle hören, wie sein großer Kopf irgendwo in der Dunkelheit unter uns am Felsen zerschellt. Wir sind nicht einmal zum eigentlichen Sachverhalt im Verfahren des Elben gekommen.
»Wer ist der Nächste?«, grollt der Vogel über uns.
Auf der Lichtung ist es still, und man sollte meinen, niemand sonst würde es wagen, in diesem Moment das Wort zu ergreifen, aber …
»He!«, schreit der Amorini dem Donnervogel entgegen. »Hier unten!«
Mein Auftritt.
Ich springe an die Seite meines Mandanten, wobei ich darauf achte, mich nicht vor ihn zu stellen, aus Angst, der Vogel könnte herabstoßen und das nächstbeste nervige Geschöpf bestrafen wollen.
»Guten Abend, Euer Ehren«, rufe ich nach oben. »Ich bin es, Rechtsanwalt Daniel Becker.« Der Donnervogel legt den Kopf schräg und beäugt uns, vor allem mich. Ein riesiger Raubvogel, der den Kopf in deine Richtung dreht, ist etwas, woran man sich nie gewöhnt. »Und es ist mir eine Ehre, in der Anhörung heute Nacht den Amorini zu vertreten, der als Cupido bekannt ist. Ich warte ergebenst auf Eure Zustimmung, fortfahren zu dürfen.«
»Ich kenne dich, Anwalt Becker. Du sprichst für diesen Göttersohn?«
»Gott«, flüstert Cupido mir zu und stößt mich in den Rücken. »Sag es ihm.«
»Mein Rat ist, diese Kleinigkeit fallen zu lassen«, flüstere ich meinem Mandanten zu und bin dankbar, dass ein Riesenvogel sich nicht um Nacktheit schert. Ich meine, alle Tiere sind nackt, oder?
Apropos nackte Tiere, irgendetwas Dickes und Großes regt sich zwischen den Bäumen. Man könnte es fälschlicherweise für einen wandelnden Baumstamm halten, aber ich weiß es besser. Es ist unser zweibeiniger Gerichtsdiener, im Volksmund auch Bigfoot genannt – der Donnervogel ist nicht das einzige Wesen hier, das einen Menschen entzweireißen kann. Und hinter unserer regionalen Version eines Yeti spähen Hunderte glänzender Augen aus dem Dickicht. Die Jury. Das Publikum. Was auch immer sie sind, sie sind neugierig und gut versteckt. Die Krähen dagegen sind nicht versteckt. Sie klammern sich an jede Kante und jeden steinernen Vorsprung des Turms und krächzen ihre Zustimmung zu den einfachsten Aussagen ihrer Gottheit heraus wie geschwätzige Speichellecker.
»Der Amorini wird nach Hause gerufen«, krächzt der Donnervogel, und die Krähen unterstreichen dies mit der Wucht ihres chaotischen Geschreis.
»Auf wessen Geheiß, Euer Ehren?«, frage ich. Ich weiß es bereits, aber ich möchte die Reaktion des Vogels sehen. Ich will wissen, ob er diese Aufgabe widerwillig im Namen mächtigerer Götter übernommen hat oder meinen Mandanten einfach nur loswerden will.
»Auf mein Geheiß«, faucht mich der Donnervogel an. »Auf wessen sonst?«
Der Vogel ist heute Nacht empfindlich. Griesgrämig ist er immer, aber auf meine Frage reagiert er besonders gereizt. Ich schätze, die römischen Götter haben ihm befohlen, den Amorini zurückzuschicken. Und der Donnervogel lässt sich nicht gerne herumkommandieren.
»Also ist es Eure Entscheidung«, halte ich fest.
»Natürlich«, sagt der Vogel, und die Krähen krächzen lautstark ihre Zustimmung.
»Wenn Ihr wolltet, könntet Ihr ihn hierbleiben lassen«, schlage ich vor. »Diese Macht habt Ihr.«
»Ich habe die Macht, ja. Er könnte bleiben, wenn ich es wollte. Aber ich will es nicht.«
»Ihr kennt seine einzigartigen Fähigkeiten, ja?«
»Pah! Das ist eine Angelegenheit zwischen Menschen. Hat irgendwas mit Paarung zu tun. Das geht mich nichts an.«
»Aber er ist ein Göttersohn mit einer bestimmten Rolle – einer rechtmäßigen Rolle, die er im komplexen System menschlicher Beziehungen zu spielen hat.«
»Drück dich klarer aus, Anwalt Becker, sonst verlierst du einen Arm.«
Ich habe den Vogel schon mal einen Gnom auseinandernehmen sehen, und ich lege großen Wert auf meine Arme, schließlich benutze ich sie für alle möglichen Dinge, unter anderem, um meinen Argumenten Nachdruck zu verleihen. Mit einer unterwürfigen Geste hebe ich die Hände. »Erlaubt mir, das anders zu formulieren, Eure Vogelschaft. Er ist aus einem triftigen Grund hier.«
»Seine Gründe gehen mich nichts an. Ich mische mich nicht ein, es sei denn, das Gleichgewicht wird gestört.«
Ich weiß nicht, was der Vogel mit »Gleichgewicht« meint, und sehe Phil an. Er zuckt die Achseln; er weiß es auch nicht. »Das Gleichgewicht?«
»Ich werde es anders formulieren«, gurrt der Vogel. »Warum sollte es mich interessieren?«
Touché. »Weil Ihr die Richterin über alle Dinge seid. Ihr trefft weise Entscheidungen. Was Ihr tut, tut Ihr immer aus gutem Grund.«
»Was wäre hier der Grund?«
Ich erstarre. Ein Rechtsanwalt sollte niemals eine Argumentationslinie einschlagen, bei der er nicht weiß, zu welcher Antwort sie führt. Aber aufgrund mangelnder Mandantenvorbereitung weiß ich tatsächlich nicht, warum der Amorini hier ist, jedenfalls nicht genau. Mit der Antwort auf diese Frage wird mein Fall gewonnen oder verloren, und ich kenne sie nicht. In leichter Panik platze ich mit der einzigen Information heraus, die ich habe – mit dem, was mein Mandant mir aufgetragen hat, der Richterin zu sagen.
»Dass ich einsam bin, Euer Ehren.«
»Er ist deinetwegen hier?«
Idiotisch! Aber jetzt, da ich es gesagt habe, muss ich dabei bleiben. »Mein Mandant hat mir das eben erst offenbart. Er ist ein ›Göttersohn‹ mit einer spezifischen, eng gefassten Aufgabe.«
»Ah, seiner göttlichen Aufgabe. Ich verstehe.«
Der Kopf des Donnervogels wippt auf und ab. Er versteht es. Mir scheint, er gibt mir sogar recht. Ich habe es geschafft! Und dabei habe ich auch noch ein universelles Gesetz entdeckt: Kleine Gottheiten, die für bestimmte Dinge zuständig sind, haben einen speziellen Zweck, und während sie diesem Zweck dienen, wird ihnen (von höheren Göttern) erlaubt, ihren Aufgaben auf eine vernünftige, gottgemäße Weise nachzugehen. Ich speichere dieses neue Gesetz auf meiner mentalen Festplatte ab und mache mich bereit, mein Plädoyer zu beenden. Man soll aufhören, solange man vorne liegt. Ich habe diesen Fall fast gewonnen, da beschließt mein Mandant, das Wort zu ergreifen.
»Nein, nein«, sage ich zu ihm, als er sich räuspert. »Wir gewinnen. Sag nichts …«
Aber Cupido stellt sich vor mich. Ich halte den Atem an. So etwas nennt man mangelnde Mandantenkontrolle.
»Ich bin die Liebe«, sagt der Amorini zu einer Kreatur, die nichts für Gefühle übrighat. Dann hält er seinen Bogen hoch. »Und das hier ist das Werkzeug, mit dem ich sie überbringe.«
Nicht einmal ich bin auf das vorbereitet, was als Nächstes passiert. Der Donnervogel fällt vom Turm wie ein gefiederter Stein und landet vor uns auf dem Felsen. Die Wucht seiner Autorität lässt den Berg unter uns erbeben. Ich taumle. Phil kippt vornüber. Martina kauert rattenartig am Boden. Und Cupido steht einfach da, unbekümmert grinsend wie ein Idiot. Bis der Vogel ihm den Bogen aus den Händen reißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Mensch einem Amorini den Bogen hätte wegnehmen können, aber der Donnervogel tut es. Mühelos. Und genauso mühelos bricht er den magischen Bogen entzwei.
Heilige Scheiße!
Kapitel 2 Ein Dämon versucht, mich zu töten (und das ist definitiv nicht rechtens)
»… und so haben wir die Auslieferungsanhörung gewonnen«, berichte ich Dennis fröhlich, während ich hinter meinem riesigen Schreibtisch sitze. »Der Amorini darf bleiben. Zumindest, bis er seine Aufgabe erfüllt hat.«
Mein vierbeiniger Rechtsanwaltsgehilfe hockt auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch, auf dem normalerweise Mandanten sitzen. Er macht sich auf dem hundegerechten Laptop mithilfe der Speech-to-Text-Funktion Notizen.
»Aber ohne seinen Bogen, genau das Instrument, das er dafür braucht«, sagt Dennis und kratzt sich mit der Hinterpfote den Nacken.
»Ich betrachte es als Sieg.«
»Es ist ein halber Sieg.«
Der Hund hat wie üblich recht. »Bäh! Warum musst du immer so pragmatisch sein?«
»Ich denke, die eigentliche Frage lautet: Warum bist du es nicht?« Dennis schüttelt langsam den Kopf. In der Hundewelt bedeutet diese Bewegung nicht zwangsläufig, dass er von mir enttäuscht ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus. »Wie gesagt, Daniel, dieser Mandant hat kein irdisches Geld. Wie soll er uns dafür bezahlen, dass wir ihn vertreten?«
Schweigen. Schuldbewusstes Schweigen. Ich schaue mich im Raum um und vermeide Blickkontakt.
»Daniel, hat der Liebesgott versprochen, dir zu helfen, Dates zu bekommen, um seine Anwaltskosten zu bezahlen?«
»Ich habe nicht darum gebeten! Der Amorini hat mich unmittelbar vor der Anhörung damit überrumpelt. Außerdem bin ich zurzeit nicht auf der Suche. Ich habe viel zu viel zu tun und eine Tochter im Teenageralter, und ich ordne mein Leben nach meiner letzten Beziehungskatastrophe gerade erst neu, ganz zu schweigen davon, dass ich mein gesunkenes Zuhause ersetzen muss. Meine aktuelle Adresse ist der Grund des Lake Washington. Ich habe keine Zeit für Liebe.«
Dennis wirft mir diesen elenden Hundeblick zu. Es ist einer der traurigsten Blicke der Welt. Dann murmelt er seine verbalen Notizen ins Mikrofon. »Die Anhörung auf dem Mount Constitution wird steuerlich mit acht abrechenbaren Anwaltsstunden und acht Stunden zu Phils Praktikantentarif abgeschrieben. Und die Kanzlei schuldet Martina acht Stundensätze als Ermittlerin in Rufbereitschaft, plus Gefahrenzulage. Das Ganze wird als Pro-bono-Tätigkeit abgelegt.«
Wohltätigkeit. Das bedeutet »pro bono«: gemeinnützige Arbeit. Gut für die Seele, schlecht fürs Geschäft. Angesichts all der Kreaturen, die nicht in der Lage waren, uns zu bezahlen, ist meine Seele in einer hervorragenden finanziellen Verfassung, aber ich muss mein mit Wasser vollgesogenes Boot ersetzen, damit ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich nicht gerade das Haus sitte, das ich Eve bei der Scheidung überlassen habe. Meine Ex-Frau wird bald zurück sein, und ich bin mir zu siebenundachtzig Prozent sicher, dass sie mich, wenn auch sehr höflich, auffordern wird, wieder auszuziehen.
Phil trifft um Punkt zwölf in der Kanzlei ein – der Junge mag Präzision. Er spaziert herein und schaut prüfend auf seine Apple Watch, gekleidet in eine hautenge Radlerhose, ein Pride-Day-Funktionsshirt und mit dunkler Wayfarer-Sonnenbrille – völlig unnötig angesichts der ständigen Wolken über Seattle, die so grau sind wie der Schnee vom Vortag am Straßenrand, den das Räumfahrzeug ausgespuckt hat. Phil ist zur Mittagszeit von der juristischen Fakultät der University of Washington hergeradelt, obwohl er nur nachmittags als Praktikant tätig ist. Er studiert noch, besteht aber darauf, dass er erwachsen und »voll und ganz dabei« sei. Ihn nach dem Hexendebakel in Oregon, bei dem er ein hufeisenförmiges Brandmal auf seinem jungen Hinterteil davongetragen hat, Gefahren auszusetzen, kommt mir immer noch nicht richtig vor. Zumindest lebt er noch.
Martina verspätet sich wie gewöhnlich. Sie folgt ihrer eigenen Zeitrechnung, die ich »Martina-Zeit« nenne, was bedeutet, dass ich sie gegen Viertel nach zwölf erwarte. Sie huscht um zwölf Uhr siebzehn herein, in ihrer ausgeleierten grauen Jogginghose und mit einem zitronengelben Haargummi um ihren mausbraunen Zopf.
»Scheißverkehr«, sagt sie.
Das ist alles. Das ist ihre ganze Erklärung. Nur gut, dass ich derjenige bin, der vor Gericht antritt – wenn man zu spät vor dem Richter erscheint, hat das schlimme Folgen für den Fall. Aber wir gehen heute nicht vor Gericht. Dies ist eine Teamsitzung, die wichtigste Teamsitzung in der kurzen Geschichte unserer kleinen Kanzlei. Denn ein Online-Dämon versucht nach wie vor, mich umzubringen.
Wir treffen uns im »Konferenzraum«, eigentlich nur mein Büro, nachdem ich Stühle um meinen lächerlich überdimensionierten Schreibtisch herum aufgestellt habe. Um den Tisch hier hereinzubekommen, mussten wir die Bürotüren aushängen, das gewaltige Ding auf die Seite kippen und es vor- und zurückruckeln. Dabei haben wir versehentlich ein Loch in die Wandverkleidung im Empfangsbereich geschlagen, aber das war es wert. Ich liebe diesen Schreibtisch. Es ist schön, hinter etwas so Massivem zu sitzen; ich fühle mich professionell und sicher. Als Konferenztisch gefällt er mir nicht ganz so gut.
Dennis beendet im Nebenzimmer irgendeine Arbeit auf seinem Laptop. Als er Martinas liebenswerte Flüche hört, gesellt er sich zu uns. Er tapst herein, hüpft auf seinen gepolsterten Stuhl und lässt seine kastanienbraunen Vorderpfoten mit einem dumpfen Geräusch auf den Schreibtisch fallen.
»Ich habe Flugtickets nach Angola gefunden«, berichtet er. »Willst du wissen, für wie viel?«
»Nein.«
»Zweitausend Dollar pro Nase.«
»Götter!« Ich wollte es nicht laut ausrufen; es rutscht mir einfach heraus. Diese Neuigkeit ist fast so beängstigend wie das Thema unseres heutigen Meetings. In Zeiten wie diesen wünschte ich mir, wir wären eine erfolgreiche Kanzlei. Ach was, ich wünschte, wir wären eine finanziell erfolgreiche Kanzlei. Wir haben schon eine Reihe von Fällen erfolgreich zu Ende gebracht, aber wir haben einfach keine regelmäßigen Einnahmen.
»Wir werden das Geld auftreiben, Daniel«, versichert mir Dennis. »Ich weiß, wie wichtig das für dich ist.«
Wir setzen uns auf unsere Stühle, und alle blicken mich erwartungsvoll an. Es gibt keine Möglichkeit, diese Sache zu beschönigen, also sage ich es einfach.
»Ich habe unser Team versammelt, um unser Vorgehen gegen den Kishi zu besprechen.«
Meine Worte hängen schwer über dem Tisch – die Jagd auf diesen Dämon, der versucht, mich zu töten, ist eine brandgefährliche Sache, und das wissen sie. Zwei seiner Hexen-Handlangerinnen sind bereits nach Seattle gekommen und haben versucht, mich umzubringen. Martinas Augen werden noch schmaler, bis sie wie schwarze Punkte unter ihren buschigen braunen Brauen liegen. Sie blinzelt mich an, und ihre Nase zuckt. Phil starrt in meine Richtung, und sein Gesichtsausdruck changiert zwischen Aufregung und Panik. Dennis sitzt einfach stirnrunzelnd auf seinem Stuhl und streckt die Pfoten auf dem Tisch aus wie auf diesen Gemälden von Hunden, die Poker spielen. Er ist derjenige, der das bedrückende Schweigen bricht.
»Ich sehe mich genötigt, darauf hinzuweisen, dass das ›Team‹, das wir hier versammelt haben, um diesem mächtigen und tödlichen Dämon in seinem afrikanischen Versteck entgegenzutreten, aus einem Anwalt, einem Hund, einer Ermittlerin, die eine Halbratte ist, und einem studentischen Praktikanten besteht.«
Phil ergreift das Wort. »Und dem Kishi steht ein weltweit agierender Hexenzirkel zu Diensten, dessen Mitglieder für ihn sterben würden.«
»Die letzte Hexengruppe, die uns über den Weg gelaufen ist, hat uns ganz schön den Hintern versohlt«, ruft Martina mir ins Gedächtnis.
»Und das war nur eine regionale Organisation«, stellt Dennis klar.
»Alles gute Argumente«, räume ich ein und hole tief Luft.
Plötzlich verspüre ich die große Last der Verantwortung für meine kleine juristische Familie hier. Ich bin sozusagen ihr Anführer, und als solcher werde ich ihnen gleich vorschlagen, sie auf einer lebensgefährlichen Mission anzuführen.
»Mir ist klar, dass dies nicht euer Problem ist. Das Biest versucht, mich umzubringen, nicht euch. Wenn jemand abspringen möchte, wird niemand schlecht von ihr oder ihm denken, und es wird sich nicht auf seine oder ihre Anstellung auswirken. Vertraglich gesehen gehört das nicht zu eurer Stellenbeschreibung.« Ich gehe um den Tisch herum. »Martina, möchtest du lieber zu Hause bleiben?«
»Was? Scheiße, nein. Ich bin dabei. Ich sage nur, dass wir aufrüsten müssen.«
»Phil?«
»Danke, dass Sie mich einbeziehen!«
»Dennis?«
»Hm. Ich bin noch nie einer Hyäne begegnet, doch mein Instinkt sagt mir, ich mag sie nicht. Ich glaube, sie sind mit Katzen verwandt.«
Phil schnaubt leise. »Was hat nur alle Welt gegen Katzen? Katzen sind doch niedlich.«
Der Hund und das Nagetier drehen sich um und blicken ihn mit gerunzelter Stirn an.
»Unsere jeweiligen Standpunkte bezüglich Katzen sind irrelevant, Team. Konzentrieren wir uns. Phil, bitte teile die Ergebnisse deiner Internetrecherche mit den Anwesenden.«
»In der angolanischen Legende ist der Kishi angeblich ein Dämon mit einem Hyänenkopf, der irgendwie menschlich erscheinen kann.«
»Ein Gestaltwandler?«, fragt Martina.
Phil schüttelt leicht den Kopf. »Oder er ergreift Besitz von Menschenmännern, die dann seine Drecksarbeit erledigen. Man weiß es noch nicht. Das sind alles nur Mythen, mündlich überlieferte Geschichten, die von Historikern dokumentiert wurden, und Spekulationen im Internet. Es heißt, dass der Dämon Frauen verführt und sie anschließend verschlingt.«
»Hurensohn.« Martina murmelt das, was ich denke. Doch ich bin zu gut erzogen, um es auszusprechen. Sie dagegen nimmt nie ein Blatt vor den Mund.
»Er frisst sie nicht alle«, sage ich. »Unsere letzte Hexe war in das Scheusal verliebt.«
»Das ist keine Liebe«, widerspricht Phil. »Das ist Co-Abhängigkeit.«
»Vielleicht ist ›fressen‹ hier eine Metapher für das Verschlingen ihrer Seele«, sagt Dennis.
Martina lacht spöttisch. »Was immer es ist, wir wollen uns nicht auch noch mit einem Haufen gottverdammter Handlangerinnen herumschlagen.«
»Deshalb gehen wir direkt zur Quelle«, erkläre ich. »Wir finden ihn in Angola und neutralisieren ihn dort.«
»Oder kastrieren ihn«, schlägt Martina vor, und obwohl Dennis Zwangskastration aus philosophischen Gründen ablehnt, widerspricht auch er nicht.
Während der nächsten Stunde schmieden wir Pläne. Es wird Wochen dauern, bis wir abreisen können, und es gibt noch viel vorzubereiten. Die Besprechung endet gegen halb drei, als Phil wegmuss, um sich auf einen Abendkurs vorzubereiten. Martina huscht davon, weil sie sich um ihre Kinder kümmern muss. Als die Eingangstür hinter ihnen zuknallt, hat Dennis das letzte Wort.
»Ich sage es nur ungern, Daniel, aber um Geld zu sparen, könnten wir fürs Erste Tickets nur für den Hinflug kaufen.«
Für den Fall, dass wir sterben.
Kapitel 3 Pike Place Market
Später am Nachmittag unterbricht das Klingeln des Telefons meine deprimierenden Grübeleien bezüglich meiner persönlichen Wohnungskrise und der düsteren geschäftlichen Einschätzungen meines Rechtsanwaltsgehilfen.
Dennis schlägt mit einer Pfote darauf, aber … keine opponierbaren Daumen. Haha! Ich reiße ihm den Apparat unter seinem pelzigen Vorderbein weg.
»Daniel Becker, Rechtsanwalt«, melde ich mich.
Dennis flüstert mir etwas zu, als ich den Anruf entgegennehme. »Denk daran zu sagen: ›Der Monsteranwalt‹. Das ist gutes Marketing.«
In letzter Zeit bin ich kein großer Fan mehr von diesem geschmacklosen Namen für unsere Kanzlei. Ja, er bringt uns Kundschaft, aber es ist offensichtlich die falsche Art von Kundschaft. Die nicht zahlende Art. Wir hätten die Kanzlei »Der lukrative Rechtsanwalt« nennen sollen oder »Goldesel und Co«.
»Becker«, sagt die Stimme am Telefon, die vor Verachtung trieft. Diese Stimme ist mir bekannt. Und verhasst. Es ist Stuart Stern, der Städtische Justiziar und die persönliche juristische Bulldogge der Bürgermeisterin. Nichts gegen Bulldoggen.
»Hallo, Stewie«, erwidere ich kühl.
Dennis springt vom Stuhl und flitzt ins Nebenzimmer, um das Telefonat an dem hundekompatiblen Anschluss zu belauschen.
»Ich habe Arbeit für Sie, Becker. Nicht, dass Sie es verdient hätten.«
»Ich brauche Ihre Almosen nicht«, kontere ich kühn. Aber ich verziehe das Gesicht, während ich mich bereitmache abzulehnen, was immer er anzubieten hat; das Büro der Bürgermeisterin bezahlt Vertragsanwälte gut.
»Doch, tun Sie«, widerspricht mir Stewie. »Lassen Sie uns nicht dieses Spielchen spielen, bei dem Sie so tun, als würde Ihre lächerlich kleine Kanzlei genug abwerfen, und ich Ihre geschmacklosen Annoncen verhöhne.«
Blöd ist er nicht, das muss ich ihm lassen. »Also gut, ich bin ganz Ohr. Oder halb.«
»Hören Sie, ich habe nur fünfzehn Minuten zwischen zwei wichtigeren Meetings, um Ihnen das Unerklärliche zu erklären. Treffen wir uns in einer halben Stunde in dem Starbucks in der Pike Street.«
»In welchem? Es gibt drei Starbucks in der Pike Street.«
»Sie sind doch angeblich so ein schlauer Bursche. Finden Sie es raus.« Und damit legt er auf.
Das Unerklärliche? Ich drehe mich um. Dennis steht in der Tür, seine Klettverschluss-Hundeleine bereits im Maul. Er hat alles gehört und weiß, dass wir diesen Job brauchen. Außerdem liebt er Spaziergänge zum Pike Place Market.
»Na schön. Ich hole meinen Mantel.«
Selbst an einem Dienstagnachmittag herrscht am Pike Place Market reges Treiben, so rege, dass man sich seitlich zwischen ernsthaften Kunden des Viertels durchquetschen muss, die mit finsterer Miene Obst und Gemüse und saisonale Schnittblumen prüfen. Daneben gibt es gedankenlose Touristen, die mitten im Gang rückwärtslaufen, um Selfies mit erwachsenen Männern im Hintergrund zu machen, die sich über die Köpfe lachender Kinder hinweg Lachse zuwerfen. Der fragliche Starbucks befindet sich einen Häuserblock entfernt an der Ecke Pike Street und First Avenue. Das ist die Filiale, die Stewie gemeint hat – ich bin mir zu dreiunddreißig Prozent sicher –, und ich bin nur ein paar Minuten vor der vereinbarten Zeit da. Dennis mag es, ein wenig über den Markt zu schlendern und zu schnuppern. Es gibt so viele Gerüche – von Fisch über Blumen bis hin zu anderen Hunden. Sein kastanienbrauner Kopf ist ständig in Bewegung, um Informationen und Unterhaltungen aufzusaugen. Er beschreibt Duftausflüge zum Pike Place abwechselnd als »Sammeln von Lokalnachrichten« und »Besuch auf dem Nasenrummelplatz.«
Ich bemerke eine Frau vor mir, die mit einem Hund Gassi geht. Sicher, manche Frauen fallen mir auf – ich bin schmerzlich Single –, aber diese fällt mir besonders auf. Sie bewegt sich sehr anmutig, bei jedem Richtungswechsel senkt sie ganz leicht die Schulter wie eine Eiskunstläuferin, die um eine Kurve gleitet. Es ist geschmeidig. Es ist rhythmisch. Es ist vertraut. Nein, nicht nur vertraut. Ich kenne sie. Ich bleibe so abrupt stehen, dass Dennis’ Klettverschlussleine strammgezogen wird und aufgeht.
»Oje«, murmelt er.
Die elegante Frau dreht eine Pirouette, als würde sie meinen Blick auf sich spüren, und schaut in unsere Richtung. Sie sieht mich, erkennt mich und schenkt mir schließlich ein vorsichtiges Lächeln.
»Daniel?« Sie ruft meinen Namen. In ihrem Gesichtsausdruck liegt eine gewisse Energie, aber ihr Enthusiasmus hält sich in Grenzen.
»Bev! Hallo.« Ich bin verblüfft, meine Ex-Freundin über den Pike Place Market schlendern zu sehen. Ich dachte, sie wäre im Libanon. Als sie das Land verließ – um in den verdammten Libanon zu ziehen –, kam es zu einer Trennung in Zeitlupe, und schließlich vereinbarten wir, dass wir den Kontakt wieder aufnehmen würden, falls wir je erneut am selben Ort wären. Und das sind wir nun!
Es folgt eine verlegene Pause, während der wir uns anstarren und uns den Kopf darüber zerbrechen, was wir sagen sollen. Wir suchen fieberhaft nach etwas Klugem und Unbeschwertem, wenn auch nicht Oberflächlichem, etwas angemessen Herzlichem und Vertrautem, aber nicht zu Forschem oder zu Ernstem. Wir sind beide überhaupt nicht vorbereitet auf diese Begegnung, wollen jedoch genau das Richtige sagen. Und das ist wirklich schwer. Ich bemerke, dass sie einen mir bekannten Rottweiler ausführt. Und ich führe Dennis aus, oder zumindest begleite ich ihn, da er darauf besteht, dass er für seine Exkursionen selbst verantwortlich ist. Was uns verbindet, sind die Hunde. Es ist mein Konversations-Joker, und ich ergreife ihn wie jemand, der gerade in einem See aus Schweigen ertrinkt.
»Meine Güte – ist das Butch?«
Ich beuge mich herunter, um Butch zu streicheln, den Hund, den ich aus dem Tierheim adoptierte, um einen Vampir abzuwehren, und den ich Bev geschenkt habe, damit sie sich vor dem Mörder, der ihre Tochter getötet hatte, sicher fühlte – lange Geschichte. Als er mich erkennt, reagiert er mit ungezügelter Liebe und Zuneigung und wickelt sich sofort um mein Bein. Es ist mehr, als Bev und ich einander geben können. Tiere sind in so etwas viel besser. Natürlich erwarte ich nicht, dass Bev sich um mein Bein wickelt, aber wir haben selbst vor einer freudigen Umarmung Angst.
Bev tritt einen Schritt von mir weg, damit ich Butch streicheln kann. »Ja«, sagt sie. »Ich konnte es gar nicht erwarten, meinen Liebling zu sehen, als ich zurückkam. Deshalb bin ich direkt zur Hundesitterin gefahren, um ihn abzuholen, bevor ich überhaupt zu Hause war.« Sie schaut zu mir auf und begreift, was sie gesagt hat. »Du hast wahrscheinlich gedacht, ich wäre immer noch im Libanon.«
»Irgendwie schon, ja.«
»Tut mir leid, dass ich dir nicht gesagt habe, dass ich wieder da bin.«
»Schon okay. Es ist nicht so, als würde ich ständig darüber nachdenken, wo du bist.« Ich zögere. »Ich meine, ich denke oft darüber nach, wo du bist, nur nicht immer, weil ich, na ja, sehr beschäftigt bin. Nur manchmal. Natürlich jetzt nicht mehr, da ich ja nun weiß, wo du bist. Ich meine, du bist hier. Da muss ich nicht weiter darüber nachdenken.« Ich bin verwirrt und verliere den Faden.
Bev schenkt mir einen sanften Blick, der zu gleichen Teilen fürsorglich und mitfühlend ist. Es ist ein Blick, den sie als Ärztin über Jahrzehnte hinweg kultiviert hat. »Wir sollten reden, Daniel. Aber nicht unvorbereitet mitten auf dem Pike Place Market.«
»Ich stimme dir zu. Hundertprozentig. Ich habe ohnehin in einigen Minuten einen Termin mit einem Mandanten. Wie gesagt, ich bin sehr beschäftigt.«
»Die Kanzlei läuft also gut?«
»Sehr gut.«
Sie läuft nicht gut, aber Bev stellt hier keine ernst gemeinte Frage – es ist nur eine höfliche Floskel. Wir mustern uns zum Abschied gegenseitig und versuchen einzuschätzen, zu erraten, wie es dem anderen geht. Sie scheint sich großartig zu fühlen – sie wirkt selbstbewusst, wortgewandt, schön. Ich stammele herum und versage in meiner ureigenen Domäne.
»Freut mich zu hören«, sagt sie und fügt ein schnelles Lächeln hinzu.
»Wie geht es Jeremy?«, frage ich, bevor die Gelegenheit dazu verstreicht. Das ist keine bloße Floskel. Ich habe eine tiefe Verbindung zu ihrem Sohn, tiefer, als selbst sie es weiß. Wir teilen uns ein Monster.
»Es hat ihm gutgetan, eine andere Kultur kennenzulernen.«
Und von dem Ort wegzukommen, an dem seine Schwester ermordet wurde, denke ich.
Butch und Dennis unterhalten sich freundschaftlich auf Hundisch zu unseren Füßen, während wir unser höfliches Geplänkel beenden.
»Also, ich muss dann mal zu meinem Termin.«
»War schön, dich zu sehen, Daniel.«
Wir nicken und lächeln. Das ist nett, aber es ist keine Umarmung. Die Hundeleinen sind ein guter Vorwand, um eine peinliche Umarmung zu vermeiden. Sie zieht Butch zu sich heran, während ich Dennis die Klettverschlussleine wieder anlege, und dann geht sie.
Ich schaue ihr nach. Verdammt. Dann sehe ich auf mein Handy. Zweimal verdammt. Mir bleiben noch drei Minuten. So viel dazu, früh dran zu sein. Glücklicherweise ist der Starbucks, auf den ich setze, nur einen Häuserblock entfernt. Ich zeige Dennis, wo wir hinmüssen, und wir eilen an dem Bronzeschwein in Lebensgröße auf dem Marktplatz vorbei. Wir gehen gerade den Hügel hinauf, als ein nackter, dicker Mann zu mir aufschließt.
»Hoppla!«, rufe ich. Denn was soll man sonst sagen, wenn ein nackter Mann neben einem auftaucht? Ich kenne aktuell nur einen nackten, dicken Mann, weshalb ich rasch draufkomme, wer er ist. »Cupido, was machst du hier?«
»Du hast mich gerufen.«
»Habe ich das?«
»Es war ein emotionaler Ruf.«
»Ein was?«
»Ein unterschwelliger.« Cupido weicht einer Frau aus, die uns entgegenkommt, und als er um sie herumtanzt, wackeln verschiedene Körperteile. Der Amorini ist überraschend leichtfüßig für einen so kräftigen Kerl, und sie scheint den in die Jahre gekommenen Flitzer nicht zu bemerken.
»Die Menschen können dich nicht sehen, nicht wahr?«
»Nur wenn ich das will.«
»Gütiger Gott, bitte nicht.« Tatsächlich, Dennis reagiert nicht auf Cupidos Anwesenheit. Er ist zu sehr mit Schnüffeln beschäftigt und es gewohnt, dass ich mit mir selbst streite, denn das tun Rechtsanwälte ständig.
»Also, Rechtsanwalt Daniel, ich bin hier, um dich für deine Dienste zu bezahlen.«
»Womit?«
Er wackelt mit den Augenbrauen. Okay, ich verstehe – er versucht, seine selbst auferlegte Mission zu erfüllen. Aber ich brauche keine Liebe. Ich brauche Bares.
»Bev? Nein. Sie ist meine Ex. Sie ist weggezogen. Wir haben uns getrennt.«
»Hast du noch nie gehört, dass die Liebe mit der Entfernung zunimmt?«
»Haben Sie noch nie gehört, dass die Liebe mit der Entfernung wegschwimmt?«
»Clever, aber – um es in deiner eigenen Juristensprache auszudrücken – ›irrelevant‹. Wenn Liebende wieder zusammenkommen und diesen Sog verspüren, diese unwiderstehliche Anziehung, dann weiß man, dass da immer noch Glut ist, dass da immer noch heiße Kohlen darauf warten, zu entflammen. Du hast den Sog gespürt, nicht wahr?«
»Sie hat mir nicht mal erzählt, dass sie wieder in der Stadt ist.«
Er wirkt enttäuscht. »Du musst ihn gespürt haben, sonst wäre ich nicht gekommen.«
Wir gehen weiter, oder zumindest tue ich es, denn ich muss zu meinem Meeting. »Vielleicht hast du dich geirrt. Es wäre nicht das erste Mal.«
»Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Welt ist voller ›Vielleichts‹, Anwalt Daniel.« Er zeigt geradeaus. »Siehst du das Pärchen da?«
»Meinst du die beiden, die sich angeregt unterhalten und zwischen mir und dem Starbucks stehen, in dem ich in einer Minute und fünfundvierzig Sekunden erscheinen muss? Ja, ich sehe sie.«
»Mit ein wenig Ermutigung könnten sie sich ineinander verlieben.« Er wackelt mit den Augenbrauen und greift über seine Schulter. »Vielleicht.«
Der Griff nach seinem Bogen ist alte Gewohnheit. Aber der Bogen ist nicht mehr da. Seine Hand tastet umher und fällt dann schlaff an seiner schwabbeligen Seite herab, als ihm einfällt, dass der Vogel ihn zerbrochen hat wie ein benutztes Essstäbchen.
»Neiiiiin!« Cupido heult so laut und in einem so schrillen Falsett, dass ich mich umschaue, ob ihn jemand hört. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich versuche, Abstand zwischen uns zu legen, doch er ist flink, vergräbt den Kopf an meiner Schulter und lehnt sich an mich, obwohl ich meine Schritte beschleunige. Außerdem weint er. Und redet. Immer redet er. »Ohne meinen Bogen«, schluchzt er, »bin ich bloß ein nackter, fetter Mann.«
»Wenigstens bist du unsichtbar«, sage ich, denn ich habe keine Ahnung, wie ich einen traurigen, nackten Halbgott trösten soll. »Und du hast immer noch deine Pfeile.«
Zu meiner Überraschung muntert ihn das sofort auf. »Ja! Die habe ich tatsächlich!« Und plötzlich stürzt er in einem Wirbel schwabbelnden Fleisches hinter dem Paar her, zieht einen Pfeil von Gott weiß wo hervor und hebt ihn in seiner plumpen Faust über seinen Kopf.
Heilige Götter, er wird Jagd auf die beiden machen und einen von ihnen abstechen wie ein Irrer in einem Horrorfilm. Ich habe keine Zeit für so etwas, und seine schauerliche Demonstration von Liebesmetzelei hat wenig oder gar nichts mit mir zu tun. Ich überquere die Straße und schlüpfe in den Starbucks.
Kapitel 4 Treffen mit Stewie
Ich habe auf den richtigen Starbucks getippt. Stewie sitzt auf einer Art Barhocker an einem hohen, runden Tisch, der nicht größer ist als ein Essteller. Er hat die Arme schützend um etwas geschlungen, von dem ich vermute, dass es ein Venti Salted Caramel Mocha Frappuccino ist. Er scheint mir der Typ dafür zu sein. Als er mich sieht, verengen sich seine Augen, und er nimmt einen großen Schluck. Sein finsterer Blick würde einen nachdenklich-bedrohlichen Eindruck machen – was vermutlich seine Absicht ist –, wenn seine Beine nicht wie die eines Kindes baumelten und er nicht einen Klecks Schlagsahne auf der Nasenspitze hätte. Er trägt ein dünnes beigefarbenes Hemd mit einer traurigen grün-weißen Krawatte.
»Hunde müssen draußen bleiben, Becker«, sagt Stewie anstelle einer Begrüßung und ohne von seinem hohen Stuhl herunterzuklettern.
»Das ist ein Assistenzhund, Stewie. Er ist hier, um mir zu helfen, Ihre fragwürdigen Entscheidungen in Sachen Mode zu verstehen.«
»Hunde sehen keine Farben«, entgegnet er erbost. »Vielleicht hatten Sie Covid und haben dadurch Ihr Stil-Gefühl verloren.«
»Sie scherzen doch nicht etwa gerade über eine Seuche, die Millionen von Menschen getötet hat?«
»Ich könnte das Gleiche über Ihre Verspottung von Assistenztieren sagen.«
Touché.
Zwei Rechtsanwälte, die verbal aufeinander einprügeln, ergeben ein unproduktives Meeting, aber wir können nicht anders. Jetzt, da wir unsere Feindseligkeiten ausgetauscht haben, zieht sich Stewie hinter seinen Frappuccino zurück und erneuert seinen Schlagsahne-Rüssel, während ich ihm gegenüber Platz nehme. Der Tisch ist so klein, dass wir unangenehm nah beieinandersitzen müssen. In einem Gerichtssaal wären wir drei Meter voneinander entfernt – das ist die Fechtdistanz für mündliche Duellanten, die mit Worten antäuschen, zustoßen und parieren. Hier sitzen wir fast Nase an Nase. Oder Nase an Sahneklecks.
»Sie fragen sich wahrscheinlich, warum ich Sie angerufen habe«, sagt Stewie, dessen sahniger Fleck hypnotisch auf- und abwippt, während er spricht.
Kommen wir also zum Geschäftlichen. »Ja. Ich dachte, die Bürgermeisterin ist unzufrieden mit mir, nachdem ihre Eishockeymannschaft fast ertrunken wäre.«
»Die Bürgermeisterin ist eine wankelmütige Frau. An einem Tag sind Sie ein Held, weil Sie für die Stadt Seattle eine Million Dollar uneinbringlicher Forderungen wiedererlangt haben, am nächsten sind Sie der Bösewicht, weil Sie das Kinderheim geschlossen haben.«
»Sie haben ein Waisenhaus dichtgemacht?«
»Ich habe der Stadt eine Million Dollar gespart«, brummt Stewie frustriert, was deutlich macht, dass es nicht das erste Mal ist, dass jemand diese spezielle juristische Entscheidung infrage stellt. »Aber darum geht es nicht, Becker. Die Bürgermeisterin dreht ihr Fähnchen nach dem politischen Wind, und im Moment bläst der Wind in Ihre Richtung.«
»Also, Sie sagten, Sie würden versuchen, das Unerklärliche zu erklären.«
»Korrekt. Es gibt eine Leiche. Wir haben sie noch nicht identifiziert, aber irgendwann werden wir es tun. Dann wird man uns verklagen. Und die Todesursache ist, sagen wir, speziell.«
»Klingt nach einem Job für die Polizei.«
»Das habe ich auch gesagt, aber die Bürgermeisterin hat das Gefühl, dass es zu speziell für die Polizei ist.«
»Sprechen Sie weiter.«
»Die Stadt ist für einen Teil des Seattle Underground verantwortlich – nicht für die Touristenfalle unter dem Pioneer Square, wo Leute dafür bezahlen, ein paar Läden unterhalb des Straßenniveaus zu sehen, die auf alt getrimmt wurden, sondern für den eingestürzten Bereich nördlich davon.«
»Ich wusste gar nicht, dass es einen eingestürzten Bereich gibt.«
»Das wusste niemand, weil es immer nur ein Haufen Schutt war – ohne Nutzen, unzugänglich und mit Sicherheit nie für die Öffentlichkeit erschlossen. Nachdem die Stadt nach dem Brand im Jahr 1889 die Straßen um zehn Meter angehoben und das neue Seattle auf den alten Geschäften in der Innenstadt errichtet hatte, stürzten einige der ehemaligen Gassen und Läden ein. Vor zwei Tagen und Nächten sind allerdings einige junge – und ich verwende den nächsten Ausdruck sehr frei – ›Erwachsene‹ in den Touristenbereich eingedrungen und haben sich irgendwie einen Weg durch eine Wand dort unten gebahnt. Sie haben einen alten Abschnitt einer Gasse geöffnet, die zu mehreren Läden führte, die man noch betreten kann. Was die Struktur angeht, sind sie sehr instabil, aber statt die Sache zu melden wie verantwortungsbewusste Bürger, haben diese Nichtsnutze über Social Media zu einem Flash Rave aufgerufen.«
»Einem was?«
»Sie haben ihren Internetkumpels gesagt, dass sie zu einer spontanen Tanzparty unter der Erde kommen sollen.«
»Klingt nach Spaß.«
»Es ist nur so lange spaßig, bis irgendein Jugendlicher offenbar in Säure aufgelöst wird.«
»Götter!« Ich kann nicht anders, ich winde mich auf meinem Stuhl. Selbst Dennis reagiert, hebt den Kopf und sucht meinen Blick. Er hat die ganze Zeit zugehört, sich im Geiste Notizen gemacht und vor allem die finanzielle Seite der Sache berechnet.
»Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit?« Stewie zieht eine Braue unter seinem fliehenden Haaransatz so obszön weit nach oben, dass es aussieht wie eine aus einem spanischen Satz entflohene Tilde, die an einer Billardkugel hochklettert.
»Klingt nach Mord.«
»Klar. Doch es ergibt keinen Sinn. Wir haben ein verschwommenes Handyvideo von einem Jungen, der durch eine Tür geht, aber sie führt in eine Sackgasse, und er kommt nie zurück. Am nächsten Tag finden wir genau an der Stelle ein Skelett. Kein Gewebe, kein Blut, keine Organe. Nichts. Nicht einmal sein Gehirn. Nur glänzende weiße Knochen. Die Bürgermeisterin sagt, es sei ›unheimlich‹ und ich solle ›alle Möglichkeiten‹ in Betracht ziehen.«
»Das ist der Code für eine Kontaktaufnahme mit mir, vermute ich?«
»Ich werde mich ganz bestimmt nicht um den Voodoo-Hokuspokus-Müll der Bürgermeisterin kümmern. Ich habe einen Ruf zu verlieren.«
»Ja, haben Sie.«
»Sie auch.«
»Hm, anscheinend bin ich die Müllkippe.«
»Ha! Das gefällt mir. Da wir neuerdings so gute Kumpel sind, soll ich Sie dann liebevoll ›Müllcontainer‹ nennen?«
»Nein, sollen Sie nicht.«
»Wie dem auch sei, für den Müll der Bürgermeisterin wird ein fettes Entsorgungshonorar gezahlt. Wenn Sie mich fragen, ist es eine Verschwendung von Steuergeldern, aber die Bürgermeisterin will es so. Ich persönlich möchte nur, dass meine Stadt nicht verklagt wird. Während Sie also für diesen Fall das Ouija-Brett befragen, notieren Sie bitte auch alle irdischen Rechtsgrundlagen, nach denen die Stadt Seattle von der Verantwortung für den Tod dieses bedauernswerten jungen Mannes freigesprochen werden kann.«
»Es ist interessant, dass Sie immer noch nicht an meine anwaltliche Tätigkeit glauben, obwohl ich Sie vor dem Untergang der Argonaut gewarnt und Ihnen im Grunde das Leben gerettet habe.«
Stewie lehnt sich zurück und presst die Lippen zusammen. Er richtet seine Krawatte, um Zeit zu schinden, damit er sich eine Antwort zurechtlegen kann. Ganz sicher will er mir nicht sein Leben verdanken. Als er bereit ist, beugt er sich vor und hält sein Plädoyer.
»Die Logik sagt mir – und ich vertraue ihr mehr als allem anderen, Sie eingeschlossen –, dass Ihre Beteiligung am Untergang des Schiffes wahrscheinlicher ist, als dass Sie ihn auf magische Weise vorhergesagt hätten. Ihr Boot ist ebenfalls gesunken, nicht wahr? Mysteriöses Feuer, ja? Und Sie haben eine Entschädigung von der Versicherung dafür bekommen, wenn ich mich nicht irre.«
Er hat die Diskussion von seinem unvernünftigen Unglauben auf meine potenziell kriminellen Handlungen verlagert und stellt mich vor Gericht, anstatt seinen Mangel an Vertrauen zu thematisieren. Stewie beäugt mich argwöhnisch und lässt mir Raum, dem natürlichen menschlichen Instinkt zu erliegen, die Stille zu füllen und mich möglicherweise selbst zu belasten. Und mit seinem Instinkt liegt er richtig – ich habe tatsächlich mein Boot selbst in Brand gesteckt und Geld von der Versicherung gefordert. Streng genommen habe ich also Betrug begangen. Okay, nicht nur streng genommen – ich habe definitiv meine Versicherungsgesellschaft betrogen. Sie hätte nicht gezahlt, wenn ich ihnen die Wahrheit über das, was in jener Nacht geschah, gesagt hätte. Das bedeutet nicht, dass ich die Argonaut versenkt habe, aber diese Debatte kann ich nur verlieren. Ich wechsle das Thema.
»Erzählen Sie mir, warum der Underground-Fall unerklärlich ist.«
»Nun, Sie wissen, dass ich Herausforderungen mag«, antwortet er. »Ich bin eine Bulldogge, wenn es darum geht, Rätsel zu lösen.«
»Witzig, ich hatte Sie gerade kürzlich als Bulldogge bezeichnet.«
»Danke.«
»Gern geschehen«, sage ich. Kein Kompliment, denke ich.
»Es gibt mehrere Merkwürdigkeiten hier, aber stellen Sie sich vor: Die Tür, durch die der Junge gegangen ist, ist verschwunden.«
»Jemand hat sie mitgenommen? Vielleicht andere Jugendliche von der Party?«
»Unklar. Unser Team sagt, dass sie nie da war, was immer das bedeutet.«
Als Stewie erneut einen Schluck von seinem lächerlichen Kaffee in sich hineinkippt, sehe ich Dennis an, der die Zunge aus dem Maul hängen lässt und hechelt – bei Hunden das Äquivalent eines Nickens. Er will, dass wir den Fall übernehmen. Oder er hätte gern etwas Wasser.
»Irgendwelche Informationen über den Verstorbenen?«, frage ich.
»Der junge Mann könnte um die zwanzig sein. Bisher hat sich niemand mit Informationen bei uns gemeldet. Es wurde auch niemand dieses Alters als vermisst gemeldet. Aber wir haben Filmaufnahmen des Vorfalls auf einer Studentenseite der University of Washington gefunden …«