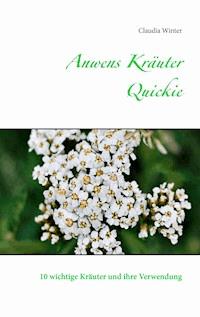8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verrückt, romantisch, köstlich – eine Liebeskomödie aus der Heimat des Dolce Vita.
Das Leben der jungen Foodjournalistin Hanna könnte so wunderbar sein. Hätte sie nur nicht diese Restaurantkritik geschrieben, wegen der eine italienische Gutsherrin einen Herzinfarkt erlitten hat! Als sie dann auch noch versehentlich in den Besitz der Urne gelangt, reist die von Schuldgefühlen geplagte Hanna nach Italien – und wird zum unfreiwilligen Opfer eines Testaments, das es in sich hat. Denn selbst über ihren Tod hinaus verfolgt Giuseppa Camini nur ein Ziel: ihren unleidlichen Enkel Fabrizio endlich in den Hafen der Ehe zu steuern. Eine Aufgabe, die ein ganzes toskanisches Dorf in Atem hält, ein Familiendrama heraufbeschwört und Hannas Gefühlswelt komplett durcheinanderwirbelt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Hanna Philipps Leben könnte perfekt sein – hätte sie nicht diese vernichtende Restaurantkritik geschrieben, wegen der eine italienische Gutsherrin einen Herzinfarkt erlitten hat. Nun droht der Foodjournalistin die Kündigung, falls sie die Sache nicht schleunigst in Ordnung bringt. Noch dicker kommt es, als die kleptomanische Hanna in den Besitz der Urne der Verstorbenen gelangt. Notgedrungen reist sie nach Italien, um das bizarre Diebesgut zurückzugeben und sich für den Artikel zu entschuldigen – doch der unleidliche Enkel der Toten weigert sich, die Urne zurückzunehmen, ehe Hanna nicht zwei Wochen Frondienst auf dem Gut abgeleistet hat. Während die Diebin in der Küche schwitzt, kämpfen die Caminis mit dem Testament der gewitzten Matriarchin: Eine Ehefrau muss her, damit Enkel Fabrizio das Landgut erbt – aber der fordert seine ganz eigene Art der Abbitte von Hanna. Und damit beschwört er nicht nur ein Familiendrama herauf, sondern wirbelt auch Hannas Gefühlswelt ordentlich durcheinander.
Weitere Informationen zu Claudia Winter sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
Aprikosenküsse
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Von der Autorin überarbeitete Neuausgabe
Copyright © der Neuausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
Umschlagmotiv: Fotolia / Konstiantyn
Redaktion: Angela Troni
CN · Herstellung: Str.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-16606-9V002
www.goldmann-verlag.de
Sämtliche Personen und Ereignisse in diesem Roman sind frei erfunden – auch den Handlungsort werden Sie vergeblich auf der Landkarte suchen. Das fiktive Örtchen Montesimo steht stellvertretend für all die kleinen italienischen Dörfer, in denen wir das zu finden hoffen, wonach wir uns im Herzen sehnen.
Sollten sich dennoch Parallelen zur Wirklichkeit auftun, handelt es sich um bloßen Zufall.
Prolog
FABRIZIO
Holzwachs, Aprikosen und dicke Bohnensuppe. Bestimmte Gerüche sind mit meiner Kindheit verbunden wie die Narbe mit meinem Handgelenk – ein winziger weißer Wurm, den der Fahrradsturz in meine Haut tätowiert hat.
Heute weiß ich nichts mehr von dem Schmerz oder der Wut, die ein Sechsjähriger fühlt, weil er sich vor seinen Freunden blamiert hat. Aber ich erinnere mich genau an den Geruch von Lippenstift und an den klebrigen Film, den die tröstenden Küsse meiner Großmutter zu hinterlassen pflegten.
Auch jetzt wische ich mir verstohlen über die Wange, dabei habe ich mittlerweile eine Körperlänge erreicht, dank derer Nonna nur schwer an mein Gesicht herankommt. Trotzdem bin ich auf der Hut, denn sie nutzt jede Gelegenheit, sobald ich in Reichweite ihres roten Mundes gelange, um mich zu küssen. Zu meinem Leidwesen gibt es im Wartezimmer von Professor Buhlfort keine Stehplätze.
»Setz dich, Fabrizio!«, befiehlt Nonna, während sie mich mit ihren knochigen Fingern auf den Stuhl drückt.
Ich kneife die Augen zu und warte auf das Unvermeidliche: ein Zwicken, als wolle sie mir mit Zeige- und Mittelfinger die Haut von der Wange reißen, gefolgt von einem Knallgeräusch ihrer Lippen.
Als nichts dergleichen passiert, schiele ich vorsichtig nach links. Nonna blättert in einer Zeitschrift und scheint mich völlig vergessen zu haben. Ich unterdrücke ein Schmunzeln, denn sie studiert die Seiten, als verstünde sie jedes Wort. Ab und zu brummt sie und wiegt dabei den Kopf, als wäre ihr Dutt an einem unsichtbaren Pendel befestigt.
»Seeehr interessant, dieses Magazin«, flüstert sie, als sie meinen Blick bemerkt, und deutet ehrfurchtsvoll auf das Zeitschriftenregal, das eine komplette Wand einnimmt. »Dieser professore muss ein wirklich guter Arzt sein. Er liest ziemlich viel.«
Ich nicke und erspare mir die Erklärung, die Nonna ohnehin nicht hören will. Sie war schon der Meinung, Buhlfort sei der beste Herzspezialist auf diesem Planeten, kaum dass ich seinen Namen gegoogelt hatte.
Die Familie Camini besitzt seit Generationen eine unerklärliche Affinität zu allem, was deutsch ist. Deutsche Autos, deutscher Fußball, deutsche Universitäten, deutsche Ärzte. Letzteres ist der Grund, weshalb wir den Nachmittag in einem überfüllten Berliner Warteraum verplempern, obwohl Nonna kerngesund ist. Doch auch hier ist es wie mit allen Dingen, die Giuseppa Camini sich in den Kopf gesetzt hat – am Ende hat sie den längeren Atem.
Ich mustere sie verstohlen von der Seite. Nonna sitzt kerzengerade auf ihrem Stuhl, ohne mit dem Rücken die Lehne zu berühren (»Sitz aufrecht, Fabrizio! Sonst bekommst du einen Buckel.«), die Knie aneinander, beide Füße auf dem Laminat. Natürlich trägt sie Absatzschuhe (»Eine echte Italienerin wird mit Pfennigabsätzen beerdigt, merk dir das, mein Junge!«), und trotz ihres Alters ist sie gertenschlank wie alle Frauen in unserer Familie. Als ich sie einmal fragte, weshalb sie ihre Kleider immer mindestens zwei Nummern zu groß kaufe, antwortete sie mit erhobenem Zeigefinger: »Man weiß nie, ob man im Alter dicker wird. Und was täte ich dann mit den guten Sachen, eh?«
Der Schriftzug Genusto Gourmetmagazin macht mich neugierig. Auf der Titelseite ist eine Aprikosenkiste abgebildet, der deutsche Text in Schnörkelschrift darunter ist schwer zu entziffern. Ich lehne mich an Nonnas Schulter und kneife die Augen zusammen. Köstliche Rezepte mit sonnengereiften … Nonna schlägt die Seite um, und das Aprikosenbild raschelt aus meinem Sichtfeld.
»Fabrizio, da steht was über uns drin.«
»Über uns?« Ich muss reichlich blöd aus dem Hemd gucken, wofür ich mir prompt einen Rippenstoß einhandele. Automatisch richte ich mich auf, als hätte mich ihre Faust in den Rücken getroffen, weil meine Nase mal wieder zu tief über dem Pastateller hing. Neben mir knistern die Seiten unverdrossen weiter.
»Fabrizio!«
»Nonna?« Irgendwie macht es Spaß, sie zappeln zu lassen.
Sie tippt ungeduldig auf den Artikel, der jetzt auf ihren Knien liegt, und tatsächlich: Das auf dem Foto abgebildete Steinhaus auf dem zypressenbewachsenen Hügel kommt mir bekannt vor. Mein Bauch kribbelt. Das Tre Camini in einer deutschen Gourmetzeitschrift. Davon habe ich bis dato nicht zu träumen gewagt!
»Bist du taub, Junge? Da hat jemand über unser ristorante geschrieben.«
»Ich habe es gehört.« Ich schmunzele über ihre Aufgeregtheit, obwohl ich ihr das Magazin am liebsten aus der Hand reißen würde. Das ältere Paar uns gegenüber wirft uns böse Blicke zu. Typisch deutsch. »Alles in Ordnung?«, frage ich in ihrer Landessprache und lächele freundlich. Sie schweigen betreten. Auch typisch deutsch.
Nonna zupft an meinem Hemdsärmel, die V-förmige Falte auf ihrer Stirn weist einen gefährlich spitzen Winkel auf.
»Gib her, ich lese dir vor«, gebe ich mich gutmütig geschlagen.
Obwohl ich seit Jahren keinen längeren deutschen Text vor mir hatte, erfasst mein Hirn die Wörter erstaunlich schnell, und die Übersetzung kommt mir flüssig über die Lippen. Ihre Bedeutung erschließt sich mir aber erst, nachdem ich den zweiten Absatz gelesen habe und neben mir ein Laut erklingt, den ich zunächst nicht einordnen kann. Und dann ist innerhalb weniger Sekunden nichts mehr so, wie es vorher war.
82-Jährige verstirbt bei Routineuntersuchung
Am Mittwoch, dem 11. Juni 2015, erlitt eine 82-jährige Patientin in der Berliner Charité bei einer Vorsorgeuntersuchung einen Herzinfarkt. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Frau noch im Wartezimmer des Herzspezialisten Prof. Dr. Buhlfort.
Die Aufsichtsbehörde stellte kein Verschulden seitens des Facharztes oder der Klinik fest. Offensichtlich litt die Frau an einem unerkannten Herzfehler.
Die italienische Staatsbürgerin wird nach der Einäscherung von einem Angehörigen nach Italien überführt. (H. Z.)
Eins
HANNA
Berlin ist wohl die einzige Stadt in Deutschland, die hält, was ihre Stadtmagazine versprechen. Sie ist gewaltig, bunt und verwirrend. Und man kann sich auch dann in ihr verloren fühlen, wenn man hier aufgewachsen ist. Ich habe es schon vor Jahren aufgegeben, mich zu entscheiden, ob ich diese Stadt liebe oder hasse. Aber seit ich beschlossen habe, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren, weiß ich, dass unter ihrer hässlichen Betonhaut mehr Leben pulsiert als in allen anderen deutschen Städten zusammen.
Ich mache einen Ausfallschritt, damit ich nicht auf das Grasbüschel trete, das sich im Kiefer eines Graffiti-Pitbulls durch eine Pflasterfuge gekämpft hat. Hier trotzt immer irgendein Unkraut dem Asphalt, besonders da, wo die Kids sich mit ihren Spraydosen austoben. Prompt erwische ich eine Pfütze, und braunes Schlickwasser schwappt in meine Pumps.
»Verdammt!«
Trotz Regenschirm bin ich bis auf die Haut durchnässt, als die dunkelgrau eingefasste Glasfront des Verlagshauses Hebel + Foch endlich vor mir auftaucht. Dabei sind es keine fünf Minuten von der U-Bahn-Haltestelle bis zur Redaktion in der Zimmerstraße. Eine Ewigkeit, rechnete man Zeit in Bindfäden. Erleichtert schlüpfe ich in die rettende Drehtür, doch noch ehe ich einen Fuß auf den Läufer im Empfangsbereich setzen kann, rauscht ein gelbes Etwas mit gefühlten sechzig Stundenkilometern in mich hinein. Ein Gegenstand fällt zu Boden, gefolgt von einem Geräusch, als platze ein wassergefüllter Ballon. Mein Knöchel knickt um, ich stolpere ins Foyer. Nur mein Schirm bleibt, wo er ist. In der Drehtür.
»O Schei…benkleister! Tschuldigung.«
Das kanariengelbe Ding, bei dem es sich unzweifelhaft um eine Frau im Regenmantel handelt, hockt jammernd in einer braunen Lache, während es Pappbecher und Plastikdeckel aufsammelt. Durch die gesamte Eingangshalle strömt verführerischer Kaffeeduft. Mein rechtes Lid zuckt.
»Guten Morgen, Sasha.«
Ich mustere die Häkelmütze, unter der sich weißblonde Löckchen in einem bleichen Kindernacken kringeln. Von Anfang an hat mich irgendetwas an meiner Praktikantin irritiert. Und das liegt bestimmt nicht nur an ihrem fragwürdigen Kleidungsstil. Das Mädchen ist einfach vollkommen durchgeknallt. Und ungeschickt obendrein. Es vergeht kein Tag ohne Fettflecken auf Papieren, verschüttete Getränke oder zerbrochenes Porzellan. Knirschend kommt die Drehtür zum Stillstand.
»Der Schirm is jetzt aber hin«, kichert es von unten.
Ich rolle die Augen und wende mich dem Fahrstuhl zu, während Sasha mit angeekeltem Gesicht einen aufgeweichten Schoko-Brownie aus der Kaffeepfütze fischt.
Sie richtet sich auf und mustert ihre durchnässte Papiertüte. »Ein Jammer. Fünfzehn Euro hat das gekostet.«
Das Display über dem Aufzug bleibt hartnäckig auf der Drei stehen. Wahrscheinlich blockiert der Hausmeister mal wieder mit seinem Putzwagen die Tür. Ich werfe einen nervösen Blick auf meine Armbanduhr. Der Zusammenstoß mit Sasha kostet mich fünf Minuten wertvolle Arbeitszeit und hat außerdem einen untertassengroßen Kaffeefleck auf meinem hellgrauen Kostüm hinterlassen. So ein Mist.
»Hanna?«, ruft Sasha vom Empfangspult herüber. Immerhin hat sie sich aus dem Hausmeisterbüro einen Mülleimer und einen Wischmopp besorgt, um die Sauerei zu beseitigen. »Hättest du kurz Zeit für mich? Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen.«
Ob ich die Treppe nehmen soll? Mein eng geschnittener Stiftrock lässt gerade mal Trippelschritte zu. Völlig indiskutabel, damit die Stufen zu erklimmen. Ungeduldig hämmere ich auf dem Aufzugknopf herum. Ein surrendes Geräusch ertönt, die Zwei leuchtet auf und wechselt kurz darauf zur Eins. Na endlich!
»Warte, ich bin gleich so weit!«, kräht Sasha.
Es klappert und rumpelt, ich schaue gar nicht hin. Mit dem vertrauten Pling gleiten die Fahrstuhltüren auseinander, und ich betrete rasch die Kabine. Im Geiste gehe ich bereits die Telefonate durch, die ich heute Morgen führen will, eins davon mit einem Kollegen vom Guide Michelin. Der Mann hasst nichts mehr als Unpünktlichkeit.
Leider schiebt sich im letzten Moment eine knallgrüne Stiefelette zwischen das Metall. Sasha drückt sich an mir vorbei und lässt mit einem erleichterten Seufzen ihre Tasche fallen.
»Du schaust mich so böse an. Hab ich dir wehgetan, als ich in dich reingerannt bin?«
Im Spiegel begegnen mir Sashas veilchenblaue Augen. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie mitten im Juni eine pinkfarbene Strumpfhose trägt, die in merkwürdig stimmigem Kontrast zu ihrem Quietscheente-Regenmantel und den grünen Stiefeletten steht.
»Du tropfst. Und du bist zu spät«, antworte ich frostig und drücke die Taste mit der Vier.
»Wieso? Ich war doch bloß zwei Sekunden nach dir da«, grinst Sasha.
Mein Blick bohrt sich in die Leuchtanzeige über der Tür. »Willst du mit mir über deine Arbeitszeiten diskutieren?«
Meine Praktikantin läuft knallrot an. »Nein … natürlich nicht.« Sie beugt sich herunter und kramt in ihrer Messenger Bag. »Wo war’s noch gleich? Ich schwöre, ich hab’s … Diese Tasche ist ein verdammtes Bermudadreieck … Ahhh! Da ist es!« Mit gewichtiger Miene hält sie mir ein zerfleddertes Blatt Papier entgegen. Mir schwant Übles, und das nicht wegen der Eselsohren. »Letzte Nacht hat mein Freund gearbeitet, und ich schlafe bei Vollmond immer so schlecht. Und da ist mir dieser coole Einfall gekommen.«
»Hm, hm.«
Ich schaue weiter demonstrativ auf die Fahrstuhlanzeige. Zweiter Stock. Das Ding fährt in der Geschwindigkeit eines handbetriebenen Flaschenzugs. Und wenn ich so tue, als verstünde ich nicht, worauf sie hinauswill? Vielleicht traut sie sich dann nicht weiterzureden. Was natürlich absolutes Wunschdenken ist, denn Sasha ist längst in ihrem eigenen Pulitzer-Preis-Film.
»Da bin ich logischerweise sofort aufgestanden. Wir Autoren müssen ja unsere Ideen gleich zu Papier bringen, sonst sind sie am nächsten Morgen wech.« Sie klopft mir auf die Schulter, als spielten wir in derselben Liga. Ich rücke einen Schritt von ihr ab.
»Sasha, du weißt doch, dass Artikel zu verfassen nicht dein Aufgabengebiet ist.«
»Urbaner Gemüseanbau!«, kreischt sie begeistert und so unvermittelt, dass ich zusammenzucke. »Dieses Thema interessiert die Leute bestimmt brennend!« Sasha strahlt, als habe sie soeben die Glühbirne erfunden.
»Gemüseanbau?«
Sie nickt eifrig. »In Blumenkästen auf dem Balkon. Möhren zum Beispiel. Eigenes Grünzeug eben, ohne Chemie und diesen ganzen Kram.«
»Du willst, dass unsere Leser auf ihren Balkonen Gemüse kultivieren? Das ist … interessant.« Dritter Stock. Himmel, geht das denn nicht schneller?
»Wirst du meinen Artikel lesen? Ich hab die halbe Nacht daran gearbeitet. Und vielleicht … also nur, wenn er dir gefällt …«
»Natürlich werde ich ihn lesen. Leg ihn in mein gelbes Postfach, ich sehe ihn mir dann später an.«
Enttäuscht atmet Sascha aus. »Du meinst das Fach, in dem schon meine anderen Texte liegen und in das du seit zwei Monaten nicht reingeguckt hast?«
Vierter Stock. Ich versuche, nicht genervt auszusehen. Die Metalltüren gleiten auseinander. Sasha bleibt wie ein begossenes Hündchen im Aufzug stehen. Jetzt komme ich mir tatsächlich wie ein schlechter Mensch vor. Ich seufze und nehme das Blatt aus ihrer schlaffen Hand. »Ich schaue es mir an. Versprochen. Aber zuerst tust du das, was du tun sollst. Kaffee kochen, die Regale abstauben und die Ablage erledigen. Du wirst die Augen und Ohren aufsperren und lernen, wie jede andere Praktikantin auch. Nächste Woche schlage ich dich für die Poststelle vor, dort wird dir vielleicht klar, was Ordnung und Sorgfalt bedeuten.«
Sasha reißt ihre hübschen Veilchenaugen auf. »Hannaaa!«
»Ich meine es nur gut mit dir, Kleine.«
Ihre Lippen verziehen sich zu einem Schmollmund. Nun sieht sie wirklich aus wie eine waschechte Berliner Straßengöre, wie sie dasteht, ein paar feuchte Strähnen auf die Stirn gepappt, die durchnässte Coffee-Fellows-Tüte in der einen Hand, die andere zur Faust geballt. Ich steuere den Flur zu unserem Großraumbüro an, den Blick fest auf den eingravierten Schriftzug Ressort Essen & Lebensart in der Glastür gerichtet.
»Ordnung wird heutzutage völlig überschätzt«, tönt es gekränkt hinter mir, doch da halte ich längst die Klinke in der Hand.
FABRIZIO
Nonna hatte darauf bestanden, dass ihr Hotelzimmer nach Osten zeigt, dorthin, wo die Sonne aufgeht. Es war ihr egal, dass vor dem Fenster die verklinkerte Fassade von Coffee Fellows aufragt, weshalb man den Kopf in den Nacken legen muss, um überhaupt ein Stück Himmel zu sehen. Von einem Sonnenaufgang ganz zu schweigen. Stattdessen Straßenlärm, Abgase und nicht mal einen Balkon.
Seufzend wende ich mich der unlösbaren Aufgabe in der Zimmermitte zu. Vier Koffer, meinen eigenen nicht mitgezählt, dazu Tüten von durchweg allen Damenboutiquen der Berliner Innenstadt. Ich setze mich auf die Bettkante. Das Laken ist gefaltet, das Kissen aufgeschüttelt, als hätte nie jemand darin geschlafen. Das Zimmer ist mir vorher schon klein vorgekommen, jetzt ist es winzig. Können Räume schrumpfen?
»Wie zum Teufel soll ich das ganze Zeug zum Flughafen schleppen, Nonna?« Muss ich das überhaupt? Die Kleider einer Toten, die ohnehin niemand mehr trägt, durch die Weltgeschichte kutschieren?
»Natürlich musst du, Fabrizio. Die guten Sachen.«
Die Porzellanurne könnte man glatt für eine Blumenvase halten. Der Bestatter war freundlich, sehr professionell. Sehr deutsch. Keine Regung in dem rasierten Gesicht, als ich widerwillig das hässliche gestreifte Ding ausgesucht habe, da die Einäscherung die unkomplizierteste, wenn auch nicht sehr katholische Möglichkeit bot, Nonna rasch nach Hause zu bringen. War das einzige verdammte Behältnis mit ein bisschen Farbe. Nonna liebt es bunt. Liebte.
Mit spitzen Fingern fische ich ein Stück blauen Stoff aus einer Tragetasche, der sich bei näherem Hinsehen als kastenförmiges Kleid entpuppt. Das zweite Kleid ist rot, dieselbe Form. Ein schmaler Gürtel und ein Halstuch, eins von der Flattersorte. In der nächsten Tüte noch mehr Kleider. Geblümt, gestreift. Ein gelbes, noch ein rotes. Ich halte eins nach dem anderen in die Höhe. Sehen alle gleich aus.
»Versteh einer die Frauen«, murmele ich in Nonnas Richtung und ziehe den Kopf ein.
»Du weißt nicht, wovon du redest«, mahnt sie prompt.
Vor allem weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Lucia ist kräftiger als Nonna, Alba zu jung, und Rosa-Marias Maße liegen außerhalb jeder Diskussion. Undenkbar, die Sachen an Fremde wegzugeben, womit sich die Frage erübrigt, was ich mit ihnen anstelle. Die Kleider fallen zu Boden, ein gelb-blau-roter Haufen. Die Miederwarentüte fasse ich nicht an. Auch Tote haben ein Recht auf Privatsphäre.
Das hast du wirklich schlau eingefädelt, Nonna. Machst dich aus dem Staub und deinen Enkel mit diesem Familiengepäck zum Gespött der ganzen Stadt. Nach einem winzigen Zögern greife ich nach der abgewetzten Lederhandtasche. Schon als kleiner Junge hat es mich brennend interessiert, was Nonna darin mit sich herumschleppt. Schleppte. Ich erinnere mich noch gut an die Schläge ihrer beringten Finger, wenn ich versuchte, den Inhalt der Zaubertasche zu ergründen. Also machten mein kleiner Bruder Marco und ich uns einen Spaß daraus, Nonna um die blödsinnigsten Dinge zu bitten, wenn sie mit uns unterwegs war – und sie fischte unverdrossen Scheren, Teigschaber, Süßigkeiten oder Zahnstocher aus diesem ledernen Monstrum hervor. Einmal sogar eine echte Pistole, aber das ist eine andere Geschichte. Das mit den Schlägen auf den Handrücken hat sich nun wohl erledigt. Trotzdem klopft mir das Herz bis zum Hals, als ich den Reißverschluss öffne und Nonnas Tasche kurzerhand auskippe.
Fast bin ich enttäuscht. Auf dem Laken türmen sich Sachen, die man in jeder anderen Frauenhandtasche auch findet. Taschentücher, ein Lippenstift, Cremetuben, eine Puderdose, eine Nagelfeile. Portemonnaie, Werbebroschüren von Boutiquen, ein Rabattgutschein von einem Schuhladen. Heftpflaster, ein Kugelschreiber und Nonnas Terminkalender. Mehr aus Ratlosigkeit als aus Neugier blättere ich darin herum und schlucke, als ich die ordentliche Handschrift wiedererkenne. Täglich ein Eintrag, manche davon mit einem Stern markiert. Geburtstage. Automatisch schlage ich die vierundzwanzigste Kalenderwoche auf. Meine linke Schläfe pocht, das Zeichen für eine bevorstehende Migräne. Ich starre auf das Datum und die Notiz in der Spalte. Zwölf Uhr, Praxis Dr. Buhlfort, steht da.
Plötzlich ertönt die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. »Du kannst heulen, solange du willst, mein Sohn. Das bringt deine Mamma nicht zurück. Putz dir die Nase und kümmer dich um deinen kleinen Bruder!«
Trotzig wische ich mir mit dem Handrücken übers Gesicht. Den Bleistifteintrag darunter hätte ich fast übersehen. Sechzehn Uhr, Isabella Colei! Wer zum Henker ist Isabella Colei?
Eine vorläufige Antwort entdecke ich wenig später in Nonnas Adressbuch. Signora Colei besitzt einen Berliner Anschluss. Keine Ahnung, warum ich nach dem Telefon greife. Ich könnte das Büchlein schließen und den Eintrag vergessen. Doch Nonna hat uns immer eingebläut, Verabredungen einzuhalten. Vielleicht ist mein Bedürfnis aber auch mehr als ein unbestimmtes Pflichtgefühl. Seit zwei Tagen habe ich mit niemandem gesprochen, den Anwalt ausgenommen, der sich um diesen Artikel kümmern will. Ein unsympathischer Kerl, aber überzeugend. Ich werde es dreimal klingeln lassen. Drei Mal. Nimmt dann keiner ab, lege ich wieder auf.
»Hallo?« Die Stimme der Frau klingt abgehetzt, jedoch freundlich.
»Entschuldigen Sie bitte die frühe Störung. Spreche ich mit Signora Colei?« Ich rede so schnell, als sei mein Satz ein zusammenhängendes Wort.
»Ja, am Apparat.«
»Mein Name ist Fabrizio Camini und ich …« Atmen, Fabrizio! Atmen! »Hallo? Sind Sie noch dran?«
»Was kann ich für Sie tun, Signor Camini?« Die Frau am anderen Ende wechselt sofort ins Italienische, doch das ist es gar nicht, was mich verwirrt. Ihre Stimme ist plötzlich zehn Grad kälter.
»Ich glaube, Sie waren vor vier Tagen mit meiner Großmutter verabredet, Giuseppa Camini. Tut mir leid, dass ich jetzt erst anrufe, aber ich muss Ihnen mitteilen …« Was mache ich denn da? Einer Fremden erzählen, dass Nonna tot ist? »Meine Großmutter hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie leider kurzfristig unpässlich war.«
Stille.
»Signora? Sind Sie noch da?«
»Ich habe den Namen Ihrer Großmutter nie gehört. Tut mir leid.«
»Das kann nicht sein. Sie stehen in ihrem Terminkalender. Für letzten Montag, den neunten.«
»Wahrscheinlich eine Verwechslung.«
»Aber …«
»Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Signor Camini.«
Die Frau hat aufgelegt. Noch während ich wie betäubt auf den Hörer starre, klopft es.
»Jetzt nicht«, murmele ich.
»Housekeeping«, dringt es dumpf durch die Tür.
»Nein danke«, sage ich lauter, doch der Schlüssel dreht sich bereits im Schloss. »Che merda! Ich hab Nein danke gesagt!« brülle ich die völlig verdatterte Frau an, und ein scharfer Schmerz durchzuckt meine Stirn.
Ich schwöre, Nonnas Zimmer hat noch ein paar Quadratmeter eingebüßt – mit einem Mal habe ich das Gefühl, zwischen diesen Wänden zu ersticken. Das dicke Zimmermädchen wird so bleich wie seine Kittelschürze und stolpert einige Schritte rückwärts. Entschuldigend zeigt sie auf den Pappanhänger, der am Türknauf baumelt, die grüne Seite nach außen, aber ich bringe es nicht fertig, um Verzeihung zu bitten. Stattdessen wedele ich gereizt mit der Hand auf und ab, woraufhin die Frau eilig die Tür schließt.
Mein Magen knurrt. Meine letzte Mahlzeit war ein Sandwich gestern Mittag, das wie ein Gemisch aus Pappe und Styropor geschmeckt hat. Kein Wunder, dass ich mich aufführe wie ein Arschloch. Behutsam lege ich den Hörer auf die Gabel, aus dem ein lang gezogenes Freizeichen dröhnt, und starre die rotblau gestreifte Porzellanurne an. Tja, Nonna, deine Heimkehr hast du dir sicher anders vorgestellt.
Ruckartig erhebe ich mich vom Bett. Man soll unangenehme Dinge nicht aufschieben, und essen kann ich ebenso gut am Flughafen. Für das Zimmermädchen lasse ich einen Zwanzigeuroschein und das Kleingeld aus Nonnas Börse auf dem Kopfkissen zurück. Besser fühle ich mich trotzdem nicht.
HANNA
Claire reißt die Augen auf und beugt sich über den Schreibtisch.
»Ist nicht dein Ernst. Sasha in der Poststelle? Mon dieu, das gibt Mord und Totschlag. Du weißt doch, wie penibel die da unten arbeiten.«
»Ach was.«
Ungerührt schlage ich meine Postmappe auf, die fast aus der Leimbindung platzt. Leserbriefe, Kommentare zu meinem letzten Artikel, Anfragen verschiedener Restaurants, die eine Kritik abgedruckt haben wollen. Unglaublich, was sich während meiner zweiwöchigen Abwesenheit alles angesammelt hat. Das mit dem Urlaub sollte ich zukünftig sein lassen, ebenso wie den ganzen sentimentalen Rest, der mich auf die blöde Idee gebracht hat, ausgerechnet nach Italien zu fliegen.
Ich sehe auf, als meine Stirn zu prickeln beginnt. Meine Kollegin kaut an ihrem Brillenbügel und schaut mich stumm an. Claire Durant gehört zu den wenigen Menschen, die einen kritisieren können, ohne ein Wort zu verlieren.
»Was ist denn?«, murmele ich unwillig.
»Du wirkst nicht besonders erholt.«
»Ach nein?«
Ihre Augen werden schmal. Die Französin ist maximal einen Meter fünfzig groß und zierlich wie eine Antilope, trotzdem schafft sie es mühelos, mich aus dem Konzept zu bringen.
»Deine Augenringe haben nicht zufällig hiermit zu tun?«
Sie schwenkt ein Magazin, vermutlich die neue Ausgabe. Hübsches Aprikosencover, das war’s auch schon. Allein die Erinnerung an diese grässliche Trattoria macht mich wütend. Keine Ahnung, wie lange man Gemüse kochen muss, damit es einen derartigen Grauton annimmt. Ein ganzes Glas Wein war nötig, um den Glutamatgeschmack der ribollita loszuwerden. Mit hochgezogenen Brauen legt Claire die Zeitschrift auf dem Tisch ab, aufgeschlagen und mir zugewandt. Die Schlagzeile »Tre Camini verpatzt la Dolce Vita« springt mir ins Gesicht.
»Glaub mir, es war höchste Eisenbahn, dass da mal einer klare Worte spricht. Ich weiß, wie gutes italienisches Essen zu schmecken hat. Und dort«, ich pikse den Finger in das rote Schindeldach auf dem Foto, »gibt’s definitiv kein gutes Essen. Der Koch kann von Glück reden, dass er es nur mit mir zu tun bekommen hat. Meine Mutter hätte ihn bei lebendigem Leib gehäutet.«
Aber Claire hört mir gar nicht zu. Sie bohrt ihre piniengrünen Augen in meine Stirn und senkt die Stimme. »Bon sang, du warst in Italien. Dem Land der schönen Künste und des Savoir-vivre, das zufällig auch dein Heimatland ist. Du solltest braun gebrannt, glücklich und nach mindestens zwei Kilogramm mehr auf deinem Popo aussehen. Stattdessen hast du fünf Artikel verfasst, alle drei Stunden eine E-Mail geschickt und dreißig Leserbriefe geschrieben. Und dein Hintern ist noch genauso mager wie vorher.«
»Ich liebe meinen Job eben«, verteidige ich mich. »Für dich mag Italien der Inbegriff deiner patinabehafteten Träume sein, mich verbindet mit diesem Land lediglich der Nachname meiner Mutter. Außerdem heißt das nicht Savoir-vivre, sondern Dolce Vita.«
»Aha. Trotzdem frage ich mich, wieso du dich nicht mal für ein paar Tage von deinem Laptop trennen kannst.«
»Hör auf zu nerven, Claire. Dieser Urlaub war ein Reinfall erster Güte. Von vierzehn Tagen hat es zehn geregnet, ich hatte weder Ruhe noch Muße und nicht den Anflug eines heimatlichen Gefühls. Ich habe ein Dorf nach dem anderen abgegrast und war umgeben von bekloppten Italienern, die allesamt ihren Führerschein in der Lotterie gewonnen haben. Nicht zu vergessen die Köche, die besser Zeitung austragen sollten. Selbstverständlich arbeite ich im Urlaub.«
Ich zucke mit den Schultern. Claire würde es sowieso nicht verstehen. Food-Journalistin zu sein ist alles, was mir von dem Traum einer Schriftstellerkarriere geblieben ist. Ich habe geschwitzt, die Nächte durchgearbeitet und mir die Finger blutig getippt, um wenigstens eine eigene Rubrik zu ergattern. Meine Kolumne bedeutet mir alles, weil ich mit ihr wirklich etwas bewege, auch wenn es nicht immer angenehm für mich ist.
Claires Gesichtsausdruck wird milde. »Wie schlimm war’s genau?«, fragt sie leise. Ich krame in meiner Tasche und fördere einen Aschenbecher, zwei Dessertlöffel, eine Seifenschale und einen Zuckerstreuer zutage. Claire seufzt. »Hast du die Adressen, damit ich die Sachen retour schicken kann?«
»Natürlich habe ich die.« Mit gesenktem Blick krame ich weiter. Auf jedem Restaurantprospekt habe ich gewissenhaft den Gegenstand notiert, den ich von dort mitgenommen habe. Beschämt stelle ich den Tamponspender neben den Rest meiner Beute. Andenken an sechs gastronomische Reinfälle innerhalb von zwei Wochen. La Dolce Vita lässt grüßen.
»Och, der Zuckerstreuer ist aber niedlich.« Sasha hat sich angeschlichen, ein paar braune Tropfen kleckern auf meine Unterlagen.
»Ouuu! Wie siehst du denn aus?« Claire schiebt ihre Brille auf die Nasenwurzel und mustert entsetzt Sashas Regenmantel. »Warum trägst du Kinderklamotten? Und diese grässliche Mütze! Hast du die selbst gehäkelt?«
»Ich mag den Mantel eben. Und die Mütze mag ich auch.« Sasha zuckt die Achseln und lehnt sich an meinen Schreibtisch. »Sag mal, wieso müssen wir eigentlich ständig deine Verrisstrophäen zurückschicken? Behalt das Zeug doch einfach, es ist eh nix wert.«
»Aber das wäre dann ja Diebstahl.« Ich schüttele entrüstet den Kopf.
»Das wäre … Hanna, du tickst nicht mehr richtig.«
»Halt die Klappe, Sasha. Du hast keine Ahnung. Außerdem bist du zu spät.« Claire deutet mit unheilvollem Blick zur Wanduhr.
»Hanna ist auch zu spät«, fällt mir Sasha in den Rücken, die Retourkutsche für das unerfreuliche Gespräch im Aufzug.
Ich schnappe nach Luft, aber Claire ist schneller als ich.
»Zur Erinnerung, Mademoiselle: Wir sind die Journalistinnen, du bist die Praktikantin. Wir mögen in dieser Redaktion eine flache Hierarchie pflegen, aber die Spielregel besagt, dass du den Kaffee kochst. Deshalb beginnt dein Arbeitstag früher als unserer, damit du die Maschine schon mal anstellen kannst. Also?«
»Also komme ich zu spät, obwohl ich an der Kaffeetheke für euch angestanden hab, aber Hanna hatte selbstverständlich einen Termin. Na, das macht Laune.« Sasha verdreht die Augen.
»Bist ein schlaues Mädchen. Jetzt zischel ab und bring mir einen Café au lait, s’il te plaît. Danach schickst du Hannas Souvenirs zu ihrem Besitzer zurück, ohne ein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen. Wie immer.«
»À la prochaine. Sofortamente.« Sasha salutiert und duckt sich, als Claire einen Kugelschreiber nach ihr wirft.
»Zischel ab?« Ich grinse. »Claire, du bist einfach süß.«
»Ich bin nicht süß. Aber dir wird das Süßholzgeraschel gleich vergehen. Der Hellwig will dich sehen. Heute noch. Und es klang nicht gerade nach einer Einladung zu einem Tête-à-Tête.«
Gedankenverloren klaube ich Claires Kugelschreiber vom Teppich auf. »Ich dachte, der Chef weilt in Helsinki.«
»Er hat einen Zwischenstopp in Berlin eingelegt, bevor er nach Wien fliegt. Die Österreicher … ouuu, frag nicht!«
Das ist auch gar nicht nötig. Unsere Wiener Redaktion schafft es jeden Monat auf die verlagsinterne Toplist der langweiligsten Printausgaben, was unseren Chefredakteur fuchsteufelswild macht.
»Weißt du, worüber er mit mir sprechen will?«
Wenn Hellwig mich zum Flughafen zitiert, kann nichts Gutes dahinterstecken. Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, mich nach Wien zu versetzen. Obwohl … die Wiener Melange und diese köstlichen buttergebackenen Teilchen wären unter Umständen ein überzeugendes Argument.
»Ich denke mal …« Claire verzieht ihre roten Lippen.
»Jetzt lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!«
»Du willst Wörter aus meiner Nase …? Ouuu, ihr Deutschen seid schon irgendwie verrückt.«
»Claire!«
»Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass du exakt eineinhalb Stunden hast, um pünktlich am Flughafen zu sein. Also hoppelahopp!«
FABRIZIO
Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe. Ein leer gefegtes Restaurant um die Mittagszeit? Taktvolle Ruhe im Tumult an- und abreisender Fluggäste, die mir vom Gesicht ablesen, dass mir weder an Rippenstößen noch an raumfüllendem Geschnatter gelegen ist? Mein Handgepäck über der Schulter und Nonna unter dem Arm, bahne ich mir einen Weg durch das überfüllte Flughafenrestaurant. Zu meiner Erleichterung erspähe ich einen frei gewordenen Tisch im hinteren Bereich des Lokals, direkt am Fenster.
Ich umrunde einen Kinderwagen, steige über einen Trolley und nicke einer Frau zu, die ihren Koffer rücksichtsvoll aus dem Weg zieht. Lasse mich auf den Holzstuhl fallen und schiebe das Tablett beiseite, auf dem ein verlassener Spaghettiteller steht, den irgendein Kenner mit Ketchup vollgekleckert hat. Wie aus dem Nichts erscheint die Bedienung an meinem Tisch und zückt ihr Kellnerblöckchen. Ihr Mund öffnet sich und entblößt eine beeindruckend weiße Zahnreihe.
»Was darf ich Ihnen bringen?«
»Die Telefonnummer Ihres Zahnarztes?«
Das Lächeln wird breiter. »Sie sind Italiener.«
»Ach, wirklich? Gut, dass Sie mich daran erinnern.« Sie lässt mir keine Wahl. Ich gehe auf ihren neckischen Ton ein, obwohl ich finde, dass sie zu stark geschminkt ist und ich zum Flirten eigentlich nicht aufgelegt bin. »Können Sie mir etwas empfehlen?«, frage ich freundlich und bemühe mich, nicht auf ihren Busen zu starren.
Sie kichert. »Wir sind hier doch nicht in einem Sternerestaurant.«
»Ach, nein?«
»Das Tagesgericht ist Schweinebraten mit Kartoffelpüree. Kostet nur sechs Euro.«
»Ein unschlagbares Argument«, sagte ich und stelle Nonna neben mir auf dem Polsterstuhl ab. Eine reichlich wackelige Angelegenheit. »Dann nehme ich das Tagesgericht und ein Wasser dazu.« Ich überlege es mir anders und hieve Nonna auf den Tisch.
»Arbeiten Sie in der Gastronomie?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sie haben die Nase gerümpft, als ich das Mittagsangebot genannt habe.«
Nachdenklich betrachte ich das rotblaue Monstrum. Irgendwie auch nicht passend, seine Großmutter neben Schweinefleisch und Instantpüree zu platzieren. Nonna mochte kein Schwein.
»Und Sie sollten Psychologie studieren. Ihre Beobachtungsgabe ist erstaunlich.« Ob ich Nonna besser auf dem Sims abstelle? Von dort aus kann sie sogar auf das Rollfeld schauen.
»Das tue ich tatsächlich. Ich studiere im zweiten Semester Soziologie, und Psychologie ist eins meiner Nebenfächer.«
Warm ist es auch auf der Fensterbank mit dem Heizkörper darunter.
»Gut, ich gehe dann mal Ihre Bestellung holen.«
»Wie bitte?«
Zerstreut schaue ich auf, erhasche jedoch nur noch einen Blick auf das runde Hinterteil der Kellnerin. Hübsch, durchaus. Automatisch drehe ich den Kopf und betrachte die Rollbahn, wo gerade eine Lufthansa-Maschine an der Fluggastbrücke andockt. Der Kofferwagen, gesteuert von einem Mann mit einer gelben Sicherheitsweste, fährt heran. Während der Kollege des Fahrers die Anhängerklappen an den Seiten öffnet, um das Gepäck einzuladen, vibriert meine Aktentasche. Oder vielmehr mein Handy, das ich seit zwei Tagen erfolgreich ignoriere. Meine Schwägerin Lucia wahrscheinlich, vielleicht auch unsere Köchin Rosa-Maria. Wenn ich Pech habe, mein unseliger Bruder Marco. Sie werden mir den Kopf abreißen, noch ehe meine Füße italienischen Boden betreten haben. Was ich ihnen nicht verdenke nach meinem Gestammel auf den Anrufbeantworter der Trattoria. »Nonna ist gestorben. Ich komme am Freitag zurück.« Nicht mehr und nicht weniger tropfte aus meinem Mund.
Seufzend beuge ich mich zu meiner Aktentasche herunter. Die Gepäckaufgabe habe ich immerhin überstanden, auch wenn mich das Übergepäck eine Stange Geld gekostet hat. Ich finde mein Handy nicht sofort, stattdessen ertasten meine Finger im Außenfach etwas, das ich eigentlich vergessen wollte. Die Zeitschrift aus dem Wartezimmer. Automatisch blättere ich zu der Seite, die ich bestimmt schon zwanzigmal gelesen habe, und wünsche mir zum hundertsten Mal, ich hätte die harmlos aussehenden Sätze nicht ins Italienische übersetzt.
Tre Camini verpatzt la Dolce Vita
Es hätte so schön sein können, überragend nahezu – vergäbe diese Redaktion Sterne für die hübscheste Location.
Denn hübsch ist das Tre Camini zweifellos, besonders für den abenteuerlustigen Gast, der kurz hinter dem idyllischen Örtchen Montesimo die Strada Provinciale 88 verlässt und sich traut, dem unbeschilderten Schotterweg zu folgen.
Belohnt wird sein Mut mit einem Bild, das der Toskana-Reisende seinen Lieben gern in Postkartenform nach Hause schickt. Ein ehrwürdiges Landgut thront auf einem blühenden Hügel, der so perfekt gerundet ist wie das Blätterteighäubchen auf Paul Bocuse’ berühmter Trüffelsuppe.
Das ockergelbe Steinhaus wirkt etwas schief, jedoch nicht schief genug, um ein Unwohlsein beim Betreten des Lokals hervorzurufen. Selbst der Umstand, dass man abends um 20:00 Uhr der einzige Gast ist, ruft zunächst keinerlei Argwohn hervor. Immerhin hieß es im Dorf, die Küche »da oben« sei weit und breit die beste. Ist man anfangs durchaus gewillt, dies zu glauben, folgt die Ernüchterung allzu schnell. Die freundliche Bedienung wirkt von der Frage nach einer Weinempfehlung überfordert und bringt statt des verlangten Pinot Grigio ein Glas Rotwein, das sie auf Nachfrage als »Hauswein« etikettiert. Der namenlose Wein schmeckt leicht und fruchtig, ist samtig im Abgang und lässt großzügig über die Unkenntnis der jungen Kellnerin hinwegsehen.
Leider war dies der Auftakt zu einem kulinarischen Trauerspiel, das seinesgleichen sucht – und das ausgerechnet in dem Land, das es mit seiner Küche zum Weltruhm gebracht hat. Ohne Löffel sitzt der Gast eine halbe Stunde später vor der Spezialität des Hauses: der ribollita. Der berühmte toskanische Eintopf entpuppt sich als Fertigbrühe, in der Tiefkühlgemüseleichen dümpeln, dazu wird altbackenes Brot gereicht.
Der zweite Gang animiert zum Mikadospiel, hätte der Koch die halb rohen Nudeln nicht unter einem undefinierbaren grünen Soßenberg versteckt, und auch beim Hauptgang ist man redlich bemüht, das Grauen zu steigern. Das Lamm besitzt die Konsistenz einer Schuhsohle, von einer Gemüse- oder Salatbeilage keine Spur, stattdessen gibt es den zähen Fleischlappen im sättigenden Doppelpack, garniert mit einem Klecks Tubensenf. Spätestens jetzt spielt der enttäuschte Gast mit dem Gedanken, besser auf die Nachspeise zu verzichten (…).
»So schlimm sieht unser Braten nun auch wieder nicht aus.«
Erschrocken schlage ich das zerknitterte Heft zu, schaue auf das lieblose Arrangement aus Fleisch, Kartoffelbrei und graubrauner Soße und anschließend nach oben. Die Kellnerin kann keine fünf Minuten weg gewesen sein. »Entschuldigung. Ich war mit den Gedanken woanders.«
»Geht schon in Ordnung. Guten Appetit.«
Das Flirtlächeln ist aus dem Gesicht der jungen Frau verschwunden. Jetzt zieht sie nur noch unverbindlich die Mundwinkel nach oben, wie sie es vermutlich bei hundert anderen Gästen auch tut. Ich schiebe das Magazin zurück in die Tasche und greife nach dem Besteck, ehe die Kellnerin auf die Idee kommt, etwas hinzuzufügen. Zu meiner Erleichterung stolziert sie hüftschwingend davon. Versteh einer die Frauen.
HANNA
Flughäfen finde ich einfach grandios. Alles an ihnen ist gewaltig, bunt und laut. Aus blechernen Lautsprechern tönen die Ansagen, die zugleich das Ende eingelöster Versprechen oder den Anfang tausender Möglichkeiten bedeuten. Am allermeisten liebe ich das Treiben in der Ankunftshalle. Obwohl ich heute Morgen in Tegel bereits in den Genuss gekommen bin, bedauere ich es zutiefst, dass ich keine Gelegenheit habe, dorthin zu schlendern, um mir die Begrüßungsszenen anzusehen, die mich beim Abspann des Hollywood-Films Tatsächlich … Liebe meist eine halbe Packung Kleenex kosten. Doch ein kleiner Spaziergang ist in meinem Zeitplan nicht vorgesehen. Ich hetze durch den Abflugterminal, auf hochhackigen Schuhen eine echte Herausforderung, und denke sogar kurz daran, die Treter abzustreifen und barfuß weiterzulaufen. Es bleibt bei dem Gedanken.
Wie erwartet, ist das Flughafenrestaurant gut besetzt. Ich drängele mich durch eine einheitlich grüne Kappen tragende Seniorengruppe, die den gesamten Thekenbereich gekapert hat, und recke den Kopf. Wie ich Hellwig kenne, hat er einen Tisch reserviert, vermutlich im hinteren Bereich. Tatsächlich entdecke ich sein vertrautes Profil an einem Vierertisch am Fenster. Ich hebe automatisch die Hand, um zu winken, besinne mich aber eines Besseren. Hellwig hasst nichts mehr, als im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, und alle Mitmenschen, die ihn dorthin befördern, sind ihm ein Gräuel.
Also presse ich meine Postmappe fest an die Brust und zwinge mich, den Raum gemessenen Stöckelschritts zu durchqueren. Leider rächt es sich, dass ich keine Zeit habe, regelmäßig ein Fitnessstudio zu besuchen. Ich hechele wie ein pummeliger Labrador und fühle mich wie eine Schülerin, die zum Rektor zitiert wird, ohne zu wissen, was sie angestellt hat.
So geht es mir bei jedem Termin mit Hellwig. Irgendwas hat dieser athletische, gut aussehende Mann mit den farblosen Augen an sich, das mich einschüchtert. Sehr zur Belustigung von Claire, die hinter meiner Nervosität etwas völlig anderes wittert, was natürlich ausgemachter Schwachsinn ist. Wer ist schon so dämlich und fängt was mit seinem Chef an? Leider macht mir eine auf dem Boden liegende Aktentasche einen Stolperstrich durch meine Ich-nähere-mich-dem-Boss-würdevollen-Schrittes-Aktion.
»Aua! Himmel, Arsch und …«
Ein stechender Schmerz durchfährt mein Schienbein. Mich trifft ein irritierter Chefblick, während ich mich für Sekundenbruchteile in einem erschrockenen Augenpaar verheddere. Espressofarben.
»Scusi, Signora.« Der Fremde am Nebentisch zieht hastig seinen Aktenkoffer zu sich her. Ich zwinge ein Lächeln auf meine Lippen und lasse den unfreiwilligen Verursacher meiner Pein im wahrsten Sinne des Wortes links sitzen. Espressoaugen hin oder her.
»Hallo, Chef! Entschuldigen Sie bitte die Verspätung.« Gut, etwas atemlos, aber durchaus so, als hätten die letzten drei Sekunden nie stattgefunden.
»Frau Philipp. Wie immer mit Pauken und Trompeten.«
Hellwigs Miene bleibt ausdruckslos. Schnell rutsche ich auf den freien Stuhl ihm gegenüber, widerstehe tapfer der Versuchung, mein Schienbein zu reiben, und greife nach der Speisekarte.
»Sind Sie hungrig?«
»Ehrlich gesagt bin ich nur nervös.«
Hellwig mustert mich stumm und lacht dann auf, ohne amüsiert zu klingen. »Sie und nervös? Im Leben nicht!«
»Gut, Sie haben gewonnen. Ich bin gespannt. Kommt nicht oft vor, dass Sie mich zum Flughafen beordern.«
»Dann sollte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen.« Er betrachtet seine Armbanduhr. »Es gibt tatsächlich ein Problem.«
»Und dieses Problem hat etwas mit mir zu tun?«, frage ich so sachlich wie möglich.
»Wir haben uns mit Ihrem Artikel eine Klage eingehandelt.«
»Ach, mal wieder?«
Hellwig erwidert mein Grinsen nicht, dabei nimmt er echauffierte Gastronomen sonst eher auf die leichte Schulter. Recherchieren Sie gründlich, halten Sie sich an die Fakten und beleidigen Sie niemanden, dann können Sie sich meinetwegen auch mit Herrn Schuhbeck oder dem Lafer anlegen. Recherche, Tatsachen, Respekt. Immer dieselbe Predigt. Bis dato habe ich die Regeln strikt befolgt.
»Sie finden es also witzig, dass man uns zur Kasse bittet.« Gedankenverloren rührt Hellwig in seiner leeren Teetasse.
Das unangenehme Geräusch von Metall auf Porzellan stellt sämtliche Härchen auf meinen Unterarmen auf. »Nein, natürlich nicht«, antworte ich rasch, während eine winzige Alarmsirene in meinem Kopf losschrillt. Dieses Gespräch verläuft überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe.
»Das ist auch besser so. Es ist nämlich alles andere als amüsant.« Hellwig beugt sich über den Tisch, und eine dezente Pfefferminzfahne dringt in meine Nase. Mein Chef ist ein Gesundheitsfanatiker. Er trinkt nie Kaffee, und ehrlich gesagt ist es ziemlich ungewohnt, ihn heute im Anzug und mit korrekt gebundener Krawatte zu sehen, da er sonst Jeans und locker geknöpfte Poloshirts trägt. »Der Kläger, ein gewisser Signor Camini, stellt eine Schadensersatzforderung im fünfstelligen Bereich.«
Fünfstellig? Ich balle die Fäuste auf meinem Schoß und kämpfe gegen das unheilvolle Prickeln in meinen Fingerspitzen an.
Hellwig betrachtet das Blumenmuster auf seiner Serviette. »Und er will Ihren Kopf.«
Meine Stimme ist irgendwie weg.
»Aus irgendeinem Grund sind Signor Camini und sein Anwalt nämlich der Meinung, dass Ihr Artikel die Großmutter seines Mandanten umgebracht hat.«
»Das ist doch lächerlich!«, bricht aus mir heraus, es klingt reichlich erbärmlich.
»Finde ich überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass die herzkranke alte Dame in den Genuss Ihrer Spitzfindigkeiten gekommen ist …« Hellwig macht eine grausame Pause, in der er den Kopf hin und her wiegt. »Selbstverständlich kann niemand das Magazin zwingen, seine Journalisten zu feuern. Wo kämen wir denn da hin? Aber die Kanzlei Donnermuth versteht sich ziemlich gut darauf, Angebote zu unterbreiten, die man kaum abschlagen kann.«
Über das abgewandelte Zitat aus Der Pate kann ich leider nicht lachen. Stattdessen drückt ein körperloses Etwas meine Brust wie ein Schifferklavier zusammen. Mein Artikel hat eine alte Dame umgebracht.
ICH habe eine alte Dame umgebracht!
Das wollte ich nicht.
Wirklich nicht.
»Donnermuth verfügt über einschlägige Kontakte zur Presse und scheut sich nicht, diese auch zu nutzen. Sie können sich vorstellen, welche Wirkung die Geschichte von der rührseligen italienischen Oma und ihrem alteingesessenen Familienbetrieb auf all jene haben wird, denen Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit schon auf die Füße getreten sind. Die zerreißen uns in der Luft. Frau Philipp, ich hänge an dem Magazin. Und ich halte jeden Journalisten für ersetzbar.«
»Aber alles, was ich über das Tre Camini geschrieben habe, ist wahr! Das Essen ist eine Katastrophe … Allein die Suppe … Die Pasta war … Und der Service …«
Hellwig unterbricht mein Gestammel mit einer unwilligen Geste. »Ich diskutiere nicht mit Ihnen darüber, ob Ihr Verriss gerechtfertigt ist. Selbstverständlich ist der Artikel auch nicht schuld am Tod der alten Frau. Herr Camini sieht die Sachlage jedoch etwas emotionaler, und nun gilt es, Schadensbegrenzung zu betreiben.«
»Aber wenn wir nicht im Unrecht sind, wieso sollten wir dann klein beigeben und einen Artikel beschönigen, der zur Aufklärung unserer Leser dient? Das ist ein Angriff auf die journalistische Freiheit.«
»Vielleicht weil Sie eine kluge Frau sind, die an ihrem Job hängt?«
Irre ich mich, oder erscheint ein Anflug von Mitleid in seinem Gesicht? Die Erkenntnis schlägt über mir zusammen und spült jede Sicherheit aus meinem Leben. Hellwig hat mich längst aufgegeben.
»Das ist nicht Ihr Ernst.«
»Mein voller Ernst. Sie sind eine brillante Schreiberin, aber allmählich werden Sie etwas teuer. Unsere Anwälte ziehen den Kopf ein, wenn sie nur Ihren Namen hören, und nach der Sache mit Rothfeld …« Er zieht ein bekümmertes Gesicht, doch in seinen stählernen Augen liegt keinerlei Verständnis. Mein Mund fühlt sich an, als hätte jemand Watte hineingestopft. »Rothfeld ist ein Betrüger. Der Befund aus dem lebensmitteltechnischen Institut hat eindeutig bewiesen, dass er Forellen als Saiblinge verkauft hat.«
»Da ist es wieder.« Hellwig seufzt. »Verraten Sie mir mal, welcher Restaurantkritiker auf die Idee kommt, ein Stück Fisch ins Labor einzuschicken. Sie verlieren allmählich den Blick für die Verhältnismäßigkeiten, Frau Philipp. Wir sind nicht das Landeskriminalamt. Sie klären keine Ritualmorde auf, sondern schreiben eine Unterhaltungskolumne in einem Dreieuro-achtzig-Food-Magazin, das vom Guide Michelin so weit entfernt ist wie mein Laptop von der Voyager.«
»Ich weiß«, flüstere ich kleinlaut, doch der Chef ist längst nicht fertig mit mir.
»Nicht dass ich Ihren Mut nicht bewundere. Sie sind eine Karrierefrau mit Biss und scheuen sich nicht, den Leuten deutliche Worte um die Ohren zu hauen. Aber Sie sind übereifrig, und dabei gehen Ihnen jede Besonnenheit und sämtliches Taktgefühl ab.«
»Heißt das, ich bin gefeuert?« Meine Handflächen sind schweißnass, das Blut schießt in meinen Kopf. Hilfe, ich verliere die Kontrolle! Mein Blick rastert den Tisch, auf der Suche nach einem Gegenstand, der meiner Not ein Ende bereitet. Bis auf Hellwigs Teetasse erspähe ich nur eine blanke Tischplatte. Was ist bloß mit den Wirten los? Sollten sie ihren Gästen nicht wenigstens ein Blumenväschen mit irgendeiner traurigen Kunstblume gönnen, wenn es schon nicht für einen Salzstreuer reicht? Schließlich kann ich meinem Chef schlecht den Löffel vom Unterteller mopsen. Ich beginne zu zittern, mein Blick saugt sich am Fenstersims fest. Darauf stehen zwei Pflanzkübel. Und eine gestreifte Porzellanvase.
»Ich verlange Folgendes von Ihnen, Frau Philipp: Sie setzen einen freundlichen Widerruf Ihres Artikels in die Juliausgabe und entschuldigen sich für den Irrtum. Anschließend bringen Sie Signor Camini dazu, dass er diese absurde Klage zurücknimmt, und wenn Sie auf Knien vor seiner Stalltür darum betteln müssen. Ein Gang nach Canossa, und ich lege im Gegenzug beim Vorstand ein gutes Wort für Sie ein.« Hellwig wendet sich ab und angelt nach seinem Sakko, während ich blitzschnell zugreife.
Die Vase ist nicht nur hässlich, sondern auch noch schwer. Gott sei Dank passt sie millimetergenau in meine Henkeltasche. Sofort ist das Zittern verschwunden, erleichtert atme ich aus, als sich das Akkordeon in meiner Brust auseinanderzieht.
Hellwig blättert in seiner Geldklammer und schenkt mir ein unverbindliches Lächeln. »Ich muss los. Gewiss werden Sie das Problem zu aller Zufriedenheit lösen.« Er reicht mir einen Zwanziger. »Würden Sie bitte meinen Tee bezahlen? Und bestellen Sie sich ein Stück Torte. Kohlehydrate sollen bei Stress wahre Wunder wirken.«
Ich nehme den Geldschein und verkneife mir die boshafte Entgegnung, die mir auf der Zunge kribbelt. »Viel Spaß in Wien«, sage ich stattdessen, ohne es ehrlich zu meinen.
Zu meiner Überraschung zwinkert Hellwig, tippt sich an die Stirn und dreht sich wortlos um. Seine hochgewachsene Gestalt schiebt sich zwischen die Reisenden und verschwindet schließlich im Gedrängel vor der Essensausgabe.
Die pummelige Kellnerin sieht mich nicht an, während sie den Rechnungsbetrag nennt und das Wechselgeld herauszählt, sondern schielt zu dem Mann am Nebentisch. Den hatte ich, versteckt hinter Hellwigs breitem Rücken, trotz seiner Espressoaugen vollkommen vergessen.
Der Südländer sitzt mit geschlossenen Lidern auf seinem Stuhl, dem Fenster zugewandt, ein Kopfhörer krallt sich wie ein riesiges schwarzes Insekt um seinen Kopf. Ein gut aussehender Mann, wie ich abwesend bemerke, mit dunklen welligen Haaren, durch die sich kupferbraune Strähnen ziehen, und mit ebenmäßigen Gesichtszügen. Seine Wimpern sind so lang, dass sie Schatten unter seinen Augen werfen. Ich weiß nicht, ob es das Wippen seiner Ferse ist oder das niedliche Grübchen, welches sich in sein unrasiertes Gesicht drückt, aber der Mann rührt mich irgendwie. Vor allem spüre ich einen Anflug von Neid, weil er so friedlich aussieht. In seinen Klanghemisphären gibt es sicher nichts, was ihm den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ich straffe den Rücken und schultere meine Tasche, die wesentlich schwerer ist als vorhin. Im Vorbeigehen ein prüfender Blick in die Spiegelwand zu meiner Linken. Beim Hereinkommen habe ich eindeutig größer ausgesehen.
FABRIZIO
Ich bin viel besserer Dinge, als ich bei der Gepäckkontrolle ankomme. Zuccheros versoffene Stimme hat mir eine halbstündige Auszeit verschafft, dank derer ich wieder klar denken kann und die mir zudem ein weiteres Gespräch mit der Kellnerin erspart hat. Wie erwartet, ertönt ein gehässiger Piepton, als ich durch die Magnetschranke gehe. Verglichen mit den italienischen Kontrollen ist Deutschland ein Hochsicherheitstrakt. Dass ich mich geweigert habe, die dünne Goldkette mit dem Kruzifix abzunehmen, rächt sich jetzt. Der Beamte deutet auf das Sünderbänkchen hinter dem dreiteiligen Paravent. Ich verdrehe die Augen gen Decke.
»Schuhe«, sagt der Uniformierte unbeeindruckt.
Hab ich. Und weiter?
»Zie-hen Sie die Schu-he aus.«
Ich glotze absichtlich verständnislos. Schon zu Studienzeiten hat es mir diebischen Spaß gemacht, deutsche Ordnungshüter auf die Palme zu bringen. Der Uniformierte zeigt auf meine Budapester. Umständlich fummele ich an den Schnürsenkeln herum. »Mach immer zwei Knoten hinein, Junge, dann kommst du nie in die Verlegenheit, in offenen Schuhen herumzulaufen.« Der erste poltert zu Boden. Nonna hatte wirklich für jede Lage den passenden Rat in petto. Ich erstarre mitten in der Bewegung.
Mir wird eiskalt.
Ich stiere von meinen Händen, die soeben den zweiten Doppelknoten aufgedröselt haben, zu den ungeduldig wippenden Beamtenbeinen … und wieder auf meine Füße. In dem linken Strumpf prangt ein Loch am großen Zeh.
Heilige Scheiße!
Mein Aktenkoffer ist längst am Ende des Transportbands angekommen. Ein weiterer Uniformierter kommt auf mich zu, ein amtlich aussehendes Papier in den Händen.
»Herr Camini? Sie führen Sondergepäck mit?«
Nonna!
Ich springe auf und drücke dem verblüfften Mann meine Schuhe in die Hände. »Bin sofort zurück.«
Dann spurte ich auf Socken an der Passkontrolle vorbei und schlittere unter erstaunten Blicken und Gelächter aus der Abfertigungshalle.
Zwei
HANNA
Zum ersten Mal in meiner zweijährigen Redaktionszugehörigkeit nehme ich die Treppe. Oben angekommen, weiß ich wieder genau, weshalb ich bis dato den Aufzug bevorzugt habe: Es sind exakt einhundertzwölf Stufen. Japsend stehe ich vor unserer Ressorttür und bin definitiv nicht in der Lage, die Klinke herunterzudrücken. Sasha kommt hinter mir die Treppe hochgehopst, einen Stapel Magazine unter dem Arm. Sie pfeift vor sich hin und ist nicht mal im Ansatz außer Puste. Ich überlege krampfhaft, vor wie vielen Jahren es mir auch so gegangen ist.
»Alles okay, Chefin?«
Ehrlicherweise erinnere ich mich überhaupt nicht daran, jemals eine Treppe dieser Größenordnung hochgehopst zu sein. Schon gar nicht pfeifend.
»Nimm mir die Tasche ab«, keuche ich und stütze mich an der Wand ab. »Ich bin gleich so weit.«
Sasha schultert ungerührt meine Henkeltasche und drückt die Glastür mit dem Ellbogen auf. »War dein Date mit dem Meister so anstrengend?«
Ich hole pfeifend Luft. »Nicht im Mindesten«, antworte ich grimmig, ignoriere Sashas spöttische Miene und stolziere mit erhobenem Kinn an ihr vorbei. Claire erwische ich in flagranti in der Belegschaftsküche. Mit meinem Nutella-Glas im Schoß.
»Das macht dick, Madame Durant.«
»Vor allem macht es gute Laune.« Ungerührt steckt sie den Löffel in ihren Puppenmund und dreht das Glas zu. »So wie du aussiehst, könntest du auch ein oder zwei Löffelchen davon gut brauchen.«
»Wir haben ein Problem.« Ich sinke auf den einzigen Küchenstuhl, der nicht von Jacken und Taschen belegt ist.
Keine Ahnung, wer wann damit angefangen hat, aus dem gemütlichen Gemeinschaftsraum eine Kleiderkammer zu machen. Mittlerweile stapeln sich sogar diverse Schuhkartons unter der Eckbank, woran unsere Praktikantin sicher nicht ganz unschuldig ist.
»Haben wir oder hast du das Problem?« Sasha schiebt sich an Claire vorbei und stellt meine Tasche auf den Tisch, auf dem sich leere Imbissboxen vom Thailänder stapeln. »Was schleppst du bloß alles mit dir rum? Die wiegt ja mindestens fünf Kilo.«
»Schick die hässliche Vase bitte zum Flughafenrestaurant zurück«, seufze ich und drehe mich zu Claire um, die mich abwartend anschaut. Meine Augen brennen. »Ich glaube, diesmal bin ich in ein richtig böses Fettnäpfchen getreten.«
Die Französin runzelt die Stirn. »Was ist ein Fettnäpfchen?«
»Sie meint, dass sie Mist gebaut hat.« Sasha rückt interessiert näher.
Ich öffne den Mund, aber der Satz bleibt in meiner Luftröhre stecken.
Claire setzt sich neben mich und greift nach meiner Hand. »Was ist passiert?«
»Der Artikel über das Tre Camini … Findest du ihn gemein?«
Ängstlich warte ich auf ihre Reaktion. Claire und Sasha schauen sich an.
»Nett ist er nicht gerade«, antwortet Claire behutsam. »Aber das sind deine Artikel selten, n’est-ce pas?«
»So schlimm?«, frage ich kleinlaut.
»Also, ich find ihn witzig. Vor allem die Tiefkühlgemüseleichen in Fertigbrühe. Oder die Spinatmatsche auf rohen Spaghetti.« Sasha grinst und zieht sofort den Kopf ein, als mein tadelnder Blick sie trifft.
»Geht es wieder um ein Schreiben von irgendeinem Anwalt?« Claire bleibt sachlich, wofür ich ihr wirklich dankbar bin.
»Der Besitzer der Trattoria ist der Überzeugung, mein Artikel sei am Herzinfarkt seiner Großmutter schuld.« Erneut das Ziehen in der Brust.
»Auweia, das is’n Ding!«
Dafür kassiert Sasha einen erhobenen Zeigefinger von Claire, woraufhin meine Praktikantin sich geschäftig meiner Tasche zuwendet. Ich rede rasch weiter, ehe ich in Tränen ausbreche. Ich kann mich nicht erinnern, jemals derart die Fassung verloren zu haben. Und das ausgerechnet in der Redaktion.
»Jetzt besteht dieser Camini darauf, dass ich gefeuert werde.«
»Das ist nicht schön.«
»Und die Kohle für seine Schadensersatzforderung kriege ich erst in zehn Jahren zusammengeschrieben, wenn überhaupt. Ich bin so was von geliefert.« Mit Todesverachtung schraube ich das Nutella-Glas auf. Treppe hin oder her, ich brauche Zucker. Viel Zucker.
»Wir finden schon eine Lösung.« Claire schielt zu unserer Volontärin hinüber, die gerade die gestreifte Blumenvase auf den Tisch stellt.
»Das bezweifle ich.«
»Hanna …« Sasha ist auch ganz bleich geworden.
Niedlich, dass sogar sie sich Sorgen um mich macht. Dabei bin ich manchmal wirklich eine grausame Vorgesetzte. Ich schnuppere an dem Nutella-Glas.
»Gibst du mir mal deinen Löffel rüber?« Sagt schließlich keiner, dass ich heute damit anfangen muss, meine Kondition zu verbessern.
»Hanna!«
»Was? Wenn Claire trotz pfundweise Nutella so dünn bleibt, kann ich ja wohl einen kleinen Löffel davon essen.«
»Das Ding da. Das ist keine Vase.« Sashas Stimme zittert.
»Was redest du da, Mädchen?« O Gott, dieses Schokoladenzeug schmeckt fantastisch!
»Ich fürchte, dir wird die Antwort nicht besonders gefallen.« Sasha scheint sich jeden Moment übergeben zu müssen, dabei ist sie doch sonst nicht so leicht zu erschüttern. Ob irgendwas Ekliges an der Vase klebt? Claire macht Anstalten, sie zu berühren, zuckt jedoch mit weit aufgerissenen Augen zurück.
»Mon Dieu!«, flüstert sie.
»Mädels, was ist denn los mit euch? Das ist doch nur …«
»Eine Urne«, murmelt Sasha mit Grabesstimme. »Mein Opa hat auch so eine bekommen. Die war nur nicht so bunt.«
Plötzlich ist es totenstill in dem kleinen Raum. Und mir ist jetzt definitiv nicht mehr nach Schokolade.
Seit ungefähr einer Viertelstunde stehen wir reglos um den Esstisch herum und starren das Porzellangefäß an, als handele es sich um einen gestreiften Kugelfisch.
»Bist du sicher, dass du dich nicht irrst?«, raune ich.
»Kannst gerne nachgucken«, wispert Sasha zurück. »Ich mach’s jedenfalls nicht.«
»Wie sollte eine Urne in ein Flughafenrestaurant geraten? Das ist doch total haarsträubend. Und wieso flüstern wir überhaupt?«
»Das hat etwas mit piété zu tun«, haucht Claire und putzt ihre Brille.
Immerhin spricht sie wieder und scheint demnach keinen größeren Schock davongetragen zu haben. Was man von mir nicht behaupten kann. Ich habe einen Leichnam gestohlen. O mein Gott.
»Genau, Pietät.« Sasha schnieft.
Die Französin bläht die Nasenflügel, ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie eine Story wittert.
»Vielleicht hat jemand sie in dem Restaurant vergessen.«
»Ich glaube es einfach nicht.« Meine Hand schnellt vor.
»Neiiin!«, brüllen die beiden im Chor, ich zucke zurück.
»Was denn? Ich muss doch wenigstens nachsehen, ob ihr recht habt!«
Claire fasst sich schließlich ein Herz und hebt die Urne vorsichtig in die Höhe. Schmaläugig begutachtet sie das Gefäß von allen Seiten, befingert die Korkversiegelung und dreht die Urne kurzerhand auf den Kopf. »Da ist eine Metallplakette.«
»Steht was drauf?« Sasha reckt das Kinn, ohne ihren Sicherheitsabstand aufzugeben.
»Ouuu!«
»Was ist?« Diesmal Sasha und ich synchron.
Merkwürdigerweise scheint Claire unentschlossen, ob sie weinen oder lachen soll. »Quelque chose ne tourne pas rond«, murmelt sie und setzt noch eine weitere Floskel hinzu, die ich nicht übersetzen kann.
»Was geht nicht mit rechten Dingen zu?«
Behutsam stellt Claire die Urne auf den Tisch zurück und hebt den Kopf. Ihr Blick ruht halb mitleidig und halb belustigt auf mir. »Ich fürchte, diesmal kommst du mit dieser Souvenirsache nicht auf dem Postweg davon.«
Trotzig schiebe ich das Kinn vor. »Was meinst du damit?«
»Sieh selber nach.«
Ich habe noch nie einen Toten berührt. Gut, eigentlich ist es kein Toter, sondern nur seine Asche, und die ist in diesem Porzellanding, aber …
»Sie wird dich nicht beißen.« Claires Himmelfahrtsnase zuckt.
Eine Frau also. Atmen, Hanna! Atmen! Die Urne fühlt sich gar nicht wie eine Urne an. Sie ist glatt und kühl und könnte ein Milchkrug sein. Ich lese die Gravur. Einmal. Dann ein zweites Mal. Giuseppa Camini, 1932-2014. Tre Camini, Toskana.
Es dauert ein paar Sekunden, bis es in meinem Kopf klick macht. »Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding hier nicht das ist, was ich denke?«, frage ich ruhig.
Claire hebt die Hand. Zwischen ihren Daumen und ihren Zeigefinger passt maximal ein Bleistift. Ich nicke langsam.
»Ich habe also mit meinem Artikel nicht nur eine italienische Großmutter umgebracht, sondern auch noch ihre Urne gestohlen.«
»Nun ja … in Frankreich sagen wir Schicksal dazu.«
FABRIZIO
»Was hast du dir bloß dabei gedacht, Carlo?«
Seit ungefähr einer halben Stunde gehe ich wütend in der Küche umher, während Rosa-Maria den Teig knetet, als hinge ihr Leben davon ab. Um ehrlich zu sein, ist Wut seit meiner Ankunft hier im Tre Camini das einzige Gefühl, das ich empfinden kann. Daran ändern Rosas ofenwarme panini nicht das Geringste. Carlo knabbert ungerührt an seinem Zahnstocher.
»Eh, Fabrizio, setz dich und nimm dir ein Glas Wein. Deine schlechte Laune ist ja kaum auszuhalten.« Mein Freund schüttelt den Kopf. Sein Zahnlückengrinsen treibt mich zur Weißglut.
»Wie konntest du nur zulassen, dass dieser cretino in meiner Küche kocht, Rosa-Maria?« Anklagend zeige ich mit dem Finger auf Carlos fleckiges T-Shirt, über das sich der Schriftzug unserer Nationalmannschaft spannt: gli Azzurri.
Rosa-Maria sinkt in sich zusammen, sodass sie noch quadratischer wirkt. Ihr Gesicht läuft tomatenrot an, der Teig blubbert kraftlos, als sie sich erneut in die Schüssel stemmt. Unter normalen Umständen hätte ich ein schlechtes Gewissen, denn Rosa-Maria ist wie eine Mutter für mich. Aber in den letzten Tagen ist nichts mehr normal.
In meinen Ohren klingt noch immer Lucias verzweifeltes Schluchzen, als ich erzählen musste, was in Berlin passiert ist. Mit Marcos missbilligendem Blick hatte ich gerechnet, doch er hütete sich klugerweise, eine dämliche Bemerkung loszulassen. Unser Gutsverwalter Alberto ist seit gestern verschwunden. Er war nie ein Mann der großen Worte, was wohl hauptsächlich daran liegt, dass er die meiste Zeit des Tages auf den Feldern oder bei den Tieren verbringt. Wahrscheinlich macht er seine Trauer mit den Hühnern aus.
»Carlo sagte, er hätte deine Erlaubnis.« Rosa-Maria wirft ihm einen wütenden Blick zu.
»Ich finde, wir sollten das nicht vor einer Angestellten besprechen«, sagt mein Freund hochmütig. »Du weißt, dass ich als Arm des Gesetzes bei allen Bürgern bella figura machen muss.«
»Ich scheiß auf deine bella figura! Und Rosa-Maria ist keine Angestellte, sie gehört zur Familie. Wieso also war die Trattoria geöffnet, obwohl wir etwas anderes vereinbart hatten?« Wieder richte ich das Wort an Rosa-Maria, die von einem heftigen Niesanfall geschüttelt wird.
»Sie kann nichts dafür, ehrlich.« Carlo schielt begierig auf die frischen Thymianbrötchen. Aus purer Gehässigkeit schiebe ich den Brotkorb außerhalb seiner Reichweite, bis er »War meine Idee« murmelt. Ich rücke den Korb noch ein wenig weiter von ihm weg. »Die arme Rosa-Maria war krank. Hat gehustet wie der alte Fiat, den ich letztes Jahr verschrotten musste. Da dachte ich: Carlo, warum tust du deinem guten Freund Fabrizio nicht einen Gefallen? Ein geschlossenes Restaurant ist kein gutes Restaurant, eh? Nichts gegen deine Kochkünste, Rosa-Maria, aber das bisschen Pasta mache ich mit verbundenen Augen. War sowieso nur ein Gast da, und der hat der kleinen Alba ordentlich Trinkgeld gegeben.«
Rosa-Marias Gesichtsfarbe wird noch eine Nuance dunkler, sie räuspert sich mehrmals und leckt über ihre behaarte Oberlippe, doch ihr stummer Hilferuf prallt ungehört an der Selbstgefälligkeit unseres Dorfpolizisten ab.
»Du hast das Zimmermädchen in den Service gelassen? Wo zum Teufel war Lucia? Wie viel hat Alba denn bekommen?«, frage ich misstrauisch, denn ein hohes Trinkgeld bedeutet hierzulande kein Kompliment für die Küche. Carlo hebt triumphierend zwei Finger in die Höhe.
»Zwanzig Euro?«
»Ich sag’s doch. War gut.«
Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich daran, Carlo das Magazin, das ich seit achtundvierzig Stunden in meiner Jackeninnentasche herumtrage, um die Ohren zu klatschen. Es bleibt bei der befriedigenden Vorstellung. Dieses Haus braucht weiß Gott nicht noch einen Aufreger in seinen Wänden.
»Ist dir klar, dass das Tre Camini einen Ruf zu verlieren hat? Wir können uns keine Pfuschereien in der Küche erlauben, sonst bleiben uns irgendwann die Touristen weg.«
Sein schwarzer Schnauzbart zuckt, ein untrügliches Zeichen von Unsicherheit. Was er natürlich nie zugeben würde. Einen Carlo Fescale erwischt man mit dem Finger im Honigglas, und er behauptet trotzdem noch, er sei es nicht gewesen. Dieser Kerl ist schon ohne Gewissen zur Welt gekommen – keine Ahnung, ob er deshalb so gut zum Ordnungshüter taugt.
»Ich mag diese ausländischen Touristen sowieso nicht. Wissen nicht mal, was al dente bedeutet. Kann ich ein Thymianbrötchen haben?«
»Du bist unverbesserlich.«
»Hab’s nur gut gemeint. Und jetzt gib mir ein panino und erzähl, was dich wirklich bedrückt«, brummt Carlo und streckt seine Pranken nach dem Brotkorb aus.