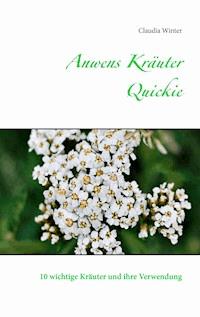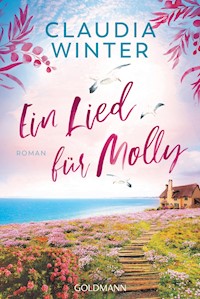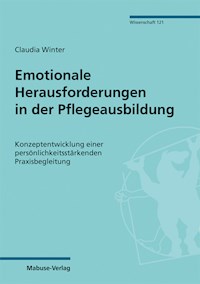9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karriere, Heirat, Kinder. Die Anwältin Josefine weiß genau, was sie vom Leben erwartet. Doch kurz vor der Hochzeit brennt Josefines Cousine mit einem Straßenmusiker nach Schottland durch, den legendären Familienring im Gepäck, den die Braut bei der Trauung tragen sollte. Als ihre abergläubische Großmutter daraufhin der Ehe ihren Segen verweigert, bleibt Josefine keine Wahl: Wutentbrannt reist sie dem schwarzen Schaf der Familie hinterher und gerät in den verregneten Highlands von einem Schlamassel in das nächste. Nicht nur einmal muss der charismatische Konditor Aidan der Braut in spe aus der Patsche helfen – dabei ist dieser Charmeur der Letzte, vor dem sie sich eine Blöße geben möchte. Aber der Zauber Schottlands lässt niemanden unberührt, und schon bald passieren seltsame Dinge mit Josefine, die so gar nicht in ihren Lebensplan passen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Karriere, Heirat, Kinder. Die Anwältin Josefine weiß genau, was sie vom Leben erwartet. Doch kurz vor der Hochzeit brennt Josefines Cousine mit einem Straßenmusiker nach Schottland durch, den legendären Familienring im Gepäck, den die Braut bei der Trauung tragen sollte. Als ihre abergläubische Großmutter daraufhin der Ehe ihren Segen verweigert, bleibt Josefine keine Wahl: Wutentbrannt reist sie dem schwarzen Schaf der Familie hinterher und gerät in den verregneten Highlands von einem Schlamassel in das nächste. Nicht nur einmal muss der charismatische Konditor Aidan der Braut in spe aus der Patsche helfen – dabei ist dieser Charmeur der Letzte, vor dem sie sich eine Blöße geben möchte. Aber der Zauber Schottlands lässt niemanden unberührt, und schon bald passieren seltsame Dinge mit Josefine, die so gar nicht in ihren Lebensplan passen …
Weitere Informationen zu Claudia Winter sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
CLAUDIA WINTER
Glückssterne
Roman
»Über alles hat der Mensch Gewalt.Nur nicht über sein Herz.«
Friedrich Hebbel
Prolog
Frankfurt im September 1952
Sie fürchtete sich überhaupt nicht. Kein bisschen. Gut, vielleicht ein wenig. In dem Wandschrank war es nämlich so dunkel, dass sie nicht mal ihre Hände sah. Außerdem roch es komisch, nach altem Holz, Staub und Mottenkugeln. Sie zog die Beine an die Brust, legte das Kinn auf die Knie und schämte sich, weil sie nicht anders konnte, als sich klitzeklein zu machen. Das Mädchen Lucy aus ihrem Lieblingsbuch war viel mutiger als sie – und auch nicht so dumm gewesen, die Schranktür zu schließen. Aber Lucy war nur eine ausgedachte Person, wie Mama behauptete. Der Zauberschrank, durch den man in das verwunschene Land Narnia gelangte, war ebenfalls eine Erfindung, genauso wie der Mann mit den Ziegenbeinen und der sprechende Löwe Aslan.
Lassen konnte sie es dennoch nicht. Vorsichtig streckte sie die Hand aus. Sie strich über weichen Stoff – Mamas Kleider, die sie nicht mehr trug, seit das Baby bei den Engeln wohnte – und tastete sich zwischen klappernden Drahtbügeln hindurch. Wenn sie nur fest genug daran glaubte …
Enttäuscht atmete sie aus, als sie an die Rückwand des Schranks stieß. Da war kein geheimer Ausgang. Nur eine raue Holzfläche, die auch nicht nachgab, als sie behutsam dagegendrückte. Es war eben nur ein ganz normaler Schrank, so wie sie ein ganz normales Mädchen war, das leider viel zu viel Fantasie besaß, wie Mama immer behauptete.
Erschrocken fuhr sie hoch, als die Schranktür aufgerissen wurde und eine kleine Gestalt zu ihr hineinschlüpfte. Diesmal blieb die Tür angelehnt, und in dem fahlen Lichtstrahl, der sich nun durch den Spalt in das Innere ihres Verstecks zwängte, tanzten Staubkörner.
»Li! Ich hab’s«, ertönte die aufgeregte Stimme ihrer Schwester.
Ihr Bauch krampfte sich zusammen. Bis zuletzt hatte sie gehofft, dass die Idee nur ein Spaß war. Sie hätte es wissen müssen. Bri machte nie einfach bloß Spaß.
»Hast du etwa Angst?«
Das Gesicht mit den Puppenlippen und den riesigen Murmelaugen verzog sich abschätzig. Bri saß ihr gegenüber, in der gleichen Haltung wie sie selbst, den Rücken an die Schrankwand gelehnt, die Arme um die Knie geschlungen. Das war der Grund, weshalb jeder sofort wusste, dass sie Zwillinge waren, obwohl sie einander überhaupt nicht ähnlich sahen. Im Gegenteil, es war eher so, als hätte der liebe Gott sich einen Scherz erlaubt und aus demselben Lehmklumpen zwei möglichst unterschiedliche Figuren geknetet. Leider war Bri ihm eindeutig besser gelungen, was Li ihm manchmal übel nahm.
»N–nein. Natürlich habe ich keine Angst.«
Sie biss die Zähne zusammen und kniff die Augen zu. Schwitzige Finger umfassten ihren Unterarm, dann drückte etwas Hartes, Kaltes gegen ihre Haut.
»Du musst die Augen schon aufmachen, damit du siehst, wo du schneidest.«
Li blinzelte. Sie konnte weglaufen, die Schranktür war offen. Was sie letztlich nicht tun würde. So war es immer.
»Mach du lieber zuerst«, wisperte sie, bemüht, sich ihre Panik nicht anmerken zu lassen.
»Hab ich längst, du Hasenfuß. Mach hin, bevor ich den ganzen Schrank vollblute.«
Bri lachte auf diese Art, die Li sagen sollte, dass sie ein dummes, kleines Ding war. Dabei war sie sogar ganze zwanzig Minuten älter als Bri, die sich schon bei der Geburt geziert hatte, das zu tun, was von ihr erwartet wurde.
Ihre Hand umkrampfte den Messergriff. Ob sie bis zehn zählen und dabei ganz langsam drücken sollte? Oder lieber schnell? Würde sie ohnmächtig werden, wenn sie zu viel Blut verlor? Es würde bestimmt schrecklich weh … »Aua!«
»Na also. Gib mir deinen Finger. Press ihn ganz fest gegen meinen. So ist es gut. Und nun«, Bri machte eine feierliche Pause, »schwör.«
»Bri, ich blute.«
»Das ist doch der Sinn der Sache. Los, schwör.«
»Aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen muss.«
»Mensch, Li«, schimpfte Bri, »du hast den Text seit gestern auswendig gelernt.«
Jetzt kullerten tatsächlich Tränen über ihre Wangen. Sie schämte sich, weil sie nicht mal ein paar Zeilen behalten konnte. Sie heulte, weil sie Hunger hatte und in diesem doofen Wandschrank hockte. Weil sie blutete. Und weil sie nie Nein sagte, wenn Bri wieder mit irgendwelchen blöden Ideen ankam.
»Nun wein doch nicht.« Bris Stimme war nun ganz sanft.
Li schluckte und schniefte, auch wenn Mama ihnen verboten hatte, die Nase hochzuziehen, weil man davon einen Gehirnschlag bekam. Wie Onkel Walter, der …
»Ich sage es zuerst. Ich, Brigitte Markwitz, schwöre bei allem, was mir lieb und teuer ist …« Li öffnete den Mund, um zu fragen, was damit gemeint war, doch Bri hob den Finger und fuhr unbeirrt fort: »… dass ich meine Schwester Lieselotte niemals verlassen werde.«
»Ich, Lieselotte Markwitz, schwöre bei allem, was mir lieb und teuer ist, dass ich meine Schwester Brigitte niemals verlassen werde«, wiederholte Li artig.
Bri lächelte. Sie konnte lächeln wie ein Engel, weshalb ihr die wenigsten Leute etwas abschlagen mochten. Li eingeschlossen.
»Der Schwur gilt für dieses und alle folgenden Leben.«
»Was denn für folgende Leben?« Li schluckte. So sehr sie ihre Schwester mochte, manchmal war sie ihr ein bisschen unheimlich. Trotzdem fügte sie sich.
»Und ich werde tot umfallen, wenn ich ihn breche.«
»Ich werde auf der Stelle tot umfallen, wenn ich ihn breche«, beeilte sich Li zu wiederholen, auch wenn sie sich dabei ein wenig gruselte. Tot umzufallen war keine schöne Sache.
»Außerdem finden wir zwei Prinzen. Hübsche Prinzen, die auch Brüder sind. Wir werden alle vier zusammen vor den Altar treten … oder niemals heiraten.«
Li riss die Augen auf. Ihr Mund hatte einfach weitergeplappert, obwohl diese Worte gar nicht auf dem zerknitterten Blatt standen, das Bri ihr gestern in die Hand gedrückt hatte. Was war nur in sie gefahren?
Doch die Schelte blieb aus. Stattdessen schaute Bri sie zuerst erstaunt und dann mit diesem Ausdruck an, der eigentlich ihrer großen Schwester Adele vorbehalten war.
»Wir werden alle vier zusammen vor den Altar treten«, sagte ihre Zwillingsschwester ernst und drückte ihre Hand.
Lis Herz machte einen freudigen Hüpfer. Auf einmal war es ihr sogar egal, dass Bri ihre Hand ein bisschen zu fest hielt – die mit dem blutenden Finger, der längst nicht mehr blutete, dafür aber ganz schön wehtat. In jenem Augenblick war sie das glücklichste Mädchen der Welt. Ach was, aller Welten in all den Büchern, die fein säuberlich auf dem Regal über dem Kopfende ihres Bettes standen.
Von heute an musste sie sich hier, in diesem fremden Haus, das dem neuen Mann von Mama gehörte und nun auch ihr Zuhause sein sollte, nie wieder verloren fühlen. Sie hatte ja Bri. Für immer.
Eins
Frankfurt im April 2016
»Er ist weg!«
Ich schloss die Augen. Das war unmöglich. Nein, das konnte … durfte nicht sein. »Was soll das heißen, er ist weg?«, erwiderte ich beherrscht und hoffte, dass ich mir den panischen Unterton in der Stimme meiner Mutter nur eingebildet hatte.
»Wenn ich es dir doch sage. Weg! Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Vor ein paar Monaten habe ich ihn aus dem Bankschließfach geholt und in den Safe gelegt. Und als ich heute früh nachsehen wollte …«
Sie fuchtelte mit ihrem Pinsel herum, als wollte sie das Unaussprechliche in die Luft malen. Gerade rechtzeitig trat ich einen Schritt zurück, und der rostrote Farbspritzer landete auf dem viktorianischen Lampenschirm. Mama bemerkte es gar nicht, sondern begann in dem Atelier, das vor Jahren einmal unser Wintergarten gewesen war, auf und ab zu gehen. Ich atmete durch, lange ein und in drei kurzen Stößen aus, wie ich es normalerweise vor einem schwierigen Mandantengespräch tat. Doch das hier war kein Mandantengespräch. Es war mein persönlicher Weltuntergang.
»Mama, könntest du bitte ein bisschen genauer werden? Der Ring kann doch nicht einfach mir nichts, dir nichts verschwinden, wenn du ihn in den Safe eingeschlossen hast.«
Meine Mutter blieb abrupt stehen. Ihr rundes Gesicht mit den Farbklecksen auf der Stirn verzog sich. »Du glaubst mir nicht.«
Ich holte Luft für eine scharfe Entgegnung, überlegte es mir aber anders und steuerte mit wackeligen Knien den Safe im Wohnzimmer an.
»Eins, sechs, null, drei, acht, sechs«, sagte Mama hinter mir.
Meine Hände verharrten auf dem Zahlendisplay. »Du hast meinen Geburtstag als Code eingegeben?«
»Wieso? Du weißt doch, dass ich mir Zahlen so schlecht merken kann«, verteidigte sie sich.
»Da hättest du ihn ebenso gut offen lassen können.«
Ich biss mir auf die Lippe, während ich die Zahlen eintippte. Mit einem eleganten Summton leuchtete das Freigabelicht auf. Ein kurzer Blick genügte für die niederschmetternde Gewissheit. Bis auf ein paar Papiere und einen Aktenordner war der Safe tatsächlich leer. Kein königsblaues Samtkästchen mit abgeriebenen Ecken, das mindestens so kostbar war wie sein Inhalt.
»Es tut mir leid, Josefine«, sagte Mama leise.
Ich hätte zu ihr gehen und sie trösten sollen. Stattdessen trat ich an das bodentiefe Fenster und sah in den Garten hinaus, wo mein Vater Setzlinge in ein Beet pflanzte. Normalerweise hätte es mich amüsiert, dass er einen Zollstock und Mamas Rouladenschnur benutzte, um die Pflänzchen in einer exakten Reihe einzusetzen. Mir war nur nicht nach Lachen zumute.
»Hast du Papa gefragt, ob er ihn rausgenommen hat?«, murmelte ich, eine rhetorische Frage, die meine Mutter wie erwartet mit einem Schnauben beantwortete.
Mein Vater interessierte sich für Heckenrosen, Möhren und seinen selbst gebauten Komposter. Wahrscheinlich wusste er nicht einmal mehr, dass dieser Ring überhaupt existierte, geschweige denn, welche Bedeutung er für die Familie meiner Mutter besaß. Und für mich.
»Gibt es irgendwelche Einbruchspuren? Hast du die Polizei gerufen?«
»Natürlich nicht!« Vor Schreck ließ Mama den Pinsel fallen. Mirabelle, die sich gerade unter der Couch hervorgetraut hatte, huschte mit einem ängstlichen Jaulen hinter die Nussbaumanrichte. Ich sah der Whippethündin stirnrunzelnd hinterher. Unser hübsches Einfamilienhaus im Bad Homburger Hardtwald hatte schon vielen Windhunden in Not Asyl gewährt, nicht gerade zur Freude der hochwohlgeborenen Nachbarschaft. Dieses Exemplar schlug in puncto Verhaltensauffälligkeit jedoch alles, was ich je erlebt hatte.
»Es ist gar nicht mehr so schlimm mit ihr«, erklärte meine Mutter, die meinem Blick gefolgt war. »Mittlerweile lässt sie sich sogar streicheln. Sie frisst, zwar nur Hühnchen und Kartoffelbrei, aber …«
»Mama, warum hast du den Diebstahl nicht angezeigt?«
Mit verschränkten Armen drehte ich mich zu ihr um. Sie schaute mich eine Weile stumm an und sank schließlich auf die Couch. Mirabelle schlich heran und ließ sich zu ihren Füßen nieder, die gesprenkelten Fledermausohren wie ein Radarschirm auf alles ausgerichtet, das ihr schaden könnte.
»Deine Großmutter wird außer sich sein wegen dieses albernen Stück Metalls«, murmelte Mama und strich gedankenverloren über das zitternde Fellbündel.
»Dieses alberne Stück Metall ist ein Vermögen wert! Vor allem wird es mich meine Ehe kosten.«
»Aber Josefine, das ist doch nur ein dummer Aberglaube. Niemand in unserer Familie denkt heute noch, dass dieser Ring irgendein Unglück heraufbeschwören könnte.«
»Großmutter glaubt nach wie vor daran. Wenn sie erfährt, dass ich ihn bei der Trauung nicht tragen werde, kann ich die Hochzeit vergessen.« Ich schluckte heftig, doch der Kloß in meiner Kehle blieb da, wo er war.
»Sie muss es ja nicht erfahren.« Mama rang sichtlich nach Worten. »Wir nehmen einfach einen anderen, ähnlichen Ring anstelle des richtigen …« Jetzt schaute sie wie ein waidwundes Reh, dabei passte dieser Blick überhaupt nicht zu ihr. »Gut, vergiss, was ich gesagt habe. Lass uns lieber noch mal überall nachsehen, bevor wir es deiner Großmutter beichten.«
Sie erhob sich und ging zu der Anrichte neben dem Kamin, begleitet von einem kleinen, gekrümmten Schatten, der sich an ihre Waden drückte.
Immer wieder erstaunlich, was die Aussicht auf den Zorn meiner Großmutter mit den Mitgliedern meiner Familie anstellte. Da bildete ich keine Ausnahme. Mit grimmiger Entschlossenheit hob ich die Tischplatte des Sekretärs zu meiner Linken an.
Etliche durchwühlte Schubladen, Schranktüren und zwei aufgeschraubte Abflussrohre später war ich ergebnislos in die Kanzlei in der Frankfurter Innenstadt zurückgekehrt. Nach einem nachdenklichen Blick auf meine Hochzeitsliste lehnte ich mich in meinem Bürostuhl zurück und sah aus dem Panoramafenster. Ein atemberaubendes Blau, durchzogen von Zuckerfadenwolken, spannte sich über die Skyline. Normalerweise gab mir allein der Anblick der futuristischen Wolkenkratzer ein unendliches Gefühl der Befriedigung. Heute empfand ich jedoch gar nichts, stattdessen zog sich mein Magen zusammen, als ob ich etwas Verdorbenes gegessen hätte. Das Ganze kam mir wie ein Albtraum vor.
Neun Jahre hatte ich auf den berühmten Kniefall gewartet, der Schriftsteller und Filmregisseure aus aller Welt zu den schönsten Liebesszenen inspiriert hat. Wobei das nur bildlich gemeint war. Mir war von vorneherein klar gewesen, dass Justus’ Antrag nicht so romantisch ausfallen würde, wie ich es mir als kleines Mädchen erträumt hatte.
Ehrlich gesagt hatte es gar keinen Kniefall gegeben.
Mein Verlobter war … Nun ja, er war eben mehr ein Mann der mittleren Temperaturen und eher zurückhaltend, was Gefühlsdinge anbetraf. Dafür war er treu, charakterfest und zuverlässig – besonders Letzteres schätzte ich sehr an ihm.
Plakatgroße Liebeserklärungen an Wolkenkratzern und Raketenherzen am Nachthimmel wurden ohnehin maßlos überhöht. Ich hatte mich wirklich gefreut, als ich vor zwei Monaten kurz nach Feierabend in meiner Unterschriftenmappe ein taubenblaues Post-it mit einem aufgeklebten Verlobungsring fand. »Zum nächsten Quartal werde ich Juniorpartner. Heirate mich!«, stand da in Justus’ krakeliger Kleine-Jungen-Schrift, die nicht mal seine Assistentin entziffern konnte, weshalb er sogar einzeilige Memos diktierte. Diesen Zettel jedoch hatte er selbst geschrieben, und Taubenblau war meine Lieblingsfarbe. Es war so …
»Erniedrigend.«
Ich zuckte zusammen, als meine Bürotür aufgerissen wurde. An Flucht war nicht mehr zu denken, denn die korpulente Frau durchquerte bereits mit großen Schritten den Raum und baute sich vor meinem Schreibtisch auf.
»Frau Ziegelow. Wie schön, Sie zu sehen«, log ich nonchalant und schob geistesgegenwärtig die Hochzeitsliste unter eine Akte.
»Ich habe es satt, Frau Sonnenthal!«
Mit einem Schluchzer, der ein bisschen wie der Wehlaut eines Kätzchens klang, ließ meine Mandantin ihren Rubenskörper in den Besucherstuhl fallen und fächerte sich mit einem amtlich aussehenden Schrieb Luft zu. Automatisch schob ich ihr die Kleenex-Packung hinüber, die wie jeden Dienstag auf ihren Einsatz wartete. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob Frau Ziegelow das Ganze hier mit einer Therapiesitzung verwechselte.
Geduldig wartete ich, bis sie sich die Augen abgetupft und kräftig geschnäuzt hatte, ehe ich auf das zerknitterte Papier in ihrer Hand deutete. »Darf ich?«
Mit angewidertem Gesichtsausdruck ließ Frau Ziegelow das Dokument auf den Schreibtisch fallen. Beim Anblick des Briefkopfes, der über ein Drittel des Bogens einnahm, schlug mein Herz schneller. Melwin & Cie. Obwohl die Scheidungsakte längst geschlossen war, scheute der Exmann meiner Mandantin keine Kosten, um ihr das Leben schwer zu machen. Ich las den Betreff und spürte, wie das Therapeutenlächeln auf meinen Lippen gefror.
»Das ist eine einstweilige Verfügung.«
Frau Ziegelow rupfte ein weiteres Kosmetiktuch aus der Box. »Egal wie man es nennt, es ist nicht rechtens. Ich bin befugt, Werbung für meinen Salon zu machen.«
»Auf dem Firmenwagen Ihres Mannes?«
Sie schürzte die kirschroten Lippen.
»Da steht, Sie hätten drei Werbebanner für Ihren Friseursalon auf dem Audi angebracht und dabei das Salonlogo Ihres Exmannes überklebt. Das fällt unter den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs.« Ich schaute streng über den Rand meiner Brille. So ernst der Vorfall nach juristischem Verständnis sein mochte – die Vorstellung, wie meine Mandantin ihre hundertzwanzig Kilo Lebendgewicht im Mondlicht über Gartenzäune schwang und mit einer Rolle Klebeband über den Audi TT ihres Exmannes herfiel, entbehrte nicht einer gewissen Komik.
»Genau genommen ist es mein Auto, weshalb ich damit machen kann, was ich will«, antwortete sie rebellisch.
»Wir haben uns gerichtlich darauf geeinigt, dass er den Audi behält und Sie das Cabrio«, erinnerte ich sie sanft. »Das betrifft auch die Eigentumsverhältnisse an allen anderen Vermögenswerten, die wir in dem Versorgungsausgleichsverfahren geklärt haben. Sie haben die beiden Penthouse-Wohnungen in der Innenstadt bekommen, er das Haus in Sachsenhausen. Sie den Salon Tausendschön, er das Cuts & Curls. Ihr Exmann könnte Sie im schlimmsten Fall nicht nur wegen Geschäftsschädigung belangen, sondern auch wegen Sachbeschädigung.« Kopfschüttelnd tippte ich auf den Brief. »Laut dieser Verfügung dürfen Sie sich dem Friseursalon Ihres Mannes bis auf hundert Meter nicht mehr nähern. Wenn ich überlege, was Sie in den letzten Monaten noch so alles angestellt haben, kommen Sie damit noch glimpflich davon.«
»Ach, die paar Zettelchen an seinem vorsintflutlich dekorierten Schaufenster!«
»Die paar Zettelchen waren eine Plakatwand, noch dazu mit Spezialkleister angebracht.«
»Und wenn schon.« Erbost klimperte meine Mandantin mit ihren Armreifen. »Das bisschen Marketingunterstützung ist er mir schuldig, dafür dass er mir schon die zweite Mitarbeiterin abgeworben hat, die jetzt wahrscheinlich das Bett von diesem alten Lüstling wärmt. Mein Boxspringbett übrigens, auch wenn es laut Versorgungsdings inzwischen seins ist.«
Ich sah sie schweigend an. Aus unerfindlichen Gründen mochte ich diese Frau, die ihre große Liebe nicht loslassen wollte. Vielleicht tat sie mir auch nur leid, so wie damals schon, als ich frisch von der Uni gekommen war und meine Azubine Lara die völlig aufgelöste Frau in mein Büro geführt und behauptet hatte, ich sei die beste Familienrechtsanwältin im Hause. Was genau genommen sogar stimmte, denn bis heute war ich die einzige Anwältin für Familienangelegenheiten bei Maibach, Roeding & Partner.
Aus dem Augenwinkel fing ich Laras neugierigen Blick auf und verwünschte wieder einmal den Innenarchitekten, der sich dieses Glaskastenbüro ausgedacht hatte. Seit dem Umbau konnte in unserer Kanzlei von Privatsphäre keine Rede mehr sein, ging es nun um Tränen oder Hochzeitslisten.
Seufzend stand ich auf und gab meiner Azubine das vereinbarte Handzeichen für zwei Tassen Automatenkaffee. Dann ließ ich vor ihrem einfältigen Gesicht das Innenrollo herunter, wofür mich mit Sicherheit wieder irgendein Kollege verpetzen würde – denn auch bei Mandantenbesprechungen galt in diesen heiligen Hallen das Gesetz der Transparenz. Der große Maibach verstand einfach nicht, weshalb manche Mandate einen höheren Grad an Diskretion erforderten als andere.
Mit einem unguten Gefühl kehrte ich an den Schreibtisch zurück, wo ich Frau Ziegelow beim Lesen meiner Hochzeitsliste erwischte.
»Das ist privat«, bemerkte ich und ärgerte mich, dass es schuldbewusst klang.
»Sie heiraten.«
Mit glänzenden Augen schaute sie zu mir auf, und ihre verkniffenen Lippen öffneten sich zu einem Lächeln, das nicht recht in diesen Raum passen wollte, in dem sich bereits Tränen und verletzte Gefühle niedergelassen hatten.
»Kindchen, ich freue mich ja so für Sie! Wer ist der Glückliche? Wie lange kennen Sie sich schon? Wo findet die Hochzeitsfeier statt, und vor allem«, mit spitzem Mund beäugte die Friseurmeisterin meinen Pferdeschwanz, »wann kommen Sie endlich mal zu mir ins Tausendschön, damit ich Ihnen einen vernünftigen Schnitt verpassen kann?«
Unangenehm berührt wand ich mich auf meinem Drehstuhl. Es war ein weiteres ungeschriebenes Gesetz in dieser Kanzlei, dass die Anwälte niemals privaten Kontakt zu einem Mandanten pflegten. Bedauerlicherweise, denn das Tausendschön zählte zu den besten Friseurgeschäften in Frankfurt.
Gott sei Dank blieb mir das Zusammenstottern einer höflichen Absage erspart, weil Lara mit Kaffee und Keksen das Büro betrat. Resigniert beobachtete ich, wie sie sich mit unsicheren Schritten über den Hochflorläufer tastete. Im Zeitlupentempo stellte sie das Tablett auf dem Tisch ab und strahlte mich Lob heischend an. Die Rüge schluckte ich hinunter. Sie machte das ja nicht absichtlich, sondern war bloß genauso verträumt wie meine Großtante Li, die zwei Drittel des Tages in ihren Büchern lebte.
»Danke, Lara.«
Ich nahm mir einen Schokoladenkeks und drehte mich demonstrativ zur Seite, damit Lara begriff, dass sie ihre Schuldigkeit getan hatte. Aber meine Azubine blieb reglos im Raum stehen.
»Das war dann alles, Mädchen«, schaltete sich meine Mandantin ein und deutete mit dem Daumen zur Tür, woraufhin Lara gehorsam den Rückzug antrat.
Ich fixierte meine Hochzeitsliste, während die Schokolade zwischen meinen Fingern schmolz.
»Sie müssen strenger sein, Kind.« Frau Ziegelow holte tief Luft. »Sonst tanzt Ihnen das Personal auf der Nase herum.«
»Alles in Ordnung bei Ihnen, Frau Sonnenthal?«
Die Jalousie wurde nach oben gezogen und knallte gegen die Rollladenleiste. Reflexartig schob ich mir den Keks in den Mund und starrte Justus an, der stirnrunzelnd im Türrahmen stand. Meine Mandantin war sichtlich irritiert, doch ich brachte nur ein gequältes Grinsen zustande, während ich kaute, als hätte ich einen Löffel Haferflocken im Mund.
»Danke, alles bestens.« Frau Ziegelow nahm sich eilig einen Keks. »Frau Sonnenthal ist eine wunderbare Anwältin. Sie weiß genau, was ihre Mandantinnen brauchen.«
Justus’ Stirnfalten glätteten sich. Der eisengraue Blick meines Verlobten ruhte jetzt wohlwollend statt tadelnd auf mir, und sein schlaksiger Körper wirkte auf einmal weniger steif. Verstohlen nahm ich die Brille ab. Justus sagte immer, das Gestell verdecke zu viel von meinem Gesicht, das ihm in natura am besten gefalle.
»Das ist schön zu hören, gnädige Frau. Bei Maibach, Roeding und Partner ist uns sehr daran gelegen, dass die Mandantschaft sich bis zuletzt gut aufgehoben fühlt«, sagte er in diesem Ton, den er auch Kindern und kleinen Hunden gegenüber anschlug. Dabei hatte ich ihm schon so oft gesagt, er solle das lassen, zumal der Schluss des Satzes klang, als endete meine Vertretung auf dem Schafott.
»Bis zuletzt?«, echote meine Mandantin schmunzelnd. »Ich hoffe nicht, Herr …?«
»Grüning. Doktor Justus Grüning. Ich bin ein Kollege von Frau Sonnenthal«, antwortete er, ohne auch nur ansatzweise über das Wort Kollege zu stolpern.
Trotz des sorgsam von Lara ausgerichteten Henkels zitterten meine Hände so sehr, dass ich danebengriff und mein Kaffee auf die Untertasse schwappte.
»Soso, ein Kollege.« Frau Ziegelow sah mich prüfend an.
Justus verbeugte sich galant und schloss nach einem höflichen »Hat mich sehr gefreut« in Frau Ziegelows und einem mahnenden »Lassen Sie das Rollo oben, Frau Sonnenthal« in meine Richtung die Tür.
Minutenlang saßen wir uns schweigend gegenüber, bis meine Mandantin das Wort ergriff.
»Sagen Sie mir bitte, dass das nicht Ihr Zukünftiger war, sondern bloß Ihr Liebhaber.«
»Mein was?« Ich hätte mich fast an meinem Kaffee verschluckt.
»Das habe ich befürchtet.«
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Er verunsichert Sie. Und leider nicht im positiven Sinn.« Ich wollte empört widersprechen, doch Frau Ziegelow fuhr unbeeindruckt fort: »Außerdem siezt er Sie.«
»Wir trennen das Berufliche vom Privaten«, erwiderte ich und fand plötzlich selbst, dass meine Antwort lahm klang.
»Was für ein Schmarrn.«
»Bei aller Höflichkeit, ich glaube kaum, dass meine Beziehung Gegenstand dieser Besprechung … Au!«
Eine beringte Hand war über den Tisch geschnellt und umfasste nun mein Handgelenk.
»Machen Sie niemals den Fehler, mit halbem Herzen zu heiraten. Schon gar nicht einen Mann, der offensichtlich keins hat«, raunte meine Mandantin im Ton einer Hellseherin, die Schreckliches in ihrer Glaskugel entdeckt hatte.
Ich wollte ihr die Hand entziehen, aber es blieb bei dem Versuch. Sie ließ sich nicht abschütteln.
»Frau Sonnenthal. Ich mag Sie. Und ich höre Ihnen gerne zu, denn Sie sind eine junge Dame, die weiß, wovon sie spricht, und meistens auch recht damit hat. Aber jetzt möchte ich Ihnen mal einen Rat geben.«
Resigniert schielte ich zur Wanduhr. Noch zehn Minuten bis zum nächsten Mandantentermin.
»Wir Frauen treffen Entscheidungen in Bezug auf Männer aus drei Gründen: weil unser Herz etwas sagt, unser Verstand oder unser Unterleib. Letzteres ist eine aufregende Sache, jedoch nicht sonderlich beständig. Der Verstand ist die beharrlichste Stimme und neigt dazu, alles zu übertönen, besonders die zarten und meist eher schüchternen Einwände des Herzens.«
»Ich kenne Herrn Doktor Grüning nun seit neun Jahren. Vertrauen Sie mir, ich habe währenddessen allen möglichen Stimmen gelauscht.«
»Aber haben Sie auch auf die Hinweise geachtet? Nichts geschieht ohne Grund, und das Schicksal ist sehr geschickt darin, dem Herzen so unauffällig in die Hände zu spielen, dass wir es oft gar nicht merken.« Frau Ziegelows Blick war ungewöhnlich klar, und ihre dunkelbraunen Zigeuneraugen saugten sich mit einer solchen Intensität an meinen fest, dass es mir schwerfiel wegzusehen. »Sie verstehen überhaupt nicht, wovon ich rede, richtig?«, fragte sie milde und gab endlich meine Hand frei.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte krampfhaft, nicht an den Ring meiner Großmutter zu denken, der ausgerechnet so kurz vor der Hochzeit auf mysteriöse Art und Weise verschwunden war.
»Jetzt habe ich mich schon wieder in Dinge eingemischt, die mich eigentlich nichts angehen. Das ist typisch für mich.« Frau Ziegelow blinzelte, dann zeigte sie betont ungezwungen auf den Briefkopf von Melwin & Cie. »Ich möchte, dass mein Exmann aufhört, mir mein Personal abzuwerben. Und ich verlange, dass er es unterlässt, mich bei meinen Stammkundinnen schlechtzumachen, auch wenn man ihm das vermutlich nur schwer nachweisen kann. Notfalls basteln Sie eben auch so eine einstweilige Fügung. Kriegen Sie das hin?«
»Wenn Sie aufhören, ständig das Gesetz zu übertreten, dann schon. Kriegen Sie das hin?«, antwortete ich, noch ein wenig durcheinander von ihrem Glaskugelvortrag.
Frau Ziegelow nickte stumm.
»Gut. Dann werde ich den Anwalt Ihres Exmannes anschreiben. Sicher bringt der Kollege seinen Mandanten zur Vernunft, wenn Sie im Gegenzug versprechen, dass Sie sich zukünftig an die Wettbewerbsregeln halten.« Ich glättete das Dokument und legte es in die Prozessmappe, die bereits so dick war, dass der Aktendeckel durch ein Gummiband zusammengehalten werden musste. »Ich denke, das war’s für heute.«
Ihr Händedruck war energisch, und sie hielt meine Hand einen Augenblick länger fest, als notwendig gewesen wäre.
»War es das wert?«
Die Frage war mir wie von selbst über die Lippen gekommen – und ich bereute sie sofort. Frau Ziegelow, die bereits auf dem Weg zur Tür war, hielt inne.
»Ich meine … Sie und … Ihr Mann, äh, Exmann … all das«, stotterte ich beschämt und deutete auf die überquellende Handakte.
Sie blickte stumm auf den abgehefteten Beweis ihrer gescheiterten Ehe, ehe sie den Kopf abwandte. »Ich würde keine Minute mit diesem Mistkerl missen wollen.«
Die traurigen Augen von Frau Ziegelow begleiteten mich noch nach Feierabend bis zu dem himmelblauen Stadthaus im Frankfurter Westend, in dem wir wohnten. Erst als ich an den Briefkästen im Hausflur nach meinem vibrierenden Handy suchte, verblasste ihr Gesicht vor meinen Augen. Mit klopfendem Herzen öffnete ich Mamas Kurznachricht.
Großmutter will uns sehen. Heute Abend, 19:00 Uhr.
Kuss Mama.
Das Flurlicht erlosch mit einem leisen Klicken. Ich lehnte mich im Halbdunkel gegen die Wand und lauschte meinem eigenen Atem. Damit blieb mir gerade mal eine Dreiviertelstunde Zeit, um nicht den Unwillen meiner Großmutter auf mich zu ziehen, die Unpünktlichkeit für eine Todsünde hielt. Seufzend öffnete ich den Briefkasten. Das Wochenblatt, ein Flyer mit Werbung für Sommerreifen, ein paar amtlich aussehende Kuverts, adressiert an Justus. Dazu eine Geburtstagspostkarte von meiner Cousine, wie üblich drei Wochen zu spät und mit einer entschuldigenden Einleitung. Ich versuchte erst gar nicht, Charlies ungelenke Schrift zu entziffern, sondern steckte den ganzen Packen in die Aktentasche und eilte in den vierten Stock hinauf.
Perplex starrte ich auf den Rollkoffer, der in der offenen Tür stand. Aus der Wohnung drang Gepolter, im Flur stolperte ich über Justus’ Segeltasche.
»Schatz?« Der Druck in meinem Bauch verstärkte sich, während ich die Mappe auf die Kommode stellte und den Trenchcoat in den Garderobenschrank hängte. Ich zuckte zusammen, als mein Verlobter neben mir auftauchte.
»Was hast du vor?«, entfuhr es mir.
Im ersten Moment wusste ich nicht, ob ich entsetzt oder belustigt sein sollte. Im Tarnanzug stand er da, wie ein Bundeswehrsoldat auf Heimaturlaub, wenn man von dem Panamahut absah.
Justus bedachte mich mit einem blasierten Blick. »Hast du meine Jack-Wolfskin-Jacke gesehen, Finchen?«
»Die hast du letztes Jahr in die Altkleidersammlung gegeben«, erwiderte ich und versuchte mich zu erinnern, wann er mir gesagt hatte, dass er zum Militär gehen wollte.
Er runzelte die Stirn und fing an, im Schrank zu wühlen.
»Verrätst du mir, was du vorhast?«, fragte ich seinen gebeugten Rücken.
»Das Combat-Survival-Training«, tönte es dumpf zurück. Mein Trenchcoat fiel vom Bügel. Mit einem zufriedenen Grunzen zog Justus seinen Wintermantel aus der hintersten Ecke des Schranks. »Ich hatte dir davon erzählt.« Er zupfte ein paar Flusen aus dem Tweedstoff, schnupperte daran und verzog das Gesicht.
»Hast du das?« Ich sah ihn verständnislos an.
»Maibach will, dass ich ein Managertraining absolviere. Ich soll ihm beweisen, dass ich ein harter Kerl bin, ehe ich den Partnervertrag unterschreibe.«
»Ach. Und da muss er dich drei Wochen vor unserer Hochzeit in den Kongo schicken?«
»In den Westerwald. Lagerfeuer, zelten, das volle Männerprogramm«, feixte Justus, als ginge es auf Pfadfinderfahrt. »In zwei Stunden werde ich abgeholt. Stell dir vor, die verbinden einem vor Ort die Augen, damit man nicht weiß, wohin man …«
»Aber du hasst Zelten«, unterbrach ich ihn ungehalten. »Außerdem wollten wir die Torte aussuchen, und ich muss die Gästeliste mit dir besprechen, ehe wir die Tischkarten drucken lassen.«
»Es sind nur fünf Tage, Finchen. Deine komischen Tanten werden entzückt sein, wenn sie sich durch sämtliche Konditoreien der Stadt naschen dürfen. Ihr Mädels habt das alles auch ohne mich bestens im Griff.«
»Aber …«
»Kein Aber. Manchmal gibt es Dinge, die ein Mann einfach tun muss«, sagte er und betonte dabei jede Silbe. »Erst recht, wenn es um eine Gehaltserhöhung von mehreren zehntausend Euro geht. Da stimmst du mir sicher zu, Josefine?«
Ich schwieg. Wenn Justus mich mit meinem vollen Vornamen ansprach, war jede weitere Diskussion zwecklos. Das war schon zu Studienzeiten so gewesen und gehörte zu den Dingen, die ich mittlerweile hinnahm. Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn und stopfte seinen Wintermantel in die Segeltasche.
»Wir könnten noch einen Kaffee zusammen trinken«, startete ich einen neuen Versuch. »Ich muss dir nämlich etwas Wichtiges erzählen …«
»Geht es um diese unmögliche Frau Ziegelow? Das kann bestimmt bis nächste Woche warten. Ich verstehe sowieso nicht, wieso sie dir ständig die Zeit stiehlt. Schick sie mit ihren Belanglosigkeiten zu den Bußgeldkollegen.«
Ich betrachtete sein kantiges Gesicht mit den grau schimmernden Augen und den langen Wimpern. Justus hatte einen leichten Silberblick, weshalb man manchmal den Eindruck gewann, dass er einen nicht direkt ansah, sondern etwas, das sich hinter einem befand. Bisher hatte ich das immer irgendwie attraktiv gefunden. Jetzt verstärkte es nur mein Gefühl, dass er unsere Wohnung geistig längst verlassen hatte.
»Natürlich kann es bis nächste Woche warten«, sagte ich gezwungen und stellte erleichtert fest, wie der verächtliche Ausdruck aus seinen Zügen verschwand.
Wir besaßen schon immer unterschiedliche Auffassungen, was den Umgang mit Mandanten anging, mit denen er vorzugsweise schriftlich verkehrte. Dabei ging es mir gar nicht um die arme Frau Ziegelow. Ich hätte gerne mit ihm über den verschwundenen Ring gesprochen, aber wahrscheinlich löste ich das Problem besser alleine. Zumal ich mir sicher sein konnte, dass er für den Aberglauben, den meine Großmutter im Hinblick auf dieses Familienerbstück hegte, kein Verständnis hatte.
»Ich rufe dich an. Das heißt …« Unschlüssig griff er nach seinem Blackberry, ehe er es mir mit einem Seufzen in die Hand drückte. »Mobilgeräte sind laut Teilnehmerregeln nicht erlaubt. Am besten lasse ich es hier.«
»Na, großartig!«, entfuhr es mir. »Und wie soll ich dich nach dem Konditoreitermin erreichen?«
»Ach, Finchen.« Er drückte mich jäh und heftig an sich. »Egal ob Schokosahne oder meinetwegen diese scheußliche Buttercremetorte, auf die deine Oma so wild ist. Ich sage auf jeden Fall ja, wenn der Priester mich fragt. Mach dir also keine Sorgen um einen albernen Kuchen.«
Mein Körper, der sich eben noch versteift hatte, entspannte sich. Justus roch immer so herrlich sauber, nach Wäschereihemd und Mundwasser. Weil ich in seiner Umarmung kaum Luft bekam, brachte ich nur ein gehauchtes »In Ordnung« heraus.
Er hielt mich auf Armeslänge von sich und zog das Gummiband aus meinem Zopf. »Diese türkisfarbene Bluse steht dir. Allerdings solltest du die Haare offen tragen.« Er zwinkerte, warf die Segeltasche über die Schulter – und ging.
Noch eine ganze Weile blieb ich reglos vor der geschlossenen Tür stehen, ehe ich zur Wanduhr hinübersah. Mir blieben keine zehn Minuten mehr, womit sich die Dusche, nach der ich mich so gesehnt hatte, erledigt hatte. Seufzend bückte ich mich nach dem Trenchcoat. Tatsächlich würde ich auch lieber im Tarnanzug durch den Westerwald robben, statt mich in die Schusslinie unseres Familienoberhauptes zu begeben. Nichtsdestotrotz gab es auch Dinge, die eine Frau tun musste. Ob sie nun wollte oder nicht.
Zwei
Als Kind war mir das Haus meiner Großmutter Adele von Meeseberg immer wie ein verwunschenes Schloss aus dem Märchen vorgekommen – wobei ich mir nie sicher war, ob es von einer guten oder einer bösen Königin bewohnt war.
Auch wenn ich mittlerweile dreißig Jahre alt und somit eindeutig erwachsen war, beschlich mich nach wie vor dieses eigentümliche Gefühl aus Ehrfurcht und Verzauberung, sobald ich das eiserne Flügeltor passierte und die beiden Steinlöwen stumm auf mich herabblickten. Ich parkte mein Auto neben Mamas Audi unter dem alten Kirschbaum, der in voller Aprilblüte stand, und stieg aus. Fast schon automatisch legte ich den Kopf in den Nacken und schaute zu der weiß getünchten Fassade mit den Sprossenfenstern hinauf. In der Dachgaube befand sich ein ovales Fenster, umrahmt von einer steinernen Blütenranke – das einzige Element, das mit der barocken Architektur der Villa Meeseberg brach.
»Willst du da draußen Wurzeln schlagen, oder beehrst du uns heute noch mit deiner Anwesenheit?«, erklang eine raue, etwas heisere Stimme. Meine Großtante lehnte an einer der roten Steinsäulen des Eingangsportals und rauchte.
»Tante Bri! Ich dachte, du hättest aufgehört.«
Sie schaute auf ihre Hand und riss die Augen auf. »Huch! Wo kommt die denn her?« Eilig nahm sie einen letzten Zug, trat die Zigarette aus und klaubte den Filter mit spitzen Fingern vom Boden auf.
Ich kannte keine andere Frau ihres Alters, die derart elegant in die Knie gehen konnte. Ganz davon abgesehen, dass ich auch kaum Frauen ihres Alters kannte, die Kleider trugen, in denen man ihre Knie überhaupt sah.
Bri richtete sich auf und schnippte die Kippe in Großmutters kostbare Rosenrabatten. »Glaub mir, die dicke Luft da drinnen ist garantiert schädlicher als das bisschen Nikotin. Eine kluge Entscheidung von dir, zu spät zu kommen.«
»Das war keine Absicht. Der Verkehr …«
»Josefine, zerstör bitte nicht meine Hoffnung, dass du wenigstens einmal im Leben etwas Ketzerisches tust.«
»Ich dachte, dafür wären andere zuständig«, gab ich zurück und deutete vielsagend in Richtung der Rosen.
Bri rückte ihren Hut gerade, der vage an eine umgedrehte eierschalenfarbene Rührschüssel erinnerte. Sie trug ständig irgendeine neue Scheußlichkeit auf dem Kopf und provozierte damit zahllose Sticheleien. Doch meine Großtante hatte schon immer getan, was ihr beliebte, worin ihr meine Cousine Charlie nicht unähnlich war.
Wortlos hakte Tante Bri mich unter und dirigierte mich ins Foyer.
»Die ganze Sippe sitzt zusammen.« Sie deutete mit dem Kinn zum Salon und verdrehte die Augen. »Und wie üblich lässt die Entrüstung unseres Stammhalters den Kronleuchter wackeln.«
Mein Herz schlug schneller. Onkel Carl und Tante Silvia waren auch hier? Hatte die Nachricht von dem verschwundenen Ring meine Großmutter derart erschüttert, dass sie gleich den kompletten Familienrat einberufen hatte?
»Ist es sehr schlimm?«, flüsterte ich Bri zu, während wir auf die metallbeschlagene Flügeltür zusteuerten.
»Schlimm? Laut Carl ist deine Cousine von Mädchenhändlern entführt und an die russische Drogenmafia verkauft worden. Subtrahiert man allerdings die Details, die er hinzugesponnen hat, bleibt unterm Strich eigentlich nur ein verliebtes Mädchen, das mit einem Jungen durchgebrannt ist.« Sie zuckte die Schultern. »Das kommt in den besten Familien vor. Dennoch meint mein hysterischer Neffe, es handele sich um einen Fall für den Bundesnachrichtendienst, weil Charlotte nicht mehr ans Telefon geht.«
Ich blieb wie angewurzelt stehen, was ein Glück für mich war, denn ich wäre sonst in die Rüstung meines Urahns Philipp hineingelaufen. »Moment mal. Verstehe ich das jetzt richtig? Wir sind wegen Charlie hier?«
Bri musste den Kopf zurückbiegen, um mich unter der Hutkrempe hervor prüfend anzusehen. »Weswegen sollte meine Schwester uns denn sonst mitten in der Woche wie Kühe zum Melken zusammentreiben? Noch dazu um diese Uhrzeit.« Ihr faltiger Mund verzog sich. »Es gibt nicht mal Kuchen.«
Mit feuchten Händen betrat ich hinter Bri den Salon und bemerkte als Erstes meine zerknirscht wirkende Mutter, die neben der aufgelösten Silvia auf dem Biedermeiersofa hockte. Charlies Mutter war von jeher nah am Wasser gebaut, und die geröteten Augen unter ihrem blondierten Pony waren ein gewohnter Anblick für mich.
»Fünfundzwanzigtausend Euro Studiengebühren. Für nichts! Denkt das Mädchen, ich sei ein Goldesel?«, dröhnte Onkel Carl, der mit geballten Fäusten vor dem Kamin auf und ab ging und alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Eine günstige Gelegenheit, um mich unauffällig zu Papa zu gesellen, der am Fenstersims lehnte und das Lilienmuster der Tapete studierte. Wir nickten einander zu, und sein warmes Lächeln sorgte dafür, dass ich mich sofort besser fühlte. Bri steuerte die Hausbar an – in einem weiten Bogen um Carl herum und nicht ohne unterwegs ihre Schwester Li anzustupsen, die trotz der lautstarken Diskussion im Lesesessel eingenickt war.
»Charlotte ist vierundzwanzig. Vier-und-zwan-zig! Da möchte man denken, meine Tochter sei alt genug, um das Leben nicht für ein verdammtes Computerspiel zu halten, bei dem man mal eben kurz die Pausetaste drückt, um sich mit einem dahergelaufenen Penner nach Schottland abzusetzen.«
»Mäßige deinen Ton, Sohn«, erklang die schneidende Stimme meiner Großmutter.
Onkel Carl blieb abrupt stehen und zeigte anklagend auf Silvia. »Charlotte gehört ins Internat, das habe ich dir immer gesagt.«
Silvia schluchzte auf, woraufhin Mama leise auf sie einredete, als wäre sie ein verstörter Hundenotfall. Meiner stummen Frage wich Mama mit gesenktem Blick aus, was meine Ahnung bestätigte, dass sie die Katze bisher nicht aus dem Sack gelassen hatte. Charlie hatte es also wieder mal geschafft, die komplette Familie in Aufruhr zu versetzen. Dabei war sie nicht mal anwesend.
»Schottland ist bezaubernd. Und so romantisch. Die sattgrünen Wiesen mit all den Schafen und die schroffen Klippen … Man sollte allerdings auf wetterfeste Kleidung achten, wenn man sich keinen Schnupfen holen will. Es regnet ziemlich oft, habe ich gelesen«, meldete sich Tante Li zu Wort, woraufhin Bri sich fast an ihrem Scotch verschluckte.
Ich verkniff mir ein Grinsen. Li war einfach hinreißend arglos und das in jeder Beziehung.
Carl atmete scharf ein, wobei seine Zigarrenraucherlunge pfiff und die Hemdknöpfe spannten. Er hatte mindestens fünf Kilo zugenommen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte.
»Bei allem Respekt, Lieselotte, deine Reisetipps kannst du dir getrost …«
»Setz dich, Sohn. Und du, Silvia, reiß dich bitte zusammen.«
Meine Großmutter war keine große Frau. Aber nachdem sie sich aus dem Lehnstuhl erhoben hatte, war ich nicht die Einzige, die für einen Moment vergaß zu atmen. Sogar Papa, den sonst wenig einschüchterte, schien kurz davor zu salutieren. Adele von Meeseberg war weit über achtzig. Trotz ihrer gebeugten Haltung hatte sie nichts von ihrer Anmut und dem Stolz eingebüßt, der Frauen zu eigen war, die auf ein Leben in der gehobenen Schicht zurückblicken durften – und es gewohnt waren, anderen Menschen Anweisungen zu erteilen.
»Könnten wir die Angelegenheit bitte sachlich besprechen?«, sagte sie ruhig in die Stille hinein.
»Jemand einen Drink?« Bri klimperte mit den Eiswürfeln in ihrem Glas.
Für einen winzigen Augenblick war ich versucht, die Hand zu heben, doch aus irgendeinem Grund traute ich mich nicht.
»Muss noch fahren«, grummelte Carl, dabei wusste jeder, dass er es sonst auch nicht sonderlich genau mit dem Thema Alkohol am Steuer nahm.
Tante Li wies bedauernd auf den geblümten Teebecher auf dem Beistelltisch, der Rest verneinte mehr oder weniger entrüstet. Zu gern hätte ich in diesem Moment gewusst, was in meiner Großmutter vorging, denn das winzige Zucken ihrer Mundwinkel war mir nicht entgangen.
»Charlie hat ihr Studium abgebrochen«, sagte Bri, während sie ihr Glas füllte. »Genauer gesagt wurde sie exmatrikuliert, weil sie offenbar die erforderlichen Prüfungen versemmelt hat.«
»Sie ist durchgefallen, weil sie seit sechs Monaten keinen Fuß mehr über die Schwelle des Hörsaals gesetzt hat«, ergänzte Carl.
»Betriebswirtschaftslehre hat sowieso nicht zu ihr gepasst. Hättest du sie damals gelassen, besäße sie jetzt zumindest eine Berufsausbildung.«
»Eine von Meeseberg, die anderen Leuten das Essen kocht? Nur über meine Leiche.«
»Sei kein Snob.« Bris Augen funkelten. »Heutzutage kann man es als begabter Koch weit bringen.«
»Du glaubst doch nicht ernsthaft, das Charlotte die Disziplin aufbringt, sich in die Spitzengastronomie hochzuarbeiten.«
»Wenn man tut, was man liebt, erreicht man oft eine ganze Menge«, versetzte Bri, und insgeheim gab ich ihr recht.
Wenn Charlie nicht gerade in irgendeiner Kellernische auf Spinnenjagd gegangen war, hatte sie früher stundenlang in der Küche geholfen und war bis heute eine leidenschaftliche Bäckerin. Besonders ihr Käsekuchen war eine echte Offenbarung. Ein Jammer, dass sie ihrem Vater nie auf diplomatische Art klarmachen konnte, was sie wollte. Aber meine Cousine setzte auf Rebellion – das tat sie schon, seit der erste zornige Babyschrei aus ihrem Mund gekommen war.
Bri nahm einen großen Schluck von ihrem Drink. »Jedenfalls ist das Mädchen von dieser schicken Privatuni geflogen und hat das Apartment an eine Kommilitonin untervermietet, die wiederum behauptet, Charlie sei nach …«
»Wieso zum Henker ausgerechnet Schottland?«, fuhr Onkel Carl dazwischen.
»Also ich finde Schottland ganz …«
»Halt die Klappe, Li!«, riefen Carl und Bri gleichzeitig.
Tante Li hob beschwichtigend die Hände.
»Sie hätte zumindest Bescheid sagen können«, schaltete sich Silvia weinerlich ein.
»Aber sie hat doch Bescheid gesagt.« Li nahm ihre Brille ab und putzte sie mit einem Zipfel ihrer Strickjacke.
Alle Augen richteten sich auf die kleine, füllige Frau, die fast in dem Lesesessel versank, während sie das unvermeidliche Buch auf den Knien balancierte. Wie so oft wunderte ich mich darüber, wie unterschiedlich die beiden Zwillingsschwestern waren. Ich hatte Bri noch nie mit einem Buch in der Hand gesehen, während Li sogar Werbebroschüren mit einer Ernsthaftigkeit studierte, als handele es sich um die Buddenbrooks.
Tante Li setzte ihre Brille auf und blinzelte verwundert in die Runde. »Was habt ihr denn?«
»Li, würdest du uns freundlicherweise aufklären?« Bri atmete scharf aus und wirkte plötzlich nervös.
»Sie waren entzückend. Eine junge, große Liebe, so voller Hoffnung. Die beiden sind wie füreinander geschaffen. Ich nehme übrigens doch etwas von dem Aprikosenlikör aus Italien, bitte. Der ist ganz wunderbar.« Sie seufzte hingerissen. »Das Gartenhäuschen stand sowieso leer.«
»Charlotte hat im Gartenhäuschen gewohnt? Mit ihrem Freund?«, entfuhr es mir.
»Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert. Man muss heute nicht mehr verheiratet sein, um im selben Bett zu schlafen.« Li errötete und strich über den gehäkelten Schutzumschlag ihres Buches. Sie produzierte etliche dieser hässlichen Dinger, die überall im Haus herumlagen oder wahlweise an Leute verschenkt wurden, die sie garantiert nicht haben wollten. »Übrigens ist er kein dahergelaufener Penner, wie Carl behauptet. Er ist ein Musiker. Ein wirklich netter, begabter Junge.«
»Erspar mir die Details. Wann war das?«, brüllte Carl die nun sichtlich verwirrte Li an, die mir langsam leidtat.
»Vor drei Wochen.« Li schob die Unterlippe vor und fügte gekränkt hinzu: »Charlotte hat mich gebeten, niemandem von ihren Reiseplänen zu erzählen. Außerdem hat sie gesagt, sie lässt ihr Telefon zu Hause, weshalb es auch keinen Sinn ergibt, sie anzurufen.«
»O Li«, seufzte Bri kopfschüttelnd und trank ihr Glas leer.
Von der Couch ertönte ein erstickter Laut. Mama hatte die Hand vor den Mund geschlagen und war leichenblass geworden. »Das hatte ich ganz vergessen«, flüsterte sie und rutschte auf ihrem Kissen hin und her. »Letzten Monat hat Charlie auch bei uns übernachtet.«
Ich starrte sie verständnislos an.
»Hat sich ganz geschickt angestellt mit der Heckenschere, ihr Freund«, brummte mein Vater.
»Na großartig. Ein Komplott. In meiner eigenen Familie«, wetterte Onkel Carl mit hochrotem Kopf.
»Sie hat etwas von einem Wasserschaden erzählt und … Hätte ich sie etwa auf der Straße schlafen lassen sollen?« Mama blinzelte nervös.
Ich stierte auf ihren Mund, der mir irgendetwas sagen wollte. Aber entweder war ich eine leidliche Lippenleserin, oder Mamas Lippen zitterten zu sehr.
»Ist alles in Ordnung mit dir, Mathilde?«, fragte Li neugierig, die ebenso fasziniert von Mamas Mund zu sein schien wie ich.
»Natürlich, Tante Li. Mir ist nur gerade eingefallen, wo ich … meine Bernsteinkette zuletzt gesehen habe.« Sie hüstelte und tippte beiläufig auf ihren Ringfinger. »Ich suche sie nämlich seit ein paar Tagen.«
»Oh, das kenne ich. Ich verlege auch andauernd irgendwelche Dinge. Neulich erst habe ich …«
Lis Stimme verschwamm zu einem undeutlichen Rauschen, als ich endlich begriff. Die chronisch abgebrannte, zurzeit offensichtlich obdachlose Charlie im Haus meiner Eltern. Mein Geburtsdatum als Zahlencode für den Safe.
Ich strich mir eine Strähne aus der Stirn und bemerkte, dass meine Hände feucht waren. Konnte es sein, dass meine Cousine hinter dem mysteriösen Verschwinden des Brautrings steckte? Es wäre nicht das erste Mal, dass sie lange Finger machte. Aber wieso zum Teufel sollte sie mir das antun? Ich schielte zu meinem Vater hinüber. Er war der Einzige, der außer Mama den Code für den Safe kannte.
»Papa?«, flüsterte ich wie betäubt. »Hast du zufällig das blaue Samtkästchen aus dem Safe genommen?«
»Welches Samtkästchen?«, fragte er gedankenverloren.
Ich hielt die Luft an. Damit war es Gewissheit. Das kleine Monster hatte sich mit meinem Ring davongemacht. Ich atmete aus und fing im nächsten Moment hysterisch an zu lachen. Onkel Carl hob befremdet den Kopf.
»Mir scheint, so einige Familienmitglieder in diesem Raum haben nicht mehr alle fünfe beisammen. Vielleicht erklärst du uns, was du plötzlich so lustig findest?«
»Hack nicht auf Josefine rum, nur weil sie tut, was wir alle gern täten«, fuhr Bri dazwischen. »Mir ist ehrlich gesagt unklar, was du mit dieser Versammlung bezweckst, werter Neffe. Wie du vorhin schon erwähnt hast, ist Charlotte vierundzwanzig Jahre alt. Niemand kann sie davon abhalten zu reisen, wohin es ihr beliebt. Du wirst deine unverhofften Vaterallüren vertagen müssen, bis deine Tochter entweder ihren Freund oder den schottischen Dauerregen satthat. Eigentlich ist das alles nur für Josefine bedauerlich, denn das Mädchen hätte sicher eine hübsche Brautjungfer abgegeben. Was übrigens Lis und mein Stichwort wäre. Wir feiern in drei Wochen eine Hochzeit – unterhalten wir uns über erfreuliche Dinge wie Blumenarrangements und Hochzeitstorten. Li, wieso hast du Friedhofsblumen bestellt, obwohl wir uns auf weiße Callas geeinigt hatten?«
Allmählich brauchte ich tatsächlich entweder einen Schnaps oder Schokoladenkekse. Viele Schokoladenkekse. Meinen resignierten Blick beantwortete Mama mit einem ebenso resignierten Kopfschütteln.
»Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, Bri«, tobte Carl. »Ich bin längst nicht am Ende mit meinen Möglichkeiten, und wenn ich einen Privatdetektiv anheuere, der meine Tochter zurück nach Deutschland holt.«
»Kopfgeldjäger«, korrigierte Li milde. »Die heißen Kopfgeldjäger. Und ehe ihr mir wieder den Mund verbietet: Ich glaube, Charlie geht es hervorragend in Schottland, trotz des Wetters.« Dann drehte sie sich mit erhobenem Kinn zu ihrer Schwester um. »Lilien sind derzeit im Sonderangebot. Erkläre du uns lieber mal, weshalb du Mechthild versprochen hast, dass sie Josefine die Haare machen darf, obwohl sie letzte Woche beim Doppelkopf geschummelt hat? Damit belohnst du diese unmögliche Person auch noch.«
Carl warf einen hochmütigen Blick in die Runde. »Kümmert euch ruhig um alberne Topfblumen und Frisuren, während ich zu verhindern versuche, dass mein Kind in sein Unglück rennt. Ich werde mit allen Mitteln dafür sorgen, dass Charlotte an die Universität zurückkehrt und einen passablen Abschluss macht. Das bin ich ihr schuldig, nachdem ihre Mutter auf ganzer Linie versagt hat.«
»Amen«, antwortete Bri und füllte ihr Glas zum dritten Mal, diesmal allerdings bis zum Rand.
Kurz nach 22:00 Uhr stand ich am Fenster, die Arme fest um den Oberkörper geschlungen, und sah zu, wie Mamas Audi mit kiesknirschenden Reifen vom Hof fuhr. Bis zuletzt hatte weder sie noch ich es über uns gebracht, meiner Großmutter die Hiobsbotschaft von dem verlorenen Brautring zu überbringen. Nicht, nachdem Onkel Carl die am Boden zerstörte Silvia untergehakt und sich mit sauertöpfischer Miene verabschiedet hatte, und auch nicht, während Bri und Li darum stritten, wer bei den Hochzeitsvorbereitungen das größere Chaos verursacht hatte. Nun würde wohl auch ich unverrichteter Dinge nach Hause fahren.
Der Duft nach Rosen stieg mir in die Nase, noch ehe meine Großmutter an meine Seite trat. Sie schaute ebenfalls zum Fenster hinaus, wo der Garten längst im Dunkeln lag. Sie wirkte so aufmerksam und wach, als erwarte sie noch einen späten Gast.
»Was möchtest du mir sagen, Josefine?« Ihre Stimme klang müde und abgespannt.
Die zwei Stunden mit Onkel Carls Zorn und der unsichtbaren Charlie, die wie ein Unfrieden stiftender Dämon über unseren Köpfen geschwebt hatte, hatten auch an ihren Nerven gezerrt. Dieses verdammte, kleine Monster.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, antwortete ich gezwungen fröhlich, dabei hätte ich viel lieber dem Impuls nachgegeben, die Arme um sie zu schlingen, wie ich es als kleines Mädchen so oft getan hatte. Aber ich war nun mal kein Kind mehr.
Mit dem Erwachsenwerden hatte sich unser Verhältnis, das von körperlicher Nähe geprägt gewesen war, in eine andere, tiefere Art der Zuneigung verwandelt, die jedoch eine unerklärliche Distanz mit sich gebracht hatte. Heute verehrte ich meine Großmutter so sehr, dass es mir respektlos vorgekommen wäre, wenn ich ohne Aufforderung ihre Hand ergriffen hätte. So süchtig ich nach ihrer Anerkennung war, so sehr fürchtete ich das kleinste Anzeichen ihres Missfallens.
»Ich bin alt, nicht senil«, erwiderte sie trocken und ging zu dem Lehnstuhl zurück. »Dir brennt schon den ganzen Abend etwas auf der Seele.«
Sie faltete die Hände im Schoß und straffte den Rücken, als sei das Geradesitzen ein sorgfältig einstudierter Vorgang. Es erinnerte mich daran, wie oft sie Charlie und mich beschworen hatte, in jeder Situation Haltung zu bewahren. Ich glaube, meine Großmutter weiß gar nicht, wie man in einem Sessel lümmelt.
»Hast du es dir mit der Heirat anders überlegt? So etwas kann passieren, weißt du? Deine Ururgroßtante beispielsweise hatte kurz vor …«
»Auf keinen Fall«, entfuhr es mir. Allein der Gedanke war vollkommen abwegig. Ich habe mir nie Dinge anders überlegt, die ich mir einmal vorgenommen hatte. Das taten nur wankelmütige Menschen wie Charlie, die keine Ziele im Leben verfolgten.
»Josefine, wenn du festgestellt hast, dass dein Verlobter nicht zu dir passt …«
»Justus und ich sind ein großartiges Team, darum musst du dir keine Sorgen machen«, beeilte ich mich zu versichern.
Ein merkwürdiger Ausdruck glitt über ihr Gesicht, aber möglicherweise spielte auch nur das flackernde Kaminfeuer meiner Wahrnehmung einen Streich.
»Was ist es dann?«
Ich zögerte. Wir konnten die Sache auch unter den Tisch fallen lassen, wie Mama heute Mittag vorgeschlagen hatte. Für einen geschickten Juwelier wäre es sicher keine große Herausforderung, ein Replikat des schlichten Goldrings anzufertigen. Ein gut geschliffener Glasstein war kaum von einem echten Diamanten zu unterscheiden, und wenn Großmutter dem guten Stück nicht allzu nah kam …
»Ich werde dir bestimmt nicht den Kopf abreißen, was es auch ist. Davon abgesehen wirst du kaum etwas angestellt haben, das über einen zerbrochenen Teller hinausgeht. Es sei denn, es handelt sich um das Porzellan deiner Urgroßmutter Helene, das würde ich dir dann doch übel nehmen.«
»Der Brautring«, hauchte ich und spürte förmlich, wie mir das Herz ein Stück tiefer rutschte. »Er ist … aus dem Safe verschwunden.«
Ich hätte damit umgehen können, wenn sie entsetzt aufgeschrien hätte. Selbst mit einem Tobsuchtsanfall hätte ich gerechnet, Haltung hin oder her. Wenn sie sogar an Urgroßmutter Helenes hässlichen Tellern hing, wie unvorstellbar musste dann für sie der Verlust eines Familienerbstücks aus dem Dreißigjährigen Krieg sein?
Doch sie saß nur reglos wie eine Statue in ihrem Stuhl, das Gesicht eigenartig wächsern im Feuerschein, und schwieg. Das tat sie eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich die Reaktion kam, die ich so sehr gefürchtet hatte.
Sie drehte den Kopf zum Fenster und stieß ein Seufzen aus, in dem alles lag, von Enttäuschung über Traurigkeit bis hin zu Resignation. »Das ist bedauerlich«, sagte sie leise und an jemanden gerichtet, der ebenso gut auf dem alten Kirschbaum im Garten hätte sitzen können.
»Ich glaube, Charlie hat ihn. Er ist also nicht wirklich weg, sondern nur … woanders.«
»Solche Dinge geschehen nicht ohne Grund.«
»Großmutter«, flehte ich und dachte irritiert, dass ich am Nachmittag einen ganz ähnlichen Satz aus Frau Ziegelows Mund gehört hatte. »Es ist nur ein Ring. Ein Stück Metall, das …«
»Du kannst ohne diesen Ring nicht vor den Altar treten, Josefine. Nicht, wenn du meinen Segen haben willst.«
Ich kannte das Gefühl, das mir mit einem Mal die Brust zusammenquetschte wie ein zu hoch geschnürtes Korsett.
Für einen winzigen Augenblick regte sich Trotz in mir, doch ich brauchte mir nichts vorzumachen. Ich war in einem Haus aufgewachsen, in dem Traditionen einen hohen Stellenwert besaßen und das Wort meiner Großmutter Gesetz war. Eine Heirat ohne den Segen Adele von Meesebergs war so unvorstellbar wie eine kirchliche Trauung ohne Priester. Eher würde ich die Hochzeit absagen.
»Bitte mach das nicht.« Ich zitterte, als ob ich barfuß in einem Eimer Eiswasser stünde.
»Was sagt dir die Zahl sechsundzwanzig?«, erwiderte meine Großmutter ungerührt.
»Das ist die Anzahl der Ehen in unserer Familie, die zerbrochen sind«, antwortete ich tonlos und hasste mich dafür, dass ich im Begriff war, mir von einem absurden Aberglauben das Leben versauen zu lassen. Aber alles, was ich an Auflehnung zustande brachte, waren zwei hinter dem Rücken geballte Fäuste.
»Was hatten diese Ehen gemeinsam?«
»Sie haben höchstens ein halbes Jahr gehalten … und … keine der Bräute hat beim Jawort den Ring getragen«
Obwohl ich diese Geschichten schon an die hundert Mal gehört hatte und längst nicht mehr an einen Zusammenhang zwischen dem Brautring und dem Scheitern besagter Ehen glaubte, überzog eine Gänsehaut meine Unterarme. Die tragischen Schicksale jener glücklosen Liebespaare begleiteten mich, solange ich denken konnte, und einige Verbindungen waren nicht nur unschön, sondern auch blutig auseinandergegangen. Hatte ich es als Zehnjährige noch genossen, Charlie mit den herzergreifenden Details der einen oder anderen Ehetragödie zum Heulen zu bringen, glaubte ich später tatsächlich, dass auf den Frauen unserer Linie ein Fluch lag. Ein Fluch, der nur durch die rituelle Brautringübergabe am Altar gebannt werden konnte.
Letztlich geschah jedoch das, was mit allen Märchen und Legenden passierte, wenn man älter wurde: Sie kamen in eine Schublade, in die Erwachsene nicht mehr hineinsahen. Bis auf meine Großmutter, die bis heute felsenfest davon überzeugt war, dass jede Ehe, die nicht unter dem Schutz des Brautrings geschlossen wurde, entweder vor dem Scheidungsrichter oder direkt im kalten Wasser des Mains endete.
»Ihr mögt mich für eine törichte Alte halten.« Sie hob die Hand, weil ich widersprechen wollte. »Bemüh dich nicht. Ich weiß sehr wohl, was meine reizende Sippe hinter meinem Rücken tuschelt. Ob Fluch, Schicksal oder Zufall – ich werde nicht verantworten, dass meine Lieblingsenkelin die nächste selbstmordgefährdete Frau in der Familie wird.« Ein feines Lächeln umspielte ihren Mund. »Aber selbstverständlich liegt es an dir zu entscheiden, was du tust, Josefine.«
»Du denkst, ich habe eine Wahl?« Meine Stimme war leise und unterwürfig. Hätte ich neben mir gestanden, hätte ich mich vermutlich geschüttelt und angeschrien. Es machte mir selbst Angst, wie eisern ich mich beherrschte.
Großmutters Lachfalten vertieften sich. »Nun, du hast gesagt, der Ring sei nicht verloren, sondern nur woanders. Bis zur Trauung hast du noch drei Wochen Zeit, wenn ich mich nicht verzählt habe.«
Ich riss die Augen auf. Schlug sie gerade allen Ernstes vor, dass ich …
»Oder lass es mich mit den Worten deiner Großtante Li sagen: Schottland ist ein bezauberndes Land.«
Noch als Teenager war ich der festen Überzeugung gewesen, dass meine Cousine einzig und allein auf die Welt gekommen war, um mir das Leben schwer zu machen.
An meinem zehnten Geburtstag beispielsweise hatte das kleine Monster herausgefunden, wozu Streichhölzer gut waren, und mit glückstrahlendem Gesicht meinen Geschenketisch angezündet. Mit vierzehn war ich unsterblich in Marius Goll aus der 10 b verliebt. Jedenfalls bis Charlie mein Geheimnis, das ich ihr in einer schwachen Minute verraten hatte, mit roter Farbe auf die Turnhallenmauer schmierte. Jo liept Marius. Leider eine einseitige Angelegenheit, wie sich herausstellte, nachdem Marius mich in der Cafeteria vor sämtlichen Mitschülern verhöhnt hatte. Bis heute beharrte Charlie darauf, dass sie mir mit der Aktion einen Gefallen getan hatte. Wenn ich es mir genau überlegte, hatte sie nie auch nur ein gutes Haar an den Jungen gelassen, die ich mochte.
Ich trat heftig auf die Bremse und kam mitten auf der regennassen Fahrbahn zum Stehen. Hinter mir quietschten Reifen, eine Hupe ertönte. Mechanisch drückte ich auf den Warnblinkknopf, ehe ich die Finger um das Lenkrad krampfte und vornübergebeugt durch die Windschutzscheibe ins Nichts starrte.
Charlie mochte auch Justus nicht.
Ich atmete tief ein, bis ich glaubte, meine Lunge müsste platzen. Dann presste ich die Luft stoßweise wieder heraus, bis ich so leer war, dass mir schwindelig wurde.
Mit meiner Heirat war Charlie von Anfang an nicht einverstanden gewesen und hatte nun offenbar einen Weg gefunden, sie zu verhindern. Zweifellos mit Erfolg, denn selbst wenn ich nach Schottland flöge – wo um Himmels willen sollte ich anfangen zu suchen?
Eine geraume Weile stierte ich auf die quietschenden Scheibenwischer. Dann ließ ich den Motor an, stellte den Warnblinker aus und trat aufs Gaspedal.
Noch immer wütend betrat ich kurz darauf unsere Wohnung und steuerte zielstrebig die Kommode an, auf der meine Aktentasche stand. Diese alberne einstweilige Verfügung kam mir gerade recht. Der Fall würde mich ablenken, bis ich eine Lösung für mein eigenes Problem gefunden …
Verwirrt schaute ich auf die Postkarte, die mit Frau Ziegelows Akte aus der Tasche gerutscht war und nun mit der Bildseite nach oben auf den Marmorfliesen lag. Charlies Geburtstagskarte. Mein Herz klopfte schneller. Ich kniete nieder und betrachtete das viktorianische Steinhaus inmitten der urwüchsigen Heidelandschaft, die mich sofort an … Das war jetzt nicht wahr!
Mit zitternden Fingern hob ich die Karte auf und suchte auf der Rückseite nach einem Hinweis, woher die Fotografie stammte.
Fàilte! O’Farrell Guesthouse, Kincraig, Scotland.
Unwillkürlich richteten sich die Härchen auf meinem Oberarm auf. Allmählich war es mühsam, all die Dinge, die heute passiert waren, keiner übergeordneten Macht in die Schuhe zu schieben, die mich offensichtlich nicht nur vom Heiraten abhalten, sondern gleich in ein fremdes Land verfrachten wollte. Ich schloss die Augen, bis ich mich imstande fühlte, die krakelige Handschrift zu entziffern, die das, was ich längst ahnte, in Worte fasste:
Liebe Jo,
es tut mir leid, aber ich hatte keine Wahl. Du solltest jemanden heiraten, der dich verdient hat.
Von ganzem Herzen, auch wenn du nie wieder mit mir redest.
Charlie
PS: Justus ist ein Idiot.
Drei
»Haben Sie noch einen Wunsch?«
Die Stewardess war Asiatin, hatte falsche Wimpern und einen Namen auf der Brust, der nicht zu ihrer exotischen Erscheinung passte: Candy Dee. Seit dem Start kam die junge Frau nun schon zum dritten Mal zu meinem Platz.
»Möchten Sie noch ein Wasser?«, fragte Candy Dee in diesem milden Ton, den Pflegekräfte normalerweise gegenüber geistig verwirrten Patienten anschlugen.
Nicken funktionierte noch, während sich der Rest meines Körpers wie gelähmt anfühlte. Ich saß kerzengerade in dem Sitz und brannte vor Angst. Weil ich in ein fremdes Land flog, das ich nur aus Filmen kannte. Weil ich die Bestätigung meines Urlaubsantrags nicht abgewartet hatte. Weil ich wusste, wie Justus reagieren würde, wenn er von dieser verrückten Idee erfuhr. Weil ich keine Ahnung hatte, was ich tun sollte, wenn ich Charlie nicht fand, geschweige denn, was ich tun würde, wenn ich sie fand. Und weil ich Flugangst hatte.
»Sie dürfen sich jetzt abschnallen und die Lehne nach hinten stellen, wenn Sie möchten.«
Candy Dee befand sich noch immer im Pflegepersonalmodus. Meine Knie zitterten, während ich die Rückenlehne meines Vordermanns zu hypnotisieren versuchte.