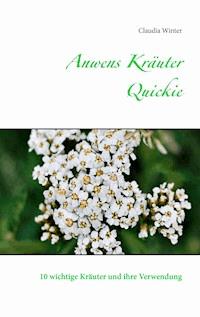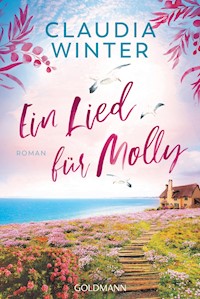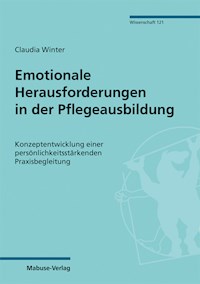10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Emilia Volani in den Ferien in ihre geliebte Heimatstadt Siena zurückkehrt, erwartet sie eine große Herausforderung. Das traditionelle Pferderennen auf der Piazza del Campo, das dem Sieger Ruhm und Ehre einbringt, steht unmittelbar bevor. Und ausgerechnet die Familie Graziotti hat hohe Chancen, zu gewinnen. Emilias Vater, der mit den Graziottis durch eine langjährige Fehde verbunden ist, fordert von seiner Tochter, den Sieg seiner Widersacher zu verhindern. Als Emilia aber erfährt, dass ihre Schwester und der jüngste Graziotti-Sohn unsterblich ineinander verliebt sind, gerät sie zwischen die Fronten. Und dann sind da noch eine kleine Stute, die ihr Herz berührt, ein Anwesen in den Hügeln, das sich wie ein Zuhause anfühlt, und ein Mann, der alles in Frage stellt, was sie über die Liebe zu wissen glaubte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Als Emilia Volani in den Ferien in ihre geliebte Heimatstadt Siena zurückkehrt, erwartet sie eine große Herausforderung. Das traditionelle Pferderennen auf der Piazza del Campo, das dem Sieger Ruhm und Ehre einbringt, steht unmittelbar bevor. Und ausgerechnet die Familie Graziotti hat hohe Chancen zu gewinnen. Emilias Vater, der mit den Graziottis durch eine langjährige Fehde verbunden ist, fordert von seiner Tochter, den Sieg seiner Widersacher zu verhindern. Als Emilia aber erfährt, dass ihre Schwester und der jüngste Graziotti-Sohn unsterblich ineinander verliebt sind, gerät sie zwischen die Fronten. Und dann sind da noch eine kleine Stute, die ihr Herz berührt, ein Anwesen in den Hügeln, das sich wie ein Zuhause anfühlt, und ein Mann, der alles infrage stellt, was sie über die Liebe zu wissen glaubte …
Weitere Informationen zu Claudia Winter und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
Sterne über Siena
Roman
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe Juni 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur
erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Umschlaggestaltung: buxdesign GbR
Umschlagmotiv: Mauritius Images/Rainer Mirau, Image Source / WALTERZERLA, Frank Krahmer; shutterstock/Lifestyle Travel Photo, ARTpok,djgis
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-30106-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für Misch. Weil du dieses Buch geschrieben sehen wolltest.
Prolog
Siena, fünfzehn Jahre zuvor.
Der Legende nach gibt es unter der Stadt einen großen, reißenden Fluss. Gesehen hat ihn noch niemand, und er ist auch in keinem Stadtplan verzeichnet. Aber wenn man nachts durch die etwas stilleren Viertel geht, kann es vorkommen, dass man ihn hört, tief unter dem krummen Pflaster, wo die Regierung damals das unterirdische Kanalsystem angelegt hat. Es heißt, man müsse sich die Ohren zuhalten, sobald man sein Rauschen vernimmt – und zwar pronto, weil sonst etwas Unerklärliches, ja Gruseliges mit einem geschieht, bei dem es sich laut ihrer Nonna nur um Teufelswerk handeln könne. Angeblich wird man beim Klang des Wassers verrückt. Oder man verschwindet. Wirklich! Puff, weg. Von jetzt auf gleich. Als hätte sich ein Loch im Boden aufgetan.
Emilia schauderte, und doch wünschte sie sich in diesem Augenblick brennend, die Legende vom Geisterfluss wäre wahr. Einfach zu verschwinden. Selbst wenn sie in einer Zwischenwelt landete, irgendwo zwischen Leben und Tod, oder an einem Ort, wo eklige Riesenspinnen herumkrabbelten … Alles wäre hundertmal besser, als den Taugenichtsen aus dem Stadtviertel der Gans in die Hände zu fallen.
Tief drückte sie ihren mageren Mädchenkörper in die Mauernische hinter dem Wandpfeiler hinein, wo sie mit dem steinernen Torbogen verschmolz. Sie lauschte, den Blick trotzig auf das grünweiße Halstuch gerichtet, das sie dem Gansjungen vom Hals gerissen hatte. Ihre Knie waren weich wie Butter, so schnell war sie mit ihrer Trophäe davongerannt, aber das berauschende Gefühl der gewonnenen Schlacht hatte nur einen Wimpernschlag überdauert. Es galt, eine zornige Gänsemeute abzuhängen, alles ältere Jungs, die sich in ihrem eigenen Viertel natürlich viel besser auskannten. Doch porca miseria, heilige Scheiße, sie hatte es irgendwie geschafft, ihnen zu entkommen – weil Padre Pio ihr Gebet erhört und den Seitenausgang der kleinen Kapelle in der Nähe des Fontebranda-Brunnens unverschlossen gelassen hatte. Danach war sie förmlich durch den Vicolo del Tiratoio geflogen, eine abschüssige Gasse, deren Breite man mit ausgestreckten Armen messen konnte, war scharf rechts und wieder links auf die Via Santa Caterina abgebogen, bis das Seitenstechen so schlimm geworden war, dass sie Zuflucht im nächstbesten Hauseingang hatte suchen müssen.
Ihr war bewusst, dass die Gefahr längst nicht gebannt war. Das bunte Fliesenmuster unter ihren nackten Füßen gehörte noch zum Feindgebiet, und sie war völlig auf sich allein gestellt, nachdem ihre Bandenmitglieder wie die Hasen die Flucht ergriffen hatten. Sicher würde der Junge mit den blitzenden Augen – seine Freunde hatten ihn Ale genannt – sie nicht so leicht davonkommen lassen. Nicht nur, weil sie zum Stadtteil des Turms gehörte, dem erklärten Erzfeind der Gans, sondern weil sich kein Junge gern im Beisein seiner Freunde von einem Mädchen vorführen ließ. Da waren sie alle gleich, ob sie nun der Contrade der Gans, des Turms, der Welle, des Adlers, der Giraffe oder einem der anderen siebzehn Stadtbezirke angehörten. Jungs waren eben Jungs, großspurig, eitel und überheblich. Sogar ihr Bruder Matteo war so gewesen, auch wenn alle immer das Gegenteil behaupteten, weil man von den Toten nicht schlecht reden durfte.
Sie war noch ganz aus der Puste. Um sich nicht zu verraten, atmete Emilia mit offenem Mund, befürchtete jedoch, dass ihr wild schlagendes Herz durch die ganze Gasse zu hören war. Das Gans-Halstuch fühlte sich feucht an, von Ales Nacken oder ihren verschwitzten Händen. Sie gab der Versuchung nach und schnupperte an dem weichen Seidenstoff, dessen Farben vom vielen Waschen ganz ausgeblichen waren. Er roch gut, nach einem Parfum, wie es erwachsene Männer benutzen. Trotzdem verzog sie das Gesicht, weil man das eben so machte, wenn einem der Geruch eines Menschen in die Nase stieg, den man schon aus Prinzip nicht leiden konnte.
Misstrauisch spähte Emilia hinter dem Pfeiler hervor. Um die Mittagszeit war es totenstill auf Sienas Straßen. Die Sonne stand hoch am Himmel, stülpte eine Glocke aus Hitze über die roten Ziegeldächer und versuchte alles, was in ihre Nähe kam, zu schmelzen, auszudörren, zu verbrennen. Hier unten, im Halbdunkel tiefer Häuserschluchten aus fahlbraunem Stein, blieb es erträglich, trocken und kühl. Die meisten Fensterläden waren geschlossen – lieber muffige Dunkelheit als Saunatemperatur im Zimmer, so lautete das ungeschriebene Gesetz des sienesischen Hochsommers. An einer Balkonbrüstung trockneten weiße Rippunterhemden und ein Büstenhalter, in den man zwei Melonen hätte hineinlegen können. Bei der Vorstellung stieg ein Kichern in ihrer Kehle auf, genau in dem Moment, als der Hall von Laufschritten und das Echo aufgeregter Stimmen an ihr Ohr drangen. Die Hand auf den Mund gepresst, zog Emilia sich blitzschnell in den Schutz der Schatten zurück. Ihre Verfolger kamen näher wie Spürhunde, die Fährte aufgenommen hatten. Drei, vier bange Atemzüge später floss ein lautstarker Strom aus Jungenkörpern die Gasse herab. Sie rannten so nah an ihrem Versteck vorbei, dass sie die Augen schloss und still zu beten anfing.
»Ich glaube, sie ist da runter. Zum Campo.«
»Mensch, Peppe. Da müsste sie schon fliegen können. So weit kann sie nicht gekommen sein.«
»Vielleicht hat sie ja einen Besen unter ihrem Kleid versteckt. Zutrauen würd ich’s der schwarzhaarigen Hexe.«
»Wir kriegen sie schon. Teilen wir uns auf.«
»Guter Plan! Und werft einen Blick in die Hauseingänge. Wahrscheinlich hat sich das Türmchen irgendwo verkrochen und heult Rotz und Wasser, weil ihm aufgegangen ist, mit wem es sich da angelegt hat.«
Das hämische Gelächter der Halbwüchsigen brachte ihr Blut zum Kochen, aber sie durfte jetzt keinen Fehler machen. Erst neulich hatte sich die Gänsebande den kleinen Giuliano Bertolozzi vorgenommen, einen Jungen aus ihrer Nachbarschaft. Sie hatten ihn in einen Hinterhof verschleppt, wo er sich bis auf die Unterhose ausziehen musste, dann hatten sie ihn in einen Müllcontainer gesteckt und die Klappe mit einer Fahrradkette verschlossen. Eine ganze Nacht lang hatte der arme Giuliano in stinkenden Restaurantabfällen ausgeharrt, bis ihn die Putzfrau der Trattoria am nächsten Morgen aus seinem furchtbaren Gefängnis befreit hatte.
Emilia presste die Zähne zusammen, bis ihr der Kiefer wehtat. Wären die Kerle nicht in der Überzahl gewesen, dann hätte sie …Heilige Katharina, lass diese Idioten einfach weitergehen! Noch ein stummes Gebet, das sich ewig lang anfühlte, weil zwischen den Gänsen eine heftige Diskussion darüber entflammt war, was denn nun als Nächstes zu tun sei. Am Ende entfernte sich die Meute geschlossen zur Piazza del Campo, ihre Rufe prallten gegen Hausfassaden und eisenbeschlagene Türen und verdunsteten schließlich in der Mittagshitze. Sie zählte hundert Herzschläge, wartete, bis sicher war, dass kein Nachzügler folgte, bevor sie sich aus ihrem Versteck löste und auf die Straße trat.
Rotz und Wasser, von wegen. Eine Volani heulte nicht. Und wenn, dann garantiert nicht wegen ein paar Gansjungen, die zu dumm waren, um … Emilias Gesichtsmuskeln erstarrten. Der neue Anführer der Gänsebande lehnte, gerade mal zehn Schritte von ihr entfernt, an einem rostigen Garagentor und musterte sie ausdruckslos.
Ihr Puls raste. Instinktiv sah sie sich nach einer Fluchtmöglichkeit um, aber ihre Beine wollten ihr nicht mehr gehorchen. Unbeweglich wie ein Fahnenmast stand sie da, hinter dem Rücken das Halstuch versteckt, das seinen Träger als Mitglied der Contrada dell’Oca auszeichnete. Der falschen Contrade, das hatte man ihr daheim schon beigebracht, bevor sie gelernt hatte, wie man mit Messer und Gabel aß.
Der Junge schaute an ihr vorbei, folgte mit den Augen dem Pflaster, an dem nichts gerade war, weder an seinem Lauf noch an seiner Beschaffenheit.
»Sie sind weg«, sagte er überflüssigerweise.
Er. Ale. Für was stand der lächerliche Spitzname überhaupt? Alessandro? Alberto? Alonso?
»Was ist, ragazza? Hat’s dir die Sprache verschlagen? In Gesellschaft deiner Turmfreunde warst du ziemlich mitteilsam. Oder sollte ich eher großspurig sagen?« Er drückte sich mit dem Fuß vom Tor ab und schlenderte, eine leere Limonadendose vor sich her kickend, in ihre Richtung.
Es war nicht so, dass sie Angst bekam. Aber sie wich zurück, sicherheitshalber. Der Junge blieb auf Armeslänge entfernt stehen. Betrachtete sie mit zur Seite geneigtem Kopf, die Hände in den Gesäßtaschen seiner Jeans, deren Bund tief unter der Hüfte saß. Sein T-Shirt war fleckig, sein dunkles Haar zerzaust, seine grünen Augen schimmerten silbern. Wie Olivenblätter.
»Mir hat es höchstens die Laune verschlagen«, antwortete sie. »Habt ihr feigen Kerle denn nichts Besseres zu tun, als kleine Mädchen durch die halbe Stadt zu jagen?«
Emilia war mit ihren dreizehn Jahren beileibe nicht klein. Aber der Satz hatte sich gut angehört, erwachsen irgendwie. Und weil seit geraumer Zeit alle von ihr verlangten, erwachsen zu sein, beschloss sie, noch einen draufzusetzen. Für den armen Giuliano. Und natürlich für die dicke Agata, die behauptete, Emilia besäße nicht genug Mumm in den Knochen, um es mit den Gänsen so aufzunehmen, wie ihr Bruder Matteo es früher getan hatte. Von wegen. Sie nahm es sogar mit ihrem Anführer auf!
»Findest du es nicht erbärmlich, einen Zehnjährigen in eine Mülltonne zu stecken?«, presste sie hervor. »Wenn das zum Ehrenkodex der Contrada dell’Oca gehört, wäre es mir an deiner Stelle peinlich, ihre Farben zu tragen.«
Er hob eine Augenbraue und verschränkte die Arme vor der Brust. Emilia fing zu schwitzen an. Vielleicht war sie doch ein bisschen zu mutig gewesen. Ale war nicht nur zwei, drei Jahre älter als sie, sondern auch größer und wesentlich stärker.
»Keine Ahnung, was du da faselst. Ich weiß nichts davon. Aber da du es schon mal erwähnst«, und zum ersten Mal vibrierte seine Stimme vor unterdrücktem Zorn, »passt es denn zum Kodex der Contrada della Torre, Menschen aus dem Hinterhalt mit Steinen zu bewerfen? Sie anzuspucken und ihnen Dinge zu stehlen? Fragt sich, wer sich hier für welche Farbe schämen sollte.« Sein Blick wanderte von dem purpurfarbenen Tuch, das um ihre Schultern lag, an ihrem Hängerkleid herunter – missbilligend, als begutachte er ein Pferd, das er sicher nicht kaufen wollte, weil es Beine wie ein Storch hatte. Dann streckte er eine Hand aus und krümmte den Zeigefinger. »Du hast etwas, das mir gehört, ragazza arrogante.«
»Ich habe einen Namen, stronzo!« Sie schloss die Finger fester um das Halstuch und ging zwei Schritte rückwärts. Er folgte ihr, reaktionsschnell wie ein Straßenkater, der eine Maus in Schach hielt.
»Mah.« Er schnalzte. »Ist es nicht ein bisschen spät für die offizielle Vorstellungsrunde, Signorina Ich-fürchte-weder-Tod-noch-Teufel? Mutig bist du ja, das muss man dir lassen.«
»Ich hatte gar nicht vor, mich vorzustellen.«
»Warum wundert mich das nicht?« Etwas wie Belustigung blitzte in seinen Augen auf, doch der Ausdruck verschwand genauso rasch, wie er gekommen war. »Du hast mein Fazzoletto geklaut«, knurrte er. »Ich will es zurück. Sofort!«
»Du könntest Bitte sagen.«
Sie hatte keine Ahnung, warum sie ihn provozierte. Vielleicht, weil sie nichts mehr zu verlieren hatte, jetzt, da sie in der Falle saß und ihre nackten Arme bei jedem Versuch, seitlich auszubrechen, am Mauerwerk des Palazzo entlangschrammten, der ihr vor wenigen Minuten noch tröstlichen Schutz geboten hatte. Den Schmerz, den sie sich selbst zufügte, bemerkte sie nicht. Ale schien jede ihrer Bewegungen vorherzusehen. Egal, wohin sie sich wandte, der Gansjunge schob seinen schlaksigen Körper blitzschnell genau dorthin, wo sie einen Fluchtweg witterte. Emilia atmete schneller, flacher. Die Gasse war und blieb menschenleer, niemand kam vorbei, den sie um Hilfe bitten konnte. Wie es aussah, würde sie ihm das blöde Halstuch zurückgeben müssen.
Verdammt noch mal! Sollte sie wirklich ihre Trophäe opfern? Den einzigen Beweis ihrer Furchtlosigkeit und Beleg dafür, dass sie Giuliano gerächt und es deshalb verdient hatte, Matteos Platz als Anführerin der Turmbande einzunehmen? Seit zwei Jahren kämpfte sie um die Anerkennung der anderen, da konnte sie jetzt doch nicht aufgeben. Das taten derzeit einfach zu viele Menschen in ihrem Leben. Papà, der sich abends in seinem Arbeitszimmer einschloss und furchtbare Dinge auf die Schreibtischunterlage zeichnete, während Mamma im Elternschlafzimmer an die Deckenfresken starrte. Nonna, die auf einem Küchenstuhl saß und wartete, bis der Morgen anbrach. Ungebetene Tränen schossen Emilia in die Augen, die sie unwirsch mit dem Handrücken fortwischte.
»Also gut. Ich werde dich bitten.« Ale zuckte die Achseln und ließ die Hände wieder in den Hosentaschen verschwinden. »Dafür musst du mir deinen Namen verraten. Damit es sich wie ein fairer Deal anfühlt.«
Eine überraschende Wendung, die ihre Chance gewesen wäre. Sie hätte ihn beiseiteschubsen und weglaufen können. Doch seine Stimme wurde ihr zum Verhängnis. Er hatte sanft geklungen, fast freundlich, als ob ihre Tränen etwas in ihm erweicht hätten. Verblüfft starrte sie auf die zwei kleinen Kerben neben seinen Mundwinkeln. Ihr Herz klopfte, aber anders als vorhin.
»Ich heiße Emilia«, sagte sie trotzig. »Emilia Volani.«
Es dauerte lange, bis er reagierte.
»Volani«, wiederholte er schließlich. Gedehnt, als wollte sie ihm weismachen, sie sei eine direkte Nachfahrin der heiligen Katharina von Siena. »Bist du mit Luciano Volani verwandt? Dem Capitano Volani?«
Sie nickte und hasste es. Hasste, was ihr Familienname bei den Leuten auslöste. Hasste, dass sie nichts dagegen tun konnte, weil sich die Zeit nun mal nicht zurückdrehen ließ.
Ale räusperte sich. Plötzlich wirkte er verunsichert, was überhaupt nicht zu ihm passte.
»Tut mir leid, ich …« Sein Blick, der sich eben noch herausfordernd in ihren gebohrt hatte, wanderte über die Häuserreihen. Er tat, als wäre ihm vorher nie aufgefallen, dass in dieser Stadt kein Haus die gleiche Höhe wie das andere hatte. »Muss los, glaub ich«, murmelte er.
Zu ihrer Verblüffung machte er kehrt und eilte mit gesenktem Kopf die Straße hinauf. Als ob sie die Rollen getauscht hätten und er nun derjenige auf der Flucht war. Sie hätte froh sein müssen, war es aber nicht.
»He, Ale!«, rief sie und wedelte mit seinem Fazzoletto in der Luft herum. »Wolltest du mich nicht um etwas bitten?«
Er drehte sich um und schien zu überlegen, ob er ihrer Aufforderung folgen sollte. Doch dann schüttelte er den Kopf, winkte und bog um die Ecke. Emilia spürte Enttäuschung. Und Wut, weil es mit einem Mal zu leicht gewesen war.
»Ich hätte dir das hässliche Ding sowieso nicht gegeben!«, brüllte sie in die Gasse, aber das Echo ihrer Entrüstung scheuchte bloß eine Taube auf, die auf einem Fenstersims gedöst hatte. Eine alte Frau im schwarzen Kleid trat aus dem Nachbarhaus. Sie sah Emilia argwöhnisch an, drehte den Schlüssel zweimal im Türschloss und schlurfte in die Richtung, in die Ale verschwunden war.
Emilia wartete. Ein paar Sekunden, Minuten. Vielleicht länger, aber das war ohnehin bedeutungslos. Der Gansjunge, der jetzt mehr von ihr wusste als sie von ihm, kam nicht zurück.
1. Teil
Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet,
das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt,
das Kostbarste, was er im Leben besitzt,
ist die Familie.
Adolph Kolping
1. Kapitel
Bologna, heute.
Emilia.
Nur wenige hundert Meter trennten den modernen Glasbau der Wirtschaftsfakultät vom Palazzo Poggi, dem altehrwürdigen Hauptgebäude der Universität von Bologna. Für Emilia waren es Welten. Besonders jetzt, da sie im Büro ihres Professors saß und bloß sehnsüchtig aus dem Fenster schauen konnte. Sie sollte da unten sein, in dem mit Girlanden und Bannern geschmückten Arkadengang, der die Piazza Verdi umsäumte. Dort, wo ihre Kommilitonen zusammen mit den Studenten der anderen Fakultäten den Beginn der vorlesungsfreien Zeit feierten – mit Musik aus dem Ghettoblaster und jeder Menge Prosecco. Aber Signor Moretti, der bereits seit rund zwanzig Minuten hinter den Papierstapeln auf seinem Schreibtisch hin und her wanderte, hörte sich gern reden, und es dauerte, bis er zur Sache kam.
Bisher hatte sie erfahren, dass Daniele Moretti aus der Nähe von Arezzo stammte und damit sozusagen ein Landsmann von ihr war, bevor er vor rund zwanzig Jahren in die rote Stadt im Norden übergesiedelt war, zusammen mit seiner Frau Marta und seinen drei Söhnen. Die Provinz zu verlassen, behauptete Moretti, sei eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen, obwohl er das Landleben vermisse. Die Weinreben vor der Haustür, die Olivenhaine, die seinen Weg zur Arbeit gesäumt hatten. Den Pecorinokäse nicht zu vergessen, den die Nachbarin selbst herstellte, das Kartenspiel vor der Bar auf dem Marktplatz und überhaupt die beschauliche Langsamkeit des Daseins. Aber er sei schon immer ein rastloser Geist gewesen. Habe bereits während seines Studiums davon geträumt, an einer Universität wie dieser zu unterrichten, einer Institution von Bedeutsamkeit, die schon seit Jahrhunderten Großes für dieses Land leiste. Man sei gerade in seiner Fakultät stolz auf all die vielversprechenden jungen Italienerinnen und Italiener, die Besten ihres Fachs, die zukünftigen Agnellis und Berlusconis …und so weiter und so weiter.
Emilia schob ihre Brille nach oben und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie sich mit dem fortschreitenden Monolog Morettis immer unbedeutender fühlte. Dabei mochte sie ihn recht gern. Er war ein lockerer Typ, der seiner eigentümlichen Vorliebe für verrückte Krawatten einen gewissen Kultstatus verdankte. Morettis Schlipse waren Gesprächsstoff, bei Studenten und Dozenten gleichermaßen, und es hieß, dass in der Cafeteria sogar Wetten darauf abgeschlossen wurden, welches Unikat er wohl dieses Mal aus dem Kleiderschrank gefischt habe. Heute trug er zu seinem Maßanzug winzige Zucchini auf himmelblauem Grund.
Emilia senkte den Blick und widerstand der Versuchung, erneut zur Wanduhr zu schielen. Sie ging ohnehin falsch, was ihr merkwürdig passend erschien. Zeit war etwas, das nur jungen Leuten unter den Nägeln brannte.
»Also, Signorina Volani. Wie grundsätzlich ist das Problem, das Sie mit Ihrem Studiengang haben?«
Im ersten Moment dachte sie, sie hätte sich verhört. Aber Morettis Miene gab ihr zu verstehen, dass mit ihren Ohren alles in Ordnung war. »Ich … ich verstehe die Frage nicht, professore«, brachte sie heraus.
Moretti plumpste in seinen Schreibtischsessel, wodurch er sekundenlang aus ihrem Blickfeld geriet. Er sortierte einige Unterlagen aus der Tischmitte wahllos nach rechts und links, bis eine Lücke entstand, durch die er sie aufmerksam fixierte.
»Gut, versuchen wir es mit der Hintertür. Wie lange kennen wir uns, Signorina Volani? Oder anders ausgedrückt: Seit wann besuchen Sie meine Vorlesungen?«
»Seit … einer ganzen Weile?« Emilias Wangen brannten. Sie hätte wie aus der Pistole geschossen antworten können. Vier Jahre, acht Monate und dreizehn Tage, heute ausgenommen. Dass sie vollkommen falsch an dieser Fakultät war, hatte sie vom ersten Tag an gewusst.
»Es sind fast fünf Jahre, Emilia. Damit gehören Sie zu unseren Langzeitstudenten. Verstehen Sie mich nicht falsch, grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen. Es gibt immer welche, die ein bisschen mehr Zeit als andere brauchen. Aber in Ihrem Fall …« Er beugte sich nach vorn und faltete die Finger unter dem bärtigen Kinn. »Nun, angesichts Ihrer recht moderaten schriftlichen Ergebnisse wundere ich mich ein wenig, denn Ihnen dürfte klar sein, dass das an dieser Universität nicht ausreicht.«
Ihr Puls beschleunigte sich. In Morettis Stimme hatte kein Vorwurf gelegen. Im Gegenteil, sein Ton war verdächtig mild gewesen.
»Ist Ihnen bewusst, dass Sie in den letzten drei Semestern keine der erforderlichen mündlichen Prüfungen abgelegt haben?«
»Ich war an den Terminen krank«, antwortete sie leise und war froh, nicht lügen zu müssen. Sie war tatsächlich unpässlich gewesen, an jedem verdammten Tag, an dem sie sich einer Prüfungskommission hätte stellen müssen. Kalter Schweiß, Bauchkrämpfe, Herzrasen. Früher war es nicht so schlimm gewesen. Hier und da ein Aussetzer während eines Vortrags in der Schule, zweimal war sie beim Führerschein durchgefallen, bevor sie das Dokument in den Händen halten durfte. Dann aber die erste schlimme Panikattacke gleich zu Beginn ihres Studiums, als sie ein Statistikreferat halten sollte, das sie vorher im Schlaf hätte herunterbeten können. In den Folgejahren hatte sie mithilfe von Beruhigungsmitteln ein paar der mündlichen Prüfungen ablegen können – bis sie eines Morgens nicht mehr aufstehen konnte.
»Sie hätten nach einem Ersatztermin fragen können.«
»Das stimmt.«
Moretti schwieg. Dann tat er das, was er mit Vorliebe tat, wenn er nicht mehr weiterkam: Er wechselte das Thema. Emilia kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass der Wirtschaftspsychologe die nächste Hintertür suchte, durch die er in ihren Kopf klettern konnte. Oder in ihr Herz, weil dort das Problem schlummerte.
»Fahren Sie in der vorlesungsfreien Zeit nach Hause? Nach Siena?«
Sie nickte, unfähig zu verhindern, dass ihre Mundwinkel nach oben zuckten. Siena. Keiner, selbst wenn er aus dem benachbarten Arezzo stammte, würde jemals verstehen oder gar nachempfinden können, was allein der Klang dieses Namens in jemandem auslöste, der in dieser Stadt geboren und aufgewachsen war. Landleben, ja. Provinz, durchaus. Aber ihre Stadt war alles andere als langsam und beschaulich. Siena war lebendig, ein Organismus mit einem wild schlagenden Puls, der über ein Adernetz aus Blut und Feuer alles miteinander verband – und es gleichzeitig spaltete, in siebzehn Stadtbezirke, siebzehn Contraden.
Moretti war ihre Reaktion nicht entgangen. Lächelnd lehnte er sich zurück, der lauernde Ausdruck in seinen Augen blieb.
»Erzählen Sie mir etwas über sich, Emilia. Etwas, das ich nicht googeln kann, denn der Name Volani ist ja nun jedem ein Begriff, der etwas von italienischen Schuhen versteht.« Er lachte etwas gequält. »Meine Frau gehört zu Ihren besten Kundinnen. Sie schwört, dass es keine bequemeren Frauenschuhe gibt. Zeitlos, elegant und trotzdem keine Blasen an den Zehen.« Moretti schnippte mit den Fingern. »Ihr Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Ich nehme an, dass Ihre Studienwahl darauf abzielt, in seine Fußstapfen zu treten? Bietet sich ja auch an. Ich habe gelesen, dass Sie mittlerweile auch Filialen in Mailand, Florenz und Rom eröffnet haben. Ein expandierendes Unternehmen also.«
Emilias Herz klopfte. Es war erstaunlich, wie zielsicher dieser Mann, der in den letzten fünf Jahren kaum ein persönliches Wort mit ihr gewechselt hatte, den Finger in ihre größte Wunde legte. Ein expandierendes Unternehmen. Das war die Calzoleria Volani zweifellos. Wobei: Niemals würde die Schuhmanufaktur ihr gehören, wenn sie so weitermachte. Da war Papà unerbittlich. Solange sie keinen Bachelor vorzuweisen hatte, würde er sie höchstens in der Versandabteilung schuften lassen.
»Ja, das war … so ist der Plan«, log sie. »Mein Vater hat viel zu tun, da er neben der Leitung der Firma der Capitano unserer Contrade ist und sich um die Angelegenheiten des Palio kümmern muss. Es wird Zeit, dass er entlastet wird.« Sie versuchte ungezwungen zu sprechen, auch wenn sie sich wie gelähmt fühlte. Ein Dauerzustand, seit Papà ihr vorgeschlagen hatte, zunächst ein BWL-Studium zu absolvieren, bevor er sie als Nachfolgerin in Betracht zog. Als hätte er geahnt, dass sie scheitern würde. Schließlich war sie bloß ein Mädchen. Nicht gemacht für eine Führungsposition, die er ursprünglich jemand anderem geben wollte. Aber das Schicksal tat, was es wollte, das wusste sie als Sienesin genau. Ihr blieb nur der Kampf gegen den Geist ihres älteren Bruders, der noch immer auf dem leeren Stuhl im Esszimmer ihres Elternhauses saß und alles besser konnte, egal, wie sehr sie sich anstrengte.
»Ah, der Palio! Natürlich. Das große Pferderennen auf der Piazza del Campo. Es ist also bald wieder so weit.« Morettis Blick blieb auf ihrem Gesicht haften. Ihnen war beiden bewusst, dass er ihr Gestotter durchschaut hatte. »Es heißt, für die Leute aus Siena fände der Palio das ganze Jahr statt. Ist das wirklich so? Ein riesengroßes Tamtam um ein Ereignis, das nicht mal zwei Minuten dauert?«
»Neunzig Sekunden«, korrigierte Emilia mit einem höflichen Lächeln und versuchte, sich nicht an Morettis abschätziger Ausdrucksweise zu stören. »Aber es ist nicht bloß ein Pferderennen. Es ist …« Sie suchte nach Worten. Es fiel ihr schwer zu erklären, was der Palio für die Bewohner Sienas bedeutete, die einer Contrade angehörten. Ein Lebensgefühl ließ sich nun mal nicht leicht beschreiben, weshalb sie es meist bei einer Andeutung und einem Achselzucken beließ.
Moretti lachte und tat, als verstünde er das Ungesagte, doch er verstand nicht das Geringste. Stattdessen kam er unumwunden auf das zurück, was er bereits vor einer halben Stunde in wenige Sätze hätte packen können.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen einen Ratschlag mit nach Hause gebe, Signorina Volani?«, fragte er, als ob sie eine Wahl hätte.
In Erwartung einer freundlichen, wenn auch bitterernst gemeinten Ermahnung straffte Emilia den Rücken. Einerseits war sie erleichtert, dass der Professor das Gespräch beendete, andererseits fürchtete sie sich vor dem, was er ihr mitteilen würde. Morettis Blick wanderte zum Fenster und verlor sich kurz in dem wolkenlosen Blau, das erfüllt war von Straßenlärm, Stimmengewirr und Gelächter.
»Wissen Sie, es gibt öfter Momente im Leben, in denen wir hinterfragen, ob das, was wir tun, das Richtige für uns ist. Da mache ich selbst keine Ausnahme. In Anbetracht der beruflichen Möglichkeiten, die sich jungen Menschen in der Welt eröffnen, ist es ganz normal zu zweifeln. Wenn dieses Zweifeln allerdings zum Dauerzustand wird …« Der Professor legte eine bedeutungsschwere Pause ein, in der er mit seiner Aufmerksamkeit zu ihr zurückkehrte. Er wirkte verständnisvoll, so, als wisse er tatsächlich, wie es in ihr aussah. »Wenn es Ihnen Bauchschmerzen bereitet und dazu führt, dass Sie sich Situationen lieber entziehen, anstatt sie entschlossen zu meistern … dann sollten Sie sich überlegen, ob das, was Sie wollen, auch das ist, was Sie brauchen. Heutzutage ist ein Studienabbruch keine Schande mehr, sondern eröffnet andere Möglichkeiten. Natürlich können Sie sich weitere zwei, drei Jahre in der hinteren Bankreihe verstecken, aber das wird Sie nicht voranbringen. Die Fakultät übrigens auch nicht. Kurz gesagt …« Moretti schälte sich umständlich aus seinem Schreibtischsessel. »Nutzen Sie Ihren Heimaturlaub, um eine Entscheidung zu treffen. Zum Besten aller.«
Sie erhob sich ebenfalls. Ihre Handflächen waren feucht, weshalb es sie Überwindung kostete, die Hand zu ergreifen, die Moretti ihr hinhielt. Sein Händedruck war fest und aufmunternd.
»Danke für Ihren Rat. Ich werde ganz bestimmt darüber nachdenken.« Sie steuerte nach einem unverbindlichen Lächeln die Tür an, bevor er bemerkte, wie sehr seine Worte sie getroffen hatten. Dennoch hielt sie aus undefinierbarem Grund inne, ehe sie die Klinke drückte.
»Professor Moretti?«
»Ja?«
Er stand jetzt am Fenster, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und betrachtete das Treiben der Studenten auf der Piazza, als wäre er gern selbst Teil der Party und nicht derjenige, der den Spaß beenden musste, sobald er ausartete. Für einen kurzen Moment sah sie ihn nicht mit den Augen einer Studentin, und stellte überrascht fest, dass er ein wenig verloren wirkte. Als würde ihm trotz des beruflichen Erfolgs etwas Grundlegendes fehlen. Sie konnte den Gedanken an nichts Konkretem festmachen, es war lediglich ein Gefühl, das vielleicht etwas mit handgeschöpftem Pecorino, Weinbergen und einem langsamen, beschaulichen Dasein zu tun hatte.
»Wegen des Palio …« Sie hob das Kinn.Allein das Wort auszusprechen genügte, um ihr ins Gedächtnis zurückzurufen, wer sie war. »Er ist mehr als ein bisschen Tamtam«, sagte sie ruhig. »Sehr viel mehr.«
Alessio.
»Was soll das heißen, er hat ein neues Pferd?« Mit schmalen Augen musterte Alessio sein Mobiltelefon, aus dem eine aufgeregte Frauenstimme schrillte. »Moment, Mamma, ich bin gerade an einer Tankstelle und muss … Warte einen Augenblick, ja?«
Er warf der blonden Kassiererin ein Lächeln zu, klemmte das Telefon zwischen Kinn und Schulter und durchforstete den Rucksack nach seiner Brieftasche. Natürlich wurde er nicht fündig, weil er sich verflucht noch mal nicht daran erinnerte, wo er das winzige Ding verstaut hatte, in dem sich sein letzter Zwanziger befand. Er hätte sich gleich ein Busticket davon kaufen sollen, statt auf die dämliche Idee zu kommen, per Anhalter nach Hause zu fahren. Draußen hatte es angefangen zu regnen, und in den vergangenen zwei Stunden hatte er es gerade mal von seiner Studenten-WG im Zentrum bis zur Stadtgrenze geschafft. Ihm war vorher gar nicht bewusst gewesen, dass er so gefährlich aussah, dass niemand ihn mitnehmen wollte. Mamma plapperte indes unbeeindruckt weiter.
»Ich hab ihm gleich gesagt, dass die Stute bösartig ist. Aber du kennst deinen Vater ja, nie hört er auf die Stimme der Vernunft. Nicht, dass er überhaupt eine solche Stimme hätte. Und was hat dieser Sturkopf davon? Sechs Wochen, sagen die Ärzte, mindestens. Du solltest den Gips sehen, den sie ihm …«
»Tut mir leid«, formte er mit den Lippen, was dem Mädchen hinter der Theke immerhin ein Nicken entlockte, wenn auch kein verständnisvolles. An der Tankstelle war die Hölle los, und er hielt den Betrieb wegen einer Zitronenlimonade und einem überteuerten Panini auf, das er offensichtlich nicht bezahlen konnte.
»… Heilige Mutter Gottes, das hässliche Gipsdings geht ihm von der Ferse bis zur Hüfte! Wie eine frisch verputzte Kirchensäule sieht er damit aus, èterribile, es ist furchtbar, ganz schlimm …«
Er hätte draußen telefonieren sollen. Die amüsierten Blicke der anderen Kunden bestätigten ihm, dass seine Mutter es mal wieder schaffte, über zweihundert Kilometer Entfernung hinweg einen kompletten Laden zu unterhalten. Dabei hatte sie noch gar nicht richtig losgelegt.
»… ein Oberschenkelhalsbruch, und er hat noch Glück gehabt, aber dein Papà tut, als hätte er sich bloß den kleinen Zeh verstaucht … Aber du weißt, wie er ist. Hat nur den Palio und seine Gäule im Kopf, und dein Bruder ist nun wirklich keine große Hilfe auf dem Hof. Alessio, du musst nach Hause kommen. Sofort!«
»Das ist mir klar, Mamma. Ich bin ja schon auf dem Weg.« Alessio gab die Suche nach seiner Brieftasche auf und bat die Kassiererin mit einer verlegenen Geste, zuerst die anderen Kunden zu bedienen, während er in seiner Jacke nach vergessenen Münzen fahndete. Eine steile Falte erschien auf ihrer Stirn, als er beiseitetrat, um einem älteren Herrn den Vortritt zu lassen. Settimio wäre so etwas garantiert nicht passiert. Sein kleiner Bruder musste nicht mal lächeln, damit ihm die Frauen aus der Hand fraßen. Mamma redete immer noch. Abwesend presste Alessio das Telefon an die Brust und bemerkte erst jetzt die dunkelhaarige, junge Frau vor dem Heißgetränkeautomaten. Falls er ihren Gesichtsausdruck richtig deutete, war das Ding vor allem gut darin, Münzen zu schlucken, statt Kaffee auszuspucken. Ihre Blicke kreuzten sich, aber sie schien ihn gar nicht wahrzunehmen.
»Alessio? Bist du noch dran? Es ist ja nicht so, dass wir auf dem Hof ohne dich nicht klarkommen würden, aber … Ich weiß, du musst lernen, und dann hast du ständig diese anstrengenden Nachtschichten. Isst du überhaupt genug, mein Schatz? Du weißt, mit vollem Bauch denkt es sich besser, und du bist sowieso viel zu dünn ge… Oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich dich mit meinen Sorgen belästige, wo du doch kurz vor dem Abschluss stehst.«
»Es ist schon in Ordnung. Die Familie geht vor«, sagte er mit gedämpfter Stimme und wandte sich vom Verkaufstresen ab, um sein Mittagessen zurückzutragen. Sein Magen knurrte und erinnerte ihn daran, dass er zuletzt gestern Abend in der Tierklinik etwas gegessen hatte. Einen halben Becher Instantnudelsuppe, den er wegen eines Notfalls stehen gelassen und danach vergessen hatte. »Außerdem habe ich das Examen so gut wie in der Tasche, und in der Uni finden keine Vorlesungen mehr statt. Ich kann zu Hause lernen.«
»Fährst du mit dem Bus? Soll ich dir Geld für das Ticket schicken? Das geht auch online, Settimio hat mir gezeigt, wie ich das machen muss.«
»Ein Freund aus Siena nimmt mich mit. Der Umweg über Castellina macht ihm nichts aus«, log er, obwohl er tatsächlich keine Ahnung hatte, wie er nach Hause kommen sollte. Aber seine Mutter steckte ihm andauernd etwas zu, dabei hatte Settimio ihm erzählt, dass sie bereits die Altkleidersäcke aus dem Keller holte, um zu sehen, was sich noch flicken ließ. So weit war es also schon.
»Hör auf, dir Sorgen um mich zu machen, okay? Das Praktikum ist zwar mies bezahlt, aber es reicht für das Nötigste«, sagte er betont unbeschwert. »Kümmer dich lieber um Papà, er braucht dich. Ich komme so schnell wie möglich.« Und wenn er bis ins Chiantital laufen musste.
»Bist du ganz sicher, dass ich dir nicht doch noch rasch etwas überweisen soll?«
»Ehrlich, ich brauche nichts. Ciao, Mamma, wir sehen uns gegen Abend.« Er legte auf, bevor sie auf die Idee kam, laute Küsse durch die Leitung zu schicken, die ihm den letzten Rest seiner Würde rauben würden. Die Leute hier hielten ihn sowieso schon für einen mammone, ein Muttersöhnchen, bis auf die Kundin, die entnervt auf den Knöpfen des Kaffeeautomaten herumdrückte und blind und taub für ihre Umgebung war. Er hielt einen Moment inne, um die Frau zu beobachten. Aus alter Gewohnheit steckte er die Hände in die Gesäßtaschen seiner Jeans und ertastete die Münzen, die er vorhin gesucht hatte. Wenigstens einen Kaffee schien das Schicksal ihm zu gönnen.
Im nächsten Moment ertönte ein ohrenbetäubender Knall. Der Getränkeautomat fauchte und setzte sich stotternd in Gang, auf dem bebrillten Gesicht der jungen Frau zeigte sich grimmige Befriedigung. Als sie ein zweites Mal gegen die Blechverkleidung trat, hätte Alessio beinahe gelacht. Na, die traute sich was.
»He! Was machen Sie da?«, rief die Kassiererin alarmiert und eilte hinter dem Tresen hervor.
Die Angesprochene reagierte nicht, sondern betrachtete gelassen den wässrigen braunen Strahl, der in den Pappbecher plätscherte. Es war kein guter Kaffee, das roch Alessio sogar aus der Entfernung. Doch nach kaum zwei Stunden Schlaf war er nicht wählerisch. Kaffee war Kaffee, und sein Gaumen zog sich sehnsüchtig zusammen.
»Wenn Sie den Automaten kaputt machen, Signora, müssen Sie den bezahlen!«, keifte die Kassiererin und stemmte die Hände in die Hüften.
Die Frau zog den Becher heraus und drehte sich um. Ihr Blick haftete sich über den schwarzen Brillenrand hinweg auf die Frau im Servicekittel. Alessio hielt den Atem an. Er war gut darin, Körpersprache zu lesen, ob bei Tieren oder Menschen. Mag sein, dass er übermüdet war, aber aus undefinierbarem Grund versagte bei dieser Frau sein Instinkt. Weder in ihrem Gesicht, dessen gebräunte, sommersprossige Haut in reizvollem Kontrast zu ihrer schwarzbraunen Kurzhaarfrisur stand, noch in ihrer reglosen Haltung zeichnete sich ab, wie sie auf den Angriff reagieren würde. Ihm blieb vorläufig nur, ihr Alter zu schätzen. Mitte zwanzig, demzufolge war sie etwas jünger als er. Aus ihren Markenklamotten schloss er, dass man bei ihr zu Hause garantiert keine Sachen aus Altkleidersäcken flickte. Unauffällig trat er näher an die Kaffeemaschine heran. Nur zur Sicherheit, bevor in diesem Laden noch irgendetwas zu Bruch ging.
Es dauerte eine geraume Weile, bis er merkte, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet hatte. Sie schob die Brille nach oben und runzelte die Stirn, als überlegte sie angestrengt, ob sie einander schon mal begegnet waren. Verrückt. Aus der Nähe erging es ihm ganz ähnlich, obwohl das vollkommen ausgeschlossen war. An eine Frau wie sie würde er sich erinnern.
»Natürlich bezahle ich die Maschine, sollte ich sie kaputtgemacht haben«, sagte sie schließlich, ohne ihre Augen von ihm zu lösen. Ihre Stimme war tiefer, als er bei einer Frau ihres Alters erwartet hatte, mit einem Timbre wie ein Seidentuch. Und dann, völlig unverhofft, bogen sich ihre Lippen zu einem mitfühlenden Lächeln nach oben. »Sie sehen aus, als hätten Sie den nötiger als ich.«
Verblüfft starrte Alessio auf den Kaffeebecher, den sie ihm in die Hand gedrückt hatte. Wie zum Abschluss einer Theaterszene, die jeder im Raum mit Spannung mitverfolgt hatte, löste sich die Stille auf und machte den üblichen Geräuschen Platz, die ungeduldige Kunden verursachten. Hüsteln, lange Seufzer. Ein Schlüsselbund rasselte. Die Kassiererin trollte sich hinter die Theke. Verwirrt wandte Alessio sich seiner Gönnerin zu, doch der hastig gemurmelte Dank erstarb auf seinen Lippen. Die Frau war verschwunden.
»Ihr gehört der weiße Fiat an Zapfsäule vier. Sieneser Kennzeichen«, rief der ältere Herr, dem er an der Kasse den Vortritt gelassen hatte. Der Mann zeigte mit einem vergnügten Zwinkern zur Tür. »Wenn du dich beeilst, mein Junge, erwischst du la bella ragazza noch, bevor sie aufs Gaspedal tritt.«
Sieneser Kennzeichen. Unter normalen Umständen wäre Alessio der Aufforderung nie gefolgt. Nicht, weil er schüchtern war. Er wollte bloß nicht aufdringlich sein, so wie viele seiner Geschlechtsgenossen, die einen spendierten Kaffee garantiert als Einladung zu mehr verstünden. Aber er befand sich in einer Notlage. Er musste nach Hause, dringend. Und es sah so aus, als stünde an Zapfsäule Nummer vier die Lösung seines Problems.
»Worauf wartest du?« Der Alte schnalzte mit der Zunge, als müsse er einen störrischen Esel antreiben. »Hol dir das Mädchen!«
Alessio machte sich nicht die Mühe, irgendetwas richtigstellen zu wollen. Er stürzte den lauwarmen Kaffee herunter und raffte sein Gepäck zusammen. Dann stolperte er, begleitet von Gelächter, nach draußen.
Emilia.
Ursprünglich hatte sie sich fest vorgenommen, während der zweistündigen Fahrt nach Hause eingehend über Morettis Worte nachzudenken. Doch dann war ihr dieser Kerl vor die Füße gestolpert. Atemlos, verlegen, bis auf den letzten Cent abgebrannt. Es war ihm spürbar unangenehm gewesen, um eine Mitfahrgelegenheit bitten zu müssen, wie hätte sie ihn da abweisen können? Er hatte so furchtbar erschöpft gewirkt, und der kleine Ort Castellina lag sozusagen auf ihrer Wegstrecke. Außerdem hatte Nonna ihr und ihrer kleinen Schwester Aurelia stets eingebläut, dass man jemandem, der um Hilfe bat, nicht die Tür vor der Nase zuschlug. Eine Autotür, in diesem Fall.
Seufzend betätigte Emilia den Blinker und wechselte auf die Spur in Richtung Florenz. Es veranstaltete schon komische Sachen, das Schicksal. Immer wenn sie im Begriff war, sich endlich einzugestehen, dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige für sie war, zeigte es unmissverständlich, dass es eigene Pläne mit ihr hatte. So auch jetzt. Sie wollte nachdenken, sich auf das zweifellos unangenehme Gespräch mit Papà vorbereiten – und bekam prompt Gesellschaft. Nicht, dass ihr neuer Reisegefährte besonders redselig gewesen wäre. Dennoch vertagte sie ihre Entscheidungsfindung, und es wäre gelogen, hätte sie behauptet, sie wäre nicht froh darüber gewesen.
Sie warf einen neugierigen Blick zur Seite. Zweifellos hatte der spendierte Kaffee seine Wirkung verfehlt. Binnen weniger Minuten war der junge Mann auf dem Beifahrersitz eingenickt. Er lehnte am Fenster, die Baseballkappe in die Stirn gezogen, die Arme fest um seinen Rucksack geschlungen, als wäre er sein einziges Hab und Gut. Sein Bart war zu lang und weckte in ihr das Bedürfnis, unterwegs bei einem Barbier zu halten. Er roch auch seltsam, nach Tütensuppe und Desinfektionsmittel, als käme er direkt aus einem Krankenhaus. Ob er krank war? Sie unterdrückte das Gefühl der Beklemmung, das unweigerlich in ihr aufstieg, wenn sie an kaltweiße Klinikflure und piepende Apparaturen dachte. Stattdessen konzentrierte sie sich auf den zäh fließenden Verkehr, an dem ausnahmsweise mal nicht die Touristen schuld waren. Die Urlauber würden erst im Hochsommer in die legendäre Postkartenidylle der Toskana einfallen, ausstaffiert mit Wohnwagen, Dachgepäckträgern und angestrengten Gesichtern, in denen sich die nächtlichen Fahrtstunden abzeichneten. Im Mai hingegen gehörten die Straßen den Teerflickern und Asphaltkosmetikern. Auf den Hauptrouten in den Süden löste eine Baustelle die nächste ab, und Emilia fragte sich nicht zum ersten Mal, warum dieses Land zwar genügend Geld besaß, um korrupte Politiker zu schmieren, aber zu geizig war, um ordentliche Straßen zu bauen. Leider konnte sie sich die Antwort der feisten Volksvertreter gut vorstellen, deren Hauptaufgabe darin bestand, Zigarren rauchend in antiken Polstersesseln zu sitzen.
»Aber warum sollten wir die Straßen neu machen, wenn wir sie doch reparieren können?«, würden sie fragen und dieses verständnislose Lächeln zeigen, das so falsch war wie die Kopie einer Gucci-Tasche. »Per essere sincero, um ehrlich zu sein, das interessiert doch keinen, am wenigsten die Touristen. Sie heben den Kopf, blicken über unsere wunderbare Landschaft, denken an Chianti, Pasta und la Dolce Vita – und schwups. Schon ist es vergessen, das klitzekleine Loch in der Straße.«
Emilia schnaubte leise, weil sie wusste, dass sich das klitzekleine Loch, Landschaft hin oder her, schon sehr bald in der Mehrzahl bemerkbar machen würde.
Letztlich war es nicht der Straßenbelag, sondern der Signalton der Telepass Box in ihrem Auto, der ihren schlafenden Reisebegleiter weckte, als sie die Mautstelle passierte. Er fuhr in die Höhe, sofort hellwach wie jemand, der es gewohnt war, aus dem Schlaf gerissen zu werden.
»Ich muss eingenickt sein«, murmelte er.
»Ist wohl spät geworden gestern«, sagte sie, um einen scherzhaften Unterton bemüht, damit er nicht das Gefühl hatte, etwas falsch gemacht zu haben.
»Ich hatte Nachtdienst. In der Tierklinik.« Er blickte aus dem Fenster, sinnierend und gleichzeitig fasziniert, als sähe er zum ersten Mal einen Weinberg. Und er hatte recht. Auch sie war immer wie verzaubert, wenn sich die sanften, mit Olivenbäumen und Rebstöcken bewachsenen Hügel des Chiantitals vor ihr ausstreckten wie ein zum Leben erwachtes Gemälde.
»Sind Sie Tierpfleger?«, fragte sie höflich.
»So ähnlich. Ist bloß ein Aushilfsjob.« Er wandte sich ihr zu, hatte aber offenbar keine Lust, das Thema weiter zu vertiefen. »Und Sie? Sind Sie eine echte Sienesin?«
»Mit Leib und Seele.« Sie tippte vielsagend gegen den schwarz-weißen Stadtwappenanhänger, der am Rückspiegel baumelte. Es gefiel ihr, dass er sich für sie interessierte. Sie kannte nur Männer, die beim ersten Kennenlernen ausschließlich von sich selbst redeten. »Ich studiere in Bologna.« Sie schnaubte leise. »Diese Universität ist wirklich eine der schlechtesten Entscheidungen, die man im Leben treffen kann.«
»Wieso das?«
»Weil das Studentenleben völlig überschätzt wird und ein BWL-Studium das Langweiligste ist, mit dem man seine Zeit verplempern kann.« Sie warf ihm einen Seitenblick zu. Er war kein Student, da war sie sich fast sicher. Sie konnte ihn sich unmöglich in einem Vorlesungssaal vorstellen. Männer seines Schlags gehörten in die Natur, dorthin, wo man die Olivenbäume zählte, die man eigenhändig in die Erde gepflanzt hatte – keine Daten in Exceltabellen. Der Glückliche, schoss es ihr durch den Kopf, auch wenn sie die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt kannte und sich nicht vorstellen mochte, wie es war, wenn man sich mit Aushilfsjobs über Wasser halten musste. In ihrer Familie war Geld nie ein Thema gewesen. Und trotzdem wünschte sie sich manchmal ein anderes Leben. Eines, das ihr allein gehörte und in dem ein akademischer Grad keine Rolle spielte.
»Warum tun Sie es dann? BWL studieren, meine ich.«
Emilia atmete scharf ein. Seine Frage war harmlos und eine natürliche Reaktion auf das Gesagte. Trotzdem fühlte sie sich angegriffen. Als säße Professor Moretti hinter ihr und durchbohrte sie über den Rückspiegel mit Blicken.
»Die Familie. Mein Vater will es so.«
»Verstehe.« Er nickte, als verstünde er tatsächlich.
»Das Problem haben Sie wahrscheinlich nicht.«
Er antwortete verzögert. »Nicht wirklich, nein.«
»Wartet in Castellina ein neuer Aushilfsjob auf Sie?«
»Ein neuer …« Er runzelte die Stirn, dann zuckte sein Mundwinkel. »So kann man es nennen, ja.«
»Aha. Helfen Sie in den Weinbergen?«
»Auf einem Gestüt.« Er hatte ein nettes Lächeln. Es wirkte ehrlich und ein bisschen herausfordernd und weckte in ihr erneut das Gefühl des Wiedererkennens, das sie schon an der Tankstelle gespürt hatte. Es wäre gelogen, wenn sie behaupten würde, dass dieser Mann sie nicht neugierig machte.
»Sie können also gut mit Pferden.«
»Das behaupten einige, ja.«
Sie lachte. »Muss man Ihnen immer jedes Wort aus der Nase ziehen?«
»Tut mir leid. Ich hatte …«
»Nachtschicht. Sie erwähnten es«, sagte sie teilnahmsvoll. »Muss anstrengend sein.«
Er schwieg, und Emilia fragte sich, ob sie sich getäuscht hatte. Anfangs dachte sie, er fände sie nett, doch jetzt wirkte er distanziert wie jemand, der einzig und allein aus Höflichkeit auf ihre Fragen einging und kein Interesse an einer Unterhaltung hatte. Das war ungewohnt. Normalerweise dauerte es keine zehn Minuten, bis man sie nach ihrer Telefonnummer fragte. Er hingegen brauchte nur fünf, um neben ihr einzuschlafen.
»Mögen Sie Pferde?«, wollte er wissen.
Emilia widerstand dem Impuls, ihn anzulügen. Wozu auch, er kam nicht aus Siena und würde die peinliche Wahrheit über die Tochter des Capitano sicher nicht in ihrem Viertel herumerzählen. »Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher«, gestand sie. »Ich mag sie, solange sie auf dem Campo galoppieren und für unsere Contrade den Palio gewinnen. Darüber hinaus finde ich Pferde eher … Ich weiß nicht. Groß? Furcht einflößend?«
Er nickte, und sie bemerkte, dass er sie unter dem Schirm seiner Baseballkappe forschend ansah. Als suche auch er in seiner Erinnerung nach etwas, das er nicht greifen konnte. Ihr Bekenntnis, Angst vor Pferden zu haben, ließ er unkommentiert. Stattdessen deutete er aus dem Fenster, hinter dem sich ein mittelalterliches Dörfchen auf einem Hügel abzeichnete. Castellina in Chianti.
»Da vorn geht es links in einen unbefestigten Feldweg. Sie können mich an der Weggabelung absetzen, von dort aus sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Hof.«
Ob sie ihn nach seiner Nummer fragen sollte? Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie es versäumt hatten, sich einander vorzustellen. Sie wusste nicht mal, wie er hieß. Emilia drosselte das Tempo und folgte mit den Augen seinem Fingerzeig. Zwischen einem Olivenhain und einer umzäunten Pferdekoppel führte ein schnurgerader, von Zypressen gesäumter Schotterweg eine Anhöhe hinauf. Am Straßenrand, eingerahmt von einem rot blühenden Rhododendron, erspähte sie ein Hinweisschild mit Pferdekopf-Emblem. Podere Graziotti.
Sie trat so unvermittelt auf die Bremse, dass die Sicherheitsblockade ihres Gurts einrastete und sie hart in ihren Sitz gepresst wurde. Hinter ihnen ertönte ein entrüstetes Hupsignal, kurz darauf schoss eine Vespa an ihr vorbei. Emilia starrte dem Roller nach, ohne ihn wahrzunehmen, während ihr Reisebegleiter bereits Anstalten machte, auszusteigen. Ob ihn das brüske Bremsmanöver irritiert hatte, zeigte er nicht.
»Da arbeiten Sie?« Ihre Stimme klang belegt. »Bei den Graziottis?«
Er stellte den Rucksack am Straßenrand ab und beugte sich in das heruntergelassene Beifahrerfenster.
»Sagt Ihnen der Name was?« Sein Lächeln war warm, erwartungsvoll. Als würde ihm die Antwort etwas bedeuten.
Ihr Magen zog sich zusammen, bis er klein und hart wurde. Wie eine schwarze, verschrumpelte Olive. Wie ihr Herz. »Nein, der Name sagt mir nichts«, flüsterte sie. »Überhaupt nichts.«
»Möchten Sie das ändern?«
»Was?« Emilia blinzelte.
»Na ja.« Auf einmal wirkte er verlegen. »Sie könnten mich dort besuchen und mir Gelegenheit geben, mich für den Kaffee zu revanchieren.« Er verzog das Gesicht. »Auch wenn er scheußlich geschmeckt hat. Ich heiße übrigens Alessio.«
Wie betäubt betrachtete Emilia die Hand, die er ihr durch das Fenster entgegenstreckte. Es war eine kräftige, große Hand mit kurz geschnittenen, sauberen Fingernägeln. Sie hätte sie gern ergriffen. Es war nicht seine Schuld, aber dieser Ort, der Name auf dem Schild … Es war unmöglich, ihn wiederzusehen, selbst wenn er bloß im Gestüt angestellt war. Ausgerechnet in diesem. In seinen Augen glomm Enttäuschung auf, als sie nicht reagierte.
»Tut mir leid, ich muss los«, murmelte sie.
»Okay, dann … Es war nett, Sie kennenzulernen.« Alessio zog die Hand zurück und tippte mit dem Zeigefinger an den Schirm seiner Kappe, lässig, als wäre ihre Abfuhr keine große Sache. »Vielen Dank fürs Mitnehmen. Man sieht sich? In Siena vielleicht?«
Sie nickte. Bewunderte ihn insgeheim für den zweiten, vorsichtigen Versuch. Rang sich ein Lächeln ab, das sich nicht echt anfühlte, und erkannte, dass er es richtig deutete. Um ehrlich zu sein, lieber nicht.
Er zwinkerte ihr zu und schulterte den Rucksack. Beim Anblick seines Rückens, der sich unter der Last des Gepäckstücks krümmte, brach etwas in ihr auf. Hastig löste sie den Gurt und stieß die Autotür auf.
»Ich gehe nach dem Wochenmarkt oft ins Café Nannini an der Piazza del Campo«, rief sie ihm hinterher, sie erschrak fast selbst vor ihrer eigenen Lautstärke. »Der Cappuccino kostet ein Vermögen da, aber er ist gut. Richtig gut!«
Alessio verharrte mitten auf dem Weg und neigte den Kopf zur Seite, als müsste er überlegen, wie er auf ihren unverhofften Sinneswandel reagieren sollte. Im ersten Augenblick befürchtete sie, er würde einfach weitergehen. Doch dann drehte er sich zu ihr um und hielt grinsend den Daumen hoch.
2. Kapitel
Emilia.
Das alte italienische Herrenhaus ihrer Familie war nichts Besonderes. Wie viele Häuser in Siena wirkte es von außen eher baufällig und stach mit seiner bröckelnden Ziegelsteinfassade, den verwitterten grünen Fensterläden und über Putz gelegten Leitungen kaum aus der Gebäudereihe in der Via Salicotto heraus. Selten schenkte ein Spaziergänger ihm im Vorübergehen mehr als einen flüchtigen Blick, ahnungslos, dass sich hinter der massiven Eichenholztür der Sitz der Contrada della Torre,der Contrade des Turms, befand.
Emilias Herz schlug voller Erwartungsfreude, als sie ihren Rollkoffer abstellte und die kleine Keramiktafel an der Hauswand berührte, auf der ein Elefant mit einem Turm auf dem Rücken abgebildet war. Ihr Wappentier zu streicheln war eine Gewohnheit aus Kindertagen, sie hatte vergessen, ob Auri, Matteo oder sie damit angefangen hatte. Jedenfalls war es lange her, aber das Ritual, mit dem die Volani-Geschwister eine glückliche Heimkehr beschworen, hatte sie bis ins Erwachsenenalter begleitet – zumindest Auri und sie, denn Matteo war nicht mehr da.
Den Hausschlüssel holte sie nicht sofort aus der Handtasche. Nach wochenlanger Abwesenheit war das Bedürfnis zu groß, die Atmosphäre in der Gasse auf sich wirken zu lassen, in der ihr jeder Pflasterstein vertraut war und sie die Klingelschilder nicht lesen musste, um zu wissen, wer in dem jeweiligen Haus wohnte.
Jetzt, am frühen Abend, strahlten die erd- und tonfarbenen Palazzi des südöstlich vom Campo gelegenen Turmviertels in einem mattgoldenen Licht. Die Luft war weich, erfüllt von Stimmen, Essensdüften und Kindergeplärr. Vor dem Ristorante Gallo Nero versprengte die dreirädrige Ape des Lieferdiensts hupend ein paar Touristen, im Obst- und Gemüseladen der Bertolozzis ratterte der Rollladen nach oben und verschluckte für einen Augenblick alle Geräusche, während ein Stockwerk höher der alte Renaldo seine Topfpflanzen goss. Sein Balkon war so winzig, dass gerade mal zwei Stühle darauf passten, einer für Renaldo, der andere blieb stets für seine verstorbene Frau reserviert.
Emilia wartete, bis Giuliano Bertolozzi sie bemerkte und aus dem Laden eilte, in der Hand den obligatorischen Apfel, den er früher aus den Obstkisten hatte stehlen müssen, weil sein Vater ein alter Geizhals gewesen war. Doch seit Giuliano das Geschäft übernommen hatte, waren keine Heimlichkeiten mehr nötig, wenn er die Menschen, die er mochte, beschenken wollte.
»Gut, dass du wieder da bist.« Der Duft von Aftershave hüllte sie ein, als ihr alter Freund sie umarmte, und sie dachte einmal mehr, was für ein ansehnlicher Mann doch aus dem mageren Kerlchen geworden war, der einst der rivalisierenden Gans-Contrade zum Opfer fiel. Klein war er immer noch, aber was ihm an Länge fehlte, glich er durch Breite in Muskelform aus. Heute würde es den Gänsejungs mit Sicherheit nicht mehr so leicht gelingen, ihn in einen Müllcontainer zu stecken.
»Du wirst mich noch irgendwann zerquetschen, Bertolozzi«, sagte sie scherzhaft, als er sie endlich losließ.
»Als ob dich jemand zerquetschen könnte, Emilia. Du hast die Haut eines Elefanten.«
Ja. Und das Herz eines Hasen.
»Täusch dich da mal nicht, mein Lieber.« Sie wackelte mit dem Zeigefinger. »Ich hoffe nicht, dass du allen Frauen solche Komplimente machst. So findest du nie eine Freundin.«
»Wer sagt denn, dass ich eine Freundin will?« Als hätte sie mit ihrer Bemerkung versehentlich einen geheimen Code benutzt, kletterte Giulianos Blick verstohlen die Fassade des Volani-Palazzo hinauf. »Siehst du Auri nachher? Kannst du ihr ausrichten, dass ich heute Morgen Aprikosen bekommen habe? Aus Sizilien. Sie sind ganz reif und süß, und … Die isst sie doch so gern.«
»Klar.« Emilia setzte ein argloses Gesicht auf. »Wenn du willst, nehme ich gleich welche mit. Dann braucht sie nicht extra in den Laden kommen.«
»Schon, aber … vielleicht möchte sie sich die schönsten lieber selbst aussuchen.« Giulianos Lächeln wirkte plötzlich angestrengt. Kaum zu glauben. Er war noch immer in ihre Schwester verknallt.
Emilia wandte sich ihrem Gepäck zu, brachte es aber nicht übers Herz, ihn ohne eine Aufmunterung zurückzulassen. »Ich sage Aurelia, dass sie bei dir vorbeischauen soll, ja? Bestimmt freut sie sich sehr, dass du an sie gedacht hast.« Der letzte Teil war gelogen, aber es war schließlich nicht ihre Aufgabe, Giuliano klarzumachen, dass seine Hoffnung totale perdita di tempo war, reine Zeitverschwendung. Auri hatte noch nie eine Beziehung gehabt, die über eine harmlose Liebelei hinausging. Und ganz bestimmt interessierte sie sich nicht für den netten Nachbarsjungen, dem sie als Fünfjährige einen Schneidezahn ausgeschlagen hatte, weil sie seinen Spielzeuglaster haben wollte.
Ob dieser Alessio ins Nannini am Campo kommen würde? Oder andersherum gefragt: Würde sie dorthin gehen, um ihn zu treffen? Sie war sich nicht sicher, weder was das eine noch das andere betraf. Davon abgesehen hatte sie keine Ahnung, warum sie nicht aufhören konnte, an ihn zu denken.
»Musst du wieder jeden Abend lernen, oder kriegt man dich auch mal in der Società zu Gesicht?«, rief Giuliano ihr nach, als sie Anstalten machte, die Tür zu öffnen. »Ich übe mit den Jungs gerade ein paar neue Fahnenwürfe für den großen Festumzug ein. Komm abends mal runter in die Bar. Ich würde mich freuen, deine Meinung zu hören.«
Emilia verharrte, die Hand auf der Bronzeklinke, die vollen Körpereinsatz erforderte, um sich herunterdrücken zu lassen. Die Società war sozusagen das Herzstück ihres Viertels, das soziale Zentrum der Turm-Contrade. Es bestand aus mehreren Räumen im Erdgeschoss des Palazzo, in denen sich das Gemeinschaftsleben der Stadtteilbewohner abspielte.
Hier, wo Feste gefeiert und Versammlungen abgehalten, Tombolas und Filmabende veranstaltet wurden, war sie praktisch aufgewachsen. Sie hatte nur die Treppe heruntergehen müssen, um ihre Freunde zu treffen oder eine Runde zu kickern. In der Bar hatte sie ihren ersten Drink probiert, der nicht aus mit Wasser verdünntem Wein bestand. Und in dem von einer hohen, mit Efeu bewachsenen Steinmauer umfriedeten Garten hatte sie sich als Sechzehnjährige von ihren Freundinnen trösten lassen, als sie fürchterlichen Liebeskummer wegen Enzo Martelli gehabt hatte. Der war mittlerweile mit der dicken Agata verheiratet – die gar nicht mehr so dick war, während Enzo mit den Jahren ordentlich zugelegt hatte. Emilia unterdrückte ein Lächeln, auch wenn es sie ein bisschen traurig machte, dass Giulianos Frage nicht ganz unberechtigt war.
Es stimmte, seit sie in Bologna studierte, ließ sie sich seltener in der Società blicken, was zum Teil daran lag, dass mittlerweile nur noch die Alten den Treffpunkt regelmäßig besuchten. Die Jungen kamen nicht mehr so oft, weil sich ihr Interesse nicht mehr ausschließlich auf die verschworene Gemeinschaft innerhalb der Contrade beschränkte. Auch Emilia musste zugeben, dass sie sich seit geraumer Zeit nicht mehr richtig wohl in der Società fühlte und meist ihr Studium vorgeschoben hatte, um nicht hinzugehen – was sie sich als Tochter des Capitano eigentlich nicht erlauben durfte. Für Papà war die Contrade heilig. Und der Palio, um den sich letztlich alles drehte.
Giuliano lehnte mit verschränkten Armen in der Ladentür und wartete auf ihre Antwort. Er gab sich lässig, aber sie spürte, dass er sie aufmerksam beobachtete. Auch für Giuliano Bertolozzi war die Contrade der Mittelpunkt des Lebens, das war schon so gewesen, als er ein Kind war. Zudem war er der einzige Contradaiolo, den sie kannte, der sein Fazzoletto nicht nur in den Tagen des Rennens, sondern das ganze Jahr trug.
»Sicher schaue ich demnächst in der Società vorbei. Ich wollte mich sowieso für den Freiwilligendienst in der Küche eintragen«, sagte sie und garnierte ihre Zusicherung mit demselben Lächeln, das sie ihm als Aufmunterung wegen ihrer kleinen Schwester geschenkt hatte. Anschließend bugsierte sie ihr Gepäck über die Schwelle, und die schwere Holztür fiel hinter ihr ins Schloss.
Im Bogengang des offenen Innenhofs standen in jedem Winkel Pflanztöpfe, Feigenbäume, Oleander, Rosmarin und Bougainvilleen. Vom Wassergeplätscher des Springbrunnens und dem Geräusch ihres Rollkoffers abgesehen, war es vollkommen still, als würden die Mauern jeden Laut von außen schlucken. In dem plötzlichen Bedürfnis, ein Lebewesen zu sehen, hielt Emilia Ausschau nach den streunenden Katzen, denen Nonna morgens Futter hinstellte. Doch sie entdeckte nicht mal eine der Ringeltauben, die sonst auf dem Eisengeländer im oberen Stock hockten und ihrem Vater mit ihrem Gegurre so auf den Nerv gingen, dass er mit dem Luftgewehr auf sie schoss. Trotz einer beachtlichen Ahnenreihe von adligen Wildschweinjägern in seinem Stammbaum war er zum Glück ein echt mieser Schütze, was wohl auch die Tauben wussten. Sie kamen immer wieder, wenn auch nicht heute.
Enttäuscht stieg Emilia die Treppe zum privaten Teil des Palazzo hinauf. Hier wohnten die Volanis, oder vielmehr: residierten. Papà benutzte das Wort häufig, wenn er vor wichtigen Leuten angeben wollte, die er brauchte, um seine Palio-Geschäfte zu tätigen. Wie diese Geschäfte vonstattengingen, bei denen es immer um eine Menge Geld ging, wusste niemand so richtig. Selbst gegenüber seiner eigenen Familie schwieg der Capitano sich aus, was genau er veranstaltete, um ihrer Contrade zum Sieg zu verhelfen. Allerdings schienen seine Strategien nicht recht aufzugehen. Der Turm hatte seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen und wurde von den anderen Contraden bereits als nonna, die Großmutter des Palio, verhöhnt. Dennoch wählte die Stadtteilkommission Luciano Volani jedes Jahr erneut zum Capitano, weil es niemanden gab, der sich den schwierigen Job zutraute.
Oben angekommen musterte Emilia den Zettel, der mit Tesafilm an der Tür klebte:
Cara mia, ich bin eben zu den Biscottis rübergegangen, ein Problem lösen. Abendessen ist für neun bestellt, ich habe im Gallo Nero Bescheid gesagt, dass du anrufst, um zu sagen, was du haben willst. Die Nummer hängt am Kühlschrank. xo Nonna.
Emilia nahm die Nachricht ab und schloss auf. Der Flur war eine Art Fortführung des Bogengangs im Erdgeschoss. Hellgraue Fliesen, an den Wänden hingen wertvolle alte Stiche von der Piazza del Campo. Die Küche war blitzsauber, der Gasherd in der Kücheninsel unbenutzt, die Arbeitsflächen leer. Das Ambiente erinnerte fast an ein Foto aus einer Wohnzeitschrift: Es bot sich dem Betrachter an, gab aber nichts über die Menschen preis, die dort lebten.
Nachdenklich musterte Emilia die Obstschale auf dem Tisch, in der drei makellose rote Äpfel lagen. Was hatte sie erwartet? Krümel auf der Arbeitsplatte und schmutziges Geschirr in der Spüle? Die fröhlichen Stimmen von Leuten, die mal eben vorbeigeschaut hatten und auf einen zweiten Kaffee geblieben sind, dazu der Duft von frisch gebackenem Pan di Ramerino, aus dem Auri immer die Rosinen herauspickte, weil sie die nicht mochte? Eine Umarmung, ein Lächeln, irgendetwas, das sich nach Heimeligkeit und – verdammt noch mal – Leben anfühlte?
Sie holte Giulianos Apfel aus der Jackentasche und legte ihn in die Schale. Er war unförmig und nicht annähernd so perfekt wie die anderen. Als hätte man ein Kuckuckskind in ein fremdes Nest geschummelt. »Willkommen daheim«, sagte sie leise.
Im zweiten Stock erwarteten sie ein weiterer Bogengang und eine antike Kommode, auf der drei Pferdestatuen aus Alabaster standen. Nonna wachte mit Argusaugen darüber, dass keiner sie anfasste, aber niemand in diesem Haus hatte sich je an das Verbot gehalten. Emilia strich mit den Fingerspitzen über den warmen, weichen Rücken einer Pferdefigur, ignorierte die Tür, die seit Jahren verschlossen war, und klopfte bei ihrer Schwester. Als niemand antwortete, drückte sie die Klinke herunter und betrat das verlassene Jugendzimmer, das keinerlei Hinweis darauf lieferte, dass seine Bewohnerin alt genug war, um auf Plüschtiere im Bett und Leuchtsterne an der Decke zu verzichten. Neugierig musterte sie die Wand über dem Schreibtisch, die Auri alle paar Wochen neu gestaltete und jetzt mit Schwarz-Weiß-Fotos gespickt war. Die meisten zeigten amerikanische Schauspieler aus den Fünfzigerjahren, aber Emilia entdeckte auch einige Schnappschüsse, auf denen ihre Schwester zu sehen war. Sie stammten offenbar von Agatas Hochzeit vor einigen Monaten. Der Fotograf hatte Auris natürliche, elfenhafte Schönheit derart gekonnt eingefangen, dass Emilia beim Anblick ihrer kleinen Schwester ganz warm ums Herz wurde. Seltsam, dass sie sich nicht daran erinnerte, wer diese Aufnahmen gemacht hatte, zumal sie selbst Gast auf der Hochzeit gewesen war. Gedankenverloren schloss sie eine geöffnete Flasche mit Nagellackentferner und bezwang das Bedürfnis, sich nach ein paar zerknüllten Wäschestücken und leeren Chipstüten zu bücken. Oder die Bettdecke aufzuschütteln, wie sie es jahrelang getan hatte. Irgendwie war es beruhigend zu sehen, dass Auri sich in den Monaten ihrer Abwesenheit kein Stück geändert hatte.